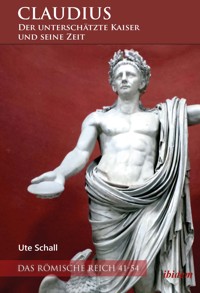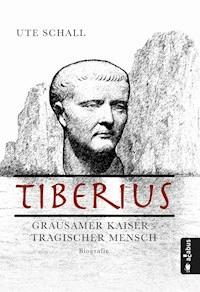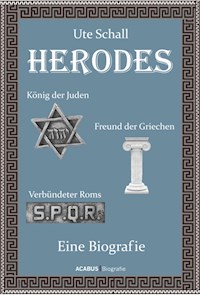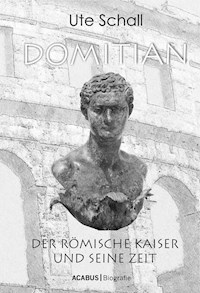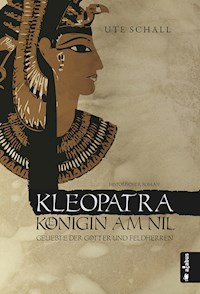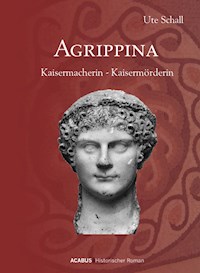
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer einzigartigen Frau. In der ebenso faszinierenden wie gefährlichen Welt der römischen Aristokratie, in der jeder noch so kleine Fehler zum eigenen Untergang führen konnte, folgt der Roman Agrippina durch das Netz der Intrigen, das nicht nur von ihr gesponnen wurde, und dem sie letztlich zum Opfer fallen sollte … Agrippina die Jüngere wird im Jahr 15 n. Chr. als Tochter des römischen Feldherrn Germanicus in die julisch-claudische Dynastie hinein geboren. In dieser Welt gelten die alten römischen Tugenden nicht mehr. Verrat, Mord und Tod sind an der Tagesordnung. Agrippina erlebt, wie ihr Vater Opfer eines Giftmordes wird, ihre Mutter auf die Insel Pandateria verbannt wird, ihr Bruder - Kaiser Caligula - dem Wahnsinn verfällt. Doch Agrippina weiß sich im gefährlichen Umfeld des römischen Hofes zu behaupten, denn sie ist schön, in hohem Maße ehrgeizig und intelligent. Skrupellos nimmt sie jede Möglichkeit wahr, Einfluss zu nehmen. Sie heiratet dreimal, mordet und intrigiert. Schließlich steigt sie als Ehefrau ihres Onkels Claudius zur Kaiserin auf. Endlich an der Macht, doch noch lange nicht am Ziel ihrer ehrgeizigen Pläne, manipuliert sie ihren Ehemann und ihren Geliebten Pallas. Ein gewagtes Spiel, doch sie setzt alles daran, ihren Sohn Nero auf den Thron zu bringen. Sie ist bereit, selbst ihr eigenes Leben diesem Ziel unterzuordnen: "Mag er mich töten, wenn er nur herrscht." Vor dem Hintergrund sorgfältig recherchierter historischer Begebenheiten nimmt Ute Schall den Leser mit auf eine Achterbahn der Ereignisse. Mit großer erzählerischer Kraft entwirft sie die Lebensgeschichte einer der außergewöhnlichsten Frauengestalten der römischen Geschichte, deren Einfluss bis heute sichtbar ist. Ihre Memoiren dienten Tacitus und anderen Historikern als Quelle. Als Kaiserin ließ sie ihren Geburtsort Köln in Colonia Agrippinensis umbenennen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ute Schall
Agrippina
Kaisermacherin – Kaisermörderin
Schall, Ute: Agrippina. Kaisermacherin – Kaisermörderin, Hamburg, ACABUS Verlag 2010
Originalausgabe
ISBN: 978-3-941404-58-8
Lektorat: Stefanie Hester, ACABUS Verlag
Umschlaggestaltung: Daniela Sechtig, ACABUS Verlag
Umschlagsmotiv: Büste Agrippina d. J.: mit freundlicher Genehmigung der NY Carlsberg Glyptotek, Copenhagen, Fotograf: Ole Haupt, Mosaik: © Micky75 – Fotolia.com
Die Buch-Ausgabe dieses Titels trägt die ISBN 978-3-941404-57-1 und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.
Der ACABUS Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© ACABUS Verlag, Hamburg 2010
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
eBook-Herstellung und Auslieferung:
Der weite Weg nach Norden
Germanien
Der Tod kommt auf gewundenen Pfaden
Wieder in Rom
Ungebetene Gäste
Der mysteriöse Tod
Livia Augusta
Tiberius
Der Herr der Welt kehrt ihr den Rücken
Sejan und die Wege der Macht
Der Kaiser ist tot …
Der unbequeme Bruder
Tragödien
Das Strafgericht
Einsamkeit
Eines Kaisers Freud und Leid
Die Verräterin
Die Stunde der Iulia Agrippina
Die neue Kaiserin
Der weiseste aller Römer
Der heimgekehrte Philosoph
Die ungleichen Brüder
Schönheiten
Überraschungen
Im Interesse der Staatsräson
Die Götterspeise
Optima Mater
Prinzentod
Die Zurückweisung
Mordpläne
Der Muttermord
Historischer Hintergrund
Die wichtigsten Personen
Glossar
Infandum, regina, iubes renovare dolorem – Du heißest mich, Königin, den unsäglichen Schmerz erneuern.
Vergil, Aeneis, II, 3
Der weite Weg nach Norden
Der schwere Reisewagen rumpelte behäbig bergan. Die beiden Zugochsen hatten sichtlich Mühe, das Gefährt mit der kostbaren Fracht durch das unwegsame Gelände zu zerren, und oft genug mussten die Begleiter die Hinterräder durch Gesteinsbrocken sichern, um ein Zurückrollen zu verhindern. Auch die Schlagstöcke wurden häufig bemüht, die die massigen Tiere daran erinnern sollten, was man von ihnen erwartete.
Agrippina saß auf der Rückbank und zitterte vor Kälte und Angst, obwohl der Innenraum ihres neuen Zuhauses weich gepolstert und mit Ziegelsteinen bestückt war, die, aufgeheizt, eine wohlige Wärme verbreiten sollten, jedoch nur an den jeweiligen Raststellen über offenem Feuer erhitzt werden konnten. Und die letzte Unterbrechung der mühseligen Fahrt lag Stunden zurück.
Mit besorgter Miene sah sie auf ihren angeschwollenen Leib hinab und konnte einen leichten Seufzer nicht unterdrücken. Sie würde hoffentlich ihr Kind bis zur Ankunft an jenem ihr fremden Ort im feindlichen Barbarenland noch da behalten können, wo es am sichersten aufgehoben war. Aber wer wusste das schon, wo sie doch Strapazen ausgesetzt war, die man in ihrem Zustand am besten mied. Freilich, man hatte ihr keine Wahl gelassen …
„Du wirst dir noch den Tod holen, Herrin!“ Antonella sprang von ihrem Sitz auf, zog die Decke, die sich Agrippina über die Schultern gelegt hatte, fester zusammen und umfasste, sich auf den Boden kauernd, deren Knie. Ihre Miene war besorgt, und sie schüttelte missbilligend den Kopf. „Dir und deiner Tochter“, fuhr sie tadelnd fort.
Agrippina lächelte müde. „Woher weißt du denn, dass es diesmal ein Mädchen wird, du Neunmalklug? Hast du etwa das Orakel von Delphi befragt?“ Agrippina streichelte der Dienerin über das seidenweiche Haar.
„Erstens“, fuhr die Kleine unbeirrt fort, „hast du bereits drei Söhne …“
„Und eine Tochter“, unterbrach sie die Schwangere.
„Und eine Tochter“, wiederholte das Mädchen nickend. „Da wäre es nur ausgleichend gerecht, wenn sich zu den drei Söhnen drei Töchter gesellten, und zweitens …“
„Zweitens?“, wollte Agrippina wissen.
„Ist der Bauch ganz schmal und spitz, gibt’s ein Menschlein mit ’nem Schlitz.“
„Antonella!“ Agrippina tat empört. Aber insgeheim musste sie über die Bemerkung der jungen Frau doch lachen.
„Lass solche Unflätigkeiten nur nicht den Herrn hören!“, warnte sie und drohte der Kleinen mit dem Finger. „Er wäre im Stande und schickte dich sogleich zurück nach Rom, und du dürftest wieder Gänse hüten.“
„Das würde Herr Germanicus nie tun“, gab Antonella vorlaut zurück. „Denn er tut ja nur, was du willst, Herrin. Und du kannst doch auf mich gar nicht mehr verzichten. Habe ich Recht?“ Mit ihren großen runden Augen sah sie Agrippina erwartungsvoll an.
„Du hast Recht“, antwortete die hohe Frau, die plötzlich ganz nachdenklich geworden war. „In den wenigen Monaten, in denen du mich umsorgst, bist du mir beinahe zur Freundin geworden, ganz zu schweigen von den Kindern, die dich gleich ins Herz geschlossen haben. Ich bin froh, nach all dem Klatsch und den Ränken am römischen Hof endlich einen Menschen mit einem derart offenen Gesicht und solch ehrlichen Augen zu besitzen.“
Erneut strich sie der jungen Frau über das goldbraune Haar.
„Ja, besitzen“, wiederholte sie, als glaube sie ihren eigenen Worten nicht.
Sie war schon recht eigenartig, die römische Rechtsordnung, die Menschen andere Menschen ‚besitzen‘ ließ. Wenn sie nun an Antonellas Stelle und nicht die Gattin des Germanicus, des derzeit berühmtesten römischen Feldherrn, und Enkelin des Augustus wäre, jenes fast schon legendären Übervaters, den die Römer beinahe wie einen Heiligen verehrten? Nein, sagte sie sich, nicht nachdenken, nicht darüber nachdenken! Nicht hier und nicht jetzt. Das führte zu nichts. Wussten nicht die alten Ammen zu berichten, es schade dem ungeborenen Kind, wenn sich eine Schwangere zu viel durch den Kopf gehen ließ? Und überhaupt, so sagten nicht nur sie, habe eine Frau das Denken den Männern zu überlassen, die von der Natur mit mehr Verstand ausgestattet worden seien, eine Behauptung, die sie freilich immer zum Widerspruch gereizt hatte.
Sie lehnte sich erschöpft in die weichen Kissen zurück und schloss die Augen, auch um Antonella zu bedeuten, dass die Unterhaltung beendet war und sie jetzt der Ruhe bedürfe. Die aber fand sie nicht. Die Erinnerung an Rom stieg in ihr auf, ihre Stadt, die sie erst vor wenigen Wochen verlassen hatte und die ihr doch seltsam entrückt zu sein schien, unwirklich fast, ein Schemen nur noch am Horizont. Sie bohrte ihr Gedächtnis an bis zur Schmerzgrenze. Da zeichneten sich vor ihren müden Augen die blühenden Orangenhaine ab, und sie sog begierig den betörenden Duft ein, den sie verströmten, und ein seltsames Gefühl ergriff von ihr Besitz, eine verzehrende Sehnsucht, und plötzlich wusste sie – woher, von wem? – , dass sie mit ihrer Abreise jener Welt für immer den Rücken gekehrt hatte, dass alles Gewohnte, als angenehm Empfundene und Vergnügliche unwiederbringlich verloren war. Sie hatte den Freuden der Hauptstadt entsagt. Sie, die jüngere Tochter des berühmten Feldherrn Marcus Vipsanius Agrippa, der schon vor über zwei Dekaden zu den unterirdischen Schatten heimgekehrt war, und der Kaisertochter Iulia, die, von ihrem Vater verbannt, fern von Rom an der Südspitze der italischen Halbinsel ein karges Leben fristete und ihre Zukunft schon hinter sich hatte.
Was blieb, war ungewiss.
Aber hatte sie sich nicht freiwillig und gegen manchen Widerstand entschlossen, ihren Gemahl in jenes unwirtliche Land zu begleiten, aus dem es womöglich keine Wiederkehr gab?
Doch dann riss sie sich zusammen. Wie konnte sie auch nur einen einzigen Augenblick an der Richtigkeit ihrer Entscheidung zweifeln? Hätte sie etwa ihren Mann im Stich lassen und ihn allein zu den unberechenbaren Germanen ziehen lassen sollen, während sie selbst im behaglichen Herzen der Welt zurückblieb, die warmen Thermen genoss, den Vergnügungen nachging, den Wagenrennen im Zirkus und den Spielen, die Rom so reichlich bot? Hätte sie allein in den weitläufigen Fluren ihres herrschaftlichen Palastes regieren sollen? Letzteren hatte ihr kein Geringerer als der Princeps Augustus selbst in einer Anwandlung seltener Großzügigkeit zur Hochzeit geschenkt, als hätte er etwas gut zu machen, als müsse er, aus welchen Gründen auch immer, sein Gewissen erleichtern.
Als mustergültig sah man ihre Ehe an, eine Verbindung, die für ihre Zeitgenossen nicht weniger beispielhaft war als die ihrer Schwiegereltern Drusus und Antonia Minor, vielleicht, weil man ihrem Mann und ihr wie jenen gestattet hatte, bei der Wahl des jeweiligen Partners den Regungen des Herzens zu folgen, was in Rom durchaus unüblich war, wo man Ehen gewöhnlich aus Gründen des Geldbeutels oder der Staatsräson schloss.
Gewiss, es würde nicht leicht sein im rauen Germanenland, das schon so viele Römer Kraft, Gesundheit und sogar das Leben gekostet und auch über ihre Familie unsägliches Leid gebracht hatte. Waren nicht, das wurde jedenfalls in der Familie erzählt, ihr Schwiegervater Drusus als Toter und ihr eigener Vater Agrippa als an Leib und Seele gebrochener Mann aus dem Norden zurückgekehrt? Und die vor einigen Jahren untergegangenen drei stolzen Legionen, deren Namen in Rom nicht mehr genannt werden und deren wenige Überlebende nie mehr zurückkehren durften, weil man fürchtete, Unglück könne anstecken wie Aussatz oder die Pest? Die vom Erfolg verwöhnte Weltmacht, die bislang unbezwingbar erschienen war, wollte keinen detaillierten Bericht über eine der schändlichsten Niederlagen, die einem römischen Heer je zugefügt worden war, und man wollte im Mittelpunkt der Welt auch keine Zeugen des beginnenden Untergangs. War es doch, und sie täuschte sich sicherlich nicht, nur noch eine Frage der Zeit, wann sich die von Rom bezwungenen Völker gegen ihre Unterdrücker erheben, das verhasste Joch abschütteln und die Römer mit ihren eigenen Waffen schlagen würden.
Nein, die Begegnung mit den Germanen würde sicherlich nicht leicht sein. Aber eine Vipsanierin zeigte ihre Furcht nicht. Sie hatte also gut daran getan, ihrem Gatten zu folgen. Wie hätte sie ihm auch von Rom aus helfen, ihm nützlich sein können?
„Mein lieber Germanicus“, hatte sie ihm erwidert, nachdem er ihr seine Bedenken vorgetragen hatte, „ich bin deine Frau. Habe ich dich etwa nur geheiratet, um in guten Zeiten Tisch und Bett mit dir zu teilen? Wo du bist, will auch ich sein, und ich will auch das Unglück mit dir zusammen geduldig ertragen. Hast du vergessen, dass geteiltes Leid nur halbes Leid ist, die geteilte Freude aber doppelt zählt?“ Mit Nachdruck hatte sie ihm die Worte entgegen geschleudert, mit zäher Entschlossenheit, sodass er augenblicklich verstummt war.
War es im Übrigen so viel, was sie zurückgelassen hatte? Gefangene einer eisernen Hofetikette, von der ihr unbarmherziger Großvater allenfalls absah, wenn es seine eigenen Belange betraf, die aber besonders den Frauen aus dem Kaiserhaus strengste Zurückhaltung auferlegte, da man an ihrer Tugend das staatliche Wohlergehen maß. Unentwegt Tratsch und Intrige ausgesetzt, in stetiger Furcht um das Leben ihrer vier Kinder – ein gütiger Himmel mochte verhindern, dass das fünfte vorzeitig in diese verfluchte Welt trat –, hatte sie sich entschlossen, trotz ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft den Unbilden dieser Reise zu trotzen, die ihr wenigstens die Gesellschaft und den Schutz ihres geliebten Gatten bot.
Drei Kinder hatte sie in der Obhut der Urgroßeltern zurückgelassen. Augustus, der Princeps, erfreute sich trotz seines hohen Alters – er hatte bereits das 75. Lebensjahr vollendet – stabiler Gesundheit und eines wachen Verstandes. Und bei Livia, seiner allwaltenden Gemahlin, der eigentlichen Herrscherin Roms, die seit Menschengedenken die Regierungsgeschäfte und die Familienangelegenheiten in sicherer Hand hielt, hatten die Jahre nur im Gesicht ihre Spuren hinterlassen. Sie, die schon manchen Angehörigen der kaiserlichen Familie auf dem Gewissen hatte, wie jedermann wusste, würde nicht wagen … Nein, daran durfte sie nicht einmal denken.
Ein heftiger Ruck des Reisewagens holte Agrippina aus ihren Gedanken in die Gegenwart zurück. Der Karren stand still, als habe ihn eine höhere Macht angehalten. Einen Augenblick lang vermisste die Reisende das Rattern der eisenbeschlagenen Räder auf dem felsigen Untergrund und das Gezänk der Fuhrknechte, an das sie sich über so viele Stunden gewöhnt hatte. Doch dann genoss sie die Ruhe, die sich langsam auch über ihr Gemüt ausbreitete.
Die Tür des Wagens öffnete sich, und Germanicus, der über weite Strecken seine Frau hoch zu Ross begleitet hatte, als müsse er sie mit seinem eigenen Leben vor Gefahren schützen, streckte den Kopf herein.
„Liebste“, flüsterte er, „störe ich dich?“
Agrippina schüttelte den Kopf. Heftig regte sich das Ungeborene in ihrem Schoß, als wollte es seinen Vater begrüßen.
„Wir werden hier unser Nachtquartier errichten“, sagte Germanicus. „Der Platz scheint mir günstig. Ich habe bereits Anweisung gegeben, die Zelte aufzuschlagen, deines natürlich zuerst, damit du dich von den Strapazen des Tages erholen kannst, und das Lager mit Wall und Graben zu befestigen.“ Beinahe ehrfurchtsvoll küsste er seiner Frau die Hand.
Agrippina zog den Vorhang des kleinen Fensters zur Seite und blickte in die Dämmerung. Bevor sie etwas sagen konnte, fuhr ihr Mann fort:
„Ich weiß, ich weiß. Es ist noch nicht spät. Aber es geht nicht nur darum, Rücksicht auf unser Kind zu nehmen. Ich bin für uns alle verantwortlich. Die Berge, die wir als nächste überqueren werden, sind unsicher. Unsere Späher berichten von Versammlungen helvetischer Stammesführer, die sich uns offenbar in den Weg stellen und den Durchzug durch ihr Gebiet zumindest erschweren wollen. Wie du weißt, gelten sie zwar längst als befriedet, doch gibt es immer noch welche, die sich der Segnungen unserer fortschrittlichen Zivilisation nicht bewusst sind. Aber fürchte dich nicht! Wir sind gut vorbereitet, und die Kompanieführer wissen, was ihre Aufgabe ist.“ Er hatte erneut Agrippinas Hand ergriffen und seine Lippen darauf gepresst.
„Ich fürchte mich nicht, Liebster. Dennoch wäre ich froh, wir hätten dieses scheußliche Gebirge hinter uns. Ich verstehe nicht, wie hier überhaupt Menschen leben können. Schnee, Eis, Kälte und Dunkelheit. Nie habe ich ein unfreundlicheres Land gesehen.“ Ein kalter Schauder lief Agrippina den Rücken hinab.
„Und dennoch lieben sie es“, gab Germanicus zu bedenken, „und sind sogar bereit, es nötigenfalls mit ihrem Leben und dem ihrer Frauen und Kinder zu verteidigen. Auch wenn wir das kaum verstehen können.“
„Ich hoffe nur“, fuhr Agrippina, auf ihren gewölbten Bauch deutend, fort, „dass unser Kind noch ein Weilchen still hält. Wo treibt sich übrigens Gaius herum? Ich habe ihn seit Stunden nicht mehr gesehen?“
Die Götter allein wussten, was Germanicus in den Sinn gekommen war, als er sich entschloss, ausgerechnet Gaius, den jüngsten seiner drei Söhne, auf diese gefährliche Reise mitzunehmen. Er war gerade drei Jahre alt und das lebhafteste Kind, das das Kaiserhaus je gesehen hatte. Niemals hielt er seinen altklugen Mund. Und mit seinen winzigen Füßen trippelte er neben, vor und unter den Pferden umher, sodass seiner Mutter manchmal vor Schreck fast das Herz stehen blieb. Oft schlüpfte er in grobe, viel zu große Soldatenstiefel, was ihm besondere Freude zu bereiten schien. Schon nannten sie ihn liebevoll Caligula, das Stiefelchen.
Stiefelchen war nirgendwo und überall. Er hockte abends am Lagerfeuer und sang mit seinen „Kameraden“ derbe Soldatenlieder. Er aß mit den Männern in den muffigen Zelten, kostete ihr hartes Brot und den ranzigen Speck. Er ritt auf dem Rücken der Mannschaftsführer und jauchzte vor Vergnügen, wenn sie dabei wie Hengste wieherten. Er kniff, schlug, trat und liebkoste das Pony, das ihm Germanicus geschenkt hatte. Und wenn ihn die Mutter besorgt zu sich rief oder zu etwas Vorsicht mahnte, streckte er ihr die Zunge heraus und rannte davon.
„Das Kind entwickelt sich prächtig“, urteilte anerkennend Soranos, der kaiserliche Leibarzt, der für Gesundheit und Leben aller Mitglieder der julisch-claudischen Gens verantwortlich war.
„Es ist klug und seinen Altersgenossen um Jahre voraus. Gestatte mir, Herrin, ihm eine große Zukunft vorauszusagen!“ Dabei verneigte er sich tief.
Agrippina gestattete. Wenn sie auch nach Livia Augusta im Augenblick die vornehmste Dame des Reiches und dem öffentlichen Wohl verpflichtet war, so war sie doch zuerst Mutter und als solche auf ihre Nachkommenschaft wie jede andere Römerin stolz.
„Der Junge ist kaum zu bändigen“, antwortete ihr Mann. „Keine Stunde hat er es bei mir auf dem Pferd ausgehalten. Er schrie und strampelte, bis ich ihn von Mann zu Mann weiterreichte. Unsere Centurionen und Tribunen reißen sich geradezu darum, ihn bei sich zu haben und ihm alles erklären zu dürfen. Warum die Sonne scheint oder es nicht tut. Was Schnee ist, und wo die Götter wohnen. Er wollte sogar wissen, wie denn die Unsterblichen bis in olympische Höhen kämen, wenn doch die Menschen nicht einmal oder nur mit Mühe auf die Gipfel mancher Berge gelangten.
Im Augenblick schaut er bei der Schanzarbeit zu. Das heißt, eigentlich steht er den Männern mehr im Weg herum. Aber niemand beschwert sich. Er kommandiert, als sei ihm das Befehlen in die Wiege gelegt worden. Und sie? Sie verehren ihn bereits wie ihren zukünftigen Kaiser. Irgendwie, weiß ich doch selbst nicht warum, ist mir der Junge unheimlich. Ja, ich bewundere ihn, so sehr ich auch dagegen bin, das Kind derart zu verwöhnen. Ach, wenn es nicht ein so elendes Geschäft wäre, dieses ewige Kriegführen, Menschenschlachten und Völkermorden! Ich würde mich über das für einen Jungen seines Alters ungewöhnliche Interesse am Soldatenleben gewiss freuen und ihm wie Soranos eine ruhmreiche Zukunft als Feldherr voraussagen. Aber nach allem, was ich in Ausübung meines Berufes im Laufe der Jahre erfahren musste, hielte ich es freilich für besser, er würde ein unbedeutender Bücherwurm. Dann lebte er wenigstens weniger gefährlich.“ Germanicus hielt inne. „Ich denke da an meinen Bruder Claudius“, lächelte er, „der sich so gern hinter der Maske geistiger Zurückgebliebenheit versteckt. Ist er nicht glücklicher als wir? Ihn ficht offensichtlich nichts an. Und seine Zeit widmet er ausschließlich Geschichtsbetrachtungen, mit denen er, sollte er sich je entschließen, sie niederzuschreiben, vermutlich nicht weniger Unsterblichkeit erlangen wird als ich mit meinem verdammten Streben nach Kriegsruhm.“
Erneut war er mit seinen Gedanken bei seiner Familie in Rom. „Mutter Antonia wird ihr Urteil über ihn übrigens gründlich revidieren müssen. Nannte sie ihn doch erst kürzlich wieder ein Ungeheuer von einem Menschen, von der Natur nur begonnen und nicht vollendet. Und wenn sie jemanden für besonders dumm hält, pflegt sie zu sagen, er sei blöder als ihr Sohn Claudius. Und das, meint sie, wolle etwas heißen.“ Germanicus schüttelte verständnislos den Kopf.
„Ja, ja, der gute Claudius“, stimmte Agrippina zu. Zu ihr war er stets von zurückhaltender Freundlichkeit, als achte er wie kein anderer die Frau seines Bruders. Nur mit seinen sehnsüchtigen Augen schaute er ihr gern und lange nach.
„Aber wolltest du denn, Geliebter, dass einer deiner Söhne ein zweiter Claudius würde?“ Es war keine wirkliche Frage, und sie schien darauf auch keine Antwort zu erwarten.
„Doch bin auch ich fest davon überzeugt, dass er uns alle täuscht“, nahm sie den Gedanken an den Schwager wieder auf. „Es sollte mich nicht wundern, wenn er noch für manche Überraschung gut wäre.“
„Übrigens danke ich dir“, fuhr Germanicus, das Thema wechselnd, fort.
„Aber wofür denn?“, wollte Agrippina wissen und blickte ihren Mann verständnislos an.
„Dafür, dass du eine so tapfere kleine Frau bist, du ungekrönte Königin Roms.“ Ganz nahe trat er an die Schwangere heran, und streichelte über ihren Bauch, sanft, um das Ungeborene nicht zu erschrecken.
„Jetzt übertreibst du“, tadelte sie. „Königin Roms!“
„Livia ist alt“, beharrte Germanicus. „Deine arme Mutter und deine Schwester, die nur zwei Jahre älter ist als du, sind bei Augustus in Ungnade gefallen und verbannt. Sie werden Rom vermutlich nicht wiedersehen. Tiberius ist nicht verheiratet, und es steht kaum zu erwarten, dass sich daran noch etwas ändern wird, auch wenn ihn Augustus als Nachfolger ins Auge gefasst hat. Du weißt, dass man ihn im ganzen Reich nur den finsteren Claudier und Menschenfeind nennt. Kaum wird sich eine von Roms Noblen dazu herablassen, ihn zum Gatten zu nehmen, auch wegen seines Alters. Er ist ja längst ein Greis. Nach Livias Tod wirst also du die erste Dame des Imperiums sein.“ Bewundernd sah er seine Frau an.
„Und du nach Tiberius womöglich der Princeps?“ Sie schüttelte den Kopf. „Abgesehen davon, dass schon der Gedanke daran lächerlich ist, stelle ich mir diese Position ganz und gar nicht lustig vor. Noch mehr Zurückgezogenheit, noch weniger Freiheit und noch mehr Einsamkeit! Nein danke! Danach ist mir, bei Herkules, nicht.“ Als Germanicus ihrem ablehnenden Blick begegnete, wusste er, dass es ihr ernst damit war. „Und dann Tiberius!“, fuhr sie fort. „Glaubst du wirklich, er ließe zu, dass du ihn auf dem Thron beerbst? Nicht Tiberius, nicht er! Da vergäbe er die Herrschaft lieber dem letzten seiner Sklaven.“
Germanicus nahm seine Frau in den Arm und küsste sie leidenschaftlich auf den Mund, ohne auf ihre Bemerkungen einzugehen.
„Bald haben wir es überstanden, meine Schöne. In ein paar Tagen werden wir den Rhein erreichen. Dort erwartet uns ein bequemes Schiff, das uns flussabwärts bringen wird – in ein Land, das wir hoffentlich bald unser und Germania Inferior nennen werden.“
Das prunkvolle Zelt, das man in aller Eile für die Gattin des Feldherrn aufgeschlagen hatte und das die Mannschaftsunterkünfte weit überragte, war mit allen erdenklichen Annehmlichkeiten ausgestattet, und Agrippina fragte sich bei jedem nächtlichen Aufenthalt erneut, wie es ihrem Mann gelang, ihr scheinbar aus dem Nichts ein Lager errichten zu lassen, das sie ihren römischen Palast kaum vermissen ließ. Wie er mit Blicken und Gesten ohne große Worte seine Leute anwies, die ihm blind ergeben waren und ihn beinahe wie einen Gott verehrten! Und wie ehrfürchtig man seinetwegen ihr selbst begegnete, obwohl es doch hieß, mit einer Frau ziehe das Unglück ins Feldlager ein! Sie durfte stolz auf diesen Gatten sein, mit dem sie ein gnädiger Himmel gesegnet hatte. So war nach dem frühen Tod ihres Vaters, als ihr Leben zu Ende zu sein schien, doch noch alles gut geworden.
Voll Mitleid dachte sie an ihre Schwester Iulia, die fern von Rom ihre Tage fristete, wenn sie überhaupt noch lebte, für immer aus der römischen Luxuswelt verbannt, eine Verstoßene, die ihr Unglück gleich ihrem Schicksalsgenossen Ovid, dem einstens berühmtesten Dichter der Stadt, der ebenfalls mit Schimpf und Schande davongejagt worden war, einem bedauerlichen Irrtum zuschrieb und nicht müde wurde, ihre Unschuld zu beteuern.
Germanicus trug seine Frau mit starken Armen über ein graues Schneefeld und legte sie sanft auf das weiche Ruhebett, neben dem ein Becken mit glühender Holzkohle wohlige Wärme verbreitete. Der hohe Raum dämmerte in rötlichem Licht, das den Dingen alles, zunächst ihre Farbe, dann ihre Form und endlich ihre Bedeutung wegnahm, sie auflöste und verschlang. Er hüllte sie vorsichtig in eine dicke Wolldecke und danach in ein Bärenfell, streichelte ihren dicken Bauch und überwachte ihren Schlaf, als wäre sie wieder Kind, und als er den Eindruck hatte, dass sie ins Reich der Träume entrückt war, küsste er sie sachte auf Stirn, Wange und Mund und verließ auf Zehenspitzen den Raum, um mit seinen Generälen und den Anführern der Fuhrknechte die Aufgaben des folgenden Tages zu besprechen. In Germanicus’ Zelt erlosch das Licht immer zuletzt. Und er erhob sich vom Lager, wenn alles um ihn herum noch schlief.
Agrippina schlug die Augen auf. Ihr Atem ging ruhig und gleichmäßig. Ein Wohlgefühl breitete sich in ihrem Körper aus. Der steinige Weg in ihr glättete sich. Sie fühlte plötzlich eine geheime Vorfreude auf das unbekannte Wesen, das sie in sich trug und das für ein besonderes Schicksal ausersehen war. Und doch konnte sie eine böse Vorahnung nicht ganz unterdrücken. Wie würde sie sein, ihre Tochter? Würde sie ihr zur Freude und Ehre gereichen?
Ihr Blick schweifte zu einer kleinen Luke im Zeltdach. Aus einem jetzt aufgerissenen Himmel regneten zahllose Sterne. Wölfe umkreisten heulend das Lager und ließen sich nur durch die auflodernden Feuer von einem Eindringen abhalten. Und in der Ferne sangen fremde Frauen Klagelieder – in einer Sprache, die sie nicht verstand.
Germanien
Aufregung herrschte im Legionslager am Rhein. Die Ubier, ein einstmals wilder Volksstamm, den Marcus Vipsanius Agrippa vor mehr als einem Menschenalter gezähmt und am linken Ufer des Stroms angesiedelt hatte, taten wieder einmal ihre Unzufriedenheit mit der römischen Provinzial- und Militärverwaltung kund. Eine ansehnliche Abordnung der Stammesältesten stand vor den Toren des Kastells, forderte lautstark Einlass und eine Unterredung mit dem Präfekten.
Das neu gegründete Oppidum Ubiorum galt als eines der gelungensten Beispiele für die Symbiose von Einheimischen und römischer Präsenz. Wie andernorts hatte sich auch hier um die befestigte römische Niederlassung ein Lagerdorf gebildet. Der Handel blühte, und manche zarte Bande sorgten dafür, dass ein friedliches Zusammenleben zwischen derart unterschiedlichen Kulturen möglich war. Nachts hörte man das Lachen der Verliebten, und die Alten, die sich mit zunehmendem Genuss von Met und Wein immer mehr öffneten, lachten mit.
Viele Jahre lang war es sogar überflüssig gewesen, die Tore der Festung zu schließen. Doch seit den Römern im unseligen Jahr 761 a.u.c. nicht allzu weit von hier bei jenen dunklen Wäldern und Sümpfen im Norden Germaniens, denen bisher niemand einen Namen gegeben hatte, eine der schändlichsten Niederlagen ihrer Geschichte zugefügt worden war – nicht weniger als drei stolze Legionen mit den dazu gehörenden Hilfstruppen waren dort nahezu aufgerieben worden und die Legionsadler verloren gegangen – war das Ansehen der vermeintlich unbesiegbaren Weltmacht heftig beschädigt und das Selbstbewusstsein der Barbaren beträchtlich gestärkt. Rom, das war nicht länger der legendäre Mythos, von dem man nur flüsternd sprach. Wenn es auch immer noch über eine nahezu unvorstellbare Macht verfügte, war es doch verletzlich geworden. Und immer wieder erhoben sich hier in Germanien bereits unterworfen geglaubte Völkerschaften, um die am Tiber das Fürchten zu lehren. Vor allem jener in Rom erzogene und zum Ritter gekürte Arminius, jetzt einer der angesehensten germanischen Stammesführer, dessen Weitblick Rom zum Verhängnis geworden war, wurde nicht müde, den Hass auf die Besatzungsmacht zu schüren und die Stämme seiner Heimat zu Eintracht und Geschlossenheit aufzurufen.
„Was soll das Geschrei?“, herrschte Aulus Caecina Largus, Statthalter wider Willen, seinen zitternden Diener an. „Stehen etwa die Germanen vor den Toren?“ Auf seiner Stirn hatten sich tiefe Sorgenfalten gebildet.
„Die Ubier wünschen den Herrn zu sprechen“, gab der Mann verunsichert zurück.
„Zum Teufel mit dem Pack!“, murrte Caecina. Er hatte seinem Dienstherrn Augustus nie verziehen, dass er in das ferne Land abkommandiert worden war, in die Einöde, unter den ewig trüben Himmel, wo die Sonnentage gezählt waren, in die undurchdringlichen Wälder, die selbst dem mutigsten römischen Soldaten Furcht einflößten, und in eine Welt, in der es keinerlei Abwechslung gab. Und alles nur, weil er, Caecina, gewagt hatte, sich mit einer verheirateten Frau der Nobilität auf eine kurze Affäre einzulassen, eine belanglose Liebelei, die längst beendet war, als die um die Moral ihrer Untertanen besorgte Staatsführung davon erfuhr. Wegen Verstoßes gegen die Sittengesetze hatte man ihn angeklagt, als hätte er allein in ganz Rom sich über sie hinweggesetzt, als hätte nicht der Princeps, wie jedermann wusste, sie Tag um Tag für sich selbst aufgehoben. Die Strafe erschien ihm unangemessen hart. Ein Jahr Verbannung in den Norden des Reiches, als ehrenhafter Posten des Statthalters deklariert. Und viele hatten ihn in der Tat um diese Stellung beneidet.
Wie sehr sehnte er sich nach den immergrünen Gärten Italiens, den plätschernden Brunnen und den vielen schönen Frauen, die in ihren pastellfarbenen Gewändern durch Parks und Straßen flanierten und den Männern den Kopf verdrehten! Zum Glück würde er, so es den Göttern gefiele, wieder nach Hause zurückkehren können, ehe das Jahr sich neigte, und ein anderer römischer Offizier, der vielleicht ehrgeiziger oder auch nur jünger war als er, würde sich hier im hohen Norden kalte Füße holen dürfen.
Caecina seufzte und nahm einen kräftigen Schluck des unvermischten Falerners, den er von zu Hause mitgebracht hatte, betrachtete den Becher mit den kunstvoll aus dem Silber getriebenen Ornamenten, stand von der Kline auf, auf der er geruht hatte, und wandte sich erneut an seinen Diener:
„Sie mögen eintreten und ihr Anliegen vorbringen!“, sagte er gereizt. „Aber höchstens drei Mann. Hörst du? Nicht mehr als drei“, rief er dem bereits Davoneilenden nach.
Er war vorsichtig geworden, seitdem ihm vor einigen Wochen einer der abgesandten Ubier zu nahe gekommen war, ein Bär von einem Kerl mit zotteligem Bart und ungepflegtem Haupthaar, in dicke Felle gewickelt, offensichtlich betrunken und von widerwärtig stechendem Geruch. Vier seiner Kammerdiener hatten Mühe gehabt, den Mann zu überwältigen und aus dem Kastell zu schaffen, aber noch Tage danach schien ihm dieser Mensch schon durch seine tierische Ausdünstung drohend präsent.
Es war ungemütlich und kalt. Wider Erwarten war nach einer Reihe für die Jahreszeit und diese Gegend ungewöhnlich warmer und freundlicher Tage, die einen vorzeitigen Frühling anzukündigen schienen, der Winter mit Macht zurückgekehrt. Der Schnee lag knöchelhoch, war schwer und nass, und die Kälte kroch den Römern über die nackten Beine bis ans Herz. Anfangs hatten sie über die seltsame Bekleidung der Germanen gelacht: Felle, die mit gekreuzten Bändern um den ganzen Körper geschnürt waren, die ebenfalls aus Tierhäuten gefertigten turmartigen Mützen und die Füße in hohen Lederstiefeln, die sie mit Heu, Stroh und Moos zum Schutz gegen den Frost ausgestopft hatten. Menschen, die von Kopf bis Fuß wie die Affen behaart waren und eher an wilde Tiere als an zivilisierte Wesen erinnerten.
Galt es für einen Römer auch als unschicklich, sich nach Barbarenart zu kleiden und die vor allem von den Galliern bevorzugten Hosen zu tragen, so begannen doch zumindest diejenigen, die den Unbilden dieses Klimas schon Jahre ausgesetzt waren, die Vorteile der heimischen Tracht zu schätzen. Caecina sah es zunächst mit Unbehagen, empfahl seinen Männern, häufig das Kastellbad aufzusuchen, um Gicht und Rheuma vorzubeugen, schritt aber nicht gegen die ganz und gar unrömische Kleidung disziplinarisch ein, um den guten Ruf, den er bei den Soldaten genoss, nicht zu gefährden. Mochte sich sein Nachfolger mit solchen Kleinigkeiten herumärgern. Für ihn, Caecina, kam es nur noch darauf an, diesen Abschnitt seines Lebens möglichst schnell hinter sich zu bringen und nach Rom zurückzukehren, zu Fabia, seiner geliebten Frau, und all den anderen, die er nicht weniger begehrte, den beiden Söhnen und in seinen weiträumigen Palast, den er zu Hause auf dem vornehmen Caelius, einem der sieben Hügel, besaß.
„Was willst du?“ Der Römer bemühte sich um Höflichkeit. Steif und ablehnend stand er dem Fremden gegenüber. Vorsorglich umfasste seine Rechte den Knauf seines Schwerts. Der ubische Bote, dessen Alter schwer zu schätzen war, blieb in angemessener Entfernung stehen, verbeugte sich und begann in schlechtem Latein:
„Herr, der Rat der Ältesten hat mich beauftragt, dir eine Beschwerde über einen deiner Kompanieführer vorzutragen. Das Oppidum Ubiorum wurde überfallen. Wieder einmal. Es ging alles ziemlich schnell, und so wissen wir nicht genau, wer es war. Wir vermuten, die Chatten. Zehn unserer Krieger wurden getötet, einige Frauen und Kinder verschleppt. Was aber am schlimmsten ist, sie haben einen Großteil unseres Viehs gestohlen. Wie sollen wir unserer Tributpflicht an euch nachkommen, wenn wir selbst nichts mehr haben? Als Stammesältester habe ich sofort einen Centurio zu Hilfe gerufen. Er sollte uns wenigstens bei der Verfolgung der frechen Diebe helfen, was uns, wie du weißt, vertraglich zugesichert ist. Aber der Mann ließ mir nur ausrichten, er denke gar nicht daran, einzugreifen. Die Bekämpfung von Stammesfehden gehöre nicht zu seinen Aufgaben. Im Übrigen sei ihm das Wetter zu schlecht, und er wolle nicht, dass sich noch mehr seiner Leute einen Schnupfen holten.“
Caecina hörte den Mann geduldig an, ohne ihn zu unterbrechen.
„Ich werde der Sache nachgehen“, versicherte er. „Du hast mein Wort.“
Der Ubier verbeugte sich und kehrte zu der Gruppe seiner wartenden Stammesgenossen zurück.
Wenn ich mir hier auch keine großen Sporen verdienen will, ging es dem Statthalter durch den Kopf, so soll man mir doch nicht nachsagen können, ich hätte meine Pflicht vernachlässigt. Es will mir auch scheinen, dass in den wenigen Monaten, in denen mir die Verantwortung für die Ordnung in dieser Weltecke anvertraut ist, die Disziplin immer mehr zu wünschen übrig lässt. Wie soll ich Germanicus begegnen, der für die nächsten Tage seinen Besuch angekündigt hat? Und womit soll ich mich rechtfertigen, wenn sich die Barbaren bei ihm, gewissermaßen als dem Stellvertreter des Princeps, beklagen? Ich werde den verantwortlichen Centurionen einbestellen und ihn fragen, wie sich die Sache tatsächlich verhalten hat. Audiatur et altera pars! Warum vom bewährten römischen Rechtsgrundsatz abweichen? Und wenn der Ubier Recht hat? Nun, vielleicht sollte man doch wieder einmal von der bewährten Dezimierung Gebrauch machen. Sie hat noch immer geholfen, die Truppen an ihre Pflicht zu erinnern.
Ein schrecklicher Gedanke, den er sogleich wieder verwarf.
„Nein“, sagte er zu sich selbst. „Es fließt genug Blut. Ich will nicht dazu beitragen, dass noch mehr davon unnötig vergossen wird.“
Nach der mühseligen Reise durch das winterliche Bergland war Agrippina die römische Befestigung am Rhein fast wie der kaiserliche Palast auf dem Palatin vorgekommen. Die Geburt ihrer Tochter hatte nicht lange auf sich warten lassen, und nicht nur sie, auch Germanicus war überglücklich, und er fand, die jüngere Agrippina sei das schönste Kind, das ihm seine Gattin bisher geschenkt hatte. Sie hatte ein liebliches Gesicht mit Grübchen in den Wangen, leuchtende Augen, deren Farbe täglich zu wechseln schien, dunkelbraunes, fast rötliches Haar, das sich so fein wie Spinnennetz um das wohlgeformte Köpfchen schmiegte, ein leicht vorstehendes Kinn und eine hohe Stirn. Ihre Stimme war angenehm kräftig und ließ starke Willenskraft erkennen.
Auguren und Haruspices waren zum Schicksal der Neugeborenen befragt worden, wie es Brauch war, und sie hatten versichert, Agrippina, die Tochter, werde größte Höhen erreichen, um in unendliche Tiefen zu stürzen.
Die düstere Vorhersage hatte die Mutter für eine Weile erschreckt. Aber Germanicus hatte sie in der unbeschwerten Art, die ihm eigen war, getröstet. Was hätten sie nicht schon alles von sich gegeben, diese römischen Möchtegern-Propheten, und was davon sei wirklich eingetroffen? Wenn es nach ihnen ginge, stünde Rom schon lange nicht mehr. Nein, er sei gewiss, es könne so schlimm nicht kommen. Der getreue Pentulus, der in seinem Auftrag das Orakel von Delphi befragt habe, habe ganz andere Botschaft mitgebracht: Pythia, die Priesterin des Gottes Apoll, habe geweissagt, Agrippina werde einst neben dem mächtigsten Mann des Imperiums sitzen und ihr Reich selbst in sicheren Händen halten. Und es werde für alle eine glückliche Zeit sein.
Die junge Familie hatte sich hier am Ende der Welt oder dessen, was Rom dafür hielt, behaglich eingerichtet. Aber die Freude über das gemeinsame Glück währte nicht lange. Es waren erst wenige Wochen vergangen, als ein Postreiter erschien, den kein Geringerer als der kaiserliche Großvater an den Niederrhein geschickt hatte, um den beliebten Feldherrn um einen Gefallen zu bitten. Germanicus, der, nun dürfe er es ja wissen, nach Tiberius zum Nachfolger im Principat bestimmt worden sei, möge sich doch an die Stelle des nationalen Unglücks begeben, in die Nähe jenes unheimlichen namenlosen Waldes, der für Rom vor fünf Jahren und mehr zum Schicksal geworden sei. Dort möge er die Gefallenen oder das, was von ihnen nach dieser langen Zeit geblieben sei, bestatten, und die Embleme der Centurien und Kohorten und vielleicht auch einen der verloren gegangenen Legionsadler suchen, damit wenigstens sie nach Rom zurückkehrten. Ihn, Augustus, verfolgten nachts die Schreie der Sterbenden, und er werde erst dann ruhig ins Schattenreich hinüberwechseln können, wenn er gewiss wäre, dass sie alle ein Römern würdiges Grab gefunden hätten. Quinctili Vare, schreie er, redde legiones – gib mir die Legionen wieder! Doch die Götter hätten sein Flehen bisher nicht erhört.
Und noch etwas habe er auf dem Herzen: Arminius, der, in Rom erzogen, undankbar seine einstigen Gönner in jenen feigen Hinterhalt gelockt habe, laufe noch immer frei herum, lasse sich von seinen Gesinnungsgenossen als Held und Befreier feiern und schmähe Rom mit jedem Atemzug. Doch er, der Princeps, habe sichere Kunde, dass sich besonders unter den Verwandten des Sprüche klopfenden Germanenführers der erste Unmut breit mache, Neid aufkomme und bereits überlegt werde, wie man den Jüngling von dem hohen Ross, das er ritt, wieder auf den Boden der Tatsachen holen könne. Germanicus möge also getreu der römischen Devise: divide et impera! dafür sorgen, einen Keil ins germanische Lager zu treiben, besonders zwischen Armin und Segestes, dessen Schwiegervater, der noch immer mit der Weltmacht am Tiber sympathisiere und sicherlich leicht für die Sache Roms zu gewinnen sei.
Germanicus gefiel zunächst der Gedanke nicht, seine Frau und die beiden Kinder für längere Zeit der Obhut des Statthalters zu überlassen, den er als schwach und launisch kennen gelernt hatte. Aber er war als Mitglied der julisch-claudischen Gens dem Stiefgroßvater, dessen bloße Wünsche mittlerweile Gesetzeskraft hatten, zu absolutem Gehorsam verpflichtet. Und die Aussicht, einmal selbst die Geschicke des Weltreichs lenken zu dürfen! Sie hätte Stärkere als Livias zurückhaltenden Enkel verlockt.
Im Übrigen wusste er, dass er kein Familienmensch war. Er liebte Frau und Kinder, gewiss. Und er hätte für sie sein Leben gegeben. Aber hatte er nicht bereits begonnen, sich zu langweilen, unentwegt das Lager zu inspizieren, an dem er nichts auszusetzen fand, sooft er auch seine Runden drehte, und seinen Männern auf die Nerven zu gehen, sodass ihn schon mancher fluchend in den Hades wünschte? Stand auch kein richtiger Feldzug an, bei dem es um Ruhm, Ehre und Beute ging, so erwartete ihn doch immerhin eine Aufgabe, zu der ihn auch seine Neugierde trieb. Wie hatte es geschehen können, dass ausgerechnet Quinctilius Varus, einer der erfolgreichsten Feldherrn der daran reichen römischen Armee (wenn ihn die öffentliche Meinung neuerdings auch als schwach und unfähig verurteilte), der sogar Statthalter der schwierigen Provinz Syrien gewesen war, in den Untergang stolperte wie ein Ochs ins Schlachthaus? Und warum hatte er sich in auswegloser Lage in sein Schwert gestürzt, anstatt für seine Niederlage vor den Göttern und der Welt die Verantwortung zu übernehmen, wie es Rom von jedem seiner Heerführer erwartete? Es konnte also durchaus interessant sein, die näheren Umstände dieser Katastrophe vor Ort zu erforschen.
Was Arminius betraf, der am Mittelpunkt der Welt erzogen worden war, um die Römer mit ihren eigenen Waffen zu schlagen, kursierten bereits die wildesten Gerüchte. Es hieß, da stünde zwischen ihm und Segestes noch eine alte Rechnung offen. Der Alte wollte dem ungeliebten Schwiegersohn einfach nicht verzeihen, dass sich dieser vor Jahr und Tag bei Nacht und Nebel Thusneldas, Segestes’ einziger Tochter, bemächtigt, sie entführt und geschwängert hatte, obwohl sie vom Vater bereits einem anderen, weit hoffnungsvolleren Heiratskandidaten versprochen worden war. Und auch der bald nach diesem Aufsehen erregenden Raub geborene Enkel habe den väterlichen Zorn auf die beiden jungen Menschen nicht zu besänftigen vermocht. Überall heize Segestes die Stimmung gegen den Sieger über drei römische Legionen an, poche an das Ehrgefühl der Stammesfürsten, einem Verräter und Mädchenschänder keinen Unterschlupf zu gewähren, und mahne sie, sich der Verträge mit der fremden Schutzmacht zu erinnern. Arminius, so hieß es, sei bereits ein toter Mann, an den man nicht mehr viel Aufmerksamkeit verschwenden müsse, und er fiele Germanicus gewiss in den Schoß wie ein reifer Apfel vom Baum.
Gaius Caligula, das Stiefelchen, verstand sicher die Aufregung nicht, die plötzlich im Lager herrschte. Aber er stapfte seinem Vater in den viel zu großen Schuhen, die er sich auszuziehen lautstark weigerte, auf Schritt und Tritt nach, als ahnte er, dass geheimnisvolle Dinge im Gange waren. Als die Pferde gesattelt, die Wagen beladen und die Männer gerüstet waren, beharrte er darauf, seinen Vater zu begleiten, strampelte und schrie und war nur mit großer Mühe davon zu überzeugen, dass er im Lager bleiben und seine kleine Schwester beschützen müsse, mit der er aber nicht allzu viel anfangen konnte, da sie unentwegt schlief.
Der Mond schwoll an und schwand, wechselte erneut und tauchte das Kastell in ein fahles, gespenstisches Licht. Wölfe umkreisten heulend das Lager, und in der Ferne sangen fremde Frauen Klagelieder.
Drei Monate waren vergangen, und Agrippina hatte von Germanicus nichts gehört. Sie hatte nächtelang auf dem lehmigen Boden gelegen, nur in ein dünnes Gewand gehüllt, zitternd vor Sorge und Kälte, und die Götter beschworen, ihr den, der ihr als einziger geblieben war und mit dem sie seit früher Kindheit eine leidenschaftliche Liebe verband, doch lebend zurückzugeben. Als die Götter ihre Gebete endlich erhörten und er müde durch die Porta Praetoria ritt, sah sie einen gebrochenen Mann. Er lebte, aber unversehrt war er nicht. Seine Augen hatten ihren Glanz verloren, und ein bitterer Zug lag um den schönen, einst volllippigen Mund. Es war, als säße ihm noch das Grauen im Nacken, und es dauerte Tage, ehe er seine Sprache wiederfand. Doch eines Abends breitete er vor ihr seine Erinnerungen aus, das schmerzhafte Andenken an die Fremde.
„Wen die Götter verderben wollen“, sagte er nachdenklich, „den schlagen sie mit Blindheit. Und so bewirken sie, dass das, was geschieht, mit vollem Recht zu geschehen scheint, und tiefes Unglück verwandelt sich in tiefste Schuld.“
Überrascht sah Agrippina von dem Himmelbettchen auf, vor dem sie, ihr Kind in den Schlaf wiegend, gekauert war. Sie trat auf Germanicus zu und legte ihm sanft die Hand auf die Schulter.
„Ich bin froh“, sagte sie, „dass du wieder reden kannst, und ich will dir geduldig zuhören, was immer du von deinen Erlebnissen auch preisgeben wirst.“
„Arminius!“, seufzte Germanicus und schlug die Hände vors Gesicht, damit sie seine Trauer nicht sähe. „Er muss ein Meister der Verstellkunst sein. Ich habe Überlebende jener Tragödie getroffen, Männer, die noch nach all den Jahren ihre Tränen nicht zurückhalten konnten, die in den feuchten Wäldern hausen und jede menschliche Berührung scheuen, die mühsam nach Worten rangen und erst beschworen werden mussten, mir zu berichten, was damals vorgefallen ist.
‚Arminius‘, stammelte einer, der sich Paterculus nannte, ‚Arminius aus dem Stamm der Cherusker, das ist kein Mensch. Das ist ein Dämon, den Pluto, der Gott der Unterwelt, selbst für eine Weile beurlaubt hat, um Rom zu verderben. Ein Hüne von Gestalt. Ein scheinbar strahlender junger Mann von rascher Auffassungsgabe und einer genial bösen Klugheit, die jenseits der Begabung eines Barbaren liegt, stets auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Als Varus’ Mundschenk hatte ich lange Gelegenheit, ihn an der Tafel des Gastgebers zu beobachten. Schon sein Gesichtsausdruck und seine Augen verrieten das verderbliche Feuer des Geistes.
Selbst Segestes hat unseren Statthalter vor diesem Menschen, seinem Schwiegersohn, gewarnt. Aber den hat Varus nur ausgelacht. Niemals, so meinte er, würde sich ein römischer Ritter, den man im Zentrum der Macht mit Ehren geradezu überhäuft habe, gegen seine Gönner erheben. Ränkespiele, meinte Varus verharmlosend, nichts als üble Ränkespiele. Ich kenne sie aus der Zeit meiner Statthalterschaft in Syrien, wo am benachbarten Hof von Judäa, an dem ich oft zu Gast war, in König Herodes’ Familie jeder gegen jeden intrigierte, sodass zuletzt der König selbst völlig verunsichert war. Nichts scheint mir unüberwindlicher zu sein als der Hass Verwandter gegen Verwandte. Wer wüsste nicht, dass Arminius und Segestes seit Jahren aufs Tiefste verfeindet sind und es da nur naheliegend ist, dass sie einander schlecht machen? Nein, sagte er mit dem Brustton der Überzeugung, für Arminius lege ich meine Hand ins Feuer. Er hätte sich verbrannt, der gute Varus, er hätte sich verbrannt.‘
Der Alte sah sich ängstlich um und bedeutete mir, näher zu treten. ‚Die Geister‘, flüsterte er. ‚Überall böse Geister. Es ist nicht gut, wenn sie geweckt werden. Ich habe versucht, vieles von dem, was ich gesehen und erlebt habe, zu verdrängen. Versucht, verstehst du? Aber es hat sich in meine Seele gefressen und mein Inneres vergiftet. Nachts fahre ich aus unruhigem Schlaf auf, in Schweiß gebadet, und glaube meinen eigenen Träumen nicht.‘
Nach einer Weile fuhr er mit glühenden Augen, Augen des Wahnsinns, fort:
‚Soweit ich mich erinnere, hat sich folgendes zugetragen:
Varus befindet sich noch im Sommerlager, als ihm Armin, der Cherusker, die Empörung eines weit entfernt siedelnden Stammes meldet. Der Statthalter hegt keinen Verdacht. Er bemerkt die Falle nicht. Er will den Aufstand während des Rückzugs ins Winterlager am Rhein niederschlagen, eine Kleinigkeit, wie er meint. Arglos bricht er auf, mit den drei ihm anvertrauten Legionen, den Hilfstruppen und dem diesmal besonders schwerfälligen Tross. Sind es 20000 Menschen, die ihm folgen, Männer und Frauen, sind es mehr? Wer will es so genau wissen? Er hat mitgenommen, was ging. Man will schließlich auch während der kalten Jahreszeit nicht auf Annehmlichkeiten verzichten. Nein, da erst recht nicht. Durch die Porta Praetoria verlässt er das Kastell, wie es Brauch ist, heißt es doch, dass sie geradewegs ins Glück führe.
Armin hat unterdessen alles gut vorbereitet. Die Germanenführer, die den Marsch der Römer begleiten, melden sich ab. Angeblich wollen sie Truppen holen und die Niederwerfung des Aufstands unterstützen.
Schon lodert, was Varus nicht weiß, denn seine Späher wurden umgebracht, ganz Germanien in hellem Aufruhr. Varus ist blind. Blind für die römischen Posten, die entlang des Weges niedergemetzelt daliegen, blind für die germanischen Krieger, die hinter jedem Busch, in jedem Hain lauern. Da setzt Regen ein. Heftiger Wind kommt auf. Die germanischen Götter greifen ein in die Schlacht. Die üblichen Herbststürme, kräftiger als man sie je erlebt hat, künden ihre Bereitschaft zur Befreiung Germaniens an.
Umgestürzte Baumstämme und der aufgeweichte Boden behindern den Vormarsch unserer Truppen. Vereinzelt greifen Germanen an. Aber Varus hat Scheuklappen vor den Augen. Erst als die ersten getroffenen Römer fluchend niedersinken, erwacht er aus seiner Lethargie. Man versucht offensichtlich, seine Reihen aufzusplittern, seine Ordnung zu verwirren. Und schon bricht die Dunkelheit herein.
Er befiehlt die Errichtung eines Nachtlagers mit dem üblichen Wall und Graben, was die Moral seiner Leute noch immer gestärkt hat. Und am nächsten Morgen setzt er, nicht ohne einen Rest von Hoffnung, seinen schweren Weg, seinen Todesmarsch fort.
Wieder wird es Abend, und wieder lässt er das Nachtlager aufschlagen. Aber für die Schanzarbeit reicht die Kraft der Männer nicht mehr aus. Zu sehr ist ihnen schon zugesetzt worden.
In Bächen stürzt am dritten Tag der Regen aus dem wolkenschweren Himmel herab, die Sicht beträgt nur wenige Ellen. Schon zeichnet sich der Untergang ab. Die Unsrigen sind in ein Sumpfgebiet geraten. Von überall her tönt jetzt der Schlachtgesang der Germanen. Das Horn, das sie so lange nicht gehört haben, ruft zum Vernichtungskampf auf. Einer der Adlerträger stürzt sich in den Morast. Er will wenigstens verhindern, dass das geheiligte Symbol seiner Legion in die Hände der Aufständischen fällt. Ein Gefangener erwürgt sich selbst mit Hilfe der Ketten, die sie ihm angelegt haben. Andere ermutigen sich zu gegenseitigem Mord. Und Varus stürzt sich in sein Schwert.
Ich war unter den wenigen, die sich ins Kastell an den Rhenus retten konnten. Aber immer wieder kehre ich, als Germane verkleidet, an den Schauplatz des Schreckens zurück und beneide die Toten, die Ruhe gefunden haben. Ich lebe, ja, aber gerettet bin ich nicht, im Gegenteil, im Gegenteil!‘
Ehe ich den Alten weiter befragen konnte, war er in dem dunklen Wald verschwunden. Die ihm sogleich nachgesandten Soldaten vermochten ihn nicht mehr aufzufinden. Er hatte sich, ein Spuk, im Nichts aufgelöst, ein Gespenst in finsterer Nacht.
So beunruhigend und grauenhaft sich die Geschichte auch angehört hatte, das, was er geschildert hatte, lag doch Jahre zurück, und Rom hat viel von seinem Selbstbewusstsein wiedergefunden. Was uns aber auf unserem weiteren Weg erwartete, stellt jede noch so grässliche Phantasie in den Schatten.
Auftragsgemäß nähern wir uns der trauerreichen Stätte. Ich habe einen Tribun vorausgeschickt, den mutigsten meiner Männer, den verfluchten Ort zu erkunden. Leichenblass, stotternd und seiner Sinne offenbar nicht mehr mächtig, kehrt er nach einigen Tagen zurück.
‚Die Zeit hat nur mehr ihre Gebeine bewahrt‘, murmelt er mit blödem Lachen. ‚Ha, ha, ihre Gebeine. Knochen, soweit das Auge reicht. Da ein römisches Skelett, da ein germanisches Skelett, ein römisches, wieder ein germanisches …‘ Dazu vollführt er einen irren Tanz um das Lagerfeuer, sodass uns ganz seltsam zu Mute wird.
Ich befehle, den Mann in sein Zelt zu bringen und ihm ein starkes Schlafmittel zu verabreichen. Jemand soll Wache halten. Am nächsten Morgen mache ich mich mit meinen mutigsten Leuten auf, nur mit Freiwilligen, ich will keine unangenehme Überraschung.
Das erste Lager des Varus zeugt noch von der Sorgfalt der Schanzarbeit dreier Legionen. Schon im zweiten Lager überall nur bleichendes Gebein und Anzeichen dafür, dass sich viele in die Büsche geschlagen haben. Doch auch Hinweise auf erbitterten Widerstand. Fragmente von Waffen und Pferdegerippe. An vielen Baumstämmen befestigte Schädel. Und in den umliegenden Hainen Altäre, an denen die Barbaren ihren Göttern die Tribunen und Centurionen geopfert haben. Dann die Orte, wo die höchsten Offiziere gefallen und die Adler verloren gegangen sind. Wo Varus die erste Wunde empfangen und den Entschluss gefasst hat, den Tod durch sein eigenes Schwert dem Zorn Roms vorzuziehen.
Ich gab Anweisung, alle Gebeine mit gleicher Ehre zu bestatten, ohne Unterschied, ob wir fremde Reste oder die der Unsrigen verscharrten, alle als Verwandte, Blutsfreunde im Unglück, Brüder im Tod betrachtend.
Unbändiger Zorn stieg in mir auf. Wir verweilten nicht lange auf dem unheimlichen Friedhof. Ich beschloss, den Verräter zu stellen, koste es, was es wolle, Arminius das Vieh, Arminius den Schlächter, der Rom um drei seiner stolzesten Legionen gebracht hatte. Aber Varus kann offenbar keine Ruhe finden. Es ist er, der unseren Vormarsch stört. Immerzu spukt er in den düsteren Wäldern fort, taucht er jäh auf aus dem schwarzen Morast, entschlüpft er blutverschmiert dem Moor und streckt uns gierig die Hände entgegen, um uns mitzureißen in den Untergang. Und dreist, als trieben sie mit uns ein lustiges Spiel, beschwören die Anführer der Feinde die unterirdischen Schatten. ‚Hier, Varus!‘, fordert ihn der Cherusker noch einmal zum Kampf. Und von weit her durchschneidet ein Leidensruf Raum und Zeit und durchdringt Mark und Bein. „Quinctili Vare, redde legiones!“
Germanicus zitterte so heftig, dass ihn Agrippina bat, sich jetzt ein wenig Ruhe zu gönnen. Er nahm einen Schluck mulsum aus dem goldgetriebenen Becher, den er in der Hand hielt, umklammerte das leuchtende Metall, als müsse er sich daran festhalten, und sah seine Frau mit blutunterlaufenen Augen an.
Agrippina erschrak. Sie wusste plötzlich – woher, von wem? –, dass ihr Gatte niemals Princeps würde. Die Götter hatten seine Tage gezählt. Voll Mitgefühl betrachtete sie das Kind, das in seiner Wiege nichtsahnend einer vaterlosen Zukunft entgegenschlummerte.
Nur wenige Jahre später machten sich Gerüchte im Römerreich breit. Arminius, so hieß es, sei seiner gerechten Strafe zugeführt worden. Die eigenen Verwandten hätten ihn, seines Hochmuts überdrüssig, erschlagen. Seine Frau Thusnelda und sein kleiner Sohn Thumelicus befänden sich bereits auf dem Weg nach Rom, wo sie als Sklaven ein trauriges Los erwartete.
Der Tod kommt auf gewundenen Pfaden
Wochen vergingen, ehe Germanicus jene Erlebnisse verarbeitet hatte, das Grauen in den dunklen Wäldern, für die die Einheimischen keinen Namen kannten. Nachts fand er keinen Schlaf. Ein Umgetriebener, wandelte er in den hohen Räumen des Kastells umher, in dem Teil des Lagers, das ihm und den Seinen als Wohnstatt diente. Bei jedem noch so geringen Geräusch begann er heftig zu zittern und sah sich ängstlich um.
Mit sehnsüchtigen Augen betrachtete er die geliebte Frau und die kleine Tochter, die ihnen ein gnädiger Himmel inmitten der Wildnis geschenkt hatte. Lange hatte er um die Gesundheit der beiden gebangt, hatte sich mit Vorwürfen überhäuft, Agrippina in diesem Zustand nicht in Rom zurückgelassen, sondern den Gefahren dieser Reise ausgesetzt zu haben, von der es womöglich keine Rückkehr gab. Nicht nur die Götter wussten, er hatte alles versucht, sie zum Bleiben zu überreden. Aber sie war die Tochter des eigenwilligen Marcus Vipsanius Agrippa, des einst nebst Augustus mächtigsten Mannes des Reiches, und der selbstbewussten Iulia. Sie war eigenwilliger als ihre anderen Geschwister, und eine ganze Legion hätte sie von dem, was sie sich einmal in den Kopf gesetzt hatte, nicht abzubringen vermocht. So hatte auch er schließlich nachgegeben. Was hätte er auch anderes tun sollen, wo sie doch sogar gedroht hatte, sich umzubringen, wenn er sie nicht mitkommen ließe!
Und doch! Er hatte das unbestimmte Gefühl, dass alles noch viel schlimmer käme. Seine Kinder sahen einer schrecklichen Zukunft entgegen. War denn ihre Sippe verflucht? Selbst Gaius, der heute von den Soldaten gefeiert wurde, als wäre er ihr künftiger Herr, würde noch in jungen Jahren tragisch enden, er fühlte es wohl.
Bei keiner Geburt hatte er versäumt, die Orakel zu befragen, Delphi, Didyma und wie sie alle hießen, auch das der Sibylle von Cumae und Vergils kühnes Epos Aeneis, das als Ort der Prophezeiungen vor kurzem in Mode gekommen war. Übereinstimmend hatten die Vorhersagen aller zu den schlimmsten Befürchtungen Anlass gegeben. Nur seine Frau durfte davon nichts wissen. Galt es doch, sie so lange als möglich zu schonen, denn auf sie wartete womöglich das schrecklichste Los.
Und er selbst? Er würde seine Familie nicht mehr lange beschützen können, soviel stand fest. In vielfältigen Vorzeichen hatte sich ihm der nahe Tod angekündigt. Die Götter Roms hatten seine Tage gezählt.
Beunruhigende Nachrichten kamen indes auch aus Rom. Beinahe wöchentlich trafen Kuriere aus der Hauptstadt ein, Germanicus möge sich allmählich auf die Heimreise vorbereiten. Noch bestünde kein Anlass zu übertriebener Eile. Aber man wolle ihn keiner Überraschung aussetzen, und die Rückreise solle gut geplant sein. Um die Gesundheit des Princeps Augustus sei es nicht zum Besten bestellt. Eigentlich lasse der Zustand in seinem Alter kaum noch hoffen.
Tatsächlich stand der Herr der Welt im 76. Lebensjahr, und es gab nur wenige, denen vom Schicksal eine ähnlich lange Lebenszeit zugemessen worden war. Bei jedem anderen hätten sich die Römer dafür dankbar gezeigt. Nicht so bei ihm, für dessen Genesung sie Tag und Nacht beteten. Niemand oder doch nur Vereinzelte erinnerten sich noch an die Tage der späten Republik, die mit seinem Erscheinen auf der Bühne des Weltgeschehens verloren war.
Ginge er tatsächlich heim zu den unterirdischen Schatten, was würde dann aus ihnen und aus Rom?
Selten zuvor hatte man die Stufen der Tempel so belagert gesehen wie in jenen Tagen des Abschiednehmens. Dass sein Tod unmittelbar bevorstand, konnte keinem entgehen.
Denn der Princeps war krank. Seit Wochen plagten ihn so heftige Leibkrämpfe, dass er manchmal wie ein Kind wimmerte. Man flüsterte hinter vorgehaltener Hand wieder einmal von Gift. Gift, das so manchen Hoffnungsträger aus dem Kaiserhaus schon in jungen Jahren dahingerafft hatte, Gift, das den Tod für die, denen er zu langsam kam, beschleunigen sollte. Und man scheute sich nicht, den Namen der Giftmischerin offen auszusprechen. Livia Drusilla, die ihres Gemahls längst überdrüssige Gattin, die Wölfin, die Hexe, habe beschlossen, dessen Platz nun endlich für Tiberius zu räumen, ihren Sohn aus früherer Ehe, Tiberius aus dem alten adelsstolzen Geschlecht der Claudier, für den sie jahrzehntelang ihr von Augustus zugefügte Demütigungen und Kränkungen mit scheinbar stoischer Gelassenheit ertragen hatte.
Nachts rotteten sich die Mutigsten zusammen, erschienen vor den Toren des herrschaftlichen Palastes und skandierten mit drohenden Gebärden Livias Namen. Und von den Wänden der Tempel des Forums hallte es unheimlich wider: Livia, Livia Drusilla, Livia!
Tiberius also, der finstere Claudier und Menschenfeind. Was hatte man von ihm zu erwarten?
War nicht Augustus selbst stets verstummt, wenn sein ungeliebter Stiefsohn in eine fröhliche Unterhaltung platzte? Und hatte der Princeps nach einer Unterredung mit ihm nicht erst kürzlich das „arme römische Volk“ bedauert, das bald zwischen Tiberius’ „langsamen Kinnbacken zermalmt“ würde?
Seit jeher ein Meister der Verstellkunst, ließ sich Augustus aber nichts anmerken. Trotz seines bedenklichen Zustands und der Warnung der ratlosen Ärzte tat er seine Pflicht. Dabei schien er von einer geradezu ansteckenden Heiterkeit befallen zu sein. Er scherzte mit den Abgesandten fremder Völker, die er im Bett liegend empfing, sodass sich diese, die ehrfurchtsvoll vor ihn getreten waren, auf das eigenartige Verhalten dieses Herrschers keinen rechten Reim machen konnten. Er besprach sich mit seiner Frau, als hätte er von den bösen Gerüchten, die über sie umliefen, nichts gehört. Wie immer, wenn er sie in Staatsdingen oder in wichtigen Familienangelegenheiten zu Rate zog – und er traf seit Jahrzehnten kaum noch eine Entscheidung ohne sie – war das, was er mit ihr zu besprechen hatte, zuvor genau aufgeschrieben worden. Er wollte schließlich nichts Unpassendes oder Falsches sagen.
Zum Schreiben freilich war der alte Mann schon lange zu schwach. Fast immer musste er jetzt seinen ab epistulis bemühen, den kaiserlichen Geheimsekretär.
Noch einmal gedachte der Princeps, eine Reise zu tun. Er mochte ahnen, dass es eine ohne Wiederkehr werden würde. Er verließ mit gewaltigem Tross das hitzeschwangere Rom, um nach Campanien ans Meer zu ziehen, wo er glückliche Zeiten verbracht und manches delikate Abenteuer erlebt hatte. Auch auf Capri zog es ihn, die sonnendurchflutete Insel, die er vor vielen Jahren von Neapolis im Tausch gegen Ischia eingehandelt und mit herrlichen Landgütern geschmückt hatte.
Sein Zustand verschlechterte sich indes zusehends. Er mochte immer noch hoffen, nach Rom zurückkehren und dort in vertrauter Umgebung sterben zu dürfen, an der gigantischen Stätte seines jahrzehntelangen Wirkens, der Stadt, die er nach eigenen Worten aus Ziegeln erbaut vorgefunden und aus der er eine Schönheit aus Marmor gemacht hatte. (Es waren genug Ziegel übrig geblieben.) Aber das Schicksal erwies sich ihm als nicht so gnädig. Er kam nur bis Nola in Campanien, wo seine Familie seit alters her ein kleines Landgut besaß. Er suchte sein Vaterhaus auf, das er so lange nicht gesehen hatte. Dort entschlummerte er sanft im Kreise seiner Lieben, und der Zufall wollte, dass er im selben Bett starb wie einst sein leiblicher Vater Octavius.
In den kühlen Nachtstunden trugen die Vorsteher der Gemeinden und Landstädte den kaiserlichen Leichnam bis Bovillae. Von dort begleitete ihn eine Abordnung römischer Ritter nach Rom, wo sie ihn im Vorraum seines Hauses auf dem Palatin aufbahrten, um den Noblen der Stadt die Möglichkeit zu geben, von ihm Abschied zu nehmen.
„Dein Großvater Augustus ist jetzt ein Gott“, wandte sich Germanicus an Agrippina, und der Gedanke daran ließ ihn lächeln. Man hatte ihn nicht weiter gedrängt, in die Hauptstadt zurückzukehren, und so hatte er beschlossen, so lange als möglich im Norden zu bleiben, wogegen seine Frau keinen Einwand erhob.
„Er ist auch dein Großvater, nepos Dei!“, gab Agrippina spottend zurück. “Oder hast du schon vergessen, was in Rom die Spatzen noch immer von den Dächern pfeifen? Dass er nämlich deine Großmutter, die ach so tugendhafte Livia Drusilla, nicht nur ihrem Gatten Tiberius Claudius Nero entführt, sondern diesem obendrein noch die Hörner aufgesetzt habe? ‚Wer Glück hat, bekommt auch noch ein Dreimonatskind‘, sagten sie damals und meinten deinen Vater, der tatsächlich bald nach der skandalösen Eheschließung zur Welt kam. Vergleiche doch nur die Bildnisse des Princeps mit denen des Drusus! Ist dir die Ähnlichkeit noch nie aufgefallen?“, wollte sie wissen.
Und ernster fuhr sie fort:
„Und unsere seltene Eintracht, die geradezu sprichwörtlich ist in Rom? So können doch nur zwei zusammenleben, die gleichen Blutes sind.“
Natürlich waren auch Germanicus bestimmte gemeinsame Merkmale der beiden Männer aufgefallen. Zwar konnte er sich an seinen von den Römern so überaus geliebten Vater kaum erinnern, denn dieser war schon vor mehr als zwei Jahrzehnten als Toter von einem Feldzug aus Germanien zurückgekehrt. Aber in seinen eigenen Zügen entdeckte er oft die des Augustus: Die Nase leicht vorspringend, die Wangenknochen ausgeprägt. Dazu ein strahlender Blick, dem niemand lange widerstehen konnte, und ein Kranz heller Locken über einer hohen, oft sorgenumwölkten Stirn.
„Wenn nur aus uns so schnell keine Götter werden!“ Germanicus versuchte zu scherzen, doch lief es ihm bei dem Gedanken an einen baldigen Tod eiskalt über den Rücken. Schon Caesar, den berühmten Ahnen, hatte ein schweres Schicksal ereilt. Wie würde er enden? Welches Schicksal war ihm bestimmt?
„Stell dir vor, wir müssten ewig leben!“ Germanicus war nachdenklich geworden. „Oder eine Ehe wie die Götter führen, mit List, Betrug, Untreue und Hinterhältigkeit. Doch im Ernst. Ich bin auf das Schlimmste gefasst. Noch nie hat sich ein Machtwechsel in Rom ohne Blutvergießen vollzogen. Und ich befürchte …“
Germanicus hatte noch nicht ausgesprochen, als von draußen Furcht erregender Lärm zu vernehmen war. Im nächsten Augenblick wurde die Tür zu den Feldherrngemächern aufgestoßen. Die Leibwache stürzte herein und hatte Mühe, die aufgebrachte Menge mit ihren Speeren am Eindringen zu hindern. Agrippina zog zitternd ihre kleine Tochter an sich und drückte sie fest an die Brust. Selbst Stiefelchen Gaius suchte mit fahlem Gesicht Schutz unter den Röcken seiner Mutter. Agrippina sah sich ängstlich um und ließ den hinteren Ausgang ihres Gemachs nicht aus den Augen, den Fluchtweg, über den sie in Gedanken mit ihren Kindern immer wieder um ihr Leben und doch nur in eine zweifelhafte Freiheit gerannt war. Anders als ihr Gatte, der viele Jahre im Feldlager verbracht und mit seinen Männern alle Gefahren gemeistert und sogar das einfache Essen geteilt hatte, und so einer der Ihren geworden war, war seine Frau stets vorsichtig, kühl und zurückhaltend geblieben. Von wenigen Reisen abgesehen, hatte sie die Sicherheit ihres römischen Palastes kaum verlassen. Dass man selbst dort nicht vor allen Gefahren gefeit war, hatte sie bei den Verhaftungen ihrer geliebten Mutter Iulia und ihrer Schwester leidvoll erfahren. Grob war man mit ihnen umgegangen, ihren hohen Stand missachtend. Und doch war es nicht das Schlechteste, unter der Herrschaft eines Augustus zu leben, der allgemein als menschlich und gerecht galt und einen unbehelligt ließ, solange man nicht allzu provozierend gegen seine Spielregeln verstieß. Hatten nicht Mutter und Schwester die Staatsführung immer wieder herausgefordert und ihr Schicksal damit weitestgehend selbst verursacht?
„Was treibt euch her, Männer? Was geht hier vor?“
Die tief stehende Sonne blendete Germanicus, sodass er schützend die Hand vor die Augen halten musste und nicht gleich erkennen konnte, wer ihm gegenüber stand. Er versuchte, Strenge in seine Stimme zu legen. Aber seine Worte gingen in dem allgemeinen Tumult unter. Erst als er aufstand, den Soldaten entgegenging und, Ruhe gebietend, die Rechte hob, verstummte langsam das undefinierbare Geschrei. Einer, den zuvor das Los bestimmt hatte, durchbrach die Front der Wachleute, trat mutig auf den Feldherrn zu und blickte ihm unverwandt in die Augen. Dieser erwiderte nicht weniger unerschrocken den eindringlichen Blick.
„Sprich!“, forderte er den Mann auf. „Was wollt ihr hier. Ist das etwa die Disziplin von Männern, um die uns eine halbe Welt beneidet?