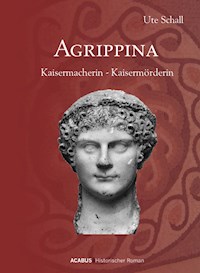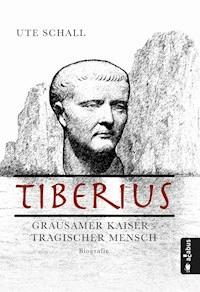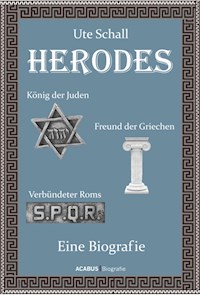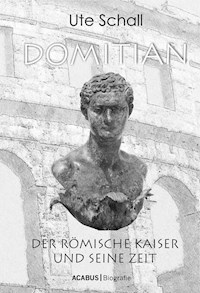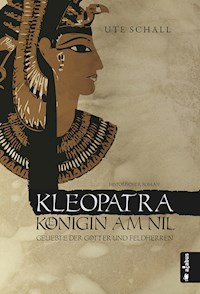Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
In der langen Reihe der römischen Kaiser war er der Erste, der einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel: C. Iulius Caesar, ermordet an den Iden des März 44 v. Chr. Die Zahl der römischen Caesaren, die die Bühne des Weltgeschehens auf natürlichem Wege verließen, war gering. Mord und Selbstmord waren bei Roms Herrschenden an der Tagesordnung. Viele von ihnen regierten nur Wochen oder gar Tage, sodass die Annalen oft kaum mehr als ihre Namen bewahrten. "So starben die römischen Kaiser" bringt dem interessierten Leser die mehr oder weniger gut dokumentierten Todesfälle in Form historischer Erzählungen näher. Wo die alten Quellen schweigen oder nur unzureichend berichten, ergreifen die Sterbenden, auf ihr Leben zurückblickend, selbst das Wort. So etwa Diocletian, der, einzigartig in der römischen Kaisergeschichte, auf seine Macht verzichtete und sich in seinen letzten Lebensjahren damit begnügte, Gemüse zu züchten. Schon die späte Republik war nie frei von Gewalt. Durch die über 500-jährige Kaisergeschichte aber zieht sich eine kontinuierliche Blutspur, die erst mit der Vertreibung des "Kaiserleins" 476 n. Chr. ein – freilich unrühmliches – Ende fand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 407
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ute Schall
SO STARBEN DIE ROMISCHEN KAISER
HISTORISCHE ERZAHLUNGEN
Schall, Ute: So starben die römischen Kaiser. Historische Erzählungen, Hamburg, ACABUS Verlag 2013
Originalausgabe
PDF: ISBN 978-3-86282-238-6
ePub: ISBN 978-3-86282-239-3
Print: ISBN 978-3-86282-237-9
Lektorat: Claudia Müllerchen, ACABUS Verlag
Korrektorat: Melanie Hahn, ACABUS Verlag
Umschlaggestaltung: ds, ACABUS Verlag
Umschlagmotiv: www.pixabay.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.deabrufbar.
Der ACABUS Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
© ACABUS Verlag, Hamburg 2013
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Meinen Freunden Alexander und Marie B. gewidmet
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Julisch-Claudische Dynastie: Von Caesar bis Nero
Der Griff nach den Sternen – Gaius Iulius Caesar
Könige des Ostens – Antonius und Kleopatra
Prinzentod – Drusus
Vom Sterben des Kaisers Augustus
Der alte Mann von Capri – Tiberius
Gaius Caesar, genannt Caligula
Ein Trottel namens Claudius
„… wenn er nur herrscht!“ – Der Tod Iulia Agrippinas
Das gefährliche Dampfbad – Octavias qualvolles Sterben
Seneca oder Der Weisheit Höhepunkt
„Seht, das ist Treue!“ Kaiser Neros mühsames Sterben
Das unrühmliche Dreikaiserjahr: Galba, Otho und Vitellius
Nur ein gichtiger Greis – Servius Sulpicius Galba
Der Kaiser, der besser starb als er herrschte. Marcus Salvius Otho
Vitellius, der Vielfraß
Das Flavische Kaiserhaus: Vespasian und seine Söhne
Der merkwürdige Kaiser Vespasian
Titus – Das Entzücken des Menschengeschlechts
„Es ist genug!“ Domitian
Adoptivkaiser und Antonine: Von Nerva bis Commodus
Nerva
Der Zweck heiligt die Mittel. Trajan
Das Ende des Regenbogens – Antinoos
Der den Frieden liebte und doch Krieg führen musste – Publius Aelius Hadrianus
Der fromme Antoninus
Lucius Verus
Der letzte Aufbruch. Marc Aurel
Der missratene Sohn – Commodus
Die aus der Fremde kamen: Die afrikanischen und syrischen Kaiser. Von Pertinax bis Alexander Severus
Wer, bitte, ist Pertinax?
Didius Iulianus
„Gibt es noch etwas zu tun?“ Kaiser Septimius Severus
Trauer muss Augusta tragen. Getas Tod
Caracalla
Der als Kaiser nie nach Rom kam – Macrinus
Ein feenhafter Priesterknabe. Elagabal
Ein Geschenk der Götter. Alexander Severus
Die Soldatenkaiser: Von Maximinus Thrax bis Carus
Maximinus Thrax. Ein Thraker und andere Emporkömmlinge
Gordianus’ III. früher Tod
Der finstere Araber. Philippus Arabs
Undank ist der Welten Lohn. Decius
Gallus
Die Pest und die Perser. Valerian
Der verhinderte Gutmensch. Gallienus
Claudius Gothicus und andere Thronräuber
Aurelian und die Königin von Palmyra
Tacitus und seine Nachfolger
Carus und wer nach ihm kam
Die Tetrarchie und die Constantinische Dynastie: Von Diocletian bis Julian Apostata
C. Aurelius Valerius Diocletianus und der Verzicht auf die Macht
Flavius Valerius Constantius
Constantin & Co. – Die Nachfolger Diocletians
Das späte Bekenntnis des Maximinus Daia
Licinius’ Tod
Constantin II., Constans & Co
Constantius II
„Du hast gesiegt, Galiläer!“ – Julian, genannt Apostata
Die Kaiser des späten vierten Jahrhunderts: Von Jovian bis Theodosius
Iovianus
Flavius Valentinianus
Flavius Valens. Der im Schatten seines Bruders stand
Gratianus
Die ungleichen Kollegen: Maximus und Valentinian II
Eine Marionette auf dem Thron. Eugenius
Der den Christengott liebte – Theodosius
Das Ende: Von Arcadius bis Romulus Augustulus
Die ungleichen Brüder. Flavius Arcadius
Honorius, das Kind
Ein weiterer Kindkaiser – Theodosius II
Valentinianus III
Der Herr der 70 Tage – Petronius Maximus
Eparchius Avitus
Der Mann, der im Osten herrschte – Flavius Marcianus
Maiorianus – Ein letzter Versuch
Der Schattenmann. Flavius Libius Severus
Anthemius, der Glücklose
Flavius Anicius Olybrius
Glycerius
Iulius Nepos
Romulus, das Kaiserlein
Das Ende des Weströmischen Reiches
Karte: Überblick über die erwähnten Orte
Glossar: Lateinische Zitate und Begriffe
Vorwort
Lang ist die Reihe der römischen Kaiser, die mit der Alleinherrschaft Gaius Iulius Caesars knapp fünfzig Jahre vor der Zeitenwende begann, und gering die Zahl derer, die die Bühne des Weltgeschehens auf natürlichem Weg wieder verließen. Von vielen von ihnen, die oft nur Tage oder Wochen regierten, haben die Annalen kaum mehr als die Namen bewahrt. Und es war eigenartig: Obwohl sich ein jeder Anwärter auf die höchste Würde, die Rom zu vergeben hatte, ausmalen konnte, dass seine Regentschaft nicht lange währen und er wahrscheinlich eines gewaltsamen Todes sterben würde, herrschte nie ein Mangel an Bewerbern. Bis zum Ende Westroms (476 n. Chr.) blieb das dortige Herrscheramt begehrt, hoffte jeder Throninhaber, ihm würde das Schicksal mehr gewogen sein als den meisten seiner Vorgänger.
„So lebten die römischen Kaiser“ hat vor einigen Jahrzehnten Ivar Lissner seine Sammlung populärwissenschaftlicher Kurzbiografien der römischen Herrscher von Caesar bis zu den Soldatenkaisern genannt. Das vorliegende Werk versucht, daran anzuknüpfen, und die mehr oder weniger gut dokumentierten Todesfälle dem interessierten Leser in verständlicher Form näher zu bringen. Dabei werden alle Kaiser des Weströmischen Reiches berücksichtigt, beginnend bei Caesar und endend bei Romulus Augustulus. Wo die alten Quellen schweigen oder nur unzureichend berichten, sprechen die Sterbenden, auf ihr Leben zurückblickend, selbst. So etwa Marc Aurel, der sich noch auf dem Krankenlager kurz vor seinem Tod ganz seinen philosophischen Betrachtungen hingab, oder Diocletian, der, wohl einzigartig in der römischen Kaisergeschichte, auf die Macht verzichtete und sich in seinen letzten Lebenstagen damit begnügte, Gemüse zu züchten …
Je kürzer und sachlicher die Berichte über die einzelnen Herrscherpersönlichkeiten werden, desto mehr nähert sich Rom seinem Untergang. Schon die ungewöhnlichen Namen der Kaiser der letzten beiden Jahrhunderte in Westrom und die rasche Abfolge der Throninhaber zeigen den Verfall des Reiches.
Mit Romulus hatte nach dem Glauben der Alten die glorreiche römische Geschichte begonnen, mit Augustus ihren Höhepunkt erreicht. Und mit Romulus Augustulus ging sie schließlich – vorerst freilich nur für Westrom – zu Ende. Schon die Republik war, vor allem in ihren letzten Jahrzehnten, nie frei von Gewalt gewesen. Durch die über fünfhundertjährige Kaiserzeit aber zieht sich eine ununterbrochene Blutspur, die mit der Ermordung Caesars an den Iden des März im Jahre 709 a.u.c. begann und mit der Vertreibung des „Kaiserleins“ 476 n. Chr. ein unrühmliches Ende fand.
Auch einigen „Nebenfiguren“, die eng mit dem Kaiserhaus verbunden waren, wurde das eine oder andere Kapitel gewidmet. So etwa Neros Erzieher Seneca oder Antinoos, der als Freund und enger Vertrauter Kaiser Hadrians auf mysteriöse Weise während einer Nilkreuzfahrt ertrank.
Die Julisch-Claudische Dynastie: Von Caesar bis Nero
Der Griff nach den Sternen – Gaius Iulius Caesar
100–44 v. Chr.
Unmittelbar bevor ihm jener Stich versetzt wurde, von dem die Ärzte später behaupten sollten, dass es von 26 der einzige tödliche war, sah Caesar auf und schaute mit schreckgeweiteten Augen in die Gesichter seiner Feinde, die er noch bis vor wenigen Minuten für seine Freunde gehalten hatte. Dann entfernte sich in der kurzen Zeit, die ihm der Tod noch gewährte, der tränenverschleierte Blick, und er erkannte sich im Feldherrnmantel, ein strahlender Held, vor dem sie ehrfurchtsvoll das Knie beugten. Noch einmal ritt er durch die Weiten Galliens, setzte über in die unheimlichen Wälder der germanischen Völker, überschritt, alles auf eine Karte setzend, den Rubikon und entdeckte sein Spiegelbild in den Wellen des Nils, dessen Grün den Augen der Königin glich, Kleopatras, der einzigen Frau, die in der Lage gewesen war, ihm wenigstens vorübergehend die Sinne zu rauben.
Ein letztes Mal kostete er den Geschmack der Macht, der ihm jetzt jedoch bitter erschien, sodass ein leises Seufzen seiner gemarterten Kehle entfuhr. „Auch du, mein Sohn?“, wunderte er sich, als er Brutus gewahr wurde, dem er so lange wie ein Vater gewesen war. Nein, dachte er, nein. So viel Aufhebens hätte es nicht bedurft. Wisst ihr Narren denn nicht, dass ich aus dem Partherkrieg nicht mehr heimgekehrt wäre, dass das Schicksal meine Tage gezählt hatte, ohnehin?
Dann griff er nach seiner blutbesudelten Toga und zog sie sich über den Kopf. Niemand sollte sagen können, ein Gaius Iulius Caesar, der große Caesar, verstünde nicht, mit Würde zu fallen. Sterbend umfing er die Statue des Pompeius, als suche er Halt an dem Mann, der sein Freund und sein Feind gewesen war. Und ein augurenhaftes Lächeln umspielte seinen schmallippigen Mund.
Der volle Mond streute ein diffuses Licht durch den hauchdünn geschliffenen Travertin der Fenster des ehelichen Schlafgemachs. Das Jahr war noch jung, und dennoch lastete schon eine fast sommerliche Schwüle über dem hohen Raum. In wenigen Tagen würden sie das Fest der Liberalia feiern, und zahllose Knaben würden ihre Kinderkleider ablegen und die toga virilis empfangen, um in den Kreis der erwachsenen und wehrfähigen Männer aufgenommen zu werden.
Calpurnia schreckte hoch aus wirrem Traum. Hatte sie überhaupt ein Auge zugetan? Sie wusste es nicht. Erinnerte sich nur, dass ihr gewesen war, als halte sie, die liebte, ohne wiedergeliebt zu werden, den blutüberströmten Gatten leblos in den Armen. Aber nein, da war nichts. Sie setzte sich auf und sah zu ihm hinüber. Sein Atem ging gleichmäßig, doch seine Züge umspielte ein leidender Ausdruck, und Schweißperlen glänzten auf der hohen gelichteten Stirn. Liebevoll strich sie ihm über die feuchtwarme Haut. „Gaius Iulius Caesar“, flüsterte sie. Sie hatte ihr Glück kaum fassen können, als er bei ihrem Vater um ihre Hand angehalten hatte, er, nach dem sich die Schönen Roms in langen Nächten verzehrten, heimlicher König des Reiches und mächtigster Mann seiner Zeit, der Rom eine Welt zu Füßen gelegt hatte. Warum sorgte sie sich nur so sehr? Warum war ihr, als hätten sie schon lange Abschied von einander genommen? Wovor diese doch sicherlich unbegründete Furcht?
Hatte er nicht bislang allen Gefahren getrotzt? Den Nachstellungen Sullas in früher Jugendzeit, der Geldgier der Piraten, die ihn auf hoher See aufgebracht und dann, wie er meinte, gegen ein viel zu geringes Lösegeld wieder freigelassen hatten. Den gallischen Kriegern, die auf seinen Kopf ein Preisgeld ausgesetzt hatten. Der Missgunst schließlich eines Pompeius Magnus, der lange sein Freund und Schwiegersohn, zuletzt jedoch sein erbittertster Gegner gewesen war.
Aus jeder Gefahr war er gestärkt hervorgegangen, sodass der Volksmund mit einer gewissen Berechtigung verbreiten konnte, ihm hafte das Glück an wie vielen anderen erkaltetes Pech. Aber ruft nicht so viel göttliche Gunst auch manchen Neider auf den Plan?
Schwerfällig erhob sich die edle Frau, zog die neben der Bettstatt bereit liegende palla über, trat ans Fenster und öffnete leise den Seitenflügel, der den Blick auf das weitläufige säulenbestandene Atrium freigab, das im hellen Mondlicht verführerisch glänzte. Die würzige Frühlingsluft vertrieb für einen Augenblick die schweren Gedanken. Sie legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen. Dann tat sie einige Schritte hinaus in die unbekannte Nacht.
Bäume und Sträucher warfen gespenstische Schatten, und silbern spielte das Mondlicht auf der glatten Fläche des Teichs. Frösche quakten. Das Murmeln des Brunnens klang wie aus weiter Ferne, aus einer anderen fremden Welt. Wie friedlich doch alles erscheint, dachte Calpurnia, doch sie wusste, dass die Idylle trog. Es lag etwas Lauerndes und Warnendes in der Luft, Bedrohung, Veränderung, Verrat und Angst. Sie schleppte sich zurück zu ihrem Gatten, betrachtete aufmerksam sein eingefallenes Gesicht, die hohen Wangenknochen und die Haut, die die Spuren des Alters vorwegnahm. Und plötzlich war ihr, als blicke sie in die fahle Maske eines Toten. Erschaudernd bettete sie sich auf ihr Lager und fiel erneut in einen schweren, schweißtreibenden Traum.
Die Zeichen der Zeit standen schlecht. Angst lähmte die siebenhügelige Stadt. Menschenleer dehnte sich das Forum selbst in den lichtdurchfluteten Tagesstunden. Nachts aber machten vermummte Gestalten und zweifelhaftes Gelichter die Straßen unsicher. Ein Ausgeraubter hier, ein Erschlagener dort. Hilferufe, die ungehört in der Dunkelheit verhallten. Morgens grässlich entstellte Leichen nackt im Tiber treibend, gesichts- oder kopflos, das Gedärm nach außen gekehrt. Köpfe, die tränenlos und unbewimpert von den Gemonien rollten. Schnödes Verbrechen blieb ungesühnt.
„Weißt du es schon? Hast du es auch gehört?“ In Etrurien wurde ein Kalb mit drei Köpfen geboren. Hafer wuchs dort aus den Kronen der Bäume. Eigenartige Vögel, für die niemand einen Namen kannte, kreisten über Dörfern und Städten. Man sah eine Schlange, die sich vom Schwanz her selbst verzehrte. In Capua gar stießen Siedler beim Bau ihrer Hütten auf uralte Gräber. In einem fand sich eine eherne Tafel. In den gestelzten Lettern einer vielhundertjährigen Schrift stand darauf geschrieben:
„Unbekannter, der du die Gebeine des Capys entdeckest, melde in Rom, ein Enkel des sagenumwobenen Gründers werde dort durch verwandte Hand heimtückisch fallen. Das aber werde Italien mit großer Heimsuchung büßen.“
Düstere Zeiten kündigten sich an, Zeiten, die die Menschen verstummen ließen. Nur einer achtete der ungünstigen Omina nicht: Gaius Iulius Caesar, der sein Geschlecht auf Iulus, den legendären Vorvater, und damit auf die Göttin Venus selbst zurückführte.
„Hüte dich vor den Iden des März!“, hatte ihm erst kürzlich Spurinna im Senat zugerufen, der Seher, der blind war und doch mehr als andere sah. Aber der heimliche König Roms, Diktator auf Lebenszeit, hatte darüber nur gelacht. „Es liegt im Interesse der Allgemeinheit, dass ich am Leben bleibe. Wenn mir nämlich etwas zustieße, würde das Rom erneut in blutige Bürgerkriege stürzen.“
Doch dann auch bei ihm Träume, immer wieder diese Träume: Da war der Zaunkönig, der, einen Lorbeerzweig im Schnabel, zur Kurie des Pompeius flog. Doch sollte er sie nicht erreichen. Denn schon unterwegs stürzte sich ein Schwarm von Raubvögeln auf ihn, um ihn zu zerreißen. Wie er, Caesar, sich in Gesichten über Wolken schwebend wiederfand und Jupiter die Hand reichte. Und dann Calpurnia, die schlafwandelnd durch Gemächer, Hallen und Flure schlich, die nachts schrie und um sich schlug, ohne sich morgens daran zu erinnern. Wie sie sich drehte und wand, wenn sich das kalte Mondlicht auf ihr Antlitz legte! Dann wieder lag sie ruhig neben ihm, als sei sie in den ewigen Schlaf gesunken.
Wie von Geisterhand angestoßen springen Türen und Fenster auf. „Wer da?“, will Caesar wissen, doch eine Antwort erhält er nicht.
Und er schüttelt sie, wortstark beschwört er sie, zu sich zu kommen. Aber erst anderntags soll er erfahren, dass ihr gewesen war, als halte sie den Gatten ermordet in den Armen.
„Ich beschwöre dich, heute nicht in den Senat zu gehen“, fleht sie ihn an. Darf denn nicht auch Caesar einmal krank sein? Händeringend wirft sich die stolze Römerin vor ihm zu Boden und umfängt seine Knie. Nur diesen einen Wunsch möge er ihr noch erfüllen. Dann werde sie nichts mehr erbitten.
Aber der Gatte schüttelt sie unwirsch ab. „Ich bitte dich, Frau, reiß dich zusammen! Was soll die Dienerschaft denken? Ist dir die Fassung abhandengekommen?“ Vergeblich ihre Tränen. Was gibt der große Diktator auf Weibergeschwätz!
Einen Augenblick lang sieht er sie an. Und er schaut in Augen, die Ratlosigkeit, nein, Verzweiflung widerspiegeln, schattenumrandet über eingefallenen, fast hohlen Wangen. In einer Nacht scheint sie ihm um Jahrzehnte gealtert zu sein. Dünn spannt sich über Knochen gelbe Haut, und unter dem durchsichtigen Gewand bebt eine magere Brust.
Da dauert sie ihn. „Nun“, verspricht er, „ich werde, ehe ich gehe, noch die Auguren befragen. Damit du beruhigt sein kannst.“ Dabei drückt er ihre knochige Hand. Als er dann seinem Herzen tatsächlich einen Stoß gibt und die von Roms Männern kundigsten zu Rate zieht, können auch sie, das Gesicht nach Süden gewandt, wie es den uralten ungeschriebenen Gesetzen entspricht, kopfschüttelnd und achselzuckend nur Zeichen von rechts, also von der Seite des Sonnenuntergangs und damit des Unheils erkennen. Und als sich sogar die heiligen Hühner weigern zu fressen, da wird auch Roms stärkster Mann für einen Augenblick schwach. Täte er doch gut daran, die Warnungen seiner Frau ernst zu nehmen? Heißt es nicht, Frauen hätten mitunter das zweite Gesicht?
Aber die Verschwörer haben vorgesorgt. Sie haben Decimus Brutus, einen der Ihren, ins Haus des Diktators geschickt. Er hat den strengen Auftrag, ihn heute, koste es, was es wolle, in die Kurie zu schleppen. Zu umfangreich sind die Vorbereitungen für diesen Tag gewesen, einen Triumphtag für die Res Publica, wie man glaubt. Die Nerven liegen allenthalben blank. Denn längst ist der geplante Anschlag kein Geheimnis weniger Eingeweihter mehr. Schon pfeifen ihn die Spatzen von den Dächern. Es gibt zu viele Mitläufer, Mitwisser und potentielle Verräter.
Decimus Brutus ist ein redegewandter Mann. Nicht zufällig ist die Wahl auf ihn gefallen. Oft genug hat er die Kunst des Redens und Überredens vor den versammelten Vätern bewiesen, und auch jetzt macht er seine Sache geschickt:
„Seit wann, mein Feldherr, achtest du auf das Geschwätz einer Frau? Du selbst hast für heute den Senat einberufen. Was werden die Väter denken, wenn sie erfahren, sie sollen nach Hause gehen und wiederkommen, wenn Calpurnia besser geträumt hat? Schöne Genugtuung für deine Feinde! Caesar, werden sie sagen, der große Caesar, dem wir für den Partherfeldzug sogar das Königsdiadem angeboten haben, fürchtet sich vor den Hirngespinsten eines einfältigen Weibes. Ich höre schon ihr schadenfrohes Lachen. Aber wenn du die Sitzung durchaus verschieben willst, nun, dann ist es wohl das Beste, wenn du es den versammelten Vätern selbst sagst.“
Die triumphierenden, lachenden Gegner: Ein Argument, das auch einen Caesar überzeugt. Freilich sind nicht alle Bedenken zerstreut. Aber darf er sich ohne Not eine Blöße geben, sich dem öffentlichen Gerede aussetzen? Nicht für alle Calpurnias der Welt! Die Tränen seiner Frau missachtend, verlässt er das Haus, um als Lebender nicht wiederzukehren.
Auf der Straße dann das gewohnte Bild: Man belagert ihn, man bedrängt ihn. Aufdringliche Bittsteller begleiten die Sänfte. Aber das ist man als Caesar gewohnt. Kaum vermögen die Liktoren, einen Weg durch die drängende Menge zu bahnen. Einem der Verfolger, er heißt Artemidorus und ist ein griechischer Gelehrter, gelingt es, ihm eine kleine Papyrusrolle in die Hand zu drücken. Sein Anliegen, keucht er, sei besonders dringend. „Lies!“, beschwört er ihn, „aber bitte lies bald! Der Inhalt ist für dich von größter Bedeutung.“
Aber Caesar kommt nicht zum Lesen. Er lehnt sich entspannt zurück. Wie angenehm ist doch das Bad in der Menge! Gleich einem Fischschwanz zieht eine anschwellende Menschenschar hinter ihm her. Hat er es nicht schon immer verstanden, die Massen für sich zu begeistern? Jubelrufe. Ave! Es lebe Gaius Iulius Caesar!
Im Senat dann lächelt er spöttisch zu Spurinna hinüber. „Du siehst, Alter, die Iden des März sind gekommen!“
„Sie sind gekommen. Aber vorüber sind sie noch nicht“, gibt der alte Mann warnend zurück.
Alles ist ruhig, gewiss. Nur die Verschwörer können wissen, dass der Tag nicht halten wird, was der Morgen verspricht.
Dann die übliche Begrüßung: ein Kopfnicken zur Linken, ein Handgruß nach rechts. Ehrerbietig erheben sich die Senatoren, weniger vor dem Mann als vor dem Amt, das er auf schmächtigen Schultern trägt. Nichts deutet auf etwas Ungewöhnliches hin, im Gegenteil. Brutus und seine Freunde sind heute besonders zuvorkommend, geleiten den Diktator sogar zu seinem Sitz. Nur einige Plätze in der ersten Reihe sind leer. Aber Caesar fällt das nicht einmal auf. Da tritt, wie auf ein verabredetes Zeichen hin, Tillius Cimber an Caesar heran.
Draußen indes hat Trebonius, einer der Verschwörer, Caesars Freund Marcus Antonius in ein Gespräch verwickelt. Denn bei Antonius weiß man nie. Manche Schlacht hat er mit dem Imperator geschlagen, längst wird er schon als dessen Nachfolger gehandelt. Es steht zu befürchten, dass der erfahrene General, hielte man ihn nicht auf, die Pläne der Attentäter noch im letzten Augenblick durchkreuzte und seinem Freund zu Hilfe eilte. Zudem verfügt er über eine stattliche Anhängerschaft im Senat.
Schon hat Cimber den noch immer Ahnungslosen an der purpurverbrämten Toga ergriffen. Er bittet um Gnade für seinen verbannten Bruder, den er so lange nicht gesehen hat, greift nach Caesars Händen, bedeckt ihm Haupt und Brust mit verräterischen Küssen. Der Bedrängte springt auf. Von Gnade will er heute nichts wissen. Da reißt ihm der Bittsteller die Toga vom Leib. „Was zögert ihr, Freunde?“ Es ist ein gewisser Casca, der mit gezücktem Dolch hinter dem Opfer auftaucht und den ersten Streich führt. Aber die Waffe prallt an einem Halswirbel ab. „Das ist ja Gewalt!“, wehrt sich der Angegriffene, sticht seinerseits zu und durchbohrt Cascas Arm mit einem Schreibgriffel. Versucht auch noch tapfer, die anderen Attentäter zurückzudrängen. Aber zu viele haben ihre Messer gewetzt. Das scharfe Eisen gräbt sich in sein müdes, verdorrendes Fleisch … Ein schmerzhafter Stich trifft die Seite, und Caesar sucht sterbend Halt am Bildnis jenes Mannes, der wie kein zweiter seinen Weg schicksalhaft begleitet hat: als Verbündeter, als Freund, als Schwiegersohn und schließlich als Gegner im Bürgerkrieg, der große Pompeius. Fest hält er die ihm von Artemidorus zugesteckte Rolle in der Hand. Zum Lesen ist er nicht gekommen. Das Schriftstück enthält einen Abriss der Verschwörung und die Namen aller, die in sie verstrickt sind …
In Windeseile war die Kunde von Caesars Fall aus dem Senatsgebäude gedrungen. Das Rad der Weltgeschichte stand für Augenblicke still. Angst lähmte das siebenhügelige Rom. Ein jeder stürzte Hals über Kopf ins Freie. Leerer als sonst gähnten die Straßen. Wer sollte das Ungeheuerliche erfassen? Was sollte nun werden? Ungehört verhallten die Rufe von Freiheit und Republik. In dieser Lage hätte wohl auch einem Cicero, dessen fast sprichwörtliche Beredsamkeit sogar einen Catilina ans Messer geliefert hatte, das Wort im Munde gestockt. Mit Bedacht jedoch hatten die Köpfe der Verschwörung den alten Zauderer nicht in ihre blutigen Pläne eingeweiht. Später freilich sollte er ihnen vorhalten, man habe ihn nicht zum Festmahl geladen …
Niemand vermag zu sagen, wie lange der Ermordete in seinem Blute lag. Stunden der Ungewissheit vergingen. Die Dunkelheit senkte sich schon über Rom, als sich drei von Caesars Sklaven – der vierte war in der allgemeinen Verwirrung geflohen – des blutüberströmten Leichnams erbarmten. Vorsichtig hoben sie ihn auf und betteten ihn auf die Sänfte, mit der sie den Lebenden am Morgen in den Senat gebracht hatten. Ein Arm des Getöteten baumelte lässig herab. Wer es sah, wandte den Blick erschaudernd zur Seite.
Dann wankte die kleine Gruppe heimwärts, um Calpurnia ihren Mann zurückzubringen oder das, was von ihm geblieben war.
Könige des Ostens – Antonius und Kleopatra
+ 31 v. Chr.
Noch nie hatte sie sich derart alt gefühlt. Und gedemütigt. Nichts würde ihr mehr nützen. Nicht ihre Schönheit, die einst legendär gewesen war. Nicht ihr wacher Geist, der manchen Mann in seinen Bann gezogen hatte. Und auch nicht die Tatsache, dass sie eine überaus gebildete Frau war, die zwölf Sprachen in Wort und Schrift beherrschte und ihre Gegner im wahrsten Sinne des Wortes immer verstand.
Sie war zu klug, um es nicht zu begreifen: Sie hatte das große Spiel um Macht und Leben verloren. Sie hatte ihn mit keinem ihrer Argumente zu überzeugen vermocht. Nicht mit ihrer sprichwörtlichen Verführungskunst, der seine beiden großen Vorgänger blind erlegen waren, nicht mit Tränen und Kniefall, mit denen sie vergeblich an sein Mitleid appelliert hatte, nicht mit dem Versprechen einer gemeinsamen Herrschaft über ihr Reich, das alte Land am Nil. Er würde sie ohnehin an sich reißen, die Macht. Auch ohne sie. Ihr Versuch, das Königtum für sich und ihre Kinder zu retten, war kläglich gescheitert. Mit seinen grauen Augen hatte er sie angesehen, Gaius Octavius, der große Rächer seines Adoptivvaters Caesar, und er hatte mit eiskalter Vernunft jedes Wort, mit dem sie sich hatte rechtfertigen wollen, widerlegt. Sie hatte sich nur lächerlich gemacht. Umsonst das golddurchwirkte verführerische Untergewand und das aufgelöste Haar. Umsonst alles, umsonst.
Es gab keine Rettung mehr. Aber sie würde nicht seinen Triumphzug in Rom krönen wie einst ihre Schwester Arsinoe den des später gemeuchelten Juliers gekrönt hatte. Dieser Elendsgang kam für sie nicht in Frage. Sie würde sterben, wie es sich gehörte. Sie würde die Todesart wählen, die einer Königin vom Nil und letzten Vertreterin einer großen hellenischen Epoche, der Erbin des großen Alexander, würdig war.
Wäre Octavian auf sein Angebot eingegangen, wer weiß? Aber er hätte es sich denken können: Caesars für seine Feigheit berühmter Nachfolger ließ sich auf derartige Spielchen nicht ein. Ein Zweikampf mit ihm, einem gestandenen Soldaten und grandiosen Feldherrn! Ein Zweikampf um ein Weltreich! „Marcus Antonius“, sagte er zu sich selbst, „wo lebst du denn? Erinnerst du dich nicht, dass er nie selbst gekämpft hat, sondern immer andere die Kastanien aus dem Feuer holen ließ? Weißt du nicht mehr, dass er sich vor jeder Schlacht schlotternd in die Büsche schlug und erst wieder zum Vorschein kam, wenn die Gefahr vorüber war? Ganz Rom verspottete ihn dafür. Aber es störte ihn nicht.“
Niederlage, Unglück und Verrat hatten Caesars einst so stolzem General schwer zugesetzt. Da waren die jahrelangen Beleidigungen und Verleumdungen Octavians, denen er zum Schluss nichts mehr entgegengesetzt hatte, weil er des ständigen Streitens müde geworden war. Da war die Niederlage bei Actium, als ihn sogar seine königliche Gemahlin im Stich gelassen hatte, da waren die einstigen Kameraden, die sich nicht gescheut hatten, ins gegnerische Lager überzulaufen. Nur wenige waren geblieben, die bereit waren, mit ihm unterzugehen.
Verzweifelt flüchtete sich Marc Anton in Ironie, in ahnungsvolle Reden. Er ergab sich einer Melancholie, die einem römischen Offizier schlecht anstand. Noch einmal wanderte im Kreise seiner Getreuen der Becher: Wer wisse schon, was der nächste Tag bringe? Wo würden dann seine Diener stehen? Bei ihm, bei einem anderen, während er selbst vielleicht schon tot war.
Am Morgen nach dem Trinkgelage forderte er seinen Waffendiener Eros auf, ihn zu töten. Doch so bereitwillig ihm der himmlische stets zu Diensten gewesen war, der irdische verweigerte ihm seinen Beistand und zog den Selbstmord vor.
„Das hast du fein gemacht, Eros. Du hast mir gezeigt, was ich zu tun habe.“
Und ehe ihn seine Freunde daran hindern konnten, raffte er sich auf und stieß sich das Schwert in den Unterleib.
Doch sogar zum Selbstmord taugte der verzweifelte Mann nicht mehr. Blut schoss aus der Wunde. Er krümmte sich vor Schmerzen, flehte die Anwesenden an, diesem unwürdigen Zustand ein Ende zu machen, winselte um die Gnade des Todes, wie andere um ihr Leben betteln. Aber niemand eilte ihm zu Hilfe. Der unwürdige Anblick des gefallenen Römers, der einer der größten seiner Zeit gewesen war, schlug auch den letzten Anhänger in die Flucht.
Oben, im turmartigen Überbau ihres Palastes, ist Kleopatra mit den Vorbereitungen ihres eigenen Abgangs beschäftigt. Sie hat von dem Ungeschick ihres Geliebten gehört. Wenn sie ihn ob seines Unglücks auch verachtet, in der Aussichtslosigkeit ihrer beider Lage will sie aller Welt zeigen, was sich für eine ägyptische Königin gehört. Sie bittet den Hofbeamten Diomedes, den tödlich verwundeten Gatten zu holen. Längst hat sie sich in ihrer sicheren Festung ihr Sterbezimmer eingerichtet, von der Welt Abschied genommen und sich mit ihren Dienerinnen hierher zurückgezogen. Diese letzte Bleibe will sie mit dem Mann teilen, der viele Jahre ihres Lebens so schicksalhaft begleitet hat, als Freund, als Geliebter, als Gemahl und Vater ihrer Kinder.
Er kauert am Fuße der Festung in einem Korb. Und sie selbst hilft bei der Bedienung des Seils, das ihn, vorbei an dem geschlossenen Untergeschoss des Bauwerks, in ihrer beider letzte Wohnung emporhebt.
Als die Königin den blutüberströmten Körper erblickt, zerreißt sie ihre Kleider, zerkratzt sich die Brüste, beschmiert ihr Gesicht mit dem Blut des Geliebten und nennt ihn immer wieder ihren Gemahl, ihren Herrn und König. Jetzt ist sie es, die Trost braucht. Mit schon brechendem Blick rät ihr Antonius, mit Octavian Frieden zu schließen, und er bittet sie, ihn selbst nicht zu beweinen. Groß und glücklich sei er gewesen, und es sei nicht unehrenhaft, von einem Römer besiegt zu werden. Dann haucht er in den Armen der Königin sein Leben aus, ein letztes Bekenntnis zum Römertum auf den Lippen: „De mortuis nil nisi bene.“ Später werden viele Historiker sagen, nicht Octavian habe Marc Anton auf dem Gewissen, er sei vielmehr sich selber erlegen …
Dann ist auch Kleopatras letzte Stunde gekommen. Und noch einmal erweist sie sich von königlicher Größe. Dienerinnen lassen ihr ein wohlriechendes Bad ein. Die Königin benötigt Entspannung. Sie frühstückt in altgewohnter Pracht und lässt sich danach ein goldenes Gewand anlegen. Es gilt, dem Tod würdig entgegenzutreten. Inzwischen hat ein Bauer einen Korb mit Feigen gebracht. Er hat, ohne den Argwohn der römischen Wachen zu erregen, die an den Toren aufgestellt sind, die innere Grabkammer erreicht …
Die „Erbin“ Alexanders starb am Biss der Uräusschlange, die unter den Früchten verborgen war. Und noch im Tode triumphierte sie über ihre Bezwinger. Denn sie starb als Pharaonin mit dem Anspruch auf Unsterblichkeit, die ihr das Gift des Tieres nach dem Glauben der Alten verhieß.
Man fand sie auf goldenem Lager, in königlicher Pracht und Herrlichkeit.
Als sich die Kunde von ihrem Tod verbreitet hatte, verblassten in Rom das glorreiche Ende der Schlacht von Actium und die Vernichtung des größten Gegners Marc Anton. „Fatale monstrum“ hatte sie der römische Pöbel in Nachahmung seiner Führer genannt, da er es nicht besser wusste. „Nunc est bibendum“, freute sich Horaz. Aber auch Bewunderung war zu hören: „Non humilis mulier“, kein gemeines Weib, habe sich da selbst gerichtet. Nicht einmal der Hass ihrer Feinde konnte umhin, das zuzugeben. Doch niemand konnte ahnen, dass die noch im Tode stolze Königin über mehr als zwei Jahrtausende lang Künstler und Poeten in hohem Maße inspirieren sollte.
Bis auf den heutigen Tag geistert sie durch unsere Phantasie als wahre Siegerin jener welthistorischen Epoche, eine Erbin, die sich wie nur wenige ihrer großen Vorfahren würdig erwies.
„… denn das Ende deines Leben und deiner Taten ist gekommen.“
Prinzentod – Drusus
39–9 v. Chr.
Wenn ich an Drusus denke, taucht sein Bild vor mir auf aus den Tiefen einer vergangenen Zeit. Das ebenmäßige, fast schöne Gesicht eines jungen Mannes kommt mir in den Sinn, tiefliegend die rätselhaften Augen, die immer ein wenig lauernd blicken und das Feuer einer unterdrückten Leidenschaft ahnen lassen. Ich sehe den Kranz der üppigen aschblonden Locken, die seine Züge umrahmen, dunkel die dichten Brauen, geradlinig die Nase mit dem schmalen Rücken, von samtener Weiche die Lippen, die stets ein geheimnisvolles Lächeln umspielt, ein sanft geschwungener Bogen über einem markanten, energischen Kinn. Ich erinnere eine hoch aufgerichtete, doch feingliedrige Gestalt, die majestätisch durch die weitläufigen Gänge meines Vaterhauses schritt, sehe ihn freundlich bald zur einen, bald zu anderen Seite grüßen, beiläufig, ohne die Überheblichkeit, die man bei einem Menschenkind, das die Natur mit so vielen Vorzügen gesegnet hat, im Allgemeinen erwartet.
Ich habe auch sie vor mir, die ungezählten Mädchen Roms, die in ihrem Staunen erstarren, wenn er auf seinem schwarzen Hengst vorübersprengt, Mensch und Tier scheinen eins, die ihn mit schmachtendem Herzen verfolgen, ehe sie ohnmächtig zu Boden sinken, wenn sie ein zufälliger Blick aus seinen strahlenden Augen streift.
Er ist es, dem Roms Jugend zujubelt, dem Blumen, Geschenke und Heilsrufe zufliegen, auch manche Aufforderung zu geheimem Treff. Einmal nur, ach schöner Drusus, es braucht ja auch niemand zu wissen.
Aber auch dieses Bild steigt auf aus dem tiefen Brunnen der Vergangenheit: Ich erlebe einen der traurigsten Tage in der vielhundertjährigen Geschichte der erhabenen Roma. Vor mir ein unüberschaubarer Leichenzug, der sich dunkel und schweigend durch die Porta Flaminia zwängt und stadteinwärts Richtung Marsfeld wälzt. Nirgendwo ist ein Durchkommen. Hoffnungslos verstopft sind Plätze, Märkte und Gassen, Menschen wie Ameisen, die sich eingefunden haben, den allzu früh verlorenen Sohn zu beweinen. Aber kein Laut ist zu hören. Selbst die Hufe der Pferde sind mit dicken Wolltüchern umwunden, damit ihr Klappern die Totenstille nicht störe.
Wo immer der sechsspännige Leichenwagen auftaucht, drängt die Menge ehrfurchtvoll heran. Ein jeder versucht, wenigstens einen Zipfel des golddurchwirkten Purpurtuchs zu berühren, das den vornehmen Leichnam vor allzu neugierigen Blicken verhüllt.
Voran schreitet gesenkten Hauptes Tiberius, die Augen vom Wein und von Tränen gerötet, als schmerze auch ihn dieser für Rom so herbe Verlust. Dabei haben die Römer längst über seine Schuld oder Unschuld am Unglück des Bruders ihre eigenen Geschichten gesponnen.
Alte Männer weinen leise vor sich hin. Frauen haben sich mit spitzen Nägeln Gesichter und Brüste zerkratzt. Schmerzverzerrt schreien stumm ihre Mienen. Viele der Trauernden haben verzweifelt die Arme zum Himmel emporgerissen, als klagten sie die Ungerechtigkeit der Himmlischen an. Aber jeder leidet still vor sich hin, als wage er nicht, die Würde des Augenblicks durch ein wie auch immer geartetes Geräusch zu entweihen.
Wenn ich an Drusus denke, läuft es mir eiskalt den Rücken hinab. So habe ich zuletzt bei den heiligen Opferhandlungen empfunden, als mir der Glaube der Kindheit noch nicht abhandengekommen war. Die Anziehungskraft kommt mir in den Sinn, die schon der Jüngling auf Menschen und Massen ausübte, und die Geschicklichkeit, mit der er ihnen, unbewusst und ohne dass sie es merkten, seinen Willen aufzwang.
Wann immer ich an Drusus denke, denke ich an den Tod.
Rom, das stolz auf mehr als sieben Jahrhunderte zurückblickt. Rom, der Nabel der Welt, auf den sich die Blicke aller Völker richten. Rom, dessen Macht das Mittelmeer zu einem Binnensee degradiert, dessen Frieden sich über die ganze bekannte zivilisierte Welt gebreitet hat.
Vor wenigen Jahren erst sind Tiberius und Drusus, Stiefsöhne des römischen Kaisers Augustus, mit ihren Truppen siegreich bis zur Donau vorgestoßen und haben der Weltmacht einmal mehr einen Gebietszuwachs beschert. Aber zufrieden ist der erste römische Princeps noch nicht. Träume, immer wieder Träume: von einem Rom, das weit bis zu den Ufern der Elbe reicht, von einem Reich, das sich vom grimmen Nordmeer bis zu den Donauauen erstreckt. Rom, das im Norden und Süden, im Osten und Westen von natürlichen Grenzen umgeben ist, Grenzen, die es erlauben, von nur wenigen Soldaten geschützt zu werden, da sie für die Barbaren nur schwer oder gar nicht zu überwinden sind. Rom, das keinen Rivalen neben sich duldet, das es für einen göttlichen Auftrag hält, allen noch nicht bekehrten Völkern der Welt seinen Frieden aufzuzwingen, was immer man im Zentrum der Macht darunter versteht.
Immer wieder dringen germanische Stämme in das Reichsgebiet ein. Immer wieder werden Roms ureigenste Interessen durch solche Dreistigkeit verletzt. Längst hat der Princeps beschlossen, der barbarischen Kühnheit in einer groß angelegten Offensive die Stirn zu bieten. Geht es doch nicht an, sich durch bloße Verteidigung vor aller Welt ständig lächerlich zu machen. Drusus fällt die ehrenvolle Aufgabe zu, den geplanten Feldzug ins feindliche Germanengebiet zu leiten. Im anschaulichen Bericht des Geschichtsschreibers Dio Cassius weht uns noch heute ein Hauch jenes Grauens entgegen, das die römischen Legionäre stets befiel, wenn es in Germaniens unheimliche Wälder ging.
Chatten und Sueben hat der Stiefsohn des Kaisers bezwungen, wenn auch in einer Art Pyrrhussieg, denn seine Verluste wiegen den Gewinn nicht auf. Dann durchquert er das Cheruskerland, überschreitet, kühn geworden, die Weser und erreicht schließlich die Gestade der Elbe, verbrannte Erde hinter sich zurücklassend. Ein mächtiger Strom liegt vor ihm, ein Fluss, der von fernen Bergen kommt und sich in den nördlichen Ozean ergießt. Sehnsüchtig blickt Roms tüchtiger Feldherr an das jenseitige Ufer, wählt Mutige aus, die mit ihm das große Abenteuer wagen wollen, den Fluss zu überschreiten bereit sind. Dichter Nebel verhüllt seinen Blick. Da taucht plötzlich aus den undurchdringlichen Schwaden eine hohe Gestalt auf, ein übergroßes Germanenweib, das sich ihm und seinem Ansinnen entschieden entgegenstellt. Und er vernimmt eine raue Stimme: „Wohin willst du, unersättlicher Drusus? Kehre um! Es ist dir nicht beschieden, das jenseitige Land zu schauen. Denn das Ende deiner Taten und deines Lebens ist gekommen.“ Und wie er gleichsam aus dem Nichts erschienen ist, fällt der Spuk in sich zusammen.
Verunsichert ist Roms begnadeter Feldherr. Viel halten sich er und seine Zeitgenossen auf ihre Vernunft zugute, und dennoch lassen sie sich durch Wunderzeichen und allerlei Vorhersagen immer wieder verstören. Man lebt in einer abergläubischen Zeit. Ein jeder hätte gehandelt wie er. Er gehorcht der unheimlichen fremden Seherin sofort. Haben nicht auch zu Hause schon Zeichen, Unheil verheißende Omina, vor allzu großer Kühnheit gewarnt? Dennoch: Es gilt, vor aller Welt Roms Besitzanspruch auf dieses Gebiet zu bekunden. In aller Eile schlägt er deshalb seine Siegeszeichen auf, um sogleich den Rückmarsch an den schützenden Rhein anzutreten. Nur Roms unsterbliche Götter können wissen, dass er ihn nie erreichen wird.
Zutiefst in seinem Selbstbewusstsein erschüttert, verfolgt von Hexenbann und Zauberspruch, reitet er, die unheilvolle Prophezeiung im Ohr, womöglich unvorsichtiger, als es durch das unwegsame Gelände geboten ist. Irgendwo zwischen Saale und Rhein behindert eine unbekannte Kraft seinen Weg. Hoch auf steigt das erschrockene Ross. Der geübte Reiter stürzt vom Pferd. Er fällt so unglücklich, dass er sich einen offenen Bruch des Oberschenkels zuzieht. Die besten Feldärzte werden zu Rate gezogen. Aber sie schütteln nur verzweifelnd den Kopf. An eine Fortsetzung des Ritts ist nicht zu denken. Müde und traurig schlagen die Legionäre das Nachtquartier auf.
Langsam siecht Roms Hoffnungsträger, das Idol seiner Jugend, dahin. Wölfe umstreifen heulend das Lager. In der Ferne ist weibliches Klagegeschrei zu vernehmen, und vom Himmel herab regnet es blutige Sterne.
Endgültig verdüstert sich der germanische Himmel. Ein Mond ist über dem schrecklichen Unfall vergangen. Die Soldaten beten und opfern, bis ihre Kraft zu Ende geht. Einige bieten den Himmlischen ihr eigenes Leben für das ihres Feldherrn an. Aber Roms Götter erweisen sich als nicht so gnädig. Sie wollen den billigen Ersatz nicht.
Vor Drusus läuft noch einmal das Leben ab, die Kindheit im Hause des Stiefvaters unter Livias strengem Blick, seine eigene Familie, die in Rom als vorbildlich gilt, die Feldzüge, die er zum Ruhme des Vaterlands unternommen hat. Dann schließt der Liebling der Römer für immer die Augen. Er ist erst 30 Jahre alt. Man schreibt das Jahr 744 a.u.c. Christliche Autoren werden vom Jahr 9 vor Beginn der neuen Zeitrechnung sprechen.
„Und dankend lasst uns alle dann nach Hause gehen.“
Vom Sterben des Kaisers Augustus
31 v.–14 n. Chr.
„Ja, ist es denn möglich?“, wunderte sich der Greis, der grau und ganz klein in seine Kissen gesunken war. „Es scheint, als neige sich mein Leben nun tatsächlich zum Ende, und die Vorzeichen, die es mir so unmissverständlich angezeigt haben, behielten zum Schluss doch Recht. Aber ist es nicht gut so? Befürchtete ich doch schon, der Tod hätte mich vergessen. Mehr als fünf Jahrzehnte mühevollen Regierens haben mich müde gemacht, meinen Körper ausgemergelt und meinen Geist verbraucht. Aber ich blicke dankbar zurück. Und auch ein wenig stolz. Habe ich nicht eine Stadt aus Ziegeln vorgefunden und sie zu einer aus Marmor gemacht? Habe ich nicht die Waffen beiseitegelegt und meinen Zeitgenossen eine Ära des Friedens, des Wohlstands und Glücks beschert? Schon beginnen sie, vom augusteischen Zeitalter zu sprechen. Und sie lieben mich. So bin ich sicher: Man wird noch meiner gedenken, wenn unsere Knochen schon Staub sind, die Berge abgeschliffen und die Flüsse und Seen ausgetrocknet. Gelassen und heiter gehe ich Charon entgegen, dem Fährmann, der mich von der Last des Lebens befreien und sicher über den Styx begleiten wird in jene andere Welt, in der die Ahnen meiner schon harren.“
Vielfach hatte sich Octavian Augustus, Kaiser des Römischen Reiches, Vater des Vaterlandes, der sich bescheiden nur Princeps nannte, der Erste unter Gleichen, der Tod angekündigt. Da hatte etwa, während er opferte, ein Blitzstrahl eine der Statuen getroffen, die ihm ein dankbares Volk in Rom und anderswo so zahlreich errichtet hatte, und das „C“ seines Namens Caesar hinweggeschmolzen. Die Seher waren mit der Deutung dieses Omens rasch zur Hand: „C“, so meinten sie, entspräche dem Buchstaben für hundert, also habe er noch hundert Tage zu leben. Und der Rest des Namens, „aesar“, bedeute in der Sprache der Etrusker „Gott“ …
Und hatte er nicht selbst das Ende vorausgesagt? Unbewusst zwar, und doch! Er hatte beabsichtigt, Tiberius, den Nachfolger und Adoptivsohn, nach Illyrien zu schicken und ihn bis Benevent zu begleiten. Aber immer neue Gerichtsfälle hielten ihn in der Hauptstadt fest. Da rief er ungehalten aus, er werde nun nicht länger in Rom bleiben, auch wenn sich alles gegen ihn verschworen habe. Allen Widrigkeiten zum Trotz begab er sich auf die Reise, die er, ganz gegen seine Gewohnheit, auch bei Nacht nicht unterbrach. Aber sein geschundener Körper spielte nicht mehr mit. Eine heftige Durchfallerkrankung befiel ihn, und er wusste wohl am besten, dass sie der Anfang vom Ende war.
Der römische Sommer stand hoch. Auf den Dächern der Millionenstadt brütete die Hitze, und von der Subura, der schmuddeligen Unterstadt, stieg ein mächtiger Gestank zum Palatin hinauf. Kaum vermochte ein Gesunder, die stickige Luft zu ertragen, die auch vom Tiber her über dem vornehmsten Hügel waberte. Schon seit den Tagen der längst verlorenen Republik hatte es sich Roms Nobilität zur Gewohnheit gemacht, die heiße Jahreszeit am Meer zu verbringen, bevorzugt am Golf von Neapel, wo eine frische Brise stets für Abkühlung sorgte. Aber man liebte die Gegend, die man liebevoll nur Campania, das Land, nannte, nicht nur wegen des heilsamen Klimas und der warmen Quellen. Seit Jahrzehnten hatte eine der lieblichsten Landschaften des gesamten Reiches die Vornehmen der Hauptstadt angezogen. So hatte Cicero in Puteoli einen feudalen Landsitz besessen und auch Vergil im nördlichen Teil des Golfes seine letzte Ruhestätte gefunden. In den berühmten Grotten hauste die geheimnisvolle Wahrsagerin Sibylle, die im Epos des größten römischen Dichters Unsterblichkeit erlangt hatte. Und es befand sich hier ein Eingang zur Unterwelt …
Der Kaiser stand nachdenklich am Fenster seines Arbeitszimmers und beobachtete das Treiben auf dem Circus unterhalb seines Palastes. „Ich muss von Rom weg“, murmelte er vor sich hin. „Die Götter haben meine Tage gezählt. Wie leicht könnte mein Ableben hier Unruhen auslösen, ehe Tiberius verständigt werden und nach Rom zurückkehren könnte, um die Dinge in die Hand zu nehmen. Wenn ich anderswo sterbe, wird sich mein Tod länger geheim halten lassen, und es ließe sich der Übergang leichter regeln. Weine nicht, kleines Mädchen!“, wandte er sich an die Kindsklavin, die soeben ins Zimmer getreten war, um ihm seine Mittagsmahlzeit, einen Kanten trockenen Brots und eine Handvoll Feigen, zu bringen. „Das ist eben der Lauf der Natur. Alles ist im Fluss, wie schon Heraklit sagte. Alles ist von der Schöpfung zum Wandel, zur Veränderung bestimmt. Auch wir, Mädchen, auch wir. Denke nur an die Metamorphosen meines Freundes Ovid! Ob er noch lebt? Ich sehe an deinem erstaunten Blick, du kennst ihn nicht. Wie solltest du auch? Kann doch kaum ich mich noch an sein Gesicht erinnern. Es ist gut. Du kannst gehen. Es ist gut.
Cum subit illius tristissima noctis imago qua mihi supremum tempus in Urbe fuit, cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui, labitur ex oculis nunc quoque gutta meis“,
erinnerte er sich des einstigen Freundes.
In Begleitung von Tiberius, dem düsteren Claudiersohn, segelte er die campanische Küste entlang. Von überall her strömten die Menschen herbei, um ihm zuzujubeln. Auch Matrosen und Passagiere eines Schiffes, das soeben aus Alexandria eingetroffen war, alle weiß gekleidet und blumenbekränzt, riefen ihm Glückwünsche und Danksagung zu. Nur durch ihn und seine umsichtige Herrschaft könnten sie Leben, Freiheit und Wohlstand genießen. Noch einmal sonnte sich der bedeutendste Mann des Imperiums in der allgemeinen Verehrung. Er war gerührt und beschloss, sich für die wenigen Tage, die das Schicksal ihm noch ließ, gegen jedermann freundlich und großzügig zu erweisen. So verteilte er Gold und wertvolle Gewänder. Noch einmal besuchte er Capri, das sonnendurchflutete Eiland, das er einst – es schien ihm wie in einem fernen früheren Leben – von Neapolis gegen das weniger reizvolle Ischia getauscht und seinem Privatvermögen einverleibt hatte. Dort verteilte er Körbe mit Delikatessen, wie sie die Inselbewohner selten gesehen und nie zuvor gekostet hatten. Und in ausgelassener Fröhlichkeit verfolgte er die sportlichen Wettkämpfe der griechischen Jünglingsvereine und dachte voll Wehmut daran, dass ihm, dem damals gerade 18-Jährigen, die Verantwortung für ein Weltreich zugefallen und eine ähnliche Unbeschwertheit nie vergönnt gewesen war.
Vor langer Zeit schon hatte er seinen Palast auf Capri zum Lieblingsaufenthaltsort für die Sommermonate erkoren, aber nur selten hatte er dort längere Zeit verbracht. Die Sorge um das Imperium gestattete private Neigungen nicht.
Vom Speisesaal aus blickte der Kaiser ein wenig neidisch zu einer nahen Insel hinüber, auf die sich einige seiner Höflinge zurückgezogen hatten, um der süßen Muße zu frönen. „Apragopolis“ nannte Augustus sie, Nichtstuerstadt. Unter den vornehmen Aussteigern hatte sich auch ein gewisser Masgaba befunden, ein Günstling des Kaisers, der im Jahr zuvor gestorben und auf der Insel begraben worden war. „Ktistes“, Gründer, hatte ihn Augustus ein wenig spöttisch genannt, als wäre er der Entdecker des Eilands gewesen. Menschen mit Fackeln besuchten gerade sein Grab. Masgaba war bei den Inselbewohnern offensichtlich sehr beliebt gewesen.
„Das Grab des Gründers seh’ ich ganz in Flammen stehen“, zitierte der Princeps einen griechischen Vers. Verwundert sah ihn Trasyllos, sein ahnungsloser Begleiter, an, und sogleich fuhr der Kaiser fort: „Siehst du der Fackeln Glanz zu Ehren Masgabas?“ Aber der Grieche konnte sich auf die Worte seines Herrn keinen Reim machen.
Zeitlebens war, wie gesagt, der Princeps um seine schwächliche Gesundheit besorgt gewesen, hatte er sich jede Beschränkung auferlegt, um das Ende möglichst lange hinauszuzögern. Jetzt, im Angesicht des Todes, zeigte er einen verblüffenden Leichtsinn. Er kümmerte sich nicht um seinen angegriffenen Zustand, als ginge ihn dieser nichts an. In erstaunlicher Gelassenheit verbrachte er mehrere Tage in seinem Palast. Wieder und wieder wandelte er durch Gänge und Zimmerfluchten, um Abschied zu nehmen, und ließ sich endlich, den Blick sehnsüchtig rückwärtsgewandt, wieder aufs Festland übersetzen, um dort noch manche Stadt mit seinem Besuch zu erfreuen.
Zum letzten Mal riefen ihn die Pflichten des Staatsoberhaupts. Sein Darmleiden hatte sich verschlimmert, und doch wohnte er, als wäre alles gut, den gymnastischen Spielen in Neapolis bei, die dort alle vier Jahre zu seinen Ehren veranstaltet wurden. Dann endlich konnte er daran denken, seinen „Sohn“ Tiberius, wie versprochen, nach Benevent zu begleiten. Von dort aus gedachte er nach Rom zurückzukehren. So es dem Willen der Götter entsprach.
Aber er kam nur bis Nola, Nola in Campanien, wo sich sein Elternhaus befand. Von Stunde zu Stunde verschlechterte sich jetzt sein Zustand. Besorgt rief Livia, Augustus’ langjährige Gefährtin, die wahre Herrscherin Roms, ihren Sohn Tiberius zurück. Doch hat er den Stiefvater wirklich noch lebend angetroffen? Darüber streiten seit 2.000 Jahren die Gelehrten.
Der Nachfolger sei zu spät gekommen, behauptet Tacitus. Aber Livia habe das vor Hofstaat und Volk geschickt verheimlicht. In weiser Voraussicht nämlich habe sie Straßen und Haus stark besetzen lassen, um den Tod des einen und die Nachfolge des anderen gleichzeitig bekannt zu geben. Sueton hingegen, der Skandalreporter der frühen Kaiserzeit, ist ganz sicher, dass zwischen Vater und Sohn noch jenes letzte klärende Gespräch stattfand, nach dem Augustus das arme römische Volk bedauert habe, das nun von so langsamen Kinnbacken zermalmt würde.
War es diese Version, die auch der offiziellen Hofberichterstattung entsprach? Konnte sich Tiberius auf diese Weise nicht auf geheime Anordnungen seines Vorgängers berufen und sie jeder Nachprüfung entziehen, wenn es unliebsame Maßnahmen zu treffen galt? Denn gerade an ihnen sollte zumindest zu Beginn seiner Herrschaft kein Mangel sein.
Auch in Campanien flirrte der Sommer. Der 19. August war angebrochen. Man schrieb das 766. Jahr nach Gründung der Stadt. Spätere Geschlechter würden vom Jahr 14 der neuen Zeitrechnung sprechen.
Augustus, der merkwürdige Greis, ist sich bis zuletzt treu geblieben. Er ist jetzt 76 Jahre alt, und das Wunder seines vom Schicksal reichlich bemessenen Lebens wird von jedermann im Reich bestaunt. Nahezu alle seine Weggefährten hat er überlebt. Jetzt endlich wartet der Tod auch am Bett dieses Kranken, den jener so lange vergessen zu haben scheint.
Sanft schlummert der alte Mann auf demselben Lager, auf dem vor Jahrzehnten sein Vater gestorben ist, seinem Ende entgegen. Auf einmal schrickt er auf und beklagt sich, er werde von 40 Jünglingen weggetragen. „Haben sich vor dem Haus schon viele versammelt?“, will er von der Frau an seiner Seite wissen, die er wie keine andere gehasst und geliebt hat. Dann verlangt er einen Spiegel. Er bittet, ihm das Haar zu kämmen und die Wangen zu heben. Auch dem Tod, dem letzten aller Feinde, muss man würdig gegenübertreten. Bei den Freunden, die sein Sterbelager umstehen, erkundigt er sich, ob er die Komödie seines Lebens gut gespielt habe.
Und, wie es auf der Bühne Brauch ist, fügt auch er, der große Schauspieler, die Schlussformel hinzu:
„Wenn es euch gefallen, gewähret Beifall diesem Spiel.
Und dankend lasst uns alle dann nach Hause gehen.“
Dann verabschiedet er sich von allen und wendet sich sterbend der Frau zu, die mehr als 50 Jahre an seiner Seite verbracht und sein Leben schicksalhaft begleitet hat:
„Livia, bleibe immer unserer glücklichen Ehe eingedenk und lebe wohl!“
Jetzt erst darf Augustus tot sein. Tiberius hat die Nachfolge angetreten, der düstere Claudier, der Menschenfeind. Stafettenreiter werden hinaus ins Reich eilen und die Nachricht allen verkünden. Und in Rom wird auf dem Marsfeld bald der Scheiterhaufen lodern, und Numerius Atticus, ein ehemaliger Prätor, wird bei Eid aussagen, er habe die Seele des Verstorbenen hinauf in den Himmel fahren sehen (und von Livia dafür eine stattliche Belohnung erhalten). So sind Augustus Tempel und göttliche Ehren gewiss.
Der neue Erbe, der, wehmütig beschworen, vor Menschengedenken von den Göttern herabgestiegen war, ist endgültig in seine himmlischen Sphären zurückgekehrt.
Der alte Mann von Capri – Tiberius
14–37 n. Chr.
Als der junge Agrippa Postumus begriff, dass es kein Entrinnen gab, dass die Henkersknechte des verhassten Alten im fernen Rom kein Erbarmen kannten und niemals seinem Zauber erliegen würden, beschwor er mit ermattenden Kräften alle Flüche des Schicksals auf Tiberius’ blutbeflecktes Haupt herab. Er sagte ihm den schrecklichsten aller Tode voraus, weissagte ihm jahrelange Einsamkeit und Menschenangst und schließlich den langsamen Fall von geduldiger Mörderhand.
„Ich sehe Tiberius“, hauchte er, „er wünscht zu sterben und wird nicht sterben können. Und doch hat er Angst vor dem Tod. Ich sehe ihn, von weit her kommend, vor den Toren Roms verharren und auf verschlungenen menschenleeren Pfaden um die Mauern der Ewigen schleichen, vom Ort seiner gemeinsten Verbrechen angezogen und abgestoßen zugleich. Sehe ihn zitternd vor Furcht auf immerwährender Flucht.
Flüstern höre ich das Volk der entsetzten Quiriten: Biberius nennen sie ihn, den Trinker. Selbst der Tod fürchtet sich vor ihm, sagen sie, selbst der Tod. Unbeweint wird er in das Reich der unterirdischen Schatten eingehen. Und mancher wird fordern, den faulenden Leib in der schlammigen Flut des Tibers zu versenken, ‚Tiberium in Tiberim‘, auf dass er, im Leben umgetrieben vor Angst, auch im Jenseits keine Ruhe fände.“