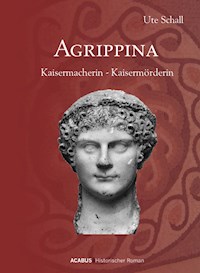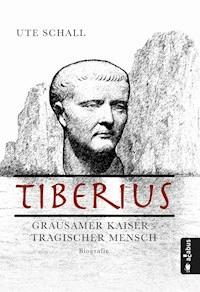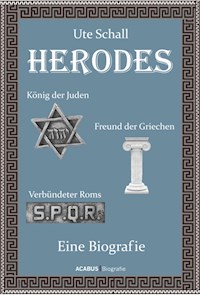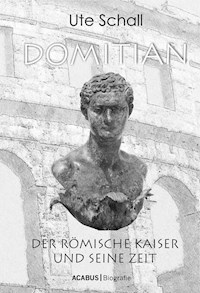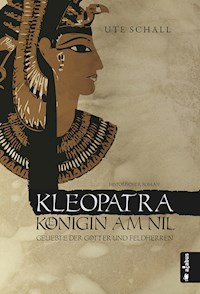
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Kleopatra, Tochter des ägyptischen Königs Ptolemaios, wird nach dem Tod ihrer Eltern zur neuen Herrscherin Ägyptens erkoren. Die Verantwortung lastet schwer auf ihren Schultern, zieht sie doch damit die Abneigung und den Hass ihrer Geschwister auf sich, die nach der Herrschaft über das alte Reich am Nil gieren. In all den blutigen Intrigen bleibt ihr nichts als ihr scharfer Verstand und ihre engsten Vertrauten, um dem Tod zu entgehen. Doch nicht nur im eigenen Land hat sie Feinde. In Rom erhebt sich der gefürchtete Feldherr Iulius Caesar, um Ägypten für sich einzunehmen. Kleopatra sieht nur einen Weg, um ihr Reich vor einem Krieg zu bewahren: Sie muss sich Caesars Gunst verschaffen. So wird ihr Feind zu ihrem Geliebten. Durch ihr Geschick und die Gunst des Feldherrn wird Kleopatra immer mächtiger. Doch dann tritt unerwartet ein weiterer Mann in ihr Leben: Marcus Antonius. Kleopatra wird zum Spielball machtgieriger Herrscher, die ihren Tod herbeisehnen. In den Wirren des Schicksals muss Kleopatra erfahren, dass sie sich nur auf sich selbst verlassen kann: Auf dass ihr Reich noch prächtiger erblüht und gedeiht, oder für immer untergeht. Ein rasanter, atemberaubender historischer Roman, der das bewegte Leben der legendären ägyptischen Königin mit viel Spannung und Liebe zum Detail zum Leben erweckt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 757
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ute Schall
KLEOPATRA
KÖNIGIN AM NIL
GELIEBTE DER GÖTTER UND FELDHERREN
Schall, Ute: Kleopatra. Königin am Nil. Geliebte der Götter und Feldherren, Hamburg, acabus Verlag 2015
Originalausgabe
PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-338-3
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-339-0
Print-ISBN 978-3-86282-337-6
Lektorat: Vera Kühn, Sabrina Claus, acabus Verlag
Umschlaggestaltung: © Marta Czerwinski, acabus Verlag
Umschlagmotiv: © von Eslam17 (Eigenes Werk) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) oder CC-BY-SA-4.0-3.0-2.5-2.0-1.0
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0-3.0-2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
© acabus Verlag, Hamburg 2015
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
eBook-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Meinen Enkelkindern
Anna und Gabriel gewidmet
Die schwere Stunde der Geburt
Gespenstische Stille herrschte in dem weitläufigen Palast. Die Sommernacht hatte sich schwarz und schwer auf Alexandria gelegt. Nur ein paar Sterne leuchteten. Niemand war zu sehen. Mitternacht war längst überschritten, und bald würde Helios-Re seinen Sonnenwagen aufziehen und Hausangestellte und Sklaven würden sich an ihre tägliche Arbeit machen.
Ab und zu durchdrang ein schriller Schrei die unheimliche Dunkelheit. Die Königin lag in den Wehen. Sie erwartete ihr erstes Kind, sie war noch sehr jung.
Vor wenigen Monaten hatte Ptolemaios, der Herr über Ober- und Unterägypten, geruht, mit ihr das Lager zu teilen; mit ihr, die nicht königlicher Abstammung und also nicht seines Blutes war, das das Königsgeschlecht auf jenen Ptolemaios zurückführte, den der große Alexander vor undenklichen Zeiten auf den Thron des alten Landes am Nil gesetzt hatte, damit er Ägypten zu seiner einstigen Größe zurückführe. Sie war stolz darauf, dem König mit der Jugend ihres Leibes dienen zu dürfen. Aber sie würde an diesem Hof immer eine Fremde bleiben. Niemals würde sie einen Platz in den Geschichtsbüchern erhalten, ja nicht einmal Erzählungen und Legenden würden ihren Namen an Nachgeborene weitergeben. Das war der Preis, den sie zu zahlen hatte, um ihr Leben an der Seite des geliebten Mannes verbringen zu dürfen. Aber sie beklagte sich nicht. Sie hatte es nicht anders gewollt.
Gewiss, es war nicht leicht, Pharao Ptolemaios, den sie den „Neuen Dionysos“ nannten, zu lieben: Er war von wenig ansprechender Erscheinung, schon in seinen noch jungen Jahren zu Fettleibigkeit neigend und aufgedunsen vom Genuss griechischen Weins, den er stets unvermischt und in reichlichen Mengen zu sich nahm. Ob man ihm deshalb den Beinamen des Weingotts gegeben hatte? Die junge Königin wusste es nicht. Auch „Auletes“ nannten ihn seine Untertanen, den Flötenspieler, ein Name, den er besonders schätzte, denn er liebte die Hausmusik. Und oft hörte man im Palast den Klang seiner Flöte und die zarten Töne der Harfe, die sie, die große königliche Gemahlin, anschlug.
Vor einem knappen Jahr war er nach Memphis gekommen, um dort in einem noch immer herrlichen Tempel aus altägyptischer Zeit nach dem Rechten zu sehen und den Gott Osiris-Apis, den verstorbenen heiligen Stier, den die Griechen Serapis nannten, Schutzgeist von Memphis, zu Grabe zu tragen. Mit den Priestern waren die religiösen Feierlichkeiten zu Ehren des Verstorbenen zu besprechen, die Griechen und Ägypter gemeinsam begehen sollten. Traditionsgemäß wurden seit vielen Jahrhunderten die heiligen Stiere einbalsamiert und in gewaltigen Steinsarkophagen im Serapeum bei Memphis beigesetzt. Dann hoffte man ungeduldig auf das Erscheinen eines neuen Apis, der Sonne und Mond, Tag und Nacht und damit Leben und Tod in sich vereinte. Nur ein Tier, das das heilige Zeichen des hellen Dreiecks auf der Stirn trug, konnte dieser Ehre teilhaftig werden …
Ptolemaios war bestrebt, die alten Kulte beizubehalten und mit den Bräuchen der Eindringlinge zu versöhnen, um so Aggressionen von Einheimischen gegen die Eroberer und von Eroberern gegen die Einheimischen abzubauen. Wie keiner seiner Vorgänger beherrschte er die Politik des Ausgleichs und der hohen Diplomatie.
Der Besuch des Königs war schon viele Wochen zuvor angekündigt worden, und die Apis-Priester hatten dazu aufgerufen, ihm ein herzliches Willkommen und einen angenehmen Aufenthalt zu bereiten. Die Neugier war groß gewesen. Noch hatte keiner den Pharao gesehen. Aber überall wurde die Erinnerung an seine Vorgänger bewahrt; jene Ägypter und gottähnlichen Menschen, die seit vielen Jahrhunderten am Westufer des Nils in gewaltigen Steinburgen wie Osiris ihrer Auferstehung harrten. Pyramiden nannte man die Grabstätten und sie wurden längst zu den Weltwundern gezählt. Die Zeit der großen Pharaonen war freilich vorbei.
Wie Ptolemaios, der Fremdherrscher, mit dem man sich allerdings gut arrangiert hatte, wohl aussah? Erwartungsvoll und von weiblicher Neugier getrieben, fieberte die Tochter des Hohepriesters der Ankunft des Königs entgegen. Hatte ihr nicht ein alter Seher erst kürzlich geweissagt, mit Ptolemaios’ Erscheinen stünden ihr ein großes Glück und eine tiefgreifende Veränderung ins Haus? Eigentlich gab sie nichts auf solche Vorhersagen. Jedermann in Memphis bescheinigte ihr neben außerordentlicher Schönheit die Gabe eines scharfen Verstandes, und dass Menschen zuverlässig in die Zukunft sehen konnten, mochten Dümmere glauben als sie. Allzu viele Speichellecker und Möchtegern-Propheten biederten sich ihrer Familie, der vornehmsten weit und breit, immer wieder an, in der Hoffnung, sich persönliche Vorteile zu verschaffen. Doch diesmal war es anders. Nachdem der Alte ihr die günstige Wendung in ihrem jungen Leben vorhergesagt und sie zur Bestätigung den Orakelspruch des Gottes Apoll aus Delphi eingeholt hatte, schwanden alle Zweifel und wuchs ihre Vorfreude, sodass sie das Kommen des neuen Herrschers kaum erwarten konnte. Vielleicht würde er sie ja nach Alexandria mitnehmen und dort seiner Gemahlin als Hofdame zum Geschenk machen!
Sie stand auf der Terrasse ihres väterlichen Palastes hoch über dem golden schimmernden Fluss und bestaunte mit geweiteten Augen den Prunk, mit dem der König seine Ankunft inszeniert hatte. Boote nach Art römischer Trieren, wie sie sie von Abbildungen her kannte, prächtig mit Girlanden, Fahnen und bunten Tüchern geschmückt, begleiteten die königliche Barke, auf der Ptolemaios unter einem purpurroten Baldachin stand, einer Statue des Gottes Osiris gleich, angetan mit einem fließenden weißen Gewand, auf den Schultern ein Pektoral aus Lapislazuli und die Doppelkrone Ober- und Unterägyptens auf dem stolz erhobenen Haupt. Seine Hände hielten Krummstab und Geißel und waren über der gewölbten Brust gekreuzt.
Das Herz der Priestertochter pochte vor Aufregung. Sie konnte ihren Blick nicht abwenden von diesem verschwenderischen Schauspiel, das ihr die große Vergangenheit ihrer Heimat wiederbrachte, von all der Prachtentfaltung, mit der der Fremde seine Untertanen ehrte. Sie wusste später nicht zu sagen, ob sie sich zuerst in den prunkvollen Auftritt verliebt hatte oder in die erhabene Haltung des Mannes, der einer Gottesstatue gleich auf dem Nil daherkam. Sie wusste nur, dass sie diesem Mann nie mehr von der Seite weichen, mit ihm eins sein wollte, solange die Götter Ägyptens ihr zu leben bestimmt hatten.
Nur wenige Tage nach seiner Ankunft waren sie ein Paar.
Sie traten vor den Vater der Schönen und baten ihn um seinen Segen, den der eitle Priester nur allzu bereitwillig erteilte. Zwar verstand er nicht, was seine Tochter an dem Fremden fand, der nach allgemeiner und auch seiner Ansicht wenig anziehend und noch nicht einmal Ägypter war. Nur seine Augen, tiefe, unergründliche Höhlen, schienen ihren Betrachter zu verschlingen, und wenn man sich ganz in sie versenkte, nahmen sie einen fast dämonischen Ausdruck an. Aber der Hohepriester war keine Frau und so vermochte er auch nicht zu sagen, was im Kopf einer solchen vorging. Sie sollte ihn haben, wenn ihr denn so viel an ihm lag, auch wenn der Brauch verlangt hätte, dass er als Vater den Ehemann für seine Tochter wählte. Schließlich konnte es nicht ganz verkehrt sein, den Inhaber des ägyptischen Thrones an die alteingesessene Priesterschaft zu binden. Und welches Band war stärker als das des Blutes?
Es spielte keine Rolle, dass Ptolemaios bereits verheiratet war, dass seine rechtmäßige Gemahlin, Kleopatra, die ihm die Tochter Berenike geboren hatte und den Beinamen Tryphaina trug, in Alexandria auf ihn wartete. Schon vor geraumer Zeit waren Gerüchte nach Memphis gedrungen, Ptolemaios würde sich nur allzu gern von der unliebsamen Frau trennen, die sich nach Berenikes Geburt als unfruchtbar erwiesen hatte und obendrein als überaus launisch galt. Freilich durfte darüber nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen werden. Wie Ptolemaios selbst, entstammte Kleopatra dem edlen griechischen Königsgeschlecht, und die Verwandten jenseits des Meeres hätten eine Trennung von ihr und eine Wiederverheiratung kaum geduldet und schon gar nicht die Verbindung mit einer Ägypterin, mochte die nun dem alten Landesadel entstammen oder auch nicht. Für die Tochter des Hohepriesters kam allerdings ein Zusammenleben ohne eine rechtmäßige Heirat nicht in Frage und sie beabsichtigte auch nicht, am Hof zu Alexandria die Nebenfrau zu spielen. Sollte sie Ptolemaios in die Hauptstadt begleiten, musste Kleopatra weg.
Tatsächlich hatte auch der König schon lange daran gedacht, die große königliche Gemahlin wie auch immer aus seiner Nähe zu entfernen, und so befahl er noch von Memphis aus ihre Verbannung, die unverzüglich zu vollziehen war. Er wollte ihr nicht mehr begegnen, denn er fürchtete sie, was er freilich nie zugegeben hätte. Durfte der große König, Herr über Ober- und Unterägypten, denn Furcht haben vor einem gewöhnlichen Weib? Doch wie würde das Volk, wie würden Griechen und Römer auf die Verbannung reagieren?
Den Römern, die immer größeren Einfluss auf sein Reich am Nil gewannen, wäre es sicherlich gleichgültig. Seine Herrschenden wandten noch ganz andere Methoden an, um sich den Rücken frei zu halten. Den Griechen freilich müsste die Trennung auf geschickte Weise verschwiegen werden. Ein Trick war zu ihrer Täuschung nötig. Niemand durfte von Kleopatras Verbannung erfahren. Die stolze Frau selbst würde stillschweigen, davon war Ptolemaios überzeugt. Denn kaum würde es ihre Eitelkeit zulassen, mit einer derartigen Kränkung an die Öffentlichkeit zu gehen. Zum anderen mochten ein ansehnlicher Geldbetrag und ein angenehmes Exil, das er ihr gewähren wollte, sie davon überzeugen, ihr Schicksal ohne Murren zu ertragen. Ohnehin hatte sie damals ihren Halbbruder Ptolemaios nur widerwillig aus familiären Gründen und im Sinne der Staatsräson geheiratet und sich als Ehefrau des Gottkönigs nie recht wohl gefühlt.
Mit der Tochter des Hohepriesters stand es da anders. Nicht nur, dass die kluge Frau daran dachte, durch eine Heirat mit dem König ihrem Volk eine Aufwertung zu verschaffen, ja es mit den griechisch-makedonischen Herrschern zu versöhnen. Sie beabsichtigte auch, in der Politik ihres Gatten kräftig mitzumischen. Ptolemaios war Wachs in ihren Händen. Zudem liebte sie ihn aufrichtig. So war sie damals auch nach anfänglichen Bedenken bereit gewesen, Kleopatras Platz neben Ptolemaios einzunehmen und namenlos oder besser: auf ihre eigene Identität verzichtend, als Mutter seiner Kinder in die Geschichte einzugehen. Niemand sollte je erfahren, was am Hof vor sich gegangen war. So veränderte sich für die griechische Verwandtschaft nichts und auch nicht für das Volk, das von der Herrin vom Nil ohnehin keine konkrete Vorstellung hatte. Denn das hohe Herrscherpaar pflegte sich kaum in der Öffentlichkeit zu zeigen und wenn, dann verhüllt in der Sänfte oder auf der königlichen Barke am Nil, weit entfernt von den Augen der das Ufer säumenden neugierigen Menge. Und allen Palastdienern, die Zugang zu den Gemächern der Königsfamilie und Schlüssel zu den geheimen Kabinetten hatten, hatte man die Zunge herausgeschnitten, damit sie das Geheimnis um die neue Königin nicht ausplaudern konnten – allen, bis auf einer: Naoma, der treuesten Dienerin, die ihrer Herrin aus Memphis nach Alexandria gefolgt war und ihr nicht von der Seite wich.
„Du musst pressen, geliebte Herrin!“, forderte sie die junge Königin mit strenger Miene auf. Die Anrede ließ eine besondere Vertrautheit erkennen. „Das Köpfchen des Kindes ist bereits zu sehen“, tröstete sie. „Das Schlimmste ist überstanden.“ Dabei streichelte sie der Gebärenden sanft über die schweißnasse Stirn.
Ein erneuter Schrei durchschnitt die nächtliche Stille.
„Warum haben die Götter vor die Freude den Schmerz gestellt?“, hauchte die Königin. „Was denkst du, Naoma?“
„Ich denke, dass sie den Menschen klar machen wollen, dass der Weg zur Ewigkeit kein reines Vergnügen ist.“
„Bist ein kluges altes Mädchen, Naoma“, bemerkte die junge Frau und lächelte gequält. „Ich bin so froh, dass du mich damals nicht im Stich gelassen hast, als König Ptolemaios beschloss, mich nach Alexandria mitzunehmen und zu seiner Königin zu machen.“
„Ptolemaios, Ptolemaios, ich mag ihn nicht, deinen Ptolemaios. Und ich konnte unmöglich verantworten, dich ihm ganz und gar zu überlassen. Habe ich dir nicht Treue bis in den Tod geschworen?“ Die Alte schüttelte ungläubig den Kopf. Wie konnte ihre Herrin auch nur einen Augenblick lang daran zweifeln, dass sie ihrer alten Amme unbedingt vertrauen konnte? War Naoma nicht bei ihr gewesen seit fernem Anbeginn, hatte sie ihr nicht bis heute, so gut sie es vermochte, die bei ihrer Geburt verstorbene Mutter ersetzt?
Die Dienerin watschelte zum Fenster, das sich zum Garten hin öffnete. Die Luft war stickig in der engen Geburtskammer, die ganz am Ende eines langen Ganges in einem Nebenflügel des Palastes lag. Nichts zu spüren von der frischen Meeresbrise, die gewöhnlich nachts die Gemächer durchdrang. Der Atem Poseidons, wie sie die Alexandriner nannten, war heute ausgeblieben. Aber schon nach wenigen Augenblicken schwängerte schwerer Rosenduft den Raum. Frösche quakten im nahe gelegenen Teich, und die Grillen, die im Zirpen miteinander zu wetteifern schienen, kündigten den nahenden Tag an.
Noch einmal nahm die junge Königin all ihre Kraft zusammen. Noch einmal erklang ein markerschütternder Schrei. Dann war alles ruhig und des Pharaos große königliche Gemahlin fiel in einen tiefen, todesähnlichen Schlaf.
„Ruhe dich nur aus, meine kleine Prinzessin, schlaf gut, geliebtes Mädchen! Sie hier wird nicht das einzige Kind sein, das Pharao und deine Stellung von dir fordern. Mögen dir die Götter Ägyptens auch künftig beistehen!“, betete die Alte. „Und die der Griechen“, fügte sie leise hinzu. Damit warf sie einen mütterlichen Blick auf die erschöpfte junge Frau und nahm das Kind, das ihre Herrin soeben geboren hatte, in die Arme.
Geburten waren Sache der Frauen und so hatte sich König Ptolemaios schon tags zuvor, als bei seiner Gemahlin die ersten Wehen eingesetzt hatten, heimlich aus dem Palast geschlichen, um sich inkognito in einem Edelbordell der Stadt die Zeit zu vertreiben. Aber er hatte bei all den schönen Damen, die ihn barbusig bedienten und ab und zu sogar ihren knappen Lendenschurz lüfteten, keine rechte Freude gefunden, nicht einmal Ablenkung, sodass er schon am frühen Morgen eher missmutig denn zufrieden das „Haus der Entspannung“ wieder verließ und den stummen Sänftenträgern durch Gesten bedeutete, dass er noch ein wenig durch die Stadt getragen, zum Grab seines berühmtesten Vorfahren und schließlich in den Palast zurück gebracht werden wolle. Was war das nur mit der Liebe? Seit gestern Abend ließ ihm diese Frage keine Ruhe. Seitdem ihm die Tochter des Hohepriesters in Memphis über den Weg gelaufen war, gelang es anderen Frauen immer seltener, ihn in Stimmung und sein Blut zum Wallen zu bringen, und oft genug hatte er schon vor fremden Schößen kläglich versagt.
Alexandria kam ihm heute nicht zum ersten Mal wie ein Kleinod vor, ein Juwel, und das sicherlich bedeutendste sichtbare Vermächtnis Alexanders des Großen, wie er inzwischen bei allen Völkern rund um das Meer und wahrscheinlich weit darüber hinaus genannt wurde. Kaum ein Herrscher oder Feldherr, der sich nicht bemühte, ihm nachzueifern, der ihn nicht als größten Heroen, der jemals unter der Sonne gelebt und gewirkt hatte, verehrte. Neugierig sah sich der König um. Rom, dachte Ptolemaios, die viel gepriesene Hauptstadt des Römerreiches, konnte kaum prächtiger sein. Breit waren Alexandrias marmorgepflasterte Straßen, gesäumt von bunten Säulenhallen, die Spaziergänger vor Sonne, Wind und Regen schützten. Inbrünstigen Gebeten gleich die zum Himmel emporstrebenden Tempel, die der Makedone den Göttern seiner Heimat gewidmet hatte. Vom großen Stadion her hörte er das Grölen der Massen und vom Musiktheater die zarten Töne einer Harfe. In der Ferne grüßte der Leuchtturm von Pharos, mit dem Alexanders Nachfolger die Stadt bereichert hatten und der die Seefahrer bei Dunkelheit sicher in den felsigen Hafen führte. Zu den Weltwundern wurde die gewaltige Anlage mittlerweile gezählt. Schiffe aller Herren Länder ankerten vor Alexandria, wurden entladen und beladen und mehrten mit ihrem Warenfluss den Wohlstand der Stadt, brachten aber auch manchen Neugierigen hierher. „Du kommst als Fremder und du gehst als Freund.“ Dieses Schlagwort hatten sich die Stadtväter auf die Fahnen geschrieben. Aber auch Gelehrte trieb es in Scharen hierher. Galt doch die Perle am Südufer des Mare Internum, wie die Römer – ein wenig überheblich, wie Ptolemaios fand, als gehöre das große Wasser nur ihnen – die Stadt nannten, neben dem viel älteren Athen als Mittelpunkt der Künste und Wissenschaften schlechthin, der all jene anzog, die nach Vervollkommnung in der Kunde des Heilens, der Rhetorik, des Steinhauens und der Jurisprudenz strebten. Nicht umsonst besaß Alexandria die größte Bibliothek der zivilisierten Welt oder zumindest dessen, was Griechen und Römer dafür hielten. Das gesamte Wissen der Menschheit war dort vereint. Ungeheure Schätze hatten sich im Laufe von vielen Jahrhunderten in den Bücherpalästen angehäuft.
Mit stolz geschwellter Brust betrachtete der große König die zu Stein gewordene Herrlichkeit, wenn ihm auch mit einem Mal all die Pracht bedroht und vergänglich erschien. War sie denn echt, die Fröhlichkeit, die auf den Straßen herrschte? War sie ehrlich, die gegenseitige Achtung, mit der hier Griechen, Ägypter, Römer und auch Juden – denen ein eigenes Stadtviertel zugewiesen war, damit sie ihrer besonderen Lebensweise nachgehen konnten – friedlich nebeneinander lebten? Oder war das alles nur ein schöner Schein? Konnte nicht ein einziger Funke genügen, die ganze Stadt in ein Flammenmeer zu verwandeln? Eine Prügelei, ein Mord oder auch nur ein unbedachtes Wort? Ptolemaios war sich durchaus bewusst, dass auch die fast drei Jahrhunderte, die sein Geschlecht inzwischen über Ägypten herrschte – mit viel Fingerspitzengefühl, wie er meinte –, die Kränkung des besiegten Volkes mit seiner vieltausendjährigen Geschichte nicht hatte wettmachen können und dass die Herrschaft der Ptolemäer zu jeder Zeit bedroht war. Waren nicht sogar einige seiner Vorgänger vom Thron gestoßen und gewaltsam ums Leben gebracht worden? Nein, man durfte sich keinen Illusionen hingeben. Er tat, aller Kritik zum Trotz, sicherlich gut daran, sich mehr und mehr an die Römer zu halten, die ihm als einzige geeignet schienen, den ägyptischen Pöbel in Schach zu halten, und die kaum Interesse daran haben konnten, auch das alte Land am Nil ihrem Imperium einzuverleiben. Schließlich wurde es seit Generationen von Griechen beherrscht und jedermann wusste, mit welch großer Bewunderung, ja Hochachtung, Rom der griechischen Kultur begegnete, sie bereitwillig bei sich aufnahm und als heiliges Erbe an die kommenden Generationen weiterzugeben gedachte. Nein, von Rom drohte ihm und den Seinen sicherlich keine Gefahr. Es kam nur darauf an, die Herren der Welt, die die Römer ja längst waren, bei Laune zu halten. Und Ptolemaios wusste, wie das gelang.
Inmitten der Stadt, die seinen Namen trug, ruhte in einer gewaltigen Grabburg in gläsernem Sarg der große Heroe, mit Wachs und Honig einbalsamiert und damit der Vergänglichkeit entrissen. Nicht nur Griechen sah man an der heiligen Stätte inbrünstig beten. Auch viele Einheimische konnten sich der Anziehungskraft, die der Mythos Alexander noch immer ausstrahlte, nicht entziehen.
Ptolemaios bedeutete seinen Dienern anzuhalten. Er zwängte seine Leibesfülle aus dem engen Tragestuhl, befahl allen Bewunderern Alexanders zu verschwinden und näherte sich voll Ehrfurcht dem Toten. Kaum wagte er, den Blick zu heben. Demütig bat er den großen Ahnen um Wohlergehen für sein Geschlecht, die Dynastie der Ptolemäer, er möge die Götter der Griechen bitten, ihnen Gesundheit, ein langes Leben und die immerwährende Herrschaft zu gewähren. Als er aufblickte, meinte er, in den Zügen des Toten ein leichtes Lächeln zu entdecken. Aber er vermochte nicht zu sagen, ob es Freude oder Spott ausdrückte. Dann kehrte er einigermaßen beruhigt, da der Angerufene geantwortet hatte, in die Stille seines Palastes zurück.
Die namenlose Königin hatte sich inzwischen etwas erholt. Sie war aus dem Geburtszimmer, das von eifrigen Dienerinnen mit Weihrauch vom Geruch des Blutes befreit worden war, in ihre eigenen Gemächer gebracht, in ein golddurchwirktes Gewand gesteckt und aufwändig geschminkt worden. Aufrecht in fülligen Kissen sitzend empfing sie ihren Gemahl. Das Neugeborene, das man ebenfalls gebadet und mit dem königlichen Erstlingsgewand bekleidet hatte, hielt sie stolz im Arm.
Die junge Frau schien glücklich zu sein. Selbst unter der dicken Schicht von Bleiweiß konnte man das Strahlen ihres Gesichts erkennen, die leuchtenden schwarzen, nach altägyptischer Art mit Kohlenstaub vergrößerten Augen und den lächelnden Mund mit den aufgeworfenen Lippen. Sachte beugte sich der König über die geliebte Frau und küsste ihr dankbar die jugendliche Stirn. Gewiss, er hatte bereits eine Tochter, jene wilde Berenike, die ihm die Schwestergemahlin Kleopatra geboren hatte. Und da war auch noch Thea, seine Stieftochter, die sich allmählich zu einer blühenden Schönheit entwickelte. Kleopatra hatte sie aus einer früheren Ehe mit einem syrischen Prinzen mit an den Hof gebracht und Ptolemaios hatte sich des kleinen Mädchens angenommen und versucht, ihr ein fürsorglicher Vater zu sein. Jetzt freilich war Thea herangereift und es würde bald an der Zeit sein, für sie eine standesgemäße Verbindung zu suchen. Er hatte selbst schon daran gedacht, sie zu seiner Gemahlin zu machen. Er schätzte ihr sanftes Wesen und die stille Art, hinter der sich dennoch ein hervorragender Geist verbarg. Schon während der letzten Jahre hatte er sie öfter beobachtet und mit Erstaunen festgestellt, dass er Thea anders sah, als ein Vater seine Tochter sehen sollte. Aber dann war ihm sie, die Schöne aus Memphis, über den Weg gelaufen und er hatte sich Hals über Kopf in sie verliebt. In das ebenmäßige Gesicht mit dem Teint, der an die Farbe heller Oliven erinnerte, in die sprechenden Augen, die Liebe und Wärme ausstrahlten, in hoch gewölbte Brauen und langes, seidenglattes, glänzendes Haar. Er betrachtete voller Mitgefühl das von den Strapazen der Entbindung gezeichnete und dennoch zufrieden lächelnde Gesicht, dachte an ihren stolzen, aufrechten Gang, der einer großen Königin würdig war und erinnerte sich ihrer klugen und umsichtigen Ratschläge, mit denen sie Einfluss auf seine Herrschaft nahm. Er hatte wahrlich keinen schlechten Tausch gemacht und seinen Entschluss nie bereut. Kleopatra, die Verbannte, die, wie man ihm berichtet hatte, ihr freies Leben in vollen Zügen genoss, war sich selbst stets genug gewesen, hatte immer nur Sinn für Mode, Schmuck und die neuesten Frisuren gezeigt und sich vor allem dafür interessiert, was bei den römischen Damen gerade gefragt war.
Gewiss, er war etwas enttäuscht. Aber er würde es der Geliebten nie zeigen. Wie alle Herrscher vor ihm hatte er sich sehnlichst einen Sohn gewünscht, einen, der das ruhmreiche Geschlecht der Ptolemäer fortführen und ihn auf dem Thron beerben könnte, doch die Vorsehung hatte ihm nur diese weitere Tochter vergönnt. Dennoch würde er versuchen, ein guter Vater zu sein. Im Übrigen war seine Gemahlin noch jung. So es den Göttern gefiele, würden sie noch viele Kinder miteinander haben. Mit gemischten Gefühlen betrachtete er das kleine runzlige Gesichtchen, die winzigen Hände, den kahlen Kinderkopf. Dann schlug die Kleine die Augen auf, die grün und unergründlich schimmerten und an das Wasser des Nils erinnerten. Da war ihm, als spiegele sich in ihnen sein eigenes Sein. Und mit einem Mal erkannte sich der große König in diesem Kind selbst.
„Nun, ich denke, meine Geliebte, es ist auch in deinem Sinn, wenn wir unser erstes gemeinsames Kind in der Familientradition Kleopatra nennen. Wir werden sie gemeinsam erziehen. Ich werde ihr die Ideale der griechischen Welt vermitteln und du sollst sie die Sprache deines Volkes, der Ägypter, lehren. So wird unsere Tochter dereinst beiden Völkern dienen können.“
Ereignisreiche Jugendjahre
„Ich kenne sie alle“, gestand Kleopatra. „Ich habe das Gestern gesehen, ich weiß, was vor 200 Jahren war, und ich kenne das Morgen. Ich sehe in die Herzen der Menschen, denn ich verstehe ihre Sprache.“
Das Mädchen war gerade fünf, als sich bereits ihre einzigartige Begabung bemerkbar machte. Ihr wacher Geist fing jedes Wort auf, jede Äußerung ihrer Untertanen, der Fremden, die nach Alexandria kamen, der Juden, die sich hier niedergelassen hatten, und nicht zuletzt die der zahlreichen Delegationen aus Parthien, Syrien und Punt, die vor dem Thron ihres Vaters erschienen, um ihm und seinem Reich ihre Aufwartung zu machen. Und schneller, als es je einem oder einer ihrer Sippe gelungen war, bildeten sich in ihrem Kopf aus dem Wort Silben, Wörter, Sätze und Geschichten, sodass jeder über das kleine Mädchen staunte, das in einem Alter, in dem andere Kinder noch mit Puppen und knöchernen Figürchen spielten, ihrem Vater schon eine große Stütze war. Er konnte sich auf seine Tochter verlassen. Kleopatra übersetzte und es dauerte nicht lange, da entfernte Ptolemaios alle anderen Dolmetscher von seinem Hof.
Die Kleine war nicht schön, was der Vater, der von sich selbst behauptete, ein Ästhet zu sein, oft bedauerte. Warum nur konnte die Natur nicht einmal eine Ausnahme machen und Schönheit und Geist in einem Menschenkind vereinen? Kleopatras Nase war etwas zu lang geraten, der Mund allzu üppig mit einem dennoch herben Zug über einem fliehenden Kinn. Ein wenig zu klein saß der Kopf auf einem langen, dürren Hals. Zudem war das Kind schmächtig geblieben, als weigere es sich zu wachsen. Ihre ganze Erscheinung hatte schon jetzt etwas Reifes, fast Greisenhaftes an sich und Ptolemaios befürchtete, dass sich daran auch nichts ändern würde. Oft hörte man den besorgten Vater seufzen. Ob sich für seine Tochter, die so gar nichts von der äußeren Schönheit ihrer ägyptischen Mutter geerbt hatte, außer vielleicht der olivfarbenen Haut, wohl je ein Mann fände? Andererseits hatten die Götter das Kind mit der Gabe eines überaus scharfen Verstandes gesegnet, vor dem er gelegentlich erschrak. War es denn möglich, dass ein Kind solcher Gedankengänge fähig war, dass ein Kind in Kleopatras Alter schon komplizierte politische Zusammenhänge verstand? Und auch noch ein Mädchen, dem die Gesellschaft doch traditionsgemäß jeden vernünftigen Gedanken absprach? Wenigstens in ihren geistigen Gaben schien sie das verkleinerte Abbild der großen königlichen Gemahlin zu sein und Ptolemaios genoss es, wenn die Kleine dafür von allen bewundert und mit einer gewissen Achtung bedacht wurde.
Nur wenige Jahre nach Kleopatras Geburt wurde die Mutter erneut schwanger. Bald kam Arsinoé zur Welt, die sich im Gegensatz zu ihrer oft nachdenklichen älteren Schwester zu einem fröhlichen, von jedermann geliebten und verhätschelten Mädchen entwickelte, deren silberhelles Lachen durch die weiten Zimmerfluchten des elterlichen Palastes drang. Auch Kleopatra war dem Charme des Kindes verfallen. War nicht die Schwester so, wie sie selbst gern gewesen wäre? Nicht nur, dass sie in Arsinoë eine willkommene Spielgefährtin fand, soweit ihre Bestimmung überhaupt irgendeine Art von Unbeschwertheit zuließ. Arsinoë war es vor allem gelungen, die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und damit unbewusst der älteren Schwester eine Freiheit einzuräumen, von der sie sich nie hatte träumen lassen. Kleopatra hasste das höfische Protokoll, das ihr Leben auf so unangenehme Weise einschränkte, sodass sie sich oft wie in einem Kokon gefangen fühlte. Ein Mädchen tut das nicht, ein Mädchen darf jenes nicht. Das geziemt sich nicht für eine Königstochter. Sie hatte zu gehorchen. Naoma, erste Dienerin der großen königlichen Gemahlin, die längst zu einer Art Haushofmeisterin aufgestiegen war – Kleopatra pflegte sie „Hausdrachen“ zu nennen –, wachte mit Argusaugen über die Sittlichkeit der Königstöchter und wurde nicht müde, der unzähmbaren Älteren die gefügige Arsinoë als leuchtendes Beispiel vor Augen zu führen. Kleopatra mochte die Alte nicht, vor deren runzligem Gesicht sie sich, solange sie denken konnte, fürchtete und deren harte graue Augen unbedingten Gehorsam forderten. Und sie mochte sie mit den Jahren immer weniger, da ihr bewusst wurde, wie sehr die Ägypterin Ptolemaios verachtete, den überaus geliebten Vater, der freilich nicht dem gängigen Ideal eines Herrschers entsprach, des neuen gottgleichen Königs für das vereinigte Reich.
Der übermäßige Weinkonsum und die gewaltigen Berge von Nahrung, die der König zu verschlingen pflegte, ließen seinen ohnehin fülligen Leib immer mehr anschwellen. Dazu kam, dass er von Tag zu Tag bequemer wurde. Selbst innerhalb der Palastanlage ließ er sich mittlerweile tragen, was er mit Schmerzen in den Beinen begründete. Auf die vorwurfsvollen Blicke seiner Tochter hin hob er nur ohnmächtig die Schultern: „Das Alter, mein Kind, das Alter.“
Die Veränderung seines Körpers wirkte sich indes nicht auf die Zuneigung seiner Gemahlin aus, deren Herz auch nach so vielen Jahren des Zusammenlebens noch Freudensprünge tat, wenn sie seiner ansichtig wurde.
Auch in seinem Regierungsstil ließ der König nach. Er war nie ein herausragender Herrscher gewesen und hatte immer wenig Interesse an der Staatsführung gezeigt, und das wusste er auch. Ob seine Bauern genügend zu essen hatten, ob die Nilschwelle rechtzeitig eingetreten war, ob Seuchen seine Untertanen heimgesucht hatten, ja selbst jene religiösen Pflichten, die nach alter Sitte dem Staatsoberhaupt oblagen; das alles schien ihn nichts anzugehen. Zufrieden mit sich saß er in seinem Palast, der einem goldenen Käfig glich, empfing Gesandte, lud Künstler, Gelehrte und Philosophen ein und erfreute sich an gutem Essen, an Musik und Tanz. Schon lange war er dazu übergegangen, seine Tochter, die bei jeder Audienz neben ihm saß, in seine Entscheidungen einzubinden und ihr mehr und mehr Aufgaben zu übertragen. Und wieder bewies das Kind eine erstaunliche Klugheit und erntete allseits Bewunderung. War es normal, dass eine Zehnjährige, nach Art der alten Gottkönige gekleidet, geschminkt und mit Krummstab und Geißel angetan, vom Thron des Königs aus Recht sprach, wobei ihr der Vater nur assistierte? Dass sie es war, die die Abgesandten fremder Völker empfing? Dass sie Gesetze erließ, die bei aller Strenge durchaus vernünftig waren und das Zusammenleben der unterschiedlichen Stämme, die in ihrem Reich lebten, regelten? Bei allen Göttern, Kleopatra hätte das Zeug dazu, seine Nachfolgerin zu werden! Und sie würde eine bessere Regentin sein als er es war. Davon war Ptolemaios mittlerweile fest überzeugt. Aber sie war ja nur ein Mädchen. Offensichtlich hatte da die große Mutter Natur etwas verwechselt. Sie hatte versehentlich den Geist eines Mannes in den Körper einer Frau gesteckt. Doch hatte es im alten Land am Nil nicht auch so manche Königin gegeben, die zum Wohle ihrer Untertanen herrschte?
„Hermes-Thot“, empfing die Königin, deren Schönheit durch die Reife des Alterns noch aufgewertet worden war, ihren Gemahl, „nun, er hat mir im Traum mitgeteilt, dass es Amun-Re gefallen habe, meinen Leib erneut zu segnen. Und diesmal, mein König, wird er unsere Ehe mit der Geburt eines Thronerben beglücken. Das hat er mir fest versprochen.“ Dabei verbeugte sie sich mit gesenktem Blick achtungsvoll vor ihrem Mann. Er sollte nicht sehen, dass sie, die nicht nur in Liebesdingen erfahrene Frau, wie ein junges Mädchen errötete. Mit inniger Zärtlichkeit nahm der König das Gesicht seines Eheweibes in die Hände und hauchte ihr einen Kuss auf die glühende Stirn. Dann schloss er sie fest in die Arme.
„Da bist du ja endlich, mein Kind!“ Mit sanfter Gewalt löste sich die Königin aus der Umarmung ihres Gemahls und wandte sich ihrer älteren Tochter zu.
„Mutter!“ Kleopatra klang verstimmt. „Ich habe dich schon so oft gebeten, mich nicht immer ‚mein Kind‘ zu nennen. Denk doch bitte an die Dienerschaft! Nur noch zwei Sommer und ich werde in die Gemeinschaft der heiratsfähigen Frauen aufgenommen werden.“
„Und wenn du dreimal so alt wärest, mein Töchterchen! Du wirst immer mein Kind bleiben.“ Sie zog Kleopatra an sich und blickte ihr liebevoll in die geheimnisvollen grünen Augen. Besonders anmutig war sie auf den ersten Blick nicht, diese Tochter, da musste sie Ptolemaios recht geben. Und dennoch ging von ihr eine Anziehungskraft aus, die jenseits all dessen lag, was man gemeinhin als schön bezeichnete. Kleopatra würde eine faszinierende Frau werden, da war sich ihre Mutter ganz sicher, hervorragend durch Geist und Bildung und die größten Männer ihrer Zeit würden ihr zu Füßen liegen … Erwartungsvoll betrachtete das Mädchen die in Gedanken versunkene Königin.
„Mutter?“ Die Frau blickte auf. „Ich habe dich rufen lassen, um dir eine freudige Mitteilung zu machen. Du bist alt genug zu erfahren, was deinen Vater und mich so glücklich macht.“ Dabei ergriff sie die Hand ihres Gatten und führte sie an die Lippen. „In wenigen Wochen“, fuhr sie fort, „wird dir ein Bruder geboren werden und ich möchte ihn dir ans Herz legen. Wir sind alt, dein Vater und ich. Vielleicht nicht so sehr an Jahren, aber du weißt ja, vor dem Tod ist man niemals sicher. Wobei wir uns diesen natürlich völlig gegensätzlich vorstellen. Dein Vater glaubt an ein Schattendasein im unterirdischen Orkus und versucht, ein guter Mensch und ein gerechter Herrscher zu sein. Denn nur wer auf der Erde rechtschaffen lebt, kann nach seiner Ansicht auch auf ein erträgliches Dasein in der Unterwelt hoffen. Ich hingegen bin davon überzeugt, nach meinem Tod Osiris gleich zu neuem Leben zu erstehen. Durch Umarmung und Mundöffnung wird mich der Totengott Anubis wieder beleben und Isis und Nephtys werden mir zur Auferstehung in Gestalt des Gottes Horus verhelfen. Ptolemaios, dein Bruder, wird für seine Untertanen der neue sichtbare Horus sein und in ihm, meinem Sohn, werde auch ich in die Ewigkeit eingehen. Du siehst also, welch große Verantwortung ich dir auferlege, meine Kleopatra.“
Das Geständnis der Königin, wieder schwanger zu sein und einen Sohn zu erwarten, ließ die Tochter für einen Augenblick einen Anflug von Eifersucht verspüren. Gehörte der Vater nicht ihr allein? Sollte sie ihn etwa mit einem Bruder teilen? Arsinoë war als zweitgeborene Tochter für sie keine Konkurrenz. Aber ein Sohn? Und war es nicht seit alters her Brauch ihrer – zugegeben mütterlichen – Vorfahren gewesen, dass Väter ihre Töchter und Brüder ihre Schwestern ehelichten, um das Blut der Familie reinzuhalten? Die Verbindung von Bruder und Schwester war immer noch erwünscht. War nicht, wenn sie gewissen Gerüchten glauben konnte, Ptolemaios sogar mit seiner Halbschwester Kleopatra, ihrer Namensvorgängerin, verheiratet gewesen, ehe er sich ihrer Mutter zugewandt hatte? Doch ihr Bruder würde noch ein unmündiges Kind sein, wenn sie auf den Thron käme. Undenkbar, ihn zum Mann zu nehmen. Oder würde ihr Vater gar ihn …? Nicht auszudenken! Eifersucht? Ja, vielleicht.
Sie vertrieb das aufsteigende Gefühl, hatte sich gleich wieder im Griff und versprach, über den Auftrag nachzudenken. Dann wandte sie sich zum Gehen. Doch noch einmal rief die Mutter sie zurück. „Übrigens berichtet mir dein ägyptischer Lehrer Imhotep, dass du Fortschritte machst. Das freut mich, mein Kind!“ Freundlich lächelnd blickte sie der Tochter nach, die sich höflich bedankte und das Gemach der Königin verließ.
„Du magst das Herz einer Zehnjährigen haben, Prinzessin, aber du hast den Verstand einer erwachsenen Frau.“ Imhotep versuchte, das verstörte Mädchen zu beruhigen. Wusste die große Königin denn überhaupt, was sie da von ihrer Tochter verlangte? „Beruhige dich, gehe in dich und bitte Amun-Re um Hilfe und Erleichterung. Und meinetwegen auch die Götter deines Vaters.“
„Amun-Re-Zeus“, begann Kleopatra schluchzend, nachdem sie sich in einen der kleinen Haustempel geflüchtet hatte, der den Göttern Griechenlands und Ägyptens gleichermaßen als Heimstatt diente. „Wie zahlreich sind doch deine Werke; sie sind dem Gesicht des Menschen verborgen, du einziger erhabener Gott, dem kein anderer gleichkommt …“ Dann trug sie dem Gott ihrer Ahnen vor, was ihre junge Seele bedrückte, und endete mit der Bitte, ihr für alles, was das Leben heute und zu jeder Zeit von ihr forderte, den Segen des Himmels zu gewähren. Erst jetzt begann sie zu weinen. Aber sie weinte längst nicht mehr wie ein Kind. Nie hätte sie geahnt, dass sie so viele Tränen barg, denn all die Jahre waren ihre Augen trocken geblieben. Mit verschleiertem Blick stürzte sie nach draußen, stolperte blind in die Arme Nefers, ihrer Dienerin und Vertrauten, und ließ sich von ihr trösten. Sie wusste, dass sie soeben einen Teil ihrer Kindheit hinter sich gelassen hatte und auf dem Weg zum Erwachsenwerden war.
Ganz Alexandria begrüßte die Geburt des neuen Prinzen mit überschwänglicher Begeisterung. Überall in der Stadt waren der Rhythmus der Rahmentrommeln und der hohe Gesang der Rohrflöten zu vernehmen. Ausgelassen tanzten die Menschen auf den hell erleuchteten Straßen. Und selbst aus dem fernen Memphis, wohin Ptolemaios’ Boten die freudige Nachricht gebracht hatten, kamen Grüße und gute Wünsche. Die Apis-Bruderschaft werde für das neue Familienmitglied und das Königshaus beten, ließ der Hohepriester den Schwiegersohn wissen. Er hoffe, dass es auch seiner Tochter gut gehe. Gern sähe er sein Kind einmal wieder und natürlich auch die Enkel, die er ja noch nicht kenne. Vielleicht wäre der Familie ja ein Besuch der alten Heimat in naher Zukunft möglich. Der alte Mann ahnte nicht, wie bald sich sein Wunsch erfüllen sollte.
Erneut war die königliche Gemahlin guter Hoffnung. Und der Verlauf der Schwangerschaft, die sich durch nichts von der vorhergehenden unterschied, ließ ahnen, dass auch diesmal ein Prinz geboren würde. Doch sollte seine Geburt unter ganz anderen Vorzeichen als denen bei der Geburt des älteren Bruders verlaufen.
Seit Tagen peitschte ein heftiger Sturm aus südwestlicher Richtung den Sand der nahe gelegenen Wüste auf, trübte die Luft, dass man die Hände vor den eigenen Augen nicht sah, und legte sich als grauer schmieriger Belag wie ein Leichentuch über die erstarrte Stadt. Totenstille überall. Die Bewohner Alexandrias waren aufgerufen, Türen und Fenster zu vernageln und ihre Behausungen nicht zu verlassen. Wie vor einem gefährlichen Feind hatte sich auch die Königsfamilie in ihrem Palast verbarrikadiert. Das schwache Licht weniger Öllämpchen verlieh den dunklen, mit kostbarem Holz getäfelten Räumen, die Ptolemaios und die Seinen bewohnten, ein gespenstisches Aussehen, das die ohnehin schlechte Stimmung noch mehr trübte. Und die Luft stand. Man war es gewohnt, den Großteil des Tages im Freien zu verbringen, außerhalb der beengenden Mauern, in den schattigen Gärten bei den murmelnden Brunnen, den seerosengeschmückten Teichen, in den duftenden Orangenhainen, den herrlichen Papyruswäldern oder unter den silberblättrigen Olivenbäumen. Selten begab man sich tagsüber ins Haus.
Die Geburt ihres vierten Kindes hatte die Königin mehr Kraft gekostet als die ihrer drei älteren Kinder zusammen. Sie schob es ihrem fortgeschrittenen Alter zu. Die alte Volksweisheit hatte schon recht, wenn sie meinte, Kinder solle man in jungen Jahren bekommen. So sei es schließlich von der Natur auch vorgesehen.
„Ich werde dafür sorgen, dass du nicht mehr schwanger wirst“, bemerkte Naoma besorgt. Sie hatte sich bereit erklärt, die Pflege ihres Schützlings zu übernehmen, der sich diesmal von der Mühsal des Wochenbetts nur langsam erholte. Naoma war alt geworden. Ihre Beine gehorchten ihr kaum mehr und ihre Hände, die mit hässlichen braunen Flecken übersät waren, zitterten. Sie bemühte sich, wenigstens ihren Kopf ruhig zu halten. Mit all den Gebrechen kostete es die Greisin eine nahezu übermenschliche Anstrengung, ihrer Aufgabe gerecht zu werden, aber sie versuchte es ohne zu murren. Die Königin bestand auf ihrer Hilfe und ihrer Gesellschaft. Sie konnte sich ein Leben ohne diesen guten Geist, der ihr bisheriges Leben so selbstlos begleitet hatte, nicht vorstellen. Die Königin brauchte sie.
„Vier Kinder in einem Jahrzehnt! Mehr kann ein noch so hoch gestellter Mann von seiner Frau nicht verlangen. Du hast deine Pflicht getan. Mehr als das, meine Schöne. Hätte ich geahnt, was dieser Grieche deiner schwachen Gesundheit zumuten würde, glaube mir, ich hätte damals deinen Vater beschworen, dich nicht mit ihm zu verheiraten. Es hat schließlich genügend Anwärter gegeben, junge Männer aus den vornehmsten Familien Ägyptens, die ein Auge auf dich geworfen hatten. Manchmal stelle ich mir vor, was geworden wäre, hättest du einen von ihnen genommen. Wir säßen jetzt bequem in Memphis, fern aller Repräsentationspflichten und vor allem fern von diesem turbulenten Alexandria, wo man nicht einmal seines Lebens sicher ist. Aber du, du musstest ja unbedingt deinen Kopf durchsetzen. So wie immer. Schon als kleines Mädchen …“
„Ich kenne deine Vorwürfe, meine Liebe“, unterbrach sie die Königin. „Ich habe sie oft genug gehört. Du bist ja mit ihnen nie sparsam gewesen. Es ist schon alles gut so. Ein jeder hat den Platz einzunehmen, der ihm vom Schicksal zugewiesen wurde. Und mein Platz ist hier, Naoma. Ich habe nie bereut, meine Heimatstadt verlassen und hier ein neues Leben begonnen zu haben, fern von meinem geliebten Vater, meinen Geschwistern und allem, was mir vertraut war. Freilich war es nicht immer leicht und manchmal schnürte mir das Heimweh das Herz zu. Aber Ptolemaios hat mich geliebt, er tut es bis heute, auch wenn mein Gesicht die ersten Spuren des Alters trägt und mein Leib allmählich aus der Form gerät. Und ich liebe ihn. Die Liebe, gute Naoma, erträgt vieles und verzeiht alles. Und wo die Liebe ist, ist man zu Hause.“ Eine Weile schwieg die Königin, als müsse sie über die Bedeutung ihrer eigenen Worte nachsinnen. Dann wandte sie sich erneut an ihre alte Amme.
„Etwas anderes beunruhigt mich, Naoma. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sich in Alexandria das Volk zusammenrottet und lauthals Ptolemaios’ Tod fordert. Er hat mir nichts davon erzählt, er hält ja alles, was mich aufregen könnte, von mir fern. Aber wie du weißt, haben die Wände unseres Palastes Ohren. Nicht nur der König hat seine Spitzel im ganzen Reich verteilt. Auch meine Vertrauensleute hören sich um. Von ihnen wurde mir zugetragen, dass die Frau, die Ptolemaios vor mir geehelicht hatte, gemeinsam mit ihrer Tochter Berenike das Volk aufwiegle und nach dem Thron lechze. Nur zum Schein habe sie sich mit dem Los der Verbannung abgefunden. Seit geraumer Zeit bereite sie mit Hilfe getreuer Anhänger ihre Rückkehr nach Alexandria vor, wo sie ihre Tochter, nach ihrer Meinung Ptolemaios’ einziges legitimes Kind, auf den Thron setzen und sich als große königliche Beraterin aufspielen wolle. Ihrem früheren Gemahl und seiner jetzigen Familie habe sie Rache geschworen.“
Auch Naoma hatte von dem drohenden Aufstand gehört. Im Palast wusste fast jeder davon. Aber sie hatte dem Gerede zunächst keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Immer wieder war von der Unzufriedenheit des Volkes die Rede und oft genug hatte sich gezeigt, dass sich diese wieder gelegt hatte oder überhaupt nur ein leeres Gerücht war. Als man ihr jedoch berichtete, der König verstärke die Mauern und erhöhe die Anzahl der Wachen, hatte sie sich genauer erkundigt. Doch wie alle anderen, die unbequeme Fragen stellten, hatte man auch sie mit der lapidaren Feststellung abgefertigt, dass die Zeiten unsicher seien und man vorsorgen müsse. Kein Grund zur Beunruhigung! Doch Naoma war nicht dumm. Mochte sie auch nur eine Sklavin sein und niemals das genossen haben, was man in Gesellschaftskreisen eine höhere Bildung nannte, so verfügte sie doch über Erfahrungen, die keine Bücher vermitteln konnten. Ein langes Leben in unmittelbarer Nähe der Vornehmen und Herrschenden hatte sie geprägt und ihr Weisheit und Weitsicht verliehen, die über jedes Schulwissen hinausgingen. Und es gab Träume, immer wieder Träume! Von dunklen Wolken träumte sie, die sich bleischwer über Alexandria und den Palast legten und dessen Mauern bis in die Grundfesten erschütterten. Von bislang unbekannten Gestirnen träumte sie, die sich blutrot vor die Sonne schoben und alles in undurchdringliches Dunkel hüllten. Sie sah das Gefieder der Ibisse, das sich von einem Augenblick zum nächsten schwarz färbte. Vögel, die Steinen gleich tot vom Himmel fielen. Und Ptolemaios, der jung und schlank im königlichen Ornat auf der Sonnenbarke gegen Westen segelte. Träumte sie? Erlebte sie? Sie vermochte es, sobald der Tag angebrochen war, nicht zu sagen. Nur ihr nächtliches Gewand, das von Schweiß durchtränkt war, verriet, wie sehr sie gelitten hatte.
Bald war sie überzeugt, dass Alexandria und der Königsfamilie turbulente Ereignisse ins Haus stünden, ja dass deren Leben und Stellung bedroht waren. In weiser Voraussicht gab sie Anweisung, alles für eine Flucht ihrer geliebten Herrin und der Kinder vorzubereiten. In Alexandria war die hohe Familie nicht mehr sicher. Memphis würde ein geeignetes Asyl sein, wo sie die Apis-Priesterschaft und vor allem der Hohepriester sicherlich mit Freude aufnähmen. Nur Ptolemaios, der nach ihrer Auffassung so großes Unglück über ihre Prinzessin gebracht hatte, als er sie zunächst ver- und dann entführte, mochte sehen, wo er blieb. Ihm würde sie gewiss keine Träne nachweinen.
Sie sprach zu ihrer Herrin von den dunklen Gedanken, die sie seit einiger Zeit umtrieben und quälten, und weihte sie in ihre Pläne ein. Alles sei vorbereitet. Die Königin müsse nur zustimmen. Aber es sei Eile geboten. Damit warf sie sich, was bisher noch nie geschehen war, der Königin zu Füßen.
Die hohe Frau war verwirrt. Vor allem, dass Naoma Ptolemaios nicht in ihre Rettungspläne einbezogen hatte, so denn diese überhaupt nötig waren, störte sie. Konnte die Alte nicht endlich begreifen, dass es ohne den geliebten Mann auch für sie, die Königin, keine Flucht gab? Durfte sie Ptolemaios so schmählich im Stich lassen? Hatte sie ihm nicht damals, als sie den Krug miteinander zerbrochen hatten, ewige Treue geschworen, ein Ausharren an seiner Seite bis zum Tod? Doch was hatte ihr Göttergemahl vor? Warum redete er nicht mit ihr? Wenn Naoma die Lage in der Stadt durchschaut und erkannt hatte, dass sich die königliche Familie in Lebensgefahr befand, um wie viel mehr musste dann ihm klar geworden sein, dass etwas zu ihrer Rettung geschehen musste? Gewiss, in letzter Zeit hatte auch sie eine gewisse Unruhe im Palast beobachtet. Sie hatte gesehen, dass Ptolemaios an Speisen und Getränken nur vorsichtig nippte, ehe er in gewohnter Weise zugriff, und dass mancher Sklave, dem das Vorkosten der königlichen Mahlzeiten befohlen worden war, schon nach wenigen Bissen oder Schlucken tot zusammenbrach. Aber man hatte Königen nach dem Leben getrachtet, solange Menschen denken konnten, und ebenso lange hatten sich die Herrschenden dagegen zu schützen vermocht. Nein, dachte die hohe Frau, an ein bevorstehendes Attentat glaubte sie nicht. Es waren die üblichen Vorsichtsmaßnahmen, die man traf. Weiter nichts.
Und wenn die besorgte Dienerin doch recht hatte? Nun, sie würde ihren Gatten darauf ansprechen, was an den umlaufenden Gerüchten wahr sei und ob es die Verstoßene und Verbannte tatsächlich wagen könnte, das freilich wegen der hohen Steuerlast nicht ganz zu Unrecht aufgebrachte Volk auf ihre Seite zu bringen und gegen ihren Wohltäter zu konspirieren. Bei Gelegenheit. Eilig schien ihr die ganze Sache nicht.
Doch kaum hatte sich Naoma, verzweifelt ob der Sturheit ihrer Herrin, in ihre Kammer zurückgezogen, wurde die Königin abrupt aus ihren Gedanken gerissen. Ohne die übliche Form der Etikette zu wahren, stürzte Ptolemaios in ihr Gemach, um ihr schwer atmend zu sagen, sie müsse Alexandria mit den Kindern eiligst verlassen und sich in Sicherheit bringen. „Das Volk probt den Aufstand“, keuchte er. „Uns bleibt keine Zeit. Kleopatra, meine frühere Gemahlin, hat im ganzen Reich Truppen gesammelt, die sich schon im Anmarsch auf Alexandria befinden. Ich habe bereits befohlen, das Nötigste zusammenzupacken. Du wirst zu deinem Vater zurückkehren und ich werde mich nach Rom unter den Schutz des Pompeius begeben und dort meine Freunde um Unterstützung bitten. Denn die Stärke meiner Truppen reicht gegen die der Verräterin nicht aus, um unseren Anspruch zu verteidigen. Und ich habe nicht vor, den Platz kampflos zu räumen. Zum Glück habe ich mir durch großzügige Geschenke die Römer von Anfang an verpflichtet, wenn man mich auch oft genug getadelt hat, ich verschleudere das Erbe unserer Vorfahren und schände die Ehre des Reiches.
Aber es ist jetzt nicht die Zeit, zu politisieren und philosophische Reden zu halten. Die Feinde der Ptolemäer werden bald vor den Toren des Palastes stehen. Ich fliehe, Liebste, und ich habe alle Vorkehrungen getroffen, dass auch du sofort aufbrechen kannst. Bete zu deinen Göttern und rufe auch die meinigen an! So es ihnen gefällt, werden wir uns bald wiedersehen.“
Noch einmal umarmte er die geliebte Frau. Dann eilte er hinaus und strebte zum Hafen, wo ein Schnellsegler bereits auf ihn wartete.
Auf der Reise nach Rom
Die Königin war der Verzweiflung nahe. Sie hatte alle Räume der großzügigen Palastanlage durchsuchen lassen. Keine Abstellkammer, keine Truhe, kein noch so düsterer Winkel war den Augen ihrer Dienerschaft verborgen geblieben. Selbst Zimmer, die seit Menschengedenken nicht mehr benutzt wurden und verschlossen waren, hatten sie aufgebrochen und aufmerksam durchforscht. Aber ihre Tochter Kleopatra war nirgendwo zu finden. Sie war und blieb verschwunden.
Auch weil Naoma zum Aufbruch drängte, entschloss sich die Königin in ihrer Todesangst schweren Herzens, ihr Töchterchen sich selbst zu überlassen. Zwar war gerade ihre Älteste für ihre Klugheit bekannt, aber sie war trotz ihrer beinahe zwölf Jahre noch ein Kind und hatte sich noch nie in einer ähnlich gefährlichen Lage befunden.
Doch draußen randalierte der Pöbel. Schon hämmerten und polterten aufgebrachte Rebellen heftig an die Tore der Residenz und forderten Einlass. Die ersten Griechen lagen erschlagen in den Straßen Alexandrias und immer wieder skandierte der aufgebrachte Mob: „Tod dem König, Tod den Ptolemäern!“
Da befahl die Königin, den Palast auf geheimen Wegen umgehend zu verlassen und eiligst die bereitstehenden Wagen zu besteigen, die sie und die Königskinder in die Sicherheit von Memphis bringen sollten.
Und was geschähe mit Kleopatra? Würde sie alleine zurechtkommen? Würde sie ihr Leben retten können? Es wäre ihr sicherlich ein Leichtes, als einfaches ägyptisches Mädchen verkleidet irgendwo in der Stadt Unterschlupf zu finden. Es blieb nur zu hoffen, dass die Tochter auf diesen Gedanken kam.
Mit tränenverschleierten Augen schlurfte König Ptolemaios indes über das Deck des Schnellseglers. Selbstvorwürfe quälten ihn. Er war ein schwacher König. Und er war ein schlechter Vater und Ehemann. Er hatte die Seinen schmählich im Stich gelassen. Wer konnte sagen, ob auch ihnen die Flucht gelungen war, ob sie sich vor den randalierenden Aufständischen noch rechtzeitig hatten in Sicherheit bringen können? Niemand wusste es, aber ein jeder konnte sehen, wie feige er, der „große König“, in Wirklichkeit war. Sollte er vielleicht umkehren und in Alexandria zu retten versuchen, was zu retten war? Sollte er nach Memphis eilen und dort zusammen mit seiner Familie warten, bis sich die Gemüter wieder beruhigt hatten? Aber was könnte er, ein Mann, dem man seine Stellung streitig machte, gegen die Überzahl seiner Gegner ausrichten? Und müsste er nicht in Memphis vor den Hohepriester, seinen Schwiegervater, treten und kleinlaut eingestehen, dass er ein Gescheiterter war? Er, der die Stadt einstmals als großer König besucht hatte, als Wiedergeburt der mächtigen Pharaonen. Als aus den Fluten des Nils auferstandener Osiris? Nein, das verbot sein Stolz.
Oft glaubte er, die verächtlichen Blicke der Seeleute auf sich ruhen zu sehen. Und hatte neulich nicht gar einer gewagt, vor ihm auszuspucken, um ihm seine Verachtung zu zeigen? So weit war es schon mit ihm gekommen. Er hatte hier, nur von einer kleinen Leibgarde bewacht – die meisten seiner Leute hatten sich auf die Gegenseite geschlagen –, der rauen See und den nicht weniger rauen Männern schutzlos ausgeliefert, nicht einmal die Möglichkeit, sich gegen solche Unverschämtheiten zu wehren. Und was das Schlimmste war: Sie hatten recht. Er war ein Verräter, ein Versager. Und er schämte sich dafür. Jetzt war er sogar nahe daran, sein Reich und seine Ehre oder das bisschen, das davon geblieben war, den Römern in den gierigen Rachen zu werfen. Aber konnte er denn anders? Wieder rollte ihm eine Flut von Tränen die feisten Wangen hinab.
Schleichende Schritte, die er hinter seinem Rücken vernahm, rissen ihn aus seinen Gedanken. Augenblicklich vermutete er ein Attentat. So also rächte sich die verstoßene Gattin. Hier auf dem Schiff, wo sich keine Art des Widerstands bot, ließ sie ihn hinterrücks ermorden. „Gut eingefädelt“, sprach er zu sich selbst. „Das hätte ich dir gar nicht zugetraut, Kleopatra.“ Dann machte er sich auf das bevorstehende Ende gefasst.
Aber nichts geschah. Der König stand klopfenden Herzens auf dem Deck. So mochten Verurteilte auf die Hand des Scharfrichters warten. Die undeutlichen Schritte waren jetzt gänzlich verhallt. Er fühlte nur einen stechenden Blick, der sich in sein müdes Fleisch grub. Langsam drehte er sich um.
Die königliche Familie, jetzt vaterlos, näherte sich unter großen Anstrengungen der alten Stadt Memphis. Immer wieder wurde sie auf ihrem Weg von Aufständischen angehalten und verhört. Doch erkannten diese weder die Frau noch die Kinder. Niemand hätte in der Reisenden, die in Lumpen gehüllt gleich einer einfachen Marktfrau auf einem klapprigen Gemüsekarren saß, die große königliche Gemahlin vermutet.
„Du siehst, liebe Naoma, manchmal hat es auch etwas Gutes, wenn man im goldenen Käfig eingesperrt ist und von keinem gesehen wird. Ich wage nicht, mir vorzustellen, was geschehen wäre, hätte sich von diesen Verbrechern auch nur einer an mein Gesicht erinnert. Arsinoë sieht aus wie ein verdreckter Spatz, und die beiden Kleinen gleichen eher den ungeliebten Ablegern von Straßenvolk als hochgeborenen Prinzen. Und dann dieses Fahrzeug! Ich darf nicht daran denken, was mit ihm vermutlich schon alles befördert wurde: verfaultes Obst und Gemüse, Kuhmist, Kameldung, verendete Tiere, und womöglich hat es auch schon als Leichenwagen gedient. Es ist derart unbequem, dass kein noch so winziger Teil meines Körpers von blauen Flecken verschont geblieben ist. Und meine Knochen! Aber verzeih, meine Liebe! Du bist so viel älter als ich, bist krank und gebrechlich, und dennoch klagst du nicht. Ich muss dir wirklich dankbar sein. Hast du nicht trotz all dieser Beschwerden alles so gut vorbereitet? Hätte ich doch nur eher auf dich gehört! Vielleicht hätten wir uns ja auf einer früheren Flucht nicht so verkleiden müssen. Ich sehe uns an und könnte lachen, wenn die ganze Sache nicht so zum Weinen wäre.“
„Wir werden überleben, meine Königin. Das ist das Einzige, was zählt.“ „Ist es das wirklich?“ Die große königliche Gemahlin zweifelte. War denn ein Leben um jeden Preis überhaupt ein Leben? Sie war im Luxus aufgewachsen und ihr Mann hatte ihr jeden Wunsch von den Augen abgelesen. Zahllose Sklaven hatten sich um ihr Wohlergehen bemüht, hatten ihr die kostbarsten Gewänder angelegt und das wertvollste Geschmeide umgehängt, das die Gold- und Silberschmiede in ihrem Reich zu fertigen imstande waren. Sie hatte nur von den edelsten Speisen gekostet. Wie selbstverständlich hatte sie das alles angenommen, ohne auch nur einen Anflug von Dankbarkeit zu zeigen. Und jetzt! Ein wenig konnte sie die Menschen verstehen, die immerzu ertragen mussten, was sie gerade ertrug. Und mit einem Mal verstand sie auch, dass sie versuchten, sich von Zeit zu Zeit mit ihren bescheidenen Mitteln dagegen zu wehren. Doch hatte sich nicht immer wieder gezeigt, dass auch neue Herrscher trotz aller gegebenen Versprechen die Bedingungen nicht änderten oder allenfalls vorübergehend Linderung verschafften? Niemand vermochte sich auf Dauer der göttlichen Ordnung zu entziehen. Einem jeden hatte die Vorsehung seinen Platz zugewiesen. Mehr denn je war sie davon überzeugt.
Sie freute sich auf ihren Vater, der inzwischen sicherlich alt und gebrechlich, aber immer noch eine Autorität war. In den Briefen, die regelmäßig zwischen Memphis und Alexandria hin- und hergegangen waren, hatte er sich zwar nie beklagt, doch zählte er jetzt beinahe 50 Jahre, ein Alter, das zu erreichen den wenigsten Bewohnern des Reiches am Nil vergönnt war.
Wie schön wäre es gewesen, im herrschaftlichen Reisewagen die marmorgepflasterte Straße hinauf zu fahren, die zum künstlich angelegten Hügel mit der unter Palmen versteckten Palastanlage führte! Wie schön, als erhabene Königin, gefolgt von den Blicken zahlreicher Neugieriger, in prächtigem Ornat dem staunenden Vater entgegen zu treten, an der Hand die Kinder, seine Enkel, die auch sein Weiterleben nach dem Tod sicherten! Zwar war ein Bote vorausgesandt worden, um den alten Mann auf seine Tochter und Enkelkinder und das Unglück, das ihnen zugestoßen war, vorzubereiten. Doch wo stand geschrieben, dass der Getreue ungehindert bis Memphis vorgedrungen war? Und wie sollte sie ihrem Vater erklären, weshalb sie ihren Mann nicht mitgebracht hatte, den König von Ober- und Unterägypten, der gerade auf dem Weg war, sein Reich, seine Familie, seine Freiheit und seine Ehre den Römern zu verkaufen? Wie, dass sie Kleopatra im Stich gelassen hatte? Ach, sie hätte das ungehorsame Mädchen länger suchen müssen, hätte nicht aufgeben dürfen. Sie hätte die Sklaven strenger antreiben müssen, alles im Haus umzudrehen, und androhen müssen, die ganze Meute einen Kopf kürzer zu machen, sollten sie das Kind nicht herbeischaffen. Wahrscheinlich hätte sie sich gerade um diese Tochter, die sich so sehr von Gleichaltrigen unterschied, mehr kümmern müssen. Sie machte sich Vorwürfe. Doch war ihr Kleopatra, die von Ptolemaios offensichtlich inniger geliebt wurde als seine anderen Kinder, immer so selbstständig erschienen, ihren Jahren an Klugheit weit voraus, und so hatte sie das Kind leichtfertig, wie sie jetzt wusste, zu oft sich selbst überlassen. Sie hatte schnell festgestellt, dass sich Kleopatra den Erziehungsversuchen Naomas verweigerte, ja gegen diese eine regelrechte Abneigung entwickelte. Nach langer und sorgfältiger Auswahl hatte sie dann Nefer, ein dunkelhäutiges Sklavenmädchen, einige Jahre älter als ihre Tochter, in ihre Familie aufgenommen und Kleopatra hatte sich rasch mit dieser angefreundet. Nefer war, was man von der Prinzessin nicht behaupten konnte, ein lebenstüchtiges, geschicktes und vorausschauendes Persönchen. Es war ihr sogar gelungen, die wilde Königstochter ein wenig zu zähmen. Ihr Einfluss auf die Prinzessin war immer größer geworden. Wie eine Klette hatte die Kleine an der neuen Dienerin gehangen, und wo Nefer gewesen war, war auch Kleopatra bald aufgetaucht. Die beiden waren in kürzester Zeit unzertrennlich geworden. Ach, wenn sie, die Königin, doch nur wüsste, dass Nefer bei ihrer Tochter war! Dann müsste sie sich keine Sorgen machen.
Endlich tauchten in der Ferne aus dem grauen Staub der Straße die ersten Behausungen von Memphis auf: Die einfachen Lehmhütten der Sklaven und die kleinen Geschäfte der Handwerker, dann Palmengärten, in denen die herrlichsten Blumen blühten. In der alten Königsstadt schien die Zeit still zu stehen. Nichts von dem Lärm, der in Alexandria herrschte. Niemand, der ihrem Gemahl und seiner Familie nach dem Leben trachtete. Memphis lag in dumpfem, seit mehr als zwei Jahrtausenden währendem Schlaf.
Der König traute seinen Augen nicht und für einen Atemzug hatte es ihm sogar die Sprache verschlagen. „Du hier?“, stammelte er. „Vater!“, rief das junge Mädchen, um Verständnis ringend. „Vater, ich konnte nicht anders.“ Damit warf sie sich ihm um den Hals.
„Ich habe alles versucht, hoher Herr, deine Tochter von dieser Unbesonnenheit abzubringen, aber du kennst sie ja selbst. Was sie sich einmal in den Kopf gesetzt hat …“ Nefer fiel Ptolemaios schluchzend zu Füßen. Sie war darauf gefasst, dass der König gleich in Zorn ausbrechen und der Mannschaft des Schiffes befehlen würde, sie zur Strafe über Bord zu werfen. Aber das hatte sie schließlich verdient. Sie hätte Kleopatra härter anfassen, sie hätte sie einsperren und der Mutter übergeben müssen. Das hätte ihr, der Dienerin, jedoch das Herz gebrochen, denn sie wusste, wie sehr ihr Schützling an dem Vater hing. „Niemals“, hatte ihr die Prinzessin entgegen geschleudert, „niemals würde ich ihn im Stich lassen, und das weißt du. Wenn er nach Rom geht, gehe ich selbstverständlich mit. Er spricht ja kaum Latein und nur ein wenig Griechisch. Wie soll er sich dort verständigen, wie soll er verstehen, was man ihm sagt, von ihm verlangt? Du weißt selbst, wie unzuverlässig unsere Übersetzer sind. Wo steht geschrieben, dass sie nicht von den Römern gekauft wurden? Und außerdem: Ich könnte es nicht ertragen, ihm so fern zu sein.“ Nefer, die die junge Herrin liebte, als wäre sie ihre Schwester (was ihr freilich wegen ihres niederen Standes nicht zukam), ließ sich beschwatzen und verschaffte ihnen beiden ein sicheres Versteck auf dem Schnellsegler, auf dem Ptolemaios zu fliehen beabsichtigte. Teuer hatte sie dafür bezahlt. Sie hatte einem der Seeleute eine sie „schon lange quälende, heimliche Liebe“ gestanden und ihm ihren Körper verkauft. Dafür hatte sie im Bauch des Schiffes einen engen Verschlag bekommen, ein finsteres, schmutziges Loch, das von Ratten und allerhand Ungeziefer bewohnt war. Kleopatra störte es nicht. Wenn sie nur in der Nähe des Königs sein konnte und ihm ihre Hilfe anbieten durfte! Sie würde jedes noch so große Ungemach auf sich nehmen. Heimlich hatten sich die beiden jungen Frauen nachts auf das Schiff geschlichen, sich in der stinkenden Behausung eingerichtet und ihren Proviant ausgepackt: einen Krug Wasser, Oliven und trockenes Brot. Es war alles, was ihnen in der Eile zusammenzuraffen gelungen war. Voller Ungeduld hatten sie dann auf das Auslaufen gewartet. Wenn sie sich erst auf hoher See befänden, könnte sie König Ptolemaios nicht mehr von Bord jagen, zumindest nicht Kleopatra, wie sich Nefer mit klopfendem Herzen eingestand.
„Aber hast du denn nicht an deine arme Mutter gedacht?“, wollte der König von seiner Tochter wissen. Seine Miene war streng, doch insgeheim war er auf dieses Kind stolz. „Kannst du dir nicht vorstellen, welche Sorgen sie sich um dich macht?“
„Was ist mit Mutter, geht es ihr nicht gut? Und meinen Geschwistern?“ Angst schwang in der Stimme des Mädchens mit. Nein, an ihre Mutter hatte sie im Augenblick der Flucht tatsächlich keinen Gedanken verschwendet und sie schämte sich dafür. Sie dachte an die hohe Frau, die schon durch ihre übermenschliche Schönheit Abstand gebot, die sie, anders als den Vater, stets mit scheuer Bewunderung betrachtet, deren Harfenspiel sie andächtig gelauscht hatte. Ach, Mutter hatte etwas so Unwirkliches an sich, dass Kleopatra, als sie noch Kind gewesen war, oft geglaubt hatte, ihre Mutter sei gar kein menschliches Wesen, sondern die Göttin Isis selbst, die liebende Schwestergemahlin, die geruhte, zum Wohle der Menschen für eine Weile auf Erden zu wandeln. Glich sie nicht jener Statue der Göttin, die den kleinen Haustempel der Ptolemäer in Alexandria schmückte? Zeigte Isis nicht das gleiche Lächeln, mit dem auch die Königin stets ihren Kindern begegnete? Trug sie nicht das ebenmäßig vornehme Gesicht mit genau den Zügen, die auch der Mutter eigen waren? Es konnte nicht anders sein: Die Mutter war Isis, und Göttern musste man, das hatte sie schon als ganz kleines Mädchen gelernt, immer mit Achtung und Abstand begegnen.