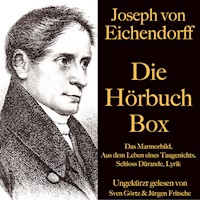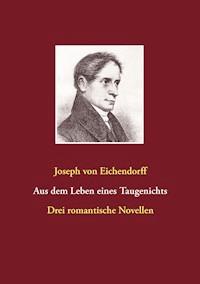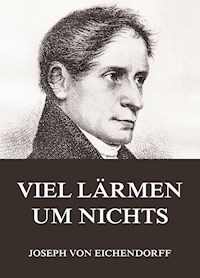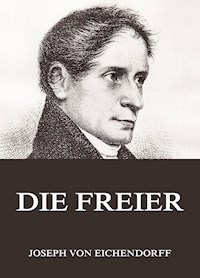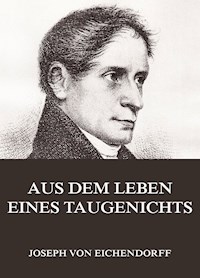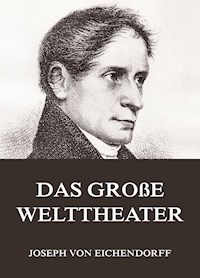3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Äußerst romantisch gestimmt verlässt der junge Graf Friedrich die Universität. Mit Gleichgesinnten zieht er durch die Lande und feiert Feste auf Burgen und Schlössern, geht auf die Jagd. Sein Liebesleben ist verwirrend; da gibt es so manche schöne Gräfin, und er denkt, alles geht so weiter. Doch dann naht der Krieg ...
Coverbild: TT Stocker / Shutterstock.com
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ahnung und Gegenwart
Roman
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenZum Buch + ERSTES BUCH
Zum Buch
Joseph von Eichendorff
Ahnung und Gegenwart
Coverbild: TT Stocker / Shutterstock.com
1. Kapitel
Die Sonne war eben prächtig aufgegangen da fuhr ein Schiff zwischen den grünen Bergen und Wäldern auf der Donau herunter. Auf dem Schiffe befand sich ein lustiges Häufchen Studenten. Sie begleiteten einige Tagereisen weit den jungen Grafen Friedrich, welcher soeben die Universität verlassen hatte, um sich auf Reisen zu begeben.
Einige von ihnen hatten sich auf dem Verdecke auf ihre ausgebreiteten Mäntel hingestreckt und würfelten. Andere hatten alle Augenblick neue Burgen zu salutieren, neue Echos zu versuchen, und waren daher ohne Unterlass beschäftigt, ihre Gewehre zu laden und abzufeuern.
Wieder andere übten ihren Witz an allen, die das Unglück hatten am Ufer vorüberzugehen, und diese aus der Luft gegriffene Unterhaltung endigte dann gewöhnlich mit lustigen Schimpfreden, welche wechselseitig so lange fortgesetzt wurden, bis beide Parteien einander längst nicht mehr verstanden.
Mitten unter ihnen stand Graf Friedrich in stiller, beschaulicher Freude. Er war größer als die andern, und zeichnete sich durch ein einfaches, freies, fast altritterliches Ansehen aus. Er selbst sprach wenig, sondern ergötzte sich vielmehr still in sich an den Ausgelassenheiten der lustigen Gesellen; ein gemeiner Menschensinn hätte ihn leicht für einfältig gehalten.
Von beiden Seiten sangen die Vögel aus dem Walde, der Widerhall von dem Rufen und Schießen irrte weit in den Bergen umher, ein frischer Wind strich über das Wasser, und so fuhren die Studenten in ihren bunten, fantastischen Trachten wie das Schiff der Argonauten.
Und so fahre denn, frische Jugend! Glaube es nicht, dass es einmal anders wird auf Erden. Unsere freudigen Gedanken werden niemals alt und die Jugend ist ewig.
Wer von Regensburg her auf der Donau hinabgefahren ist, der kannte die herrliche Stelle, welche der Wirbel genannt wird. Hohe Bergschluchten umgeben den wunderbaren Ort. In der Mitte des Stromes steht ein seltsam geformter Fels, von dem ein hohes Kreuz trost- und friedenreich in den Sturz und Streit der empörten Wogen hinabschaut.
Kein Mensch ist hier zu sehen, kein Vogel singt, nur der Wald von den Bergen und der furchtbare Kreis, der alles Leben in seinen unergründlichen Schlund hinabzieht, rauschen hier seit Jahrhunderten gleichförmig fort.
Der Mund des Wirbels öffnet sich von Zeit zu Zeit dunkelblickend wie das Auge des Todes. Der Mensch fühlt sich auf einmal verlassen in der Gewalt des feindseligen, unbekannten Elements, und das Kreuz auf dem Felsen tritt hier in seiner heiligsten und größten Bedeutung hervor. Alle wurden bei diesem Anblicke still und atmen tief über dem Wellenrauschen.
Hier bog plötzlich ein anderes fremdes Schiff, das sie lange in weiter Entfernung verfolgt hatte, hinter ihnen um die Felsenecke. Eine hohe, junge, weibliche Gestalt stand ganz vorn auf dem Verdecke und sah unverwandt in den Wirbel hinab.
Die Studenten waren von der plötzlichen Erscheinung in dieser dunkelgrünen Öde überrascht und brachen einmütig in ein freudiges Hurra aus, dass es weit an den Bergen hinunterschallte.
Da sah das Mädchen auf einmal auf, und ihre Augen begegneten Friedrichs Blicken. Er fuhr innerlichst zusammen. Dann es war, als deckten ihre Blicke plötzlich eine neue Welt von blühender Wunderpracht, uralten Erinnerungen und nie gekannten Wünschen in seinem Herzen auf.
Er stand lange in ihrem Anblick versunken und bemerkte kaum, wie indes der Strom nun wieder ruhiger geworden war und zu beiden Seiten schöne Schlösser, Dörfer und Wiesen vorüberlogen, aus denen der Wind das Geläute weidender Herden herüberwehte.
Sie fuhren soeben an einer kleinen Stadt vorüber. Hart am Ufer war eine Promenade mit Alleen. Herren und Damen gingen im Sonntagsputze spazieren, führten einander, lachten, grüßten und verbeugten sich hin und wieder, und eine lustige Musik schallte aus dem bunten, fröhlichen Schwalle.
Das Schiff, worauf die schöne Unbekannte stand, folgte unseren Reisenden immerfort in einiger Entfernung nach. Der Strom war hier so breit und spiegelglatt wie ein See. Da ergriff einer von den Studenten seine Gitarre und sang der Schönen auf dem andern Schiffe drüben lustig zu:
»Die Jäger ziehn in grünen Wald
Und Reiter blitzend übers Feld,
Studenten durch die ganze Welt,
So weit der blaue Himmel wallt.
Der Frühling ist der Freudensaal,
Viel tausend Vöglein spielen auf,
Da schallt's im Wald bergab, bergauf:
Grüß' dich mein Schatz, viel tausendmal!«
Sie bemerkten wohl, dass die Schöne allezeit zu ihnen herübersah, und alle Herzen und Augen waren wie frische junge Segel nach ihr gerichtet. Das Schiff näherte sich ihnen hier ganz dicht.
»Wahrhaftig, ein schönes Mädchen!«, riefen einige, und der Student sang weiter:
»Viele rüst'ge Bursche ritterlich,
Die fahren hier in Stromes Mitt',
Wie wilde sie auch stellen sich,
Trau' mir, mein Kind, und fürcht' dich nit!
Querüber übers Wasser glatt
Lass werben deine Äugelein,
Und der dir wohlgefallen hat,
Der soll dein lieber Buhle sein.«
Hier näherten sich wieder die Schiffe einander. Die Schöne saß vorn, wagte es aber in dieser Nähe nicht, aufzublicken. Sie hatte das Gesicht auf die andere Seite gewendet und zeichnete mit ihrem Finger auf dem Boden. Der Wind wehte die Töne zu ihr herüber, und sie verstand wohl alles, als der Student wieder weiter sang:
»Durch Nacht und Nebel schleich' ich sacht',
Kein Lichtlein brennt, kalt weht der Wind,
Riegl' auf, riegl' auf bei stiller Nacht,
Weil wir so jung beisammen sind!
Ade nun, Kind, und nicht geweint!
Schon gehen Stimmen da und dort,
Hoch übern Wald Aurora scheint,
Und die Studenten reisen fort.«
So war es endlich Abend geworden, und die Schiffer lenkten ans Ufer. Alles stieg aus und begab sich in ein Wirtshaus, das auf einer Anhöhe an der Donau stand. Diesen Ort hatten die Studenten zum Ziele ihrer Begleitung bestimmt. Hier wollten sie morgen Früh den Grafen verlassen und wieder zurückreisen. Sie nahmen sogleich Beschlag von einem geräumigen Zimmer, dessen Fenster auf die Donau hinausgingen.
Friedrich folgte ihnen erst etwas später von den Schiffen nach. Als er die Stiege hinaufging, öffnete sich seitwärts eine Tür, und die unbekannte Schöne, die auch hier eingekehrt war, trat eben aus dem erleuchteten Zimmer. Beide schienen übereinander erschrocken. Friedrich grüßte sie, sie schlug die Augen nieder und kehrte schnell wieder in das Zimmer zurück.
Unterdes hatten sich die lustigen Gesellen in ihrer Stube schon ausgebreitet. Da lagen Jacken, Hüte, Federbüsche, Tabakspfeifen und blanke Schwerter in der buntesten Verwirrung umher, und die Aufwärterin trat mit heimlicher Furcht unter die wilden Gäste, die halbentkleidet auf Betten, Tischen und Stühlen, wie Soldaten nach einer blutigen Schlacht, gelagert waren. Es wurde bald Wein angeschafft, man setzte sich in die Runde, sang und trank des Grafen Gesundheit.
Friedrich war heute dabei sonderbar zumute. Er war seit mehreren Jahren diese Lebensweise gewohnt, und das Herz war ihm jedes Mal aufgegangen, wie diese freie Jugend ihm so keck und mutig ins Gesicht sah.
Nun, da er von dem allem auf immer Abschied nehmen sollte, war ihm wie einem, der von einem lustigen Maskenballe auf die Gasse hinaustritt, wo sich alles nüchtern fortbewegt wie vorher.
Er schlich sich unbemerkt aus dem Zimmer und trat hinaus auf den Balkon, der von dem Mittelgange des Hauses über die Donau hinausging. Der Gesang der Studenten, zuweilen von dem Geklirre der Hieber unterbrochen, schallte aus den Fenstern, die einen langen Schein in das Tal hinauswarfen.
Die Nacht war sehr finster. Als er sich über das Geländer hinauslehnte, glaubte er neben sich atmen zu hören. Er langte nach der Seite hin und ergriff eine kleine, zarte Hand. Er zog den weichen Arm näher an sich, da funkelten ihn zwei Augen durch die Nacht an.
Er erkannte an der hohen Gestalt sogleich das schöne Mädchen von dem anderen Schiffe. Er stand so dicht vor ihr, dass ihn ihr Atem berührte. Sie litt es gern, dass er sie noch näher an sich zog, und ihre Lippen kamen zusammen.
»Wie heißen Sie?«, fragte Friedrich endlich.
»Rosa« sagte sie leise und bedeckte ihr Gesicht mit beiden Händen.
In diesem Augenblicke ging die Stubentür auf, ein verworrener Schwall von Licht, Tabaksdampf und verschiedenen tosenden Stimmen quoll heraus, und das Mädchen war verschwunden, ohne dass Friedrich sie halten konnte.
Erst lange Zeit nachher ging er wieder in sein Zimmer zurück. Aber da war indes alles still geworden. Das Licht war bis an den Leuchter ausgebrannt und warf, manchmal noch aufflackernd, einen flüchtigen Schein über das Zimmer und die Studenten, die zwischen Trümmern von Tabakspfeifen, wie Tote, umherlagen und schliefen.
Friedrich machte daher die Türe leise zu und begab sich wieder auf den Balkon hinaus, wo er die Nacht zuzubringen beschloss. Entzückt in allen seinen Sinnen, schaute er da in die stille Gegend hinaus.
»Fliegt nur, ihr Wolken«, rief er aus, »rauscht nur und rührt euch recht, ihr Wälder! Und wenn alles auf Erden schläft, ich bin so wach, dass ich tanzen möchte!«
Er warf sich auf die steinerne Bank hin, wo das Mädchen gesessen hatte, lehnte die Stirn ans Geländer und sang still in sich verschiedene alte Lieder, und jedes gefiel ihm heut besser und rührte ihn neu.
Das Rauschen des Stromes und die ziehenden Wolken schifften in seine fröhlichen Gedanken hinein; in Hause waren längst alle Lichter verlöscht. Die Wellen plätscherten immerfort so einförmig unten an den Steinen, und so schlummerte er endlich träumend ein.
2. Kapitel
Als die ersten Strahlen der Sonne in die Fenster schienen, erhob sich ein Student nach dem andern von seinem harten Lager, riss das Fenster auf und drehte sich in den frischen Morgen hinaus.
Auch Friedrich befand sich wieder unter ihnen; denn eine Nachtigall, welche die ganze Nacht unermüdlich vor dem Hause sang, hatte ihn draußen geweckt und die kühle, der Morgenröte vorausfliegende Luft in die wärmende Stube getrieben.
Singen, Lachen und muntere Reden erfüllten nun bald wieder das Zimmer. Friedrich überdachte seine Begebenheit in der Nacht. Es war ihm, als erwachte er aus einem Rausche, als wäre die schöne Rosa, ihr Kuss und alles nur Traum gewesen.
Der Wirt trat mit der Rechnung herein.
»Wer ist das Frauenzimmer«, fragte Friedrich, »die gestern abends mit uns angekommen ist?«
»Ich kenne sie nicht, aber eine vornehme Dame muss sie sein, denn ein Wagen mit vier Pferden und Bedienten hat sie noch lange vor Tagesanbruch von hier abgeholt.«
Friedrich blickte bei diesen Worten durchs offene Fenster auf den Strom und die Berge drüben, welche heute Nacht stille Zeugen seiner Glückseligkeit gewesen waren. Jetzt sah da draußen alles anders aus, und eine unbeschreibliche Bangigkeit flog durch sein Herz.
Die Pferde, welche die Studenten hierher bestellt hatten, um darauf wieder zurückzureiten, harrten ihrer schon seit gestern unten.
Auch Friedrich hatte sich ein schönes, munteres Pferd gekauft, auf dem er nun ganz allein seine Reise fortsetzen wollte.
Die Reisebündel wurden daher nun schnell zusammengeschnürt, die langen Sporen umgeschnallt, und alles schwang sich auf die rüstigen Klepper.
Die Studenten beschlossen, den Grafen noch eine kleine Strecke landeinwärts zu geleiten, und so ritt denn der ganze bunte Trupp in den heiteren Morgen hinein. An einem Kreuzwege hielten sie endlich still und nahmen Abschied.
»Lebe wohl«, sagte einer von den Studenten zu Friedrich, »du kommst nun in fremde Länder, unter fremde Menschen, und wir sehen einander vielleicht nie mehr wieder. Vergiss uns nicht! Und wenn du einmal auf deinen Schlössern hausest, werde nicht wie alle andere, werde niemals ein trauriger, vornehmer, schmunzelnder, bequemer Philister! Denn, bei meiner Seele, du warst doch der beste und bravste Kerl unter uns allen. Reise mit Gott!«
Hier schüttelte jeder dem Grafen vom Pferde noch einmal die Hand, und sie und Friedrich sprengten dann in entgegengesetzten Richtungen voneinander.
Als er so eine Weile fortgeritten war, sah er sie noch einmal, wie sie eben, schon fern, mit ihren bunten Federbüschen über einen Bergrücken fortzogen. Sie sangen ein bekanntes Studentenlied, dessen Schlusschor: »Ins Horn, ins Horn, ins Jägerhorn!« der Wind zu ihm herüberbrachte.
»Ade, ihr rüstigen Gesellen«, rief er gerührt; »ade, du schöne, freie Zeit!«
Der herrliche Morgen stand flammend vor ihm. Er gab seinem Pferde die Sporen, um den Tönen zu entkommen, und ritt, dass der frische Wind an seinem Hute pfiff.
Wer Studenten auf ihren Wanderungen sah, wie sie frühmorgens aus dem dunklen Tore ausziehen und den Hut schwenken in der frischen Luft, wie sie wohlgemut und ohne Sorgen über die grüne Erde reisen, und die unbegrenzten Augen an blauem Himmel, Wald und Fels sich noch erquicken, der mag gern unsern Grafen auf seinem Zuge durch das Gebirge begleiten.
Er ritt jetzt langsam weiter. Bauern ackerten, Hirten trieben ihre Herden vorüber. Die Frühlingssonne schien warm über die dampfende Erde, Bäume, Gras und Blumen äugelten dazwischen mit blitzenden Tropfen, unzählige Lerchen schwirrten durch die laue Luft.
Ihm war recht innerlichst fröhlich zumute. Tausend Erinnerungen, Entwürfe und Hoffnungen zogen wie ein Schattenspiel durch seine bewegte Brust. Das Bild der schönen Rosa stand wieder ganz lebendig in ihm auf, mit aller Farbenpracht des Morgens gemalt und geschmückt. Der Sonnenschein, der laue Wind und Lerchensang verwirrte sich in das Bild, und so entstand in seinem glücklichen Herzen folgendes Liedchen, das er immerfort laut vor sich hersang:
»Grüß' euch aus Herzensgrund:
Zwei Augen hell und rein,
Zwei Röslein auf dem Mund,
Kleid blank aus Sonnenschein!
Nachtigall klagt und weint,
Wollüstig rauscht der Hain,
Alles die Liebste meint:
Wo weilt sie so allein?
Weil's draußen finster war,
Sah ich viel hellem Schein,
Jetzt ist es licht und klar,
Ich muss im Dunkeln sein.
Sonne nicht steigen mag,
Sieht so verschlafen drein,
Wünschet den ganzen Tag,
Dass wieder Nacht möcht' sein.
Liebe geht durch die Luft,
Holt fern die Liebste ein;
Fort über Berg und Kluft!
Und sie wird doch noch mein!«
Das Liedchen gefiel ihm so wohl, dass er seine Schreibtafel herauszog, um es aufzuschreiben. Da er aber anfing, die flüchtigen Worte bedächtig aufzuzeichnen und nicht mehr sang, musste er über sich selber lachen und löschte alles wieder aus.
Der Mittag war unterdes durch die kühlen Waldschluchten sanft unvermerkt vorübergezogen. Da erblickte Friedrich mit Vergnügen einen hohen, bepflanzten Berg, der ihm als ein berühmter Belustigungsort dieser Gegend anempfohlen worden war.
Farbige Lusthäuser blickten von dem schattigen Gipfel ins Tal herab. Rings um den Berg herum wand sich ein Pfad hinauf, auf dem man viele Frauenzimmer mit ihren bunten Tüchern in der Grüne wallfahrten sah.
Der Anblick war sehr freundlich und einladend. Friedrich lenkte daher sein Pferd um und ritt mit dem fröhlichen Zuge hinan, sich erfreuend, wie bei jedem Schritte der Kreis der Aussicht ringsum sich erweiterte.
Noch angenehmer wurde er überrascht, als er endlich den Gipfel erreichte. Da war ein weiter, schöner und kühler Rasenplatz. An kleinen Tischchen saßen im Freien verschiedene Gesellschaften umher und speisten in lustigem Gespräch. Kinder spielten auf dem Rasen, ein alter Mann spielte die Harfe und sang.
Friedrich ließ sich sein Mittagsmahl ganz allein in einem Sommerhäuschen bereiten, das am Abhange des Berges stand. Er machte alle Fenster weit auf, sodass die Luft überall durchstrich, und er von allen Seiten die Landschaft und den blauen Himmel sah.
Kühler Wein und hellgeschliffene Gläser blinkten von dem Tische. Er trank seinen fernen Freunden und seiner Rosa in Gedanken zu. Dann stellte er sich ans Fenster. Man sah von dort weit in das Gebirge. Ein Strom ging in der Tiefe, an welchem eine hellglänzende Landstraße hinablief. Die heißen Sonnenstrahlen schillerten über dem Tale, die ganze Gegend lag unten in schwüler Ruhe.
Draußen vor der offenen Türe spielte und sang der Harfenist immerfort. Friedrich sah den Wolken nach, die nach jenen Gegenden hinaussegelten, die er selber auch bald begrüßen sollte.
»O Leben und Reisen, wie bist du schön!«, rief er freudig, zog dann seinen Diamanten vom Finger und zeichnete den Namen Rosa in die Fensterscheibe.
Bald darauf wurde er unten mehrere Reiter gewahr, die auf der Landstraße schnell dem Gebirge zu vorüberflogen. Er verwandte keinen Blick davon. Ein Mädchen, hoch und schlank, ritt den andern voraus und sah flüchtig mit den frischen Augen den Berg hinan, gerade auf den Fleck, wo Friedrich stand.
Der Berg war hoch, die Entfernung und Schnelligkeit groß; doch glaubte sie Friedrich mit einem Blicke zu erkennen, es war Rosa. Wie ein plötzlicher Morgenblick blitzte ihm dieser Gedanke fröhlich über die ganze Erde.
Er bezahlte eiligst seine Zeche, schwang sich auf sein Pferd, und stolperte so schnell wie möglich den sich ewig windenden Bergpfad hinab; seine Blicke und Gedanken flogen wie Adler von der Höhe voraus.
Als er sich endlich bis auf die Straße hinausgearbeitet hatte und freier Atem schöpfte, war die Reiterin schon nicht mehr zu sehen. Er setzte die Sporen tapfer ein und sprengte weiter fort. Ein Weg ging links von der Straße ab in den Wald hinein. Er erkannte an der frischen Spur der Rosseshufe, dass ihn die Reiter eingeschlagen hatten. Er folgte ihm daher auch.
Als er aber eine große Strecke so fortgeritten war, teilten sich auf einmal wieder drei Wege nach verschiedenen Richtungen und keine Spur war weiter auf dem härteren Boden zu bemerken.
Fluchend und lachend zugleich vor Ungeduld, blieb er nun hier eine Weile still stehen, wählte dann gelassener den Pfad, der ihm der anmutigste dünkte, und zog langsam weiter.
Der Wald wurde indes immer dunkler und dichter, der Pfad enger und wilder. Er kam endlich an einen dunkelgrünen, kühlen Platz, der rings von Felsen und hohen Bäumen umgeben war.
Der einsame Ort gefiel ihm so wohl, dass er vom Pferde stieg, um hier etwas auszuruhen. Er streichelte ihm den gebogenen Hals, zäumte es ab und ließ es frei weiden. Er selbst legte sich auf den Rücken und sah dem Wolkenzuge zu.
Die Sonne neigte sich schon und funkelte schräge durch die dunklen Wipfel, die sich leise rauschend hin und her bewegten. Unzählige Waldvögel zwitscherten in lustiger Verwirrung durcheinander. Er war so müde, er konnte sich nicht halten, die Augen sanken ihm zu.
Mitten im Schlummer kam es ihm manchmal vor, als höre er Hörner aus der Ferne. Er hörte den Klang oft ganz deutlich und näher, aber er konnte sich nicht besinnen und schlummerte immer wieder von Neuem ein.
Als er endlich erwachte, erschrak er nicht wenig, da es schon finstere Nacht und alles um ihn her still und öde war. Er sprang erstaunt auf.
Da hörte er über sich auf dem Felsen zwei Männerstimmen, die ganz in der Nähe schienen. Er rief sie an, aber niemand gab Antwort, und alles war auf einmal wieder still.
Nun nahm er sein Pferd beim Zügel und setzte so seine Reise auf gut Glück weiter fort. Mit Mühe arbeitete er sich durch die Rabennacht des Waldes hindurch und kam endlich auf einen weiten und freien Bergrücken, der nur mit kleinem Gesträuch bewachsen war.
Der Mond schien sehr hell, und der plötzliche Anblick des freien, grenzenlosen Himmels erfreute und stärkte recht sein Herz.
Die Ebene musste sehr hoch liegen denn er sah ringsumher eine dunkle Runde von Bergen unter sich ruhen. Von der einen Seite kam der einförmige Schlag von Eisenhämmern aus der Ferne herüber. Er nahm daher seine Richtung dorthin. Sein und seines Pferdes Schatten, wie er so fortschritt, strichen wie dunkle Riesen über die Heide vor ihm her und das Pferd fuhr oft schnaubend und sträubend zusammen.
»So«, sagte Friedrich, dessen Herz recht weit und vergnügt war, »so muss vor vielen hundert Jahren den Rittern zumute gewesen sein, wenn sie bei stiller, nächtlicher Weile über diese Berge zogen und auf Ruhm und große Taten sannen. So voll adeliger Gedanken und Gesinnungen mag mancher auf diese Wälder und Berge hinuntergesehen haben, die noch immer dastehen, wie damals.
Was mühn wir uns doch ab in unseren besten Jahren, lernen, polieren und feilen, um uns zu rechten Leuten zu machen, als fürchteten oder schämten wir uns vor uns selbst und wollten uns daher hinter Geschicklichkeiten verbergen und zerstreuen, anstatt dass es darauf ankäme, sich innerlichst nur recht zusammenzunehmen zu hohen Entschließungen und einem tugendhaften Wandel.
Denn wahrhaftig, ein ruhiges, tapferes, tüchtiges und ritterliches Leben ist jetzt jedem Manne, wie damals, vonnöten. Jedes Weltkind sollte wenigstens jeden Monat eine Nacht im Freien einsam durchwachen, um einmal seine eitlen Mühen und Künste abzustreifen und sich im Glauben zu stärken und zu erbauen.
Wie bin ich so fröhlich und erquickt! Gebe mir Gott nur die Gnade, dass dieser Arm einmal was Rechtes in der Welt vollbringe!«
Unter solchen Gedanken schritt er immer fort. Der Fußsteig hatte sich indes immer mehr gesenkt, und er erblickte endlich ein Licht, das aus dem Tale herauf schimmerte.
Er eilte darauf los und kam an eine elende, einsame Waldschenke. Er sah durch das kleine Fenster in die Stube hinein. Da saß ein Haufen zerlumpter Kerls mit bärtigen Spitzbubengesichtern um einen 'Fisch und trank. In allen Winkeln standen Gewehre angelehnt. An dem hellen Kaminfeuer, das einen grässlichen Schein über den Menschenklumpen warf, saß ein altes Weib gebückt und zerrte, wie es schien, blutige Därme an den Flammen auseinander.
Ein Grausen überlief den Grafen bei dem scheußlichen Anblick, er setzte sich rasch auf sein Pferd und sprengte querfeldein.
Das Rauschen und Klappern einer Waldmühle bestimmte seine Richtung. Ein ungeheurer Hund empfing ihn dort an dem Hofe der Mühle.
Friedrich und sein Pferd waren zu ermattet, um noch weiterzureisen. Er pochte daher an die Haustüre. Eine raue Stimme antwortete von innen, bald darauf ging die Türe auf, und ein langer, hagerer Mann trat heraus. Er sah Friedrich, der ihn um Herberge bat, von oben bis unten an, nahm dann sein Pferd und führte es stillschweigend nach dem Stalle.
Friedrich ging nun in die Stube hinein. Ein Frauenzimmer stand drinnen und pickte Feuer. Er bemerkte bei den Blitzen der Funken ein junges und schönes Mädchengesicht.
Als sie das Licht angezündet hatte, betrachtete sie den Grafen mit einem freudigen Erstaunen, das ihr fast den Atem zu verhalten schien. Darauf ergriff sie das Licht und führte ihn, ohne ein Wort zu sagen, die Stiege hinauf in ein geräumiges Zimmer mit mehreren Betten.
Sie war barfuß, und Friedrich bemerkte, als sie vor ihm herging, dass sie nur im Hemde war und den Busen fast ganz bloß hatte. Er ärgerte sich über die Frechheit bei solcher zarten Jugend.
Als sie oben in der Stube waren, blieb das Mädchen stehen und sah den Grafen furchtsam an. Er hielt sie für ein verliebtes Ding.
»Geh«, sagte er gutmütig, »geh schlafen, liebes Kind.«
Sie sah sich nach der Türe um, dann wieder nach Friedrich.
»Ach Gott!«, sagte sie endlich, legte die Hand aufs Herz und ging zaudernd fort.
Friedrich kam ihr Benehmen sehr sonderbar vor, denn es war ihm entgangen, dass sie beim Hinausgehen an allen Gliedern zitterte.
Mitternacht war schon vorbei. Friedrich war überwacht und von den verschiedenen Begegnissen viel zu sehr aufgeregt, um schlafen zu können. Er setzte sich ans offene Fenster. Das Wasser rauschte unten über ein Wehr. Der Mond blickte seltsam und unheimlich aus dunklen Wolken, die schnell über den Himmel flogen. Er sang
»Er reitet nachts auf einem braunen Ross,
Er reitet vorüber an manchem Schloss:
Schlaf droben, mein Kind, bis der Tag erscheint,
Die finstre Nacht ist des Menschen Feind!
Er reitet vorüber an einem Teich,
Da stehet ein schönes Mädchen bleich
Und singt, ihr Hemdlein flattert im Wind,
Vorüber, vorüber, mir graut vor dem Kind!
Er reitet vorüber an einem Fluss,
Da ruft ihm der Wassermann seinen Gruß,
Taucht wieder unter dann mit Gesaus,
Und stille wird's über dem kühlen Haus.
Wann Tag und Nacht in verworrenem Streit,
Schon Hähne krähen in Dörfern weit,
Da schauert sein Ross und wühlet hinab,
Scharret ihm schnaubend sein eigenes Grab.«
Er mochte ungefähr eine Stunde so gesessen haben, als der große Hund unten im Hofe ein paar Mal anschlug. Bald darauf kam es ihm vor, als hörte er draußen mehrere Stimmen.
Er horchte hinaus, aber alles war wieder still. Eine Unruhe bemächtigte sich seiner, er stand vom Fenster auf, untersuchte seine geladenen Taschenpistolen und legte seinen Reisesäbel auf den Tisch.
In diesem Augenblicke ging auch die Tür auf, und mehrere wilde Männer traten herein. Sie blieben erschrocken stehen, da sie den Grafen wach fanden. Er erkannte sogleich die fürchterlichen Gesichter aus der Waldschenke und seinen Hauswirt, den langen Müller, mitten unter ihnen.
Dieser fasste sich zuerst und drückte unversehens eine Pistole nach ihm ab. Die Kugel prellte neben seinem Kopfe an die Mauer.
»Falsch gezielt, heimtückischer Hund«, schrie der Graf außer sich vor Zorn und schoss den Kerl durchs Hirn. Darauf ergriff er seinen Säbel, stürzte sich in den Haufen hinein und warf die Räuber rechts und links, mit in die Augen gedrücktem Hute um sich herumhauend, die Stiege hinunter.
Mitten in dem Gemetzel glaubte er das schöne Müllermädchen wiederzusehen. Sie hatte selber ein Schwert in der Hand, mit dem sie sich hochherzig, den Grafen verteidigend, zwischen die Verräter warf.
Unten an der Stiege endlich, da alles, was noch laufen konnte, Reißaus genommen hatte, sank er, von vielen Wunden und Blutverluste ermattet, ohne Bewusstsein nieder.
3. Kapitel
Als Friedrich wieder das erste Mal die Augen aufschlug und mit gesunden Sinnen in der Welt umherschauen konnte, erblickte er sich in einem unbekannten, schönen und reichen Zimmer. Die Morgensonne schien auf die seidenen Vorhänge seines Bettes; sein Kopf war verbunden. Zu den Füßen des Bettes kniete ein schöner Knabe, der den Kopf auf beide Arme an das Bett gelehnt hatte, und schlief.
Friedrich wusste sich in diese Verwandlungen nicht zu finden. Er sann nach, was mit ihm vorgegangen war. Aber nur die fürchterliche Nacht in der Waldmühle mit ihren Mordgesichtern stand lebhaft vor ihm, alles Übrige schien wie ein schwerer Traum.
Verschiedene fremde Gestalten aus dieser letzten Zeit waren ihm wohl dunkel erinnerlich, aber er konnte keine unterscheiden. Nur eine einzige ungewisse Vorstellung blieb ihm lieblich getreu. Es war ihm nämlich immer vorgekommen, als hätte sich ein wunderschönes Engelsbild über ihn geneigt, sodass ihn die langen, reichen Locken rings umgaben, und die Worte, die es sprach, flogen wie Musik über ihn weg.
Da er sich nun recht leicht und neugestärkt spürte, stieg er aus dem Bette und trat ans Fenster. Er sah da, dass er sich in einem großen Schloße befand. Unten lag ein schöner Garten, alles war noch still, nur Vögel flatterten auf den einsamen, kühlen Gängen, der Morgen war überaus heiter.
Der Knabe an dem Bette war indes auch aufgewacht.
»Gott sei Dank!«, rief er aus Herzensgrunde, als er die Augen aufschlug und den Grafen aufgestanden und munter erblickte.
Friedrich glaubte sein Gesicht zu kennen, doch konnte er sich durchaus nicht besinnen, wo er es gesehen hatte.
»Wo bin ich?«, fragte er endlich erstaunt.
»Gott sei Dank!«, wiederholte der Knabe nur, und sah ihn mit seinen großen, fröhlichen Augen noch immer unverwandt an, als könnte er sich gar nicht in die Freude finden, ihn wirklich wieder hergestellt zu sehen.
Friedrich drang nun in ihn, ihm den Zusammenhang dieser ganzen seltsamen Begebenheit zu entwirren.
Der Knabe besann sich einen Augenblick und erzählte dann:
»Gestern Früh, da ich eben in den Wald ging, sah ich dich blutig und ohne Leben am Wege liegen. Das Blut floss über den Kopf, ich verband die Wunde mit meinem Tuche, so gut ich konnte. Aber das Blut drang durch und floss immerfort, und ich versuchte alles vergebens, um es zu stillen.
Ich lief und rief nun inmeiner Angst rings im Walde umher und betete und weinte dann wieder dazwischen, da ich mir gar nicht mehr zu helfen wusste. Da kam auf einmal ein Wagen die Straße gefahren. Eine Dame erblickte uns aus demselben und ließ sogleich stillhalten.
Die Bedienten verbanden die Wunde sehr geschickt. Die Dame schien sehr verwundert und erschrocken über den Umstand. Darauf nahm sie uns beide mit in den Wagen und führte uns hierher auf ihr Schloss. Die Gräfin hat bei nahe die ganze Nacht hindurch hier am Bette gewacht.«
Friedrich dachte an das Engelsbild, das sich wie im Traume über sein Gesicht geneigt hatte, und war noch verwirrter als vorher.
»Aber wer bist denn du?«, fragte er darauf den Knaben wieder.
»Ich habe keine Eltern mehr«, antwortete dieser und schlug verwirrt die Augen nieder, »ich ging eben über Land, umDienste zu suchen.«
Friedrich fasste den Furchtsamen bei beiden Händen. »Willst du bei mir bleiben?«
»Ewig, mein Herr!«, sagte der Knabe mit auffallender Heftigkeit.
Friedrich kleidete sich nun völlig an und verließ seine Stube, um sich hier umzusehen und über sein Verhältnis in diesem Schlosse auf irgendeine Art Gewissheit zu erlangen.
Er erstaunte über das Altfränkische der Bauart und der Einrichtung. Die Gänge waren gewölbt, die Fenster in der dicken, dunklen Mauer alle oben in einem Bogen zugespitzt und mit kleinen runden Scheiben versehen. Wunderschöne Bilder von Glas füllten oben die Fensterbogen, die von der Morgensonne in den buntesten Farben brannten. Alles im ganzen Hause war still.
Er sah zum Fenster hinaus. Das alte Schloss stand von dieser Seite an dem Abhange eines hohen Berges, der, sowie das Tal, unten mit Schwarzwald bedeckt war, aus welchem die Klänge einsamer Holzhauer heraufschallten. Gleich am Fenster, über der schwindelichten Tiefe, war ein Ritter, der sein Schwert in den gefalteten Händen hielt, in Riesengröße, wie der steinerne Roland, in die Mauer gehauen.
Friedrich glaubte jeden Augenblick, das Burgfräulein, den hohen Spitzenkragen um das schöne Gesicht, werde in einem der Gänge heraufkommen. In der sonderbarsten Laune ging er nun die Stiege hinab und über eine Zugbrücke in den Garten hinaus.
Hier standen auf einem weiten Platze die sonderbarsten fremden Blumenarten in fantastischem Schmucke. Künstliche Brunnen sprangen, im Morgenscheine funkelnd, kühle hin und wieder. Dazwischen sah man Pfauen in der Grüne weiden und stolz ihre tausendfarbigen Räder schlagen. Im Hintergrunde saß ein Storch auf einem Beine und sah melancholisch in die weite Gegend hinaus.
Als sich Friedrich an dem Anblicke, den der frische Morgen prächtig machte, so ergötzte, erblickte er in einiger Entfernung vor sich einen Mann, der hinter einem Spaliere an einem Tischchen saß, das voll Papiere lag. Er schrieb, blickte manchmal in die Gegend hinaus und schrieb dann wieder emsig fort. Friedrich wollte ausweichen, um ihn nicht zu stören, aber es war nur der einzige Weg und der Unbekannte hatte ihn auch schon erblickt. Er ging daher auf ihn zu und grüßte ihn.
Der Schreiber mochte eine lange Unterredung befürchten.
»Ich kenne Sie wahrhaftig nicht«, sagte er halb ärgerlich, halb lachend, »aber wenn Sie selbst Alexander der Große wären, so müsst' ich Sie für jetzt nur bitten, mir aus der Sonne zu gehen.«
Friedrich verwunderte sich höflichst über diesen unhöflichen Diogenes und ließ den wunderlichen Gesellen sitzen, der sogleich wieder zu schreiben anfing.
Er kam nun an den Ausgang des Gartens, an den ein lustiges Wäldchen von Laubholz stieß. An dem Saume des Waldes stand ein Jägerhaus, das ringsum mit Hirschgeweihen ausgeziert war. Auf einer kleinen Wiese, welche vor dem Hause mitten zwischen dem Walde lag, saß ein schönes, kaum fünfzehnjähriges Mädchen auf einem, wie es schien, soeben erlegten Rehe, streichelte das Tierchen und sang:
»Wär' ich ein muntres Hirschlein schlank,
Wollt' ich im grünen Walde gehn,
Spazieren gehn bei Hörnerklang,
Nach meinem Liebsten mich umsehn.«
Ein junger Jäger, der seitwärts an einem Baum gelehnt stand und ihren Gesang mit dem Waldhorne begleitete, antwortete ihr sogleich nach derselben Melodie:
»Nach meiner Liebsten mich umsehn,
Tu' ich wohl, zieh' ich früh von hier,
Doch sie mag niemals zu mir gehen
Im dunkelgrünen Waldrevier.«
Sie sang weiter:
»Im dunkelgrünen Waldrevier,
Da blitzt der Liebste rosenrot,
Gefällt so sehr dem armen Tier,
Das Hirschlein wünscht, es läge tot.«
Der Jäger antwortete wieder:
»Und wär' das schöne Hirschlein tot,
So möcht' ich länger jagen nicht;
Scheint übern Wald der Morgen rot:
Hüt', schönes Hirschlein, hüte dich!«
Sie:
»Hüt' schönes Hirschlein, hüte dich!
Spricht's Hirschlein selbst in seinem Sinn,
Wie soll ich, soll ich hüten mich,
Wenn ich so sehr verliebet bin?«
Er:
»Weil ich so sehr verliebet bin,
Wollt' ich das Hirschlein, schön und wild,
Aufsuchen tief im Walde drin
Und streicheln, bis es stille hielt.«
Sie:
»Ja, streicheln, bis es stille hielt,
Falsch locken so in Stall und Haus!
Zum Wald springt's Hirschlein frei und wild
Und lacht verliebte Narren aus.«
Hierbei sprang sie von ihrem Rehe auf, denn Pferde, Hunde, Jäger und Waldhornsklänge stürzten auf einmal mit einem verworrenen Getöse aus dem Walde heraus und verbreiteten sich bunt über die Wiese.
Ein sehr schöner, junger Mann in Jägerkleidung und das Halstuch in einer unordentlichen Schleife herabhängend, schwang sich vom Pferde und eine Menge großer Hunde sprangen von allen Seiten freundlich an ihm herauf.
Friedrich erstaunte beim ersten Blick über die große Ähnlichkeit, die derselbe mit einem älteren Bruder hatte, den er seit seiner Kindheit nicht mehr gesehen, nur dass der Unbekannte hier frischer und freudiger anzusehen war.
Dieser kam sogleich auf ihn zu.
»Es freut mich«, sagte er, »Sie so munter wiederzufinden. Meine Schwester hat Sie unterwegs in einem schlimmen Zustande getroffen und gestern abends zu mir auf mein Schloss gebracht. Sie ist heute noch vor Tagesanbruch wieder fort. Lassen Sie es sich bei uns gefallen, Sie werden lustige Leute finden.«
Während ihm nun Friedrich eben noch für seine Güte dankte, brachte auf einmal der Wind aus dem Garten oben mehrere Blätter Papier, die hoch über ihre Köpfe weg nach einem nahe gelegenen Wasser zuflatteren. Hinterdrein hörte man von oben eine Stimme: »Halt, halt, halt auf!« rufen, und der Mensch, den Friedrich im Garten schreibend angetroffen hatte, kam eilends nachgelaufen.
Leontin, so hieß der junge Graf, dem dieses Schloss gehörte, legte schnell seine Büchse an und schoss das unbändige Papier aus der Luft herab.
»Das ist doch dumm«, sagte der Nachsetzende, der unterdes atemlos angelangt war, da er die Blätter, auf welche Verse geschrieben waren, von den Schroten ganz durchlöchert erblickte. Das schöne Mädchen, das vorher auf der Wiese gesungen hatte, stand hinter ihm und kicherte. Er drehte sich geschwind herum und wollte sie küssen, aber sie entsprang in das Jägerhaus und guckte lachend hinter der halbgeöffneten Türe hervor.
»Das ist der Dichter Faber«, sagte Leontin, dem Grafen den Nachsetzenden vorstellend.
Friedrich erschrak recht über den Namen. Er hatte viel von Faber gelesen; manches hatte ihm gar nicht gefallen, vieles andere aber ihn wieder so ergriffen, dass er oft nicht begreifen konnte, wie derselbe Mensch so etwas Schönes erfinden könne. Und nun, da der wunderbare Mensch leibhaftig vor ihm stand, betrachtete er ihn mit allen Sinnen, als wolle er alle die Gedichte von ihm, die ihm am besten gefallen, in seinem Gesichte ablesen. Aber da war keine Spur davon zu finden.
Friedrich hatte sich ihn ganz anders vorgestellt und hätte viel darum gegeben, wenn es Leontin gewesen wäre, bei dessen lebendigem, erquicklichem Wesen ihm das Herz aufging.
Herr Faber erzählte nun lachend, wie ihn Friedrich in seiner Werkstatt überrascht habe.
»Da sind Sie schön angekommen«, sagte Leontin zu Friedrich, »denn da sitzt Herr Faber wie die Löwin über ihren Jungen, und schlägt grimmig um sich.«
»So sollte jeder Dichter dichten«, meinte Friedrich, »am frühen Morgen, unter freiem Himmel, in einer schönen Gegend. Da ist die Seele rüstig, und so wie dann die Bäume rauschen, die Vögel singen und der Jäger vor Lust in sein Horn stößt, so muss der Dichter dichten.«
»Sie sind ein Naturalist in der Poesie«, entgegnete Faber mit einer etwas zweideutigen Miene.
»Ich wünschte«, fiel ihm Leontin ins Wort, »Sie ritten lieber alle Morgen mit mir auf die Jagd, lieber Faber. Der Morgen glüht Sie wie eine reizende Geliebte an, und Sie klecksen ihr mit Tinte in das schöne Gesicht.«
Faber lachte, zog eine kleine Flöte hervor und fing an, darauf zu blasen. Friedrich fand ihn in diesem Augenblicke sehr liebenswürdig.
Leontin trug dem Grafen an, mit ihm zu seiner Schwester hinüberzureiten, wenn er sich schon stark genug dazu fühle. Friedrich willigte mit Freuden ein, und bald darauf saßen beide zu Pferde.
Die Gegend war sehr heiter. Sie ritten eben über einen weiten grünen Anger. Friedrich fühlte sich bei dem schönen Morgen recht in allen Sinnen genesen und freute sich über den anmutigen Leontin, wie das Pferd unter ihm mit gebogenem Halse über die Ebene hintanzte.
»Meine Schwester«, sagte Leontin unterwegs und sah den Grafen mit verstecktem Lachen immerfort an, »meine Schwester ist viel älter als ich und, ich muss es nur im Voraus sagen, recht hässlich.«
»So!«, sagte Friedrich langsam und gedehnt, denn er hatte heimlich andere Erwartungen und Hoffnungen gehegt. Er schwieg darauf still; Leontin lachte und pfiff ein lustiges Liedchen. Endlich sah man ein schönes, neues Schloss sich aus einem großen Park lustig erheben. Es war das Schloss von Leontins Schwester.
Sie stiegen unten am Eingange des Parks ab und gingen zu Fuße hinauf. Der Garten war ganz im neuesten Geschmacke angelegt. Kleine, sich schlängelnde Gänge, dichte Gebüsche von ausländischen Sträuchern, dazwischen leichte Brücken von weißem Birkenholze lustig geschwungen, waren recht artig anzuschauen.
Zwischen mehreren schlanken Säulen traten sie in das Schloss. Es war ein großes gemaltes Zimmer mit hellglänzendem Fußboden; ein kristallener Lüster hing an der Decke und Ottomanen von reichen Stoffen standen an den Wänden umher. Durch die hohe Glastüre übersah man den Garten.
Niemand, da es noch früh, war in der ganzen Reihe von prachtvollen Gemächern, die sich an dieses anschlossen, zu sehen. Die Morgensonne, die durch die Glastüre schien, erfüllte das schöne Zimmer mit einem geheimnisvollen Helldunkel und beleuchtete eben eine Gitarre, die in der Mitte auf einem Tischchen lag.
Leontin nahm dieselbe und begab sich damit wieder hinaus. Friedrich blieb an der Türe stehen, während Leontin sich draußen unter die Fenster stellte, in die Saiten griff und sang:
»Frühmorgens durch die Winde kühl
Zwei Ritter hergeritten sind,
Im Garten klingt ihr Saitenspiel,
Wach' auf, wach' auf, mein schönes Kind!
Ringsum viel Schlösser schimmernd stehn,
So silbern geht der Ströme Lauf,
Hoch, weit rings Lerchenlieder wehn,
Schließ Fenster, Herz und Äuglein auf!«
Friedrich war gar nicht begierig, die alte Schöne kennenzulernen, und blieb ruhig in der Türe stehen. Da hörte er oben ein Fenster sich öffnen.
»Guten Morgen, lieber Bruder!«, sagte eine liebliche Stimme.
Leontin sang:
»So wie du bist, verschlafen heiß,
Lass allen Putz und Zier zu Haus,
Tritt nur herfür im Hemdlein weiß,
Siehst so gar schön verliebet aus.«
»Wenn du so garstig singst«, sagte oben, die liebliche Stimme, »so leg' ich mich gleich wieder schlafen.«
Friedrich erblickte einen schneeweißen, vollen Arm im Fenster, und Leontin sang wieder:
»Ich hab' einen Fremden wohl bei mir,
Der lauert unten auf der Wacht,
Der bittet schön dich um Quartier,
Verschlafnes Kind, nimm dich in Acht!«
Friedrich trat nun aus seinem Hinterhalte hervor und sah mit Erstaunen – seine Rosa im Fenster. Sie war in einem leichten Nachtkleide und dehnte sich mit aufgehobenen Armen in den frischen Morgen hinaus. Als sie so unverhofft Friedrich erblickte, ließ sie mit einem Schrei die Arme sinken, schlug das Fenster zu und war verschwunden.
Leontin ging nun fort, um ein neues Pferd der Schwester im Hofe herumzutummeln, und Friedrich blieb allein im Garten zurück.
Bald darauf kam die Gräfin Rosa in einem weißen Morgenkleide herab. Sie hieß den Grafen mit einer Scham willkommen, die ihr unwiderstehlich schön stand. Lange, dunkle Locken fielen zu beiden Seiten bis auf die Schultern und den blendendweißen Busen hinab. Die schönste Reihe von Zähnen sah man manchmal zwischen den vollen, roten Lippen hervorschimmern. Sie atmete noch warm von der Nacht; es war die prächtigste Schönheit, die Friedrich jemals gesehen hatte.
Sie gingen nebeneinander in den Garten hinein. Der Morgen blitzte herrlich über die ganze Gegend, aus allen Zweigen jubelten unzählige Vögel.
Sie setzten sich in einer dichten Laube auf eine Rasenbank. Friedrich dankte ihr für ihr hilfreiches Mitleid und sprach dann von seiner schönen Donaureise.
Die Gräfin saß, während er davon erzählte, beschämt und still, hatte die langen Augenwimpern niedergeschlagen, und wagte kaum zu atmen.
Als er endlich auch seiner Wunde erwähnte, schlug sie auf einmal die großen, schönen Augen auf, um die Wunde zu betrachten. Ihre Augen, Locken und Busen kamen ihm dabei so nahe, dass sich ihre Lippen fast berührten. Er küsste sie auf den roten Mund und sie gab ihm den Kuss wieder. Da nahm er sie in beide Arme und küsste sie unzählige Mal, und alle Freuden der Welt verwirrten sich in diesen einen Augenblick, der niemals zum zweiten Male wiederkehrt.
Rosa machte sich endlich los, sprang auf und lief nach dem Schlosse zu. Leontin kam ihr eben von der anderen Seite entgegen, sie rannte in der Verwirrung gerade in seine ausgebreiteten Arme hinein. Er gab ihr schnell einen Kuss und kam zu Friedrich, um mit ihm wieder nach Hause zu reiten.
Als Friedrich wieder draußen im Freien zu Pferde saß, besann er sich erst recht auf sein ganzes Glück. Mit unbeschreiblichem Entzücken betrachtete er Himmel und Erde, die im reichsten Morgenschmucke vor ihm lagen.
Sie ist mein!, rief er immerfort still in sich, sie ist mein!
Leontin wiederholte lachend die Beschreibung von der Hässlichkeit seiner Schwester, die er vorhin beim Herritt dem Grafen gemacht hatte, jagte dann weit voraus, setzte mit bewunderungswürdiger Leichtigkeit und Kühnheit über Zäune und Gräben und trieb allerlei Schwänke.
Als sie bei Leontins Schlosse ankamen, hörten sie schon von ferne ein unbegreifliches, verworrenes Getös. Ein Waldhorn raste in den unbändigsten, falschesten Tönen, dazwischen hörte man eine Stimme, die unaufhörlich fortschimpfte.
»Da hat gewiss wieder Faber was angestellt«, sagte Leontin.
Und es fand sich wirklich so. Herr Faber hatte sich nämlich in ihrer Abwesenheit niedergesetzt, um ein Waldhornecho zu dichten.
Zum Unglück fiel es zu gleicher Zeit einem von Leontins Jägern ein, nicht weit davon wirklich auf dem Waldhorne zu blasen. Faber störte die nahe Musik, er rief daher ungeduldig dem Jäger zu, still zu sein.
Dieser aber, der sich, wie fast alle Leute Leontins, über Herrn Faber von jeher ärgerte, weil er immer mit der Feder hinterm Ohre so erbärmlich aussah, gehorchte nicht.
Da sprang Faber auf und überhäufte ihn mit Schimpfreden.
Der Jäger, um ihn zu übertäuben, schüttelte nun statt aller Antwort einen ganzen Schwall von verworrenen falschen Tönen aus seinem Horne, während Faber, im Gesichte überrot vor Zorn, vor ihm stand und gestikulierte.
Als der Jäger jetzt seinen Herrn erblickte, endigte er seinen Spaß und ging fort.
Faber aber hatte indes, so boshaft er auch aussah, schon längst der Zorn verlassen, denn es waren ihm mitten in der Wut eine Menge witziger Schimpfwörter und komischer Grobheiten in den Sinn gekommen, und er schimpfte tapfer fort, ohne mehr an den Jäger zu denken, und brach endlich in ein lautes Gelächter aus, in das Leontin und Friedrich von Herzen mit einstimmten.
Am Abend saßen Leontin, Friedrich und Faber zusammen an einem Feldtische auf der Wiese am Jägerhause und aßen und tranken. Das Abendrot schaute glühend durch die Wipfel des Tannenwaldes, welcher die Wiese ringsumher einschloss. Der Wein erweiterte ihre Herzen, und sie waren alle drei wie alte Bekannte miteinander.
»Das ist wohl ein rechtes Dichterleben, Herr Faber«, sagte Friedrich vergnügt.
»Immer doch«, hub Faber ziemlich pathetisch an, »höre ich das Leben und Dichten verwechseln.«
»Aber, aber, bester Herr Faber«, fiel ihm Leontin schnell ins Wort, dem jeder ernsthafte Diskurs über Poesie die Kehle zusammenschnürte, weil er selber nie ein Urteil hatte. Er pflegte daher immer mit Witzen, Radottements, dazwischenzufahren und fuhr auch jetzt, geschwind unterbrechend, fort:
»Ihr verwechselt mit Euren Wortwechseleien alles so, dass man am Ende seiner selbst nicht sicher bleibt. Glaubte ich doch einmal in allem Ernste, ich sei die Weltseele und wüsste vor lauter Welt nicht, ob ich eine Seele hatte, oder umgekehrt. Das Leben aber, mein bester Herr Faber, mit seinen bunten Bildern verhält sich zum Dichter, wie ein unübersehbar weitläufiges Hieroglyphenbuch von einer unbekannten, lange untergegangenen Ursprache zum Leser. Da sitzen von Ewigkeit zu Ewigkeit die redlichsten, gutmütigsten Weltnarren, die Dichter, und lesen und lesen. Aber die alten, wunderbaren Worte der Zeichen sind unbekannt, und der Wind weht die Blätter des großen Buches so schnell und verworren durcheinander, dass einem die Augen übergehn.«
Friedrich sah Leontin groß an, es war etwas in seinen Worten, das ihn ernsthaft machte.
Faber aber, dem Leontin zu schnell gesprochen zu haben schien, spann gelassen seinen vorigen Diskurs wieder an:
»Ihr haltet das Dichten für eine gar so leichte Sache, weil es flüchtig aus der Feder fließt, aber keiner bedenkt, wie das Kind, vielleicht vor vielen Jahren schon in Lust empfangen, dann im Mutterleibe mit Freuden und Schmerzen ernährt und gebildet wird, ehe es aus seinem stillen Hause das fröhliche Licht des Tages begrüßt.«
»Das ist ein langweiliges Kind«, unterbrach ihn Leontin munter; »wäre ich so eine schwangere Frau, wie Sie da sagen, da lacht' ich mich gewiss, wie Philine, vor dem Spiegel über mich selber zu Tode, eh' ich mit dem ersten Verse niederkäme.« Hier erblickte er ein Paket Papier, da aus Fabers Rocktasche hervorragte; eines davon war »An die Deutschen« überschrieben. Er bat ihn, es ihnen vorzulesen.
Faber zog es heraus und las es. Das Gedicht enthielt die Herausforderung eines bis zum Tode verwundeten Ritters an alle Feinde der deutschen Ehre.
Leontin sowohl als Friedrich erstaunten über die Gediegenheit und männliche Tiefe der Romanze und fühlten sich wahrhaft erbaut.
»Wer sollte es glauben«, sagte Leontin, »dass Herr Faber diese Romanze zu eben der Zeit verfertigt hat, als er Reißaus nahm, um nicht mit gegen die Franzosen zu Felde ziehn zu dürfen.«
Faber nahm darauf ein anderes Blatt zur Hand und las ihnen ein Gedicht vor, in welchem er sich selber mit höchst komischer Laune in diesem seinem feigherzigen Widerspruche darstellte, worin aber mitten durch die lustigen Scherze ein tiefer Ernst, wie mit großen, frommen Augen, ruhend und ergreifend hindurchschaute.
Friedrich ging jedes Wort dieses Gedichtes schneidend durchs Herz. Jetzt wurde es ihm auf einmal klar, warum ihm so viele Stellungen und Einrichtungen in Fabers Schriften durchaus fremd blieben und missfielen.
»Dem einen ist zu tun, zu schreiben mir gegeben«, sagte Faber, als er ausgelesen hatte. »Poetisch sein und Poet sein«, fuhr er fort, »das sind zwei sehr verschiedene Dinge, man mag dagegen sagen, was man will. Bei dem Letzteren ist, wie selbst unser großer Meister Goethe eingesteht, immer etwas Taschenspielerei, Seiltänzerei usw. mit im Spiele.«
»Das ist nicht so«, sagte Friedrich ernst und sicher, »und wäre es so, so möchte ich niemals dichten. Wie wollt Ihr, dass die Menschen Eure Werke hochachten, sich daran erquicken und erbauen sollen, wenn Ihr Euch selber nicht glaubt, was Ihr schreibt, und durch schöne Worte und künstliche Gedanken Gott und Menschen zu überlisten trachtet? Das ist ein eitles, nichtsnutziges Spiel, und es hilft Euch doch nichts, denn es ist nichts groß, als was aus einem einfältigen Herzen kommt. Das heißt recht, dem Teufel der Gemeinheit, der immer in der Menge wach und auf der Lauer ist, den Dolch selbst in die Hand geben gegen die göttliche Poesie.
Wo soll die rechte, schlichte Sitte, das treue Tun, das schöne Lieben, die deutsche Ehre und alle die alte herrliche Schönheit sich hinflüchten, wenn es ihre angebornen Ritter, die Dichter, nicht wahrhaft ehrlich, aufrichtig und ritterlich mit ihr meinen? Bis in den Tod verhasst sind mir besonders jene ewigen Klagen, die mit weinerlichen Sonetten die alte schöne Zeit zurückwinseln wollen und, wie ein Strohfeuer, weder die Schlechten verbrennen, noch die Guten erleuchten und erwärmen.
Denn wie wenigen möchte doch das Herz zerspringen, wenn alles so dumm geht, und habe ich nicht den Mut, besser zu sein als meine Zeit, so mag ich zerknirscht das Schimpfen lassen, denn keine Zeit ist durchaus schlecht. Die heiligen Märtyrer, wie sie, laut ihren Erlöser bekennend, mit aufgehobenen Armen in die Todesflammen sprangen – das sind des Dichters echte Brüder, und er soll ebenso fürstlich denken von sich; denn so wie sie den ewigen Geist Gottes auf Erden durch Taten ausdrückten, so soll er ihn aufrichtig in einer verwitterten, feindseligen Zeit durch rechte Worte und göttliche Erfindungen verkünden und verherrlichen.
Die Menge, nur auf weltliche Dinge erpicht, zerstreut und träge, sitzt gebückt und blind draußen im warmen Sonnenscheine und langt rührend nach dem ewigen Lichte, das sie niemals erblickt. Der Dichter hat einsam die schönen Augen offen; mit Demut und Freudigkeit betrachtet er, selbst erstaunt, Himmel und Erde, und das Herz geht ihm auf bei der überschwänglichen Aussicht, und so besiegt er die Welt, die, wie Memnons Bild, voll stummer Bedeutung, nur dann durch und durch erklingt, wenn sie die Aurora eines dichterischen Gemütes mit ihren verwandten Strahlen berührt.« Leontin fiel hier dem Grafen freudig um den Hals.
»Schön, besonders zuletzt sehr schön gesagt«, sagte Faber, und drückte ihm herzlich die Hand.
Sie meinen es doch alle beide nicht so wie ich, fühlte und dachte Friedrich betrübt.
Es war unterdes schon dunkel geworden und der Abendstern funkelte vom heiteren Himmel über den Wald herüber. Da wurde ihr Gespräch auf eine lustige Art unterbrochen. Die kleine Marie nämlich, die am Morgen mit dem Jäger auf der Wiese gesungen, hatte sich als Jägerbursche angezogen. Die Jäger jagten sie auf der Wiese herum, sie ließ sich aber nicht erhaschen, weil sie, wie sie sagte, nach Tabaksrauch röchen. Wie ein gescheuchtes Reh kam sie endlich an dem Tische vorüber.
Leontin fing sie auf und setzte sie vor sich auf seinen Schoß. Er strich ihr die Haare aus den munteren Augen und gab ihr aus seinem Glase zu trinken. Sie trank viel und wurde bald ungewöhnlich beredt, dass sich alle über ihre liebenswürdige Lebhaftigkeit erfreuten.
Leontin fing an, von ihrer Schlafkammer zu sprechen und andere leichtfertige Reden vorzubringen, und als er sie endlich auch küsste, umklammerte sie mit beiden Armen seinen Hals.
Friedrich schmerzte das ganze lose Spiel, so sehr es auch Faber gefiel, und er sprach laut vom Verführen.
Marie hüpfte von Leontins Schoß, wünschte allen mit verschmitzten Augen eine gute Nacht und sprang fort ins Jägerhaus.
Leontin reichte Friedrich lächelnd die Hand und alle drei schieden voneinander, um sich zur Ruhe zu begeben.
Faber sagte im Weggehen, seine Seele sei heute so wach, dass er noch tief in die Nacht hinein an einem angefangenen großen Gedichte fortarbeiten wolle.
Als Friedrich in sein Schlafzimmer kam, stellte er sich noch eine Weile ans offene Fenster. Von der anderen Seite des Schlosses schimmerte aus Fabers Zimmer ein einsames Licht in die stille Gegend hinaus. Fabers Fleiß rührte den Grafen, und er kam ihm in diesem Augenblicke wie ein höheres Wesen vor.
»Es ist wohl groß«, sagte er, »so mit göttlichen Gedanken über dem weiten, stillen Kreis der Erde zu schweben. Wache, sinne und bilde nur fleißig fort, fröhliche Seele, wenn alle die anderen Menschen schlafen! Gott ist mit dir in deiner Einsamkeit und Er weiß es allein, was ein Dichter treulich will, wenn auch kein Mensch sich um dich kümmert.«
Der Mond stand eben über dem altertümlichen Turme des Schlosses, unten lag der schwarze Waldgrund in stummer Ruhe. Die Fenster gingen nach der Gegend hinaus, wo die Gräfin Rosa hinter dem Walde wohnte. Friedrich hatte Leontins Gitarre mit hinaufgenommen. Er nahm sie in den Arm und sang:
»Die Welt ruht still im Hafen,
Mein Liebchen, gute Nacht!
Wann Wald und Berge schlafen,
Treu' Liebe einsam wacht.
Ich bin so wach und lustig,
Die Seele ist so licht,
Und eh' ich liebt', da wusst' ich
Von solcher Freude nicht.
Ich fühl' mich so befreiet
Von eitlem Trieb und Streit,
Nichts mehr das Herz zerstreuet
In seiner Fröhlichkeit.
Mir ist, als müsst' ich singen
So recht aus tiefster Lust
Von wunderbaren Dingen,
Was niemand sonst bewusst.
O könnt' ich alles sagen!
O wär' ich recht geschickt!
So muss ich still ertragen,
Was mich so hoch beglückt.«
4. Kapitel
Friedrich gab Leontins Bitten, noch länger auf seinem Schlosse zu verweilen, gern nach. Leontin hatte nach seiner raschen, fröhlichen Art bald eine wahre Freundschaft zu ihm gefasst, und sie verabredeten miteinander, einen Streifzug durch das nahe Gebirge zu machen, das manches Sehenswerte enthielt.
Die Ausführung dieses Planes blieb indes von Tage zu Tage verschoben. Bald war das Wetter zu neblicht, bald waren die Pferde nicht zu entbehren oder sonst etwas Notwendiges zu verrichten, und sie mussten sich am Ende selber eingestehen, dass es ihnen beiden eigentlich schwer fiel, sich auch nur auf wenige Tage von ihrer hiesigen Nachbarschaft zu trennen.
Leontin hatte hier seine eigenen Geheimnisse. Er ritt oft ganz abgelegene Wege in den Wald hinein, wo er nicht selten halbe Tage lang ausblieb. Niemand wusste, was er dort vorhabe, und er selber sprach nie davon.
Friedrich dagegen besuchte Rosa fast täglich. Drüben in ihrem schönen Garten hatte die Liebe ihr tausendfarbiges Zelt aufgeschlagen, ihre wunderreichen Fernen ausgespannt, ihre Regenbogen und goldenen Brücken durch die blaue Luft geschwungen, und rings die Berge und Wälder wie einen Zauberkreis um ihr morgenrotes Reich gezogen. Er war unaussprechlich glücklich.
Leontin begleitete ihn sehr selten, weil ihm, wie er immer zu sagen pflegte, seine Schwester wie ein gemalter Frühling vorkäme. Friedrich glaubte von jeher bemerkt zu haben, dass Leontin bei aller seiner Lebhaftigkeit doch eigentlich kalt sei, und dachte dabei: Was hilft dir der schönste gemalte oder natürliche Frühling! Aus dir selber muss doch die Sonne das Bild bescheinen, um es zu beleben.
Zu Hause, auf Leontins Schlosse, wurde Friedrichs poetischer Rausch durch nichts gestört; denn was hier Faber Herrliches ersann und fleißig aufschrieb, suchte Leontin auf seine freie, wunderliche Weise ins Leben einzuführen. Seine Leute mochten alle fortleben, wie es ihnen ihr frischer, guter Sinn eingab; das Waldhorn irrte fast Tag und Nacht in dem Walde hin und her, dazwischen spukte die eben erwachende Sinnlichkeit der kleinen Marie wie ein reizender Kobold, und so machte dieser seltsame, bunte Haushalt diesen ganzen Aufenthalt zu einer wahren Feenburg.
Mitten in dem schönen Feste blieb nur ein einziges Wesen einsam und anteillos. Das war Erwin, der schöne Knabe, der mit Friedrich auf das Schloss gekommen war.
Er war allen unbegreiflich. Sein einziges Ziel und Augenmerk schien es, seinen Herrn, den Grafen Friedrich, zu bedienen, welches er bis zur geringsten Kleinigkeit aufmerksam, emsig und gewissenhaft tat. Sonst mischte er sich in keine Geschäfte oder Lust der anderen, erschien zerstreut, immer fremd, verschlossen und fast hart, so lieblich weich auch seine helle Stimme klang.
Nur manchmal, bei Veranlassungen, die oft allen gleichgültig waren, sprach er auf einmal viel und bewegt, und jedem fiel dann sein schönes, seelenvolles Gesicht auf.
Unter seine Seltsamkeiten gehörte auch, dass er niemals zu bewegen war, eine Nacht in der Stube zuzubringen. Wenn alles im Schlosse schlief und draußen die Sterne am Himmel prangten, ging er vielmehr mit der Gitarre aus, setzte sich gewöhnlich auf die alte Schlossmauer über dem Waldgrunde und übte sich dort heimlich auf dem Instrumente.
Wie oft, wenn Friedrich manchmal in der Nacht erwachte, brachte der Wind einzelne Töne seines Gesanges über den stillen Hof zu ihm herüber, oder er fand ihn frühmorgens auf der Mauer über der Gitarre eingeschlafen. Leontin nannte den Knaben eine wunderbare Laute aus alter Zeit, die jetzt niemand mehr zu spielen verstehe.
Eines Abends, da Leontin wieder auf einem seiner geheimnisvollen Ausflüge ungewöhnlich lange ausblieb, saßen Friedrich und Faber, der sich nach geschehener Tagesarbeit einen fröhlichen Feierabend nicht nehmen ließ, auf der Wiese um den runden Tisch. Der Mond stand schon über dem dunklen Turme des Schlosses.
Da hörten sie plötzlich ein Geräusch durch das Dickicht brechen und Leontin stürzte auf seinem Pferde, wie ein gejagtes Wild, aus dem Walde hervor. Totenbleich, atemlos und hin und wieder von den Ästen blutig gerissen, kam er sogleich zu ihnen an den Tisch und trank hastig mehrere Gläser Wein nacheinander aus.
Friedrich erschütterte die schöne, wüste Gestalt. Leontin lachte laut auf, da er bemerkte, dass ihn alle so verwundert ansahen. Faber drang neugierig in ihn, ihnen zu erzählen, was ihm begegnet sei. Er erzählte aber nichts, sondern sagte statt aller Antworten:
»Ich reise fort ins Gebirge, wollt Ihr mit?«
Faber sagte überrascht und unentschlossen, dass ihm jetzt jede Störung unwillkommen sei, da er soeben an dem angefangenen großen Gedichte arbeite, schlug aber endlich ein.
Friedrich schwieg still. Leontin, der ihm wohl ansah, was er meine, entband ihn seines alten Versprechens, ihn zu begleiten; er musste ihm aber dagegen geloben, ihn auf seinem Schlosse zu erwarten.
Sie blieben nun noch einige Zeit beieinander. Aber Leontin blieb nachdenklich und still. Seine beiden Gäste begaben sich daher bald zur Ruhe, ohne zu wissen, was sie von seiner Veränderung und raschem Entschlusse denken sollten. Noch im Weggehn hörten sie ihn singen:
»Hinaus, o Mensch, weit in die Welt,
Bangt dir das Herz in krankem Mut!
Nichts ist so trüb in Nacht gestellt,
Der Morgen leicht macht's wieder gut.«
Am Morgen frühzeitig blickte Friedrich aus seinem Fenster. Da sah er Leontin schon unten auf der Waldstraße auf das Schloss seiner Schwester zureiten. Er eilte schnell hinab und ritt ihm nach.