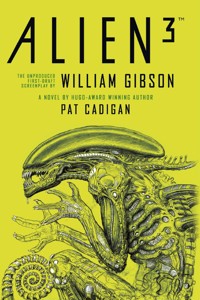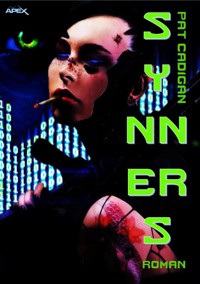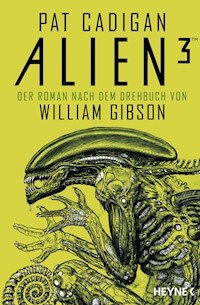
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Mit knapper Not sind Ripley, Newt, der Androide Bishop und der schwer verletzte Corporal Hicks den Xenomorphen entkommen. Auf dem Rückweg vom Planeten LV-426 docken sie mit der Sulaco an der Raumstation Anchorpoint an, in Sicherheit sind sie deshalb aber noch lange nicht. Kaum haben die Marines die Sulaco betreten, um sie zu inspizieren, werden sie angegriffen. In höchster Bedrängnis können sich die Soldaten mit den Neuankömmlingen nach Anchorpoint zurückziehen. Doch dann kommen Gerüchte über eigenartige Experimente auf, die auf der Raumstation durchgeführt werden. Experimente, die ein Geschöpf hervorbringen könnten, das schrecklicher ist als alles, dem sich Ripley, Newt, Bishop und Hicks je entgegenstellen mussten ...
Jetzt schon ein einzigartiges Werk der Science-Fiction – Hugo-Award-Preisträgerin Pat Cadigan hat aus dem nie verfilmten Drehbuch von William Gibson einen bis zur letzten Zeile fesselnden Roman gemacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Mit knapper Not sind Ripley, Newt, der Androide Bishop und der schwer verletzte Corporal Hicks den Xenomorphen entkommen. Auf dem Rückweg vom Planeten LV-426 docken sie mit der Sulaco an der Raumstation Anchorpoint an, in Sicherheit sind sie deshalb aber noch lange nicht. Kaum haben die Marines die Sulaco betreten, um sie zu inspizieren, werden sie angegriffen. In höchster Bedrängnis können sich die Soldaten mit den Neuankömmlingen nach Anchorpoint zurückziehen. Doch dann kommen Gerüchte über eigenartige Experimente auf, die auf der Raumstation durchgeführt werden. Experimente, die ein Geschöpf hervorbringen könnten, das schrecklicher ist als alles, dem sich Ripley, Newt, Bishop und Hicks je entgegenstellen mussten …
Jetzt schon ein einzigartiges Werk der Science-Fiction – Hugo-Award-Preisträgerin Pat Cadigan hat aus dem nie verfilmten Drehbuch von William Gibson einen bis zur letzten Zeile fesselnden Roman gemacht.
Die Autorin
Pat Cadigan, geboren 1953, ist Science-Fiction-Autorin und wurde für ihr Werk bereits dreimal mit dem Locus Award, zweimal mit dem Arthur C. Clarke Award und einmal mit dem Hugo Award ausgezeichnet. Sie hat über zwanzig Bücher geschrieben, und mit Alien 3 hat sie nun aus William Gibsons legendärem Drehbuch einen Roman gemacht. Pat Cadigan lebt mit ihrem Ehemann und ihrer Katze in London.
Mehr über Pat Cadigan und ihre Romane erfahren Sie auf:
PATCADIGAN
ALIEN 3
Roman
Nach einem Drehbuch von William Gibson
Aus dem Englischen von Kristof Kurz und Stefanie Adam
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe:
ALIEN 3: THEUNPRODUCEDSCREENPLAYBYWILLIAMGIBSON
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Deutsche Erstausgabe 02/2023
Copyright © 2021 by Twentieth Century Studios
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe
und der Übersetzung by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Joern Rauser
Umschlagillustration: Mike Worrall,
Copyright © 2022 by Twentieth Century Studios
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-29586-8V001
diezukunft.de
Für William Gibson, einen wahren Freund und brillanten Geist, und für den Rest der Spiegelschatten-Truppe (aufgeführt in der Reihenfolge ihres Erscheinens im Inhaltsverzeichnis von Spiegelschatten):
Bruce Sterling, Tom Maddox, Rudy Rucker, Marc Laidlaw, James Patrick Kelly, Greg Bear, Lewis Shiner, John Shirley, Paul DiFilippo
(Für alle, die danach suchen: Den Namen der einzigen beteiligten Frau finden Sie auf dem Cover des Buches, das Sie gerade in der Hand halten.)
Und wie alle meine Werke widme ich auch dieses natürlich dem einzigartigen und jederzeit charmanten Chris Fowler.
1
HOMOSAPIENSHATTEGANZE dreihunderttausend Jahre damit verbracht, zu den Sternen aufzublicken, bevor er endlich von seinem Heimatplaneten zu den zahllosen Lichtpunkten am Himmel aufgebrochen war. Von da an hatte es allerdings nicht annähernd so lange gedauert, bis interstellare Raumreisen so normal wurden, wie es die tägliche Fahrt zur Arbeit für die vorhergehenden Generationen gewesen war.
Die Menschheit machte viele Veränderungen durch, verhielt sich in mancher Hinsicht aber genau so, wie sie es schon immer getan hatte: neugierig, beständig miteinander konkurrierend, in ihrem Territorialverhalten feindselig und unverbesserlich. Dann traf sie auf anderes intelligentes Leben und wurde von der Tatsache, dass sie als Zivilisation die Raumreise noch nicht lange beherrschte, unangenehm überrascht. Sie hatte eine Menge zu lernen – vor allem, was Entfernungen anging.
Auf ihrem eigenen Planeten maßen die Menschen räumliche Abstände in Meilen oder Kilometern. Im All waren die Entfernungen aber so groß, dass auf der Geschwindigkeit des Lichts basierende Größeneinheiten – von Lichtsekunde bis Lichtjahr – verwendet werden mussten. Herkömmliche Organisationsformen, die die Entwicklung der menschlichen Zivilisation bisher begleitet hatten, verloren angesichts derartiger Dimensionen an Bedeutung.
Eine große Herausforderung für die Menschheit bestand auch darin, neue Formen der Konfliktlösung zu finden. Die meisten planetengebundenen menschlichen Gesellschaften funktionierten zwar weiterhin nach dem altbekannten Schema Krieg, Frieden, Krieg, Frieden und dazwischen ein bisschen Diplomatie und politische Winkelzüge.
Im Weltraum aber ließ sich kein herkömmlicher Krieg führen. Dass keine Regierung es sich leisten konnte und wollte, eine Kriegsflotte loszuschicken, lag einerseits daran, dass der Krieg oftmals längst vorbei war, wenn die Streitkräfte der gegnerischen Parteien aufeinandertrafen, andererseits waren Raumreisen zwar einfacher geworden, aber nicht unbedingt günstiger.
Darüber hinaus war es aber auch nicht nötig, sich in der unendlichen Weite des Alls irgendwelche Territorien streitig zu machen. Selbst in jenem abgelegenen Teil der Milchstraße, in dem sich die Erde befand, gab es unbesiedelte Welten im Überfluss, von denen die Menschen Besitz ergreifen konnten. Viele dieser Planeten mussten zwar erst mittels Terraforming bewohnbar gemacht werden, aber an der dafür notwendigen Technologie oder Freiwilligen für die neuen Kolonien herrschte kein Mangel – meist waren es Abenteurer oder Menschen, die in einer neuen Welt noch einmal von vorn anfangen wollten.
Die Kolonisten von LV-426 waren allesamt Pioniere – Landentwickler, deren Aufgabe darin bestand, aus einem bestimmten Stück Fels im All einen etwas weniger lebensfeindlichen Ort zu machen. LV-426 war ein Planetoid in einer stabilen Umlaufbahn um einen ebenso stabilen Stern. Sein Reichtum an Bodenschätzen ließ ihn für die Geldgeber des Besiedelungsprojekts äußerst attraktiv erscheinen. Das waren die American Extrasolar Colonization Administration und die Weyland-Yutani Corporation, die sehr zuversichtlich waren, dass diese Investition jeden Penny wert war. Bei Weyland-Yutani war man sogar so hoffnungsvoll, dass man die Kolonie zu Ehren von Curtis Hadley, ihres ersten Kolonieverwalters, Hadley’s Hope nannte.
Neben Landentwicklern und Planetentechnikern befanden sich unter den hundertfünfzig Bewohnern von Hadley’s Hope auch Wissenschaftler, Ingenieure, Geologen sowie einfache Arbeiter samt ihren Familien, aber auch medizinisches Personal, Ernährungswissenschaftler, Lehrer und andere Hilfskräfte. Alle arbeiteten ununterbrochen, und so gelang es ihnen, in weniger als vierzig Jahren eine atembare Atmosphäre zu schaffen und damit den bisherigen Rekord von neunundfünfzig Jahren zu brechen. Von nun an galt Hadley’s Hope als Paradebeispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen einer staatlichen Institution und einem Privatunternehmen und war der ganze Stolz beider Organisationen.
Und dann erschien wie aus dem Nichts diese schreckliche Frau. Sie hatte siebenundvierzig Jahre im Kälteschlaf verbracht und behauptete, dass es auf LV-426 Monster gäbe. Sie war Dritte Offizierin an Bord des Frachters Nostromo gewesen, wo ihr zufolge eine grauenhafte Kreatur ihre Crewmitglieder getötet hatte. Daraufhin war sie als einzige Überlebende gezwungen gewesen, das Schiff zu verlassen und in die Luft zu jagen. Nur die Schiffskatze hatte sie retten können.
Ihre gesamte Crew war getötet worden, aber ausgerechnet die Katze hatte sie gerettet? Na klar, das konnte doch jedem mal passieren …
Schnell war offensichtlich, dass diese verrückte Katzentante für Ärger sorgen würde – und es schien fast so, als hätte sie einen Fluch mitgebracht, denn kurz nach ihrem Auftauchen verlor Weyland-Yutani den Kontakt zu den Kolonisten. Man schickte ein paar Marines auf eine Rettungsmission und die verrückte Katzentante gleich mit – und damit war die Sache erledigt. Die Geschichte verschwand aus den Medien und geriet in Vergessenheit. Man ging davon aus, dass sich die Colonial Marines wie immer erfolgreich darum gekümmert hatten.
Vier Jahre später empfing der Grenzschutz der Union Fortschrittlicher Völker ein Warnsignal. Ein Raumschiff hielt auf die Grenze zu. Wenn es seinen Kurs beibehielt, würde es in das Gebiet der UFV eindringen – und damit ein Abkommen verletzen, das die prinzipienlosen Kapitalisten geschworen hatten, immer und unter allen Umständen einzuhalten.
Sich nicht an Abmachungen zu halten war für die Kapitalisten typisch. Die UFV war lediglich erstaunt darüber, dass es überhaupt so lange gedauert hatte.
Die Sulaco war mit zwölf Colonial Marines, dem ihnen zugeteilten Syntheten sowie zwei Zivilisten – einem Repräsentanten des Weyland-Yutani-Konzerns und der verrückten Katzentante – nach LV-426 aufgebrochen. Als das Schiff vier Jahre später wieder auftauchte, befanden sich in seinen Schlafkapseln nur noch vier Passagiere: ein Marine, die mittlerweile in Vergessenheit geratene verrückte Katzentante, ein neunjähriges Mädchen – die einzige überlebende Bewohnerin der Hadley’s-Hope-Kolonie – und der Synthet, beziehungsweise das, was von ihm noch übrig war.
Ein Mensch hätte derart schlimme Verletzungen nicht überlebt, und auch die meisten Syntheten nicht. In diesem Fall handelte es sich aber um ein ausgesprochen robustes Modell, eine Spezialanfertigung für besonders schwierige Einsätze, die mit allen möglichen Werkzeugen – und Waffen – umgehen konnte.
Leider hatten ihm all diese Fähigkeiten gegen eine wütende Xenomorphen-Königin ebenso wenig genutzt wie den Marines ihr ganzes Können, ihre Ausbildung und ihre Waffen.
Und das Schlimmste daran war: Es war noch nicht vorbei.
2
SCHONBEVORDIEKONDENSATION das Sichtfenster der Schlafkapsel milchig weiß färbte, hatte Bishop durch den trüben Plastikkokon, in den Ripley ihn gesteckt hatte, nicht viel sehen können. Nur ein paar undeutliche Schemen, und als das Licht schwächer wurde, verschwanden auch diese fast vollständig. Die Umrisse des Dings, das aus der Unterseite seines an der Hüfte auseinandergerissenen Körpers herauswuchs, waren kaum noch zu erkennen, aber das war auch nicht nötig. Er wusste genau, um was es sich handelte. Viel interessanter war die Frage, wie es dort hingekommen sein mochte.
Dass es dort war, widersprach allem, was sie mittlerweile über die Xenomorphen in Erfahrung gebracht hatten. Anscheinend gab es noch eine Menge, was sie über diese grauenhaften Kreaturen nicht wussten. Sie mussten von einer äußerst intelligenten und hoch entwickelten Spezies erschaffen worden sein. Von einer Spezies, die selbst noch viel gefährlicher war als ihre Kreaturen.
Bishop zweifelte keinen Moment daran, dass es sich bei den Xenomorphen um künstlich erschaffene Kreaturen handelte. Die Menschheit hatte bereits viele außerirdische Lebensformen in ihrem jeweiligen fremdartigen Lebensraum entdeckt. Die Natur war auf jedem Planeten grausam und gnadenlos und brachte dementsprechend furchterregende Wesen hervor. Dennoch wohnte ihr eine Ordnung inne, in der auch das gefährlichste Raubtier seinen Platz hatte. Das Verhalten dieser Kreaturen dagegen passte in keine ihm bekannte natürliche Ordnung.
So bildeten die Xenomorphen keine Reviere, dieses Konzept schien ihnen völlig unbekannt zu sein. Sie spürten veränderte Umweltbedingungen, schienen sich abgesehen davon jedoch nicht dafür zu interessieren, wo sie sich gerade befanden. Es spielte auch keine Rolle, denn sie machten jeden Ort umgehend zu ihrem Jagdrevier.
Bishop notierte diesen Gedanken im Geiste, um sich später noch einmal tiefergehend damit zu beschäftigen – auch wenn er sich nicht sicher war, ob es überhaupt ein »später« für ihn geben würde. Die Sulaco befand sich derart weitab von ihrem Kurs, dass man ihn höchstwahrscheinlich nicht finden würde, bevor das, was da aus seinen Eingeweiden wuchs, sich den neuen Bedingungen angepasst und auch noch seinen restlichen Körper verschlungen hatte. Keine andere ihm bekannte Lebensform verfügte über eine ähnliche Fähigkeit, ihre Biologie schnell und umfassend an neue Bedingungen anzupassen – oder über einen auch nur annähernd vergleichbar ausgeprägten Tötungstrieb.
Soweit Bishop es beurteilen konnte, war das Töten tatsächlich der einzige Existenzgrund dieser Spezies. Derart einfach gestrickt war bisher keine Lebensform gewesen, der die Menschen begegnet waren, zumindest keine, die größer war als ein Virus. Diese Einfachheit war allerdings trügerisch, da die Menschen dazu neigten, »einfach« mit »dumm« zu verwechseln – was dazu geführt hatte, dass sie diese Spezies unter- und ihre Chancen im Kampf gegen sie überschätzt hatten. Obendrein lagen nur wenige Informationen über diese Kreaturen vor, denn kaum ein Mensch hatte die Begegnung mit ihnen lange genug überlebt, um detaillierte Aufzeichnungen zu machen. Und auch die wenigen Überlebenden hatten keinen anderen Rat beisteuern können, als diese Monster möglichst großflächig mit Nuklearwaffen zu bombardieren.
Die Aliens zeichneten sich aber keineswegs ausschließlich durch Einfachheit aus – vielmehr verkörperten sie konzeptionelle Reinheit.
Plötzlich war ein Alarmsignal zu hören. Durch die Schlafkapsel drang es leicht gedämpft zu ihm, blieb aber dennoch dissonant und unangenehm. Offenbar gab es ein weiteres Problem, aber Bishop hatte keine Möglichkeit festzustellen, ob es sich einfach nur um ein paar fehlerhafte Sensoren auf dem Frachtdeck oder um eine Instabilität der Schiffshülle handelte, weil sie bei ihrer Inspektion vor dem Kälteschlaf einen Schaden übersehen hatten. Oder besser gesagt: noch einen Schaden, dachte er. Der unwillkommene Besuch in seiner Schlafkapsel ließ darauf schließen, dass sie wohl eine ganze Menge übersehen hatten.
Plötzlich erwachte die Konsole neben seiner Schlafkapselreihe zum Leben. Eine Nachricht, die langsam von unten nach oben über den Monitor scrollte, wurde gleichzeitig in das Ereignisprotokoll von Bishops neuronalem Netz übertragen:
TRUPPENTRANSPORTER SULACO
CMC 846A/BETA
STATUS: ROT
VERLETZUNG DES GRENZSICHERHEITSABKOMMENS
REF # 99A655865
URSACHE: NAVIGATIONSFEHLER
Der Alarm verstummte abrupt, und die ausdruckslose weibliche Stimme des internen Sicherheitssystems hallte durch das leere Schiff.
»Achtung, an alle Besatzungsmitglieder: Aufgrund eines Navigationsfehlers befindet sich die Sulaco im Hoheitsgebiet der Union Fortschrittlicher Völker. Die Hilfssysteme sind online, eine Kurskorrektur wurde bereits vorgenommen. Der Einsatz von Nuklearwaffen ist ohne Autorisierung durch das diplomatische Korps nicht möglich. Ich wiederhole: nicht möglich. Auf dem gegenwärtigen, korrigierten Kurs wird die Sulaco den UFV-Sektor um 19.58 Uhr wieder verlassen.«
Ein Navigationsfehler war zwar keine gute Nachricht, einem strukturellen Versagen der Schiffshülle aber allemal vorzuziehen. Bishop bereitete es weit größere Sorge, dass es überhaupt eine Durchsage gegeben hatte, obwohl sich alle Mitglieder der Crew im Kälteschlaf befanden. Das war nicht vorgesehen. Dabei konnte es sich um eine weitere Funktionsstörung handeln. Aber egal, was es sein mochte: Ein Unglück kam selten allein. Und das galt ganz besonders für Funktionsstörungen. Oder aber jemand war wach und bewegte sich durch das Schiff. Jemand – oder etwas.
Bishop wusste, dass es keiner der drei Menschen sein konnte. Eine Fehlfunktion der Kapsel hätte ein anderes Warnsignal ausgelöst und sie aufgeweckt, und dann hätten sie ihn ganz gewiss nicht einfach hier liegen lassen. Also musste es sich um einen weiteren Xenomorphen handeln. Trotz ihrer Größe und ihrer Mordlust konnten sie sich erstaunlich gut verbergen.
Die Königin auf LV-426 hatte sich im Fahrwerk des Landeshuttles der Sulaco versteckt, ohne einen Alarm auszulösen. Sie hatten sie erst bemerkt, als sie Bishop mit ihrem Schwanz durchbohrt und wie ein Blatt Papier in zwei Teile gerissen hatte. Sie waren davon ausgegangen, dass die Königin allein gewesen war – im Rückblick betrachtet war das ein ebenso törichter Fehler, wie zu glauben, dass alles vorbei war, nachdem Ripley sie aus der Luftschleuse befördert hatte. Doch in diesem Augenblick hatten sie sich ausschließlich auf Corporal Hicks konzentriert, der aufgrund von Verätzungen durch das Säureblut der Xenomorphen unter starken Schmerzen gelitten hatte. Ripley hatte ihn gerade noch über den Stand der Dinge informieren können, bevor er das Bewusstsein verloren hatte.
Newt in die Schlafkapsel zu befördern war um einiges schwieriger gewesen. Als Ripley ihr gesagt hatte, dass sie nun keine Angst mehr davor haben musste zu träumen, hatte das Mädchen sie mit einer Mischung aus Hoffnung und Zweifel angesehen. Sie hätte Ripley gern geglaubt, doch es war ihr einfach nicht gelungen.
Anschließend hatte Ripley Bishop so vorsichtig wie möglich in den Plastikkokon eingewickelt und in die Kapsel gelegt – auch wenn er ihr wiederholt versichert hatte, dass sie ihm gar nicht wehtun konnte. Wie alle Syntheten war er zwar in der Lage, Schmerzen wahrzunehmen – wie bei den Menschen dienten ihm diese als Warnsignal –, aber es war nicht dieselbe Art von Empfindung. Schmerzen mochten für ihn zwar nicht angenehm sein, hatten aber sonst keine psychischen oder physischen Auswirkungen. Er konnte den Schmerz dämpfen, bis er ihn nur noch als Hintergrundrauschen wahrnahm, und so weiterhin einsatzfähig bleiben.
Von einem wütenden Alien in Stücke gerissen zu werden hatte die Parameter seiner Empfindungsfähigkeit allerdings weit überstiegen und sein Schmerzzentrum überlastet, woraufhin es sich abgeschaltet hatte. Sein Körper nutzte die letzten noch verbliebenen Reserven stattdessen für möglichst kohärente Denkprozesse. Er war darauf programmiert, trotz allem weiter zu funktionieren und seinen Auftrag zu erfüllen – gesetzt den Fall, dass ihm nicht vorher der Strom ausging.
Ripley schien das nicht zu verstehen, vermutlich war sie einfach nicht mit künstlichen, für schwierige Spezialeinsätze konstruierten Personen vertraut. Aber vielleicht hatte sie ihm so auch nur demonstrieren wollen, dass sie ihm die Tatsache, dass er ein Synthet war, verziehen hatte.
Leider war er körperlich nicht dazu in der Lage gewesen, sie in den Kälteschlaf zu versetzen. Dabei stand sie derart unter Schock, dass sie Hilfe viel nötiger gehabt hätte als er. Andererseits: Hätte er sie in die Kapsel gelegt, wäre sie nun womöglich diejenige gewesen, in deren Körper etwas heranwuchs. Aber vielleicht war das sowieso der Fall – vielleicht war das sogar bei allen drei Menschen der Fall. Er hatte keine Möglichkeit, es herauszufinden.
Das Einzige, was er mit Sicherheit wusste, war: Ein Unglück kam selten allein.
Sein Blick trübte sich, als sein Körper in den Stand-by-Modus schaltete, um die letzten Energiereserven zu schonen. Als Letztes bemerkte er noch, dass der Kondensationsfilm an der Kapselinnenseite immer dichter wurde.
3
INRODINA – der interstellaren Hauptstadt der Union Fortschrittlicher Völker – beobachteten die Grenzschützer bereits seit vier Schichten das immer näher herantreibende Raumschiff. Sie schlossen Wetten darüber ab, ob der Pilot beidrehen oder es tatsächlich wagen würde, widerrechtlich in UFV-Territorium einzudringen.
Im ersteren Fall war es natürlich möglich, dass zum Beispiel die Lebenserhaltungssysteme ausgefallen waren und der Sauerstoff knapp wurde. Wenn die Besatzung ein Notsignal absetzte, würde man sie selbstverständlich in Rodina aufnehmen – alle Nationen waren durch das Partnerschaftsabkommen befreundeter Zivilisationen dazu verpflichtet, in Not geratenen Schiffen Hilfe zu leisten, andernfalls mussten sie mit einem Totalembargo rechnen. Die UFV vermied nach Möglichkeit den Kontakt mit dekadenten Kapitalisten, aber eine interstellare Raumstation war nun mal auf Handel angewiesen.
Einer der Grenzschützer stellte die Theorie auf, dass es sich bei dem Piloten des Raumschiffs um einen dieser unberechenbaren libertär-unabhängigen Anarchisten handeln könnte, die mit voller Absicht Grenzen missachteten, da sie grundsätzlich keine Nationen anerkannten, jegliche staatliche Autorität als Bullshit bezeichneten und der Überzeugung waren, dass der leere Weltraum niemandem gehörte. Das konnte durchaus spannend werden, war aber nicht besonders wahrscheinlich, denn es gab kaum noch unberechenbare libertär-unabhängige Anarchisten. Die meisten von ihnen saßen mittlerweile in den Gefängnissen jener Bullshit-Autoritäten, die noch nicht gemerkt hatten, dass es sie eigentlich gar nicht gab.
Die Kapitalisten dagegen hatten sich wie eine Seuche im Universum ausgebreitet.
Als die Sulaco dann tatsächlich in das Staatsgebiet der UFV eindrang, gab sie nicht das kleinste Signal von sich. Es schien fast so, als hätte niemand an Bord bemerkt, dass hier gegen ein Abkommen verstoßen wurde. Derart frech war schon lange keiner dieser überheblichen, konsumsüchtigen Kapitalisten mehr gewesen. Bekämpften sie so ihre Langeweile? Suchten sie Ärger, um sich aus ihrem durch zwanghaftes Konsumverhalten hervorgerufenen Stumpfsinn wachzurütteln?
Die diensthabenden Grenzschützer versetzten ganz Rodina sofort in höchste Alarmbereitschaft, obwohl sie noch keine näheren Informationen über das vom Kurs abgekommene Raumschiff hatten. Als sie endlich mehr wussten, war die Enttäuschung groß, weil niemand seine Wette gewonnen hatte.
Rodinas Nachrichtendienst dagegen war überhaupt nicht enttäuscht. Da die Sulaco ein Schiff der Colonial Marines war, fiel ihnen mit ihr nun ganz zufällig eine wahre Fundgrube an Informationen in die Hände. Das Pech der Sulaco war für sie also ein großer Glücksfall. Und da sie nur für einen begrenzten Zeitraum Zugriff darauf hatten, mussten sie schnell handeln.
Der Abfangjäger, den Rodina der Sulaco entgegenschickte, war zwar ein älteres Modell, das schon seit Jahren nicht mehr hergestellt wurde, aber deswegen noch lange nicht veraltet. Dem Piloten gelang eine perfekte Landung auf der Sulaco, direkt über einer Luftschleuse. Er und seine beiden Besatzungsmitglieder waren ein eingespieltes Team, wenn es darum ging, unter schwierigsten Umständen Informationen aus unzugänglichen (und nicht immer legalen) Quellen zu beschaffen.
Ihr jetziger Auftrag mochte zwar nicht besonders gefährlich sein, trotzdem standen sie unter Druck. Der Regierungsrat hatte sie gar nicht erst darauf hinweisen müssen, dass sie auf keinen Fall ohne einen spektakulären Fund zurückzukehren brauchten – das war ihnen auch so klar.
Kommandant ihrer kleinen Spezialeinheit war ein alter Haudegen mit einem ebenso altmodischen Namen – Boris –, der für sich in Anspruch nahm, direkt von jenen Bolschewiken abzustammen, die Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts den Zaren gestürzt hatten. Eine dreiste und noch dazu ziemlich fragwürdige Behauptung, konnten doch die meisten Einwohner von Rodina ihre Herkunft nicht besonders weit zurückverfolgen. Und überhaupt waren Stammbäume etwas für Tiere – bei Menschen galten sie als wenig fortschrittlich. Aber jeder hatte nun mal seine Macken, und seine schien ziemlich harmlos zu sein.
Zweite Offizierin war eine junge Vietnamesin, die vor ein paar Jahren mit einem Transportschiff voller heimat-, staaten- und hoffnungsloser Menschen in Rodina gelandet war. Sie wurde von allen – sogar von denen, die kein Englisch konnten – Lucky genannt. Zu erklären, dass Luc eigentlich ihr Nachname und Hai ihr Vorname war (auf Rodina war – wie auch sonst überall – die westliche Art der Namensnennung üblich, also Vorname vor Nachname), hatte sie schon lange aufgegeben. Genauso wenig versuchte sie, den anderen die richtige Aussprache ihres Namens nahezubringen. Die Fortschrittlichen Völker waren in dieser Hinsicht ebenso ignorant wie jene Kapitalisten, die sie so sehr verachteten.
Außerdem hatte sie nichts gegen den Spitznamen – schließlich hatte sie wirklich oft Glück. Zwar nicht, wenn es um Geld oder materielle, oberflächliche Dinge ging, aber immer dann, wenn es darauf ankam. Wenn es um Leben und Tod ging. Luc Hai hatte schon früh gelernt, dass eine gute Beobachtungsgabe der Schlüssel zu dieser Art von Glück war. Schlimme Dinge konnten jedem passieren, den guten Menschen genauso wie den weniger guten, unschuldigen genauso wie den nicht ganz so unschuldigen, gerechten genauso wie den ungerechten. So war die Welt nun mal. Aber egal, wer man war, wo man war oder in welcher Situation man sich gerade befand: Das Glück bevorzugte immer den vorbereiteten Geist.
Der Dritte im Bunde war Ashok. Luc Hai kannte seinen Namen und das Repertoire seiner Fähigkeiten, wusste aber sonst nicht viel über ihn. Das war allerdings nichts Ungewöhnliches, denn viele, die nach Rodina kamen, waren nicht sonderlich mitteilsam, wenn es um persönliche Dinge ging. Glück bevorzugte zwar den vorbereiteten Geist, aber Verschwiegenheit war vielleicht noch wichtiger.
Bereits aus einiger Entfernung waren Schäden am Schiff zu sehen, die nur aus einem Kampfeinsatz stammen konnten. Das Logo auf der Außenhülle war zerkratzt, aber immer noch erkennbar: Weyland-Yutani. Dass das faschistische Militär mittlerweile dem korruptesten Konzern der Galaxis unterstand, war nicht weiter verwunderlich.
Sobald sie den Abfangjäger sicher an dem unbekannten Raumschiff festgemacht hatten, zogen sie ihre Raumanzüge an. Boris öffnete die Luke im Boden, ließ Luc Hai in die Luftschleuse des Abfangjägers und schloss sie wieder hinter ihr, damit sie die Luft herauspumpen und die Außenluke öffnen konnte. Sie befestigte mehrere elektronische Dietriche an der Luftschleuse der Sulaco und legte eine Hand auf die Einstiegsluke, damit sie die Vibrationen der Maschinen bei ihrer Arbeit spüren konnte.
Doch nichts geschah.
Sie blickte zu Boris hoch, der ihr von dem kleinen Fenster der inneren Schleusenluke aus zusah, und schüttelte den Kopf. Er machte Ashok ein Zeichen und bedeutete ihr dann zu warten. Fünfzehn Sekunden später fing die Luke der Luftschleuse an zu zittern und öffnete sich. Luc Hai sah wieder zu Boris hinüber und hob den Daumen, dann schloss sie die Außenluke des Abfangjägers, damit auch die anderen beiden durch die Luftschleuse zu ihr gelangen und sie die Sulaco gemeinsam betreten konnten.
Als sich das Licht zusammen mit der künstlichen Schwerkraft des Schiffes einschaltete, sahen sie, dass sie sich in einem Lagerraum befanden. Luc Hai stieg als Erste die Leiter zum Frachtdeck hinunter, sah sich kurz um und signalisierte dann Boris und Ashok, dass keine Gefahr drohte und sie ihr folgen sollten. Mit Funk wäre alles viel einfacher gewesen, aber der für solche Einsätze zuständige Befehlshaber hatte alle drahtlose Kommunikation untersagt, da er keine Frequenz für absolut abhörsicher hielt.
Luc Hai war der Ansicht, dass Zeichensprache auch nicht viel sicherer sein konnte, doch ihr derzeitiger Rang erlaubte es ihr nicht, diese Kritik laut zu äußern. Sie konnte also nicht mehr tun, als immer auf der Hut zu sein und darauf zu hoffen, dass sie nicht mit vollen Händen in eine lebensgefährliche Situation geriet. Zum Glück war die Luft im Inneren des Schiffes atembar, sodass sie die Visiere öffnen konnten.
Mit den Waffen im Anschlag schwärmten sie aus. Da sich alle Passagiere im Kälteschlaf befanden, hatte sich auf dem Schiff schon seit einer Ewigkeit nichts mehr geregt. Trotzdem wurde Luc Hai das Gefühl nicht los, dass hier etwas Schlimmes passiert war. Das ziemlich mitgenommen aussehende Landeshuttle, das nur ein paar Meter weiter an Deck festgemacht war, trug auch nicht gerade zu ihrer Beruhigung bei.
Hatte es auf LV-426 einen bewaffneten Konflikt gegeben? Sie hatte von nichts dergleichen gehört, aber Boris vielleicht. Er betrachtete das Shuttle mit großem Interesse und achtete sorgfältig darauf, ihm nicht zu nahe zu kommen.
Luc Hai machte einen Schritt auf ihn zu und blieb dann wie angewurzelt stehen, als sie etwas Merkwürdiges unter ihrem Stiefel spürte. Sie blickte nach unten, konnte sich aber keinen Reim auf das machen, was sie sah.
Auf dem Boden lagen menschliche Beine, völlig verdreht und gebrochen. Sie hingen an einem Unterleib, der anscheinend mit roher Gewalt vom restlichen Körper abgerissen worden war. Was hatte so viel Kraft, dass es einen Menschen wie einen Stofffetzen in zwei Hälften reißen und dann wie Müll wegwerfen konnte?
Die wesentlich interessantere Frage lautete: Befand es sich noch hier?
Die weniger interessante Frage: Warum waren die Leichenteile mit Milchpulver bedeckt? Oder war es Talkumpuder?
Dann wurde ihr klar, dass es sich dabei um getrocknetes Roboterblut handelte. Es gab da einen alten Witz über jemanden, der es sich in den Kaffee streute. Aber weder trank sie Kaffee, noch hatte sie sich die Pointe gemerkt – und unter diesen Umständen hätte sie sie wohl auch nicht besonders witzig gefunden.
Bevor sie weiter darüber nachdenken konnte, schlossen Boris und Ashok zu ihr auf, um herauszufinden, was ihre Aufmerksamkeit erregt hatte. Angeekelt verzog Boris das Gesicht. Dann erinnerte er sie daran, dass die Uhr tickte und der Rat etwas mehr von ihnen erwartete als ein Paar kaputte Roboterbeine. Sie mussten den Frachtraum verlassen und sich auch den Rest der Sulaco ansehen. Sie und Ashok eilten gehorsam los, wobei Ashoks verängstigte Miene widerspiegelte, wie sie sich fühlte.
»Achtung, Sicherheitsmitteilung an alle Crewmitglieder.«
Sie zuckten vor Schreck zusammen. Die weibliche Stimme klang nicht im Mindesten aufgeregt, sondern ganz ruhig und nüchtern.
»Unbefugtes Eindringen registriert«, fuhr sie fort. »Das Sicherheitspersonal wird angewiesen, sich sofort zum B-Deck, Lagerraum 3 zu begeben und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.«
Für den Fall, dass tatsächlich Sicherheitspersonal in Form von Menschen oder Robotern auftauchte, blieben die drei wie angewurzelt stehen, doch alles blieb ruhig. Zehn Sekunden später wiederholte die Stimme ihre Durchsage. Luc Hai hoffte, dass sie sich irgendwie abstellen ließ, bevor sie alle in den Wahnsinn trieb.
Boris winkte ihr und Ashok vom Eingang eines dunklen Korridors aus zu. Er ging einen Schritt hinein und schwenkte den Arm, um den Bewegungsmelder auszulösen. Das Licht ging an. Das ist sicher ein gutes Zeichen, dachte Luc Hai. Wenn die Bewegungsmelder funktionierten, konnte das Schiff in keinem allzu schlechten Zustand sein. Dann waren die zerstörten Roboterbeine vielleicht schon das Schlimmste gewesen.
Die Durchsage wurde nur noch ein weiteres Mal wiederholt, während sie sich vorsichtig durch den Korridor bewegten. Vielleicht wurde sie ebenfalls durch Bewegung ausgelöst, überlegte Luc Hai, und da das System nun keine Bewegung mehr auf dem Deck wahrnahm, ging es davon aus, dass die Situation unter Kontrolle war. Die Sicherheitssysteme der Kapitalisten waren wirklich lächerlich.
Der Gang führte zu einer Kälteschlafkammer. Sobald sie eintraten, schaltete sich eine allerdings nur schwache Beleuchtung ein. Luc Hai hätte sich gern eingeredet, dass die Passagiere beim Aufwachen nicht von allzu grellem Licht geblendet werden sollten, aber sie war noch nie besonders gut darin gewesen, sich in die eigene Tasche zu lügen.
Beim Anblick der vielen leeren Schlafkapseln wurde ihr Unbehagen immer größer. Die aufgeklappten Deckel erinnerten an sterile Mäuler. Nur die vier ersten Kapseln in der Reihe, die ihr am nächsten war, machten einen geschlossenen Eindruck.
Boris bedeutete Ashok, dass er sich umsehen sollte, während er selbst zu der ersten geschlossenen Kapsel ging. Luc Hai folgte ihm mit der Waffe im Anschlag.
In den ersten drei Kapseln lagen eine Frau, ein kleines Mädchen und ein Marine. Hier war nichts Ungewöhnliches festzustellen. Die Statuslichter zeigten Normalbetrieb an und auch die schlafenden Menschen wirkten normal – selbst wenn der Marine im Gesicht und am Oberkörper verletzt zu sein schien. Unter den Verbänden waren die Wunden kaum zu erkennen, sahen aber wie Verbrennungen aus. Wenn er aufwachte, würde er sicher einen Arzt brauchen.
Die letzte der vier Kapseln wiederum verhieß nichts Gutes. Der Kondensfilm auf der Innenseite hatte dieselbe milchig weiße Farbe wie Roboterblut. Luc Hai war sich sicher, dass das kein Zufall war. Wenn sich der Oberkörper des Roboters dort befand, musste etwas schiefgegangen sein – und zwar so richtig.
Luc Hai trat beiseite, als Boris versuchte, die Kapsel gewaltsam zu öffnen, indem er seine behandschuhten Finger unter den Deckel schob. Er konnte ihn kaum bewegen, aber seiner Körpersprache war trotz des unförmigen Raumanzugs deutlich zu entnehmen, dass Boris keine Hilfe wollte.
Luc Hai war das nur recht. Sie wollte ihm gar nicht helfen – im Gegenteil, am liebsten hätte sie ihn davon abgehalten. Doch das verkniff sie sich lieber. Boris war üblicherweise nicht besonders begeistert davon, wenn ihm seine Untergebenen Ratschläge erteilten.
Boris knurrte frustriert und hieb mit der Faust gegen die Kapsel. Vor Überraschung blieb Luc Hai der Mund offen stehen. Boris benahm sich zwar oft ungehobelt, blieb dabei aber normalerweise die Ruhe selbst. Er ließ sich grundsätzlich nicht dazu hinreißen, Wut oder Frust freien Lauf zu lassen, und er tolerierte ein solches Verhalten auch bei anderen nicht. Die Wucht, mit der seine Faust auf die Kapsel prallte, machte seinem Wutanfall augenblicklich ein Ende, und Boris war wieder er selbst.
Mit einem verlegenen Grinsen drehte er sich zu ihr um. »Das nennt sich ›Klopftechnik‹. Hab ich von einem Ingenieur gelernt.«
Luc Hai hörte ihm nur mit halbem Ohr zu, während sie die Kapsel anstarrte, die nun etwas schief in ihrer Halterung saß. Die roten und grünen Statuslichter flackerten noch ein paar Sekunden lang, dann verloschen sie. Die Verriegelung öffnete sich mit einem leisen dumpf-metallischen Geräusch, und der Kapseldeckel hob sich langsam. Das Sichtfenster war vollständig beschlagen.
Ein schwerer weißer Nebel strömte in elegantem Schwung über den Rand der Kapsel. Luc Hai wich zurück und wollte Boris mitziehen, doch er schüttelte sie ab und machte ihr mit einem eindeutigen Handzeichen klar, dass sie auf Abstand bleiben sollte. Sie trat noch einen Schritt zurück und rechnete schon fast damit, dass sich der Nebel verflüssigen würde, sobald er den Boden erreichte. Doch er löste sich einfach auf. Gerade als sie noch einmal versuchen wollte, Boris zum Weitergehen zu überreden, lichtete sich der Nebel, und in der Mitte der Kapsel kam ein eiförmiges Objekt zum Vorschein.
Das Ei schien aus dem Oberkörper des Roboters zu wachsen, wobei die Wurzeln an seiner Basis mit den zerfetzten Innereien der Maschine verschmolzen zu sein schienen.
Anscheinend hatte es keine harte Schale, sondern eine gummiartige, feuchte Außenhaut, als stammte es von einem Reptil. Hatten die Kapitalisten ihre Roboter darauf programmiert, sich wie Robotereidechsen zu reproduzieren? War es billiger, wenn Roboter sich selbst ausbrüteten? Luc Hais Unbehagen nahm zu. Sie trat links hinter Boris hervor, um besser sehen zu können.
Unter dem Kopf des Roboters waren ein paar Plastikfetzen erkennbar. Die Reste eines medizinischen Rettungskokons. Diesen auf eine Maschine zu verschwenden war ein weiteres Beispiel für die Dummheit der Kapitalisten, doch sie konnte sich nicht so richtig darüber empören. Vermutlich hatten sie noch zwei Dutzend solcher Rettungskokons unbenutzt herumliegen, und keiner der Menschen hatte einen gebraucht, nicht einmal der Marine.
Der Kopf des Roboters rollte zur Seite, seine Augen öffneten sich und sahen sie mit einem leidenden Ausdruck an.
Luc Hai spürte, wie sich ein Knoten in ihrem Magen zusammenzog. Egal ob es sich um eine Zentrifuge, ein Raumschiff oder einen Roboter handelte, der wie ein Mensch aussah – Maschinen konnten nicht leiden. Ihr Blick wanderte von seinem Gesicht über seinen Torso entlang bis zu dem Ei, das aus ihm herauswuchs. Auch das war unmöglich. Aus einem leblosen Objekt konnte nichts Derartiges entstehen.
Plötzlich öffneten sich mit einem nassen, schmatzenden Geräusch Hautlappen an der Spitze des Eis. Boris trat einen Schritt zurück, als mit einem Schwall widerlicher gelblicher Flüssigkeit etwas daraus hervorschoss und ihm ins Gesicht sprang. Luc Hai zuckte zurück und wich damit gerade so einem großen unförmigen Klumpen aus, der genau da landete, wo sie eben noch gestanden hatte. Zu ihrem Entsetzen fraß er sich mit einem lauten Zischen durch den Metallboden, was aber beinahe sofort von Boris’ Kreischen übertönt wurde.
Luc Hai drehte sich um. Boris stand immer noch aufrecht da, während das Wesen aus dem Ei, das wie eine Kreuzung aus Schlange, Qualle und Tintenfisch aussah, förmlich durch seinen Helm schmolz. Seine Schreie klangen erst gedämpft und schließlich erstickt, als er nach hinten taumelte und die Kreatur mit beiden Händen zu packen versuchte. Dann drehte er sich um und stolperte davon.
Luc Hai schloss ihr Visier und folgte Boris in einem – wie sie hoffte – sicheren Abstand zurück in den Korridor. Unter dem Helm erklangen ihre eigenen hektischen Atemgeräusche nun unnatürlich laut, aber sie hörte trotzdem weiterhin Boris’ Schmerzensschreie, während er zurück in Richtung Frachtdeck taumelte. Dabei rannte er immer wieder gegen eine Wand und prallte davon ab, nur um gleich gegen die gegenüberliegende zu stolpern.
Er würde sicher jeden Augenblick zusammenbrechen. Sie fragte sich, was sie dann tun sollte und wie sie ihm überhaupt helfen konnte. Irgendwie schaffte er es bis zum Frachtdeck und hielt sich noch fast eine halbe Minute lang auf den Beinen, bevor er schließlich mit dem Gesicht voran zu Boden ging – nur drei Meter von einer Luftschleuse entfernt, auf der NOTAUSGANG stand.
In der Hoffnung, dass es nun vorüber war, rollte Luc Hai Boris mithilfe des Laufs ihrer Waffe auf den Rücken, aber er schien weiter um sein Leben zu kämpfen. Seine kraftlosen Hände versuchten, nach der pulsierenden Kreatur auf seinem Gesicht zu greifen, wahrscheinlich waren es jedoch nur noch Muskelreflexe. Es schien unmöglich, dass er noch lebte, schließlich fraß gerade ein Monster seinen Kopf.
Sie hängte sich das Gewehr wieder um die Schulter und zog stattdessen ihre Handfeuerwaffe. Dann zögerte sie. Für Boris gab es keine Hoffnung mehr, aber nach allem, was sie gemeinsam durchgestanden hatten, kam es ihr respektlos vor, ihm einfach ins Gesicht zu schießen – selbst wenn er streng genommen wohl keines mehr besaß.
Andererseits hätte er ihr ganz sicher befohlen, dem Vieh den Garaus zu machen. Egal, auf wessen Gesicht es gelandet war.
Sie brachte etwas mehr Abstand zwischen sich und das Wesen, zielte, schloss die Augen und drückte ab.
Die Kreatur explodierte, woraufhin sich das Durcheinander aus blutigem Gewebe, Knochensplittern und Helmfragmenten darunter sofort auflöste. Überall dort, wo die Fetzen des Dings landeten, entstanden kleine Löcher, und das dabei entstehende Zischen wuchs sich zu einem regelrechten Donnern aus. Luc Hai konnte ihr eigenes angestrengtes Keuchen kaum hören, als sie Boris an einem Bein zur nächsten Luftschleuse zog, bevor er sich komplett auflöste.
Sie murmelte wegen der respektlosen Behandlung eine Entschuldigung, schlug mit der Hand auf den mit ÖFFNEN beschrifteten Knopf neben der Schleuse und schob ihn hinein. Dann drückte sie auf NOTAUSSTOSS. Ein rotes Licht begann zu blinken, als sich die innere Luke schloss. Eine Sirene heulte los. Luc Hai schloss die Augen. Die Luftschleuse vibrierte, als sie sich nach außen hin öffnete und Boris’ Körper in die Leere des Weltalls trieb.
Sobald sich die Außenluke wieder geschlossen hatte und der Druck innerhalb der Luftschleuse ausgeglichen war, verstummte die Sirene abrupt. Luc Hai stand wie erstarrt da, zählte ihre Atemzüge und nahm ihre ganze Willenskraft zusammen, um ihr rasendes Herz zu beruhigen. Sie war zur Elitesoldatin ausgebildet worden und würde sich erst von ihren Emotionen überwältigen lassen, wenn sie wieder in ihrem Quartier war. Dennoch dauerte es einen Moment, bis sie sich ganz in der Gewalt hatte.
Rein, Daten abzapfen und wieder raus, ohne auch nur die allerkleinste Spur zu hinterlassen. Eigentlich hätte dies ein einfacher und risikoloser Einsatz sein sollen, die ungefährlichste Spionagemission, die man sich nur vorstellen konnte.
Hätte sein sollen. Wäre er auch gewesen, wenn sie einfach nur eine Datentransferschnittstelle auf dem Frachtdeck eingerichtet hätten, ohne gleich den Rest des Schiffes zu erkunden. Dann wären sie in diesem Augenblick schon längst wieder zurück im Abfangjäger und würden den reichlich von der Sulaco fließenden Datenstrom auswerten. Boris wäre gerade dabei, ihnen zu erklären, was sie alles falsch gemacht hatten. Er würde ihnen irgendwelche Märchen über seine heldenhaften Bolschewiken-Vorfahren erzählen, anstatt tot und ohne Kopf durchs All zu treiben. Und Luc Hai wäre nicht geschockt, sondern nur etwas gelangweilt. Und Ashok …
Ihr Herz schlug schneller, als sie plötzlich spürte, dass sie nicht länger allein war. Vor Schreck war sie wie betäubt gewesen und hatte nicht gemerkt, dass sich von hinten etwas an sie heranschlich. Zum Teufel, ihr war noch nicht einmal aufgefallen, dass das Zischen der Säure, die sich durch das Metall fraß, nun viel leiser geworden war. Luc Hai schluckte erst, dann richtete sie sich auf und drehte sich um.
Das Monster, das im Eingang zum Korridor stand, hatte zahlreiche Gliedmaßen, die in seltsamen Winkeln von seinem unförmigen Körper abstanden. Als sie ihre Waffe hob, machte das Wesen, das da auf zwei Beinen ging, einen Schritt nach vorn und verwandelte sich in Ashok, der einen halben Roboter in den Armen hielt. Die obere Hälfte.
Ashok ist wirklich schlau, dachte sie. Der Roboter hatte bestimmt noch viel mehr Daten gespeichert als der Schiffscomputer. Außerdem hatten sie die Befugnis, verdächtige Technologie an Bord eines unberechtigterweise in das Territorium der UFV eingedrungenen Raumschiffs zu konfiszieren. Das würde der UFV einen unverhofften Vorteil verschaffen.
Sobald sie wieder im Abfangjäger waren, schloss Ashok den Roboter in eine Quarantänebox ein. Um auf Nummer sicher zu gehen, dekontaminierten sie sich auf dem Rückflug drei Mal und dann noch zwei Mal, nachdem sie wieder in Rodina gelandet waren. Luc Hai gelang es nicht, das Gesicht des Roboters aus ihren Gedanken zu verbannen. Sooft sie sich auch ermahnte, dass sie ihm menschliche Eigenschaften zusprach, die er nicht besaß – die Erleichterung darüber, die Quarantänebox abzuschließen und den leidenden Gesichtsausdruck des Roboters nicht mehr sehen zu müssen, würde sie so schnell nicht vergessen.
4
ANCHORPOINTWAREINEVON vielen Stationen entlang der interstellaren Handelsrouten, die man nur auf der Durchreise besuchte, um Treibstoff zu tanken. Diese Station von der Größe eines kleinen Mondes sah aus, als hätte sie ein zwar kreatives, aber launisches Kleinkind aus den unterschiedlichsten Bauklötzen zusammengesetzt. Immer wurde irgendwo gebaut, ein neues Element hinzugefügt oder ein bereits existierendes den wechselnden Bedürfnissen ihrer Bewohner angepasst.
Dabei war die Fluktuation nicht einmal besonders stark. Auf Anchorpoint gab es einen militärischen Stützpunkt sowie ein kleines, aber nicht unbedeutendes Kontingent an künstlichen Personen, das der Stammbelegschaft der Station zugeteilt war. Die meisten der auf Anchorpoint ansässigen Personen jedoch hatten Langzeitverträge mit einem der zahlreichen dort niedergelassenen Unternehmen abgeschlossen.
Wie lang ein solcher Langzeitvertrag dann tatsächlich lief, unterschied sich von Firma zu Firma. Aber da niemand eine lange Reise im Kälteschlaf mitten durch interstellares Niemandsland für ein verlängertes Wochenende auf sich nahm, blieben die meisten gleich mehrere Jahre, üblicherweise mindestens fünf, obwohl es – je nach Tätigkeit – auch nur drei sein konnten. Über die Hälfte der Arbeiter verpflichteten sich gleich wieder für fünf oder sieben weitere Jahre, sobald ihr erster Vertrag auslief – meist um ein Projekt zum Abschluss zu bringen oder um weiter den Entfernungszuschlag zu kassieren. Nur sehr wenige blieben noch länger.
Wer in den Bereichen Forschung und Technik arbeitete, verlängerte seinen Vertrag selten öfter als einmal. Orte wie Anchorpoint waren nur Zwischenstationen, die sich gut im Lebenslauf machten. Wenn man seine Zeit irgendwo im Niemandsland abgesessen hatte, war die Wahrscheinlichkeit größer, später einen Arbeitsplatz an einem schöneren, weniger abgelegenen Ort zu bekommen.
Genau das war auch Charles A. Tullys Plan gewesen, als er seinen Fünfjahresvertrag als Zellkulturlabortechniker bei Weyland-Yutani unterzeichnet hatte. Vor mittlerweile sechs Monaten hatte er seinen zweiten Fünfjahresvertrag unterschrieben, und nun wurde ihm langsam klar, dass er nicht ganz so zuversichtlich in die Zukunft blickte wie damals, als er gerade neu in eine der vielen Wohnkabinen eingezogen war, in denen die Unverheirateten, Ungebundenen und allgemein Ziellosen hausten.
Alle um ihn herum waren unter dreißig, die meisten – wie Tully selbst – sogar unter fünfundzwanzig, also noch jung genug, um sich in einer Unterkunft wohlzufühlen, die eher einem Studentenwohnheim glich. Jedem stand nur ein einziger kleiner Raum zur Verfügung, der eher einer Zelle glich, doch zumindest verfügte dieser über eine abschließbare Tür – das war immer noch besser als bei den Marines, die in ihren Quartieren überhaupt keine Privatsphäre hatten.
Ein Verhaltenspsychologe hätte Tully anhand der Einrichtung seiner Kabine wohl als »unreifen jungen Erwachsenen« bezeichnet: Überall lag verstreute Kleidung herum, dazwischen glänzende Hightech-Spielsachen und Werkzeuge. Die Regale waren kaum breit genug für ein Glas Wasser, und den Rest der Wände hatte Tully mit Fotos fremder Welten bedeckt, die er vermutlich niemals wirklich zu Gesicht bekommen würde.
Das Fenster – das Gesetz zum Schutz des persönlichen Wohlergehens sah in jedem privaten Wohnraum mindestens eines vor – war sogar 10,19 Quadratzentimeter größer als vorgeschrieben. Doch dafür war der Ausblick ziemlich trostlos.
Für jemanden, der das Leben im Weltall noch nicht kannte, bot es zwar ein fantastisches Panorama, spätestens nach drei Tagen setzte allerdings die Erkenntnis ein, dass man alles gesehen hatte, was es zu sehen gab, und die Begeisterung ließ spürbar nach. Die Sterne waren leblos – sie bewegten sich nicht, sie veränderten sich nicht. Und hier draußen im Weltall funkelten sie noch nicht einmal.
An diesem Etwas-größer-als-die-Vorschrift-Fenster zogen auch keine Raumschiffe in majestätischer Langsamkeit vorbei, denn die Schiffsroute verlief an der anderen Seite der Station entlang, um die Bewohner bei einem Unfall – wie zum Beispiel einer Explosion – nicht (oder nur so wenig wie möglich) zu gefährden. Wer dabei zusehen wollte, wie die Schiffe eintrafen und wieder abflogen, musste sich auf die Aussichtsterrasse begeben. Aber das lohnte sich auch nur selten, da sich der Verkehr in Grenzen hielt. Und überhaupt: Wenn man ein Schiff gesehen hatte, hatte man sie alle gesehen. So viel zu dem Abenteuer in den Weiten des Weltraums.
Für Tully allerdings war die Enge der Station die größere Herausforderung. Sogar in den großzügig bemessenen Gemeinschaftsräumen wurde er das Gefühl nicht los, dass der Platz endlich war. Ging man auf einem Planeten spazieren, gelangte man zwar früher oder später an einen Zaun mit einem Durchgang-verboten-Schild. Dann konnte man sich entweder umdrehen und zurückgehen oder das Schild auf eigenes Risiko ignorieren und über den Zaun steigen – je nach Laune.
Auf der Raumstation dagegen stieß man früher oder später unweigerlich an ein Schott, hinter dem es einfach nicht weiterging. Hier gab es keine Zäune, über die man klettern konnte.
Das Gefühl, an einem Ort eingesperrt zu sein, wo es nur ein Innen und kein Außen gab, verfolgte ihn beständig und ließ ihn nie zur Ruhe kommen. In Anchorpoint lebte man vielleicht nicht gerade eingepfercht, aber dennoch war es dort ein bisschen zu eng für seinen Geschmack.
Dabei war er auf der Erde gar kein Freund langer Spaziergänge gewesen, und verbotenerweise über Zäune geklettert war er erst recht nicht. Als Kind hatte er lieber zu Hause gesessen und gelesen. Offenbar war ihm die Wahlmöglichkeit in einem Maße wichtig, das ihm vorher kaum bewusst gewesen war.
Nach mittlerweile fast sechs Jahren auf der Station hatte er sich daran gewöhnt, aber so richtig wohl würde er sich auf Anchorpoint wahrscheinlich nie fühlen – abgesehen von seiner Wohnkabine, die tatsächlich wie ein Zuhause für ihn war. Aber dort hielt er sich – wie die meisten der in diesen Quartieren untergebrachten Angestellten – meistens nur zum Schlafen auf.
Das Intercom hatte bereits seit einer ganzen Weile geklingelt, bevor Tully es endlich hörte. Er hatte schon immer einen festen Schlaf gehabt. Spence hatte ihm dabei geholfen, das Licht so zurechtzubasteln, dass es sich bei Anrufen von selbst anschaltete – anderenfalls würde das Intercom wahrscheinlich seinen ganzen Akku verbrauchen, ohne dass er es hörte. Oder die vom Lärm wahnsinnig gewordenen Nachbarn stürmten vorher sein Zimmer und machten ihm den Garaus. Falls das jemals passierte, wäre es auf jeden Fall Mandala Jacksons Schuld.
Als Einsatzleiterin konnte Jackson auch bei eingeschalteter Voicemail jeden kontaktieren, wann immer sie es für notwendig hielt. Angeblich stand das im Einklang mit dem Gesetz zum Schutz des persönlichen Wohlergehens, denn auf diese Weise konnte jemand, der krank oder verletzt allein in seiner Kabine lag, schneller entdeckt werden und musste nicht so lange leiden oder gar sterben – nur weil die anderen seine Privatsphäre respektierten.
In Wirklichkeit bedeutete es vor allem, dass man auch dann mit dienstlichen Anrufen belästigt wurde, wenn man gerade nicht im Dienst war.
Tully stöhnte. Er setzte sich auf und rieb sich widerstrebend mit einer Hand den Schlaf aus den Augen, während er mit der anderen nach dem Intercom auf dem Tisch neben seinem Bett schlug. Jackson erschien auf dem Bildschirm. Sie trug wie immer eine ihrer dämlichen Basecaps, an deren Schirm sie ihren dämlichen Lightpen geklemmt hatte. Ein dämlicher selbst gebastelter Behelf, um die Hände frei zu haben. Im Kontrollraum hinter ihr schien der Teufel los zu sein – und das war tatsächlich ungewöhnlich.
»Guten Morgen«, sagte sie.
»Morgen?«, winselte er. »Oh Mann, Jackson, ich hab frei. ›Guten Morgen‹ heißt es bei mir erst wieder in anderthalb Tagen.«
»Mir bricht das Herz«, sagte sie. »Aber erst später. Hier bei uns im Kontrollraum gibt es nun mal kein ›Ich hab frei‹. Vor sechzehn Stunden ist ein Marines-Truppentransporter eingetroffen. Per Autopilot.« Sie bewegte den Kopf, als sie mit dem Lightpen auf die linke Seite des Bildschirms zielte. »Das Schiff heißt Sulaco und ist vor vier Jahren mit fünfzehn Leuten an Bord von Gateway aus aufgebrochen. Zwölf Colonial Marines, ein Android, ein Weyland-Yutani-Vertreter und eine ehemalige Dritte Offizierin eines Handelsschiffs, das gesprengt wurde.«
»Und?«, fragte Tully genervt.
»Lassen Sie mich doch erst mal ausreden«, erwiderte Jackson. »Der Bioscan hat ergeben, dass nur noch drei Personen an Bord sind. Diese ehemalige Dritte Offizierin …« – sie nickte, während sie die Informationen von ihrem Monitor ablas, und der Lightpen malte einen dicken Strich auf den unteren Rand von Tullys Bildschirms – »ein – ein einziger – Marine, ein neunjähriges Mädchen, gleichzeitig die einzige Überlebende der Kolonie auf LV-426 und außerdem eine halbe künstliche Person. Die untere Hälfte. Da fragt man sich doch, was da wohl passiert ist, oder etwa nicht?«
»Warum fragen Sie die nicht selbst?«, antwortete Tully. »Sondern mich?«
Jacksons plötzliches breites Grinsen wirkte ebenso bizarr wie schockierend. »Aber jetzt kommt die gute Nachricht«, sagte sie in gespieltem Ernst. »Drei Stunden vor dem Auftauchen der Sulaco hat hier ein Transporter aus Gateway mit höchster Priorität angelegt – die Mona Lisa. An Bord waren zwei Passagiere von MiliSci. Militärwissenschaftler.« Ihr Grinsen wurde noch etwas breiter. »Von der Abteilung für Waffenentwicklung.«
Tully wurde flau im Magen. Wenn die Waffenentwicklungsabteilung ins Spiel kam, gab es normalerweise Tote. »Ist das nicht die schlechte Nachricht?«, fragte er. Etwas Geistreicheres fiel ihm vor Schreck nicht ein.
Jackson ignorierte seine Frage. »Unsere neuen Militärwissenschaftler-Freunde wollen, dass wir die Sulaco um punkt acht Uhr reinholen. Und zwar unter Sicherheitsvorkehrungen der höchsten Stufe. Für einen solchen Einsatz kommen ja nur hochrangige Biotechnologen infrage. Und da dürfen Sie natürlich nicht fehlen, Charles A. Tully.«
Er öffnete den Mund, aber der Bildschirm wurde schwarz, bevor er protestieren konnte.
»Ach du Scheiße«, sagte er und hatte es noch nie ernster gemeint.
Es kostete ihn die größte Anstrengung, sich aufzusetzen. Dann wühlte er in seinem Klamottenhaufen nach etwas Tragbarem herum, wobei der Geruch sein hauptsächliches Kriterium darstellte. Ob seine Kleidung verknittert war, spielte keine Rolle – von Labortechnikern erwartete man ja förmlich, dass sie schlampig herumliefen. Aber selbst die größten Chaoten waren empfindlich, wenn es um Körpergeruch ging.
Die soeben aussortierte und achtlos aufs Bett geworfene Kleidung bewegte sich und fiel dann auf den Boden, als Spence sich neben ihm aufsetzte. Sie strich sich die dunklen wirren Locken aus dem schläfrigen Gesicht.
»Was ist los?«, fragte sie gähnend und sah ihm dabei zu, wie er an einem T-Shirt schnupperte.
»Was los ist? Der ›militärisch-industrielle Komplex‹ ist los«, antwortete er. »Und deswegen muss ich jetzt mitten in der Nacht aufstehen. Und mich rumkommandieren lassen. Das ist los.« Er roch an einem weiteren T-Shirt und entschied, dass man es durchaus noch einmal anziehen konnte. »Es ist doch immer der gleiche Scheiß.« Spence nickte resigniert und stand auf, um ihm zu helfen.
Fünf Minuten später trat ein noch immer ziemlich müder, inzwischen aber vollständig bekleideter Tully in den Flur. Er trug – entgegen Spence’ Rat – eine abgewetzte Fliegerjacke über dem als annehmbar ausgewählten T-Shirt und eine nur leicht fleckige Hose. Die Ärmel der Fliegerjacke waren von den Schultern bis zu den Handgelenken mit den Logos verschiedener Firmen und Produkte verziert. Anchorpoint legte großen Wert darauf, seine Bewohner zu ermutigen, für die Firmen zu werben, die sich auf der Station eingemietet hatten – damit diese sich willkommen fühlten und hoffentlich weitere Investitionen tätigten.
Sein Blick fiel auf die ID-Plakette neben der Tür, auf der sein Name, sein Beruf und seine Kontaktinformationen aufgeführt waren. Das Foto auf diesen war am Tag seiner Ankunft aufgenommen worden und zeigte einen aufgeregten und nervösen Tully mit glänzenden Augen. Einerseits hatte er es kaum erwarten können, seine neue Stelle auf einer Raumstation anzutreten, andererseits aber hatte er befürchtet, die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen zu können – ein Gefühl, das seine Großmutter als Enthusiangst bezeichnet hatte.
Enthusiängstlich – das beschrieb den Typ auf dem Foto wirklich sehr treffend. Ein ahnungsloser Frischling, der es allen recht machen will.
Und? Hattest du dir das alles auch so vorgestellt?, fragte er im Stillen den Typen auf dem Foto. Dieser Neuling mit den glänzenden Augen hätte sicher mit Ja geantwortet.
»Volltrottel«, murmelte Tully. Es klang etwas wehmütig.
5
DECK 4Δ WARDERGRÖSSTE in Benutzung befindliche Raum auf Anchorpoint – und einer der wenigen Orte, an denen Tully sich nicht eingeengt fühlte. Selbst wenn mehrere Arbeitstrupps um die langsam und schwerfällig über den Metallboden des Decks stapfenden, rollenden oder gleitenden Laderoboter herumschwärmten, kam er sich hier nicht wie eingesperrt vor.
Unter dem großen Portalkran stand ein Arbeitstrupp mit Gerüststangen und Flutlichtern bereit. Ein kleines Stück weiter wartete eine andere Gruppe in voller Bioschutzausrüstung. War dies das Team, das an Bord gehen sollte? Tully runzelte die Stirn – mehr als die Hälfte davon waren Marines. Er holte sein Flexi aus der Jackeninnentasche. Jackson hatte ihm in einer Nachricht mitgeteilt, wo er sich einfinden sollte – mit dem Hinweis darauf, dass er zu spät kam. Verdammte Jackson.
Das medizinische Personal half ihm in den Schutzanzug, versiegelte diesen und befestigte das Flexi über dem Anzug an seinem Unterarm. Dann scheuchte man ihn in Richtung des Erkundungstrupps. Kaum war er dort angekommen, hörte er auch schon die Stimme des zuständigen befehlshabenden Offiziers aus seinen Helmlautsprechern.
»Alle Besatzungsmitglieder mit Ausnahme des Erkundungstrupps und der Hilfsmannschaft begeben sich in die ausgewiesenen Sicherheitsbereiche. Erkundungstrupp, Vorsicht vor dem Hallensturm. Die Kleine liegt nun in der Wiege, wir holen sie rein«, ließ er über den allgemeinen Kanal verlauten.
»Hallensturm …« Tully hatte diese Bezeichnung schon immer albern gefunden. Aber offenbar war dies der schnellste und unkomplizierteste Weg, alle Anwesenden darauf gefasst zu machen, dass beim Öffnen Luft aus oder in die Schleuse strömen würde. Ob dies eine leichte Brise oder eine Sturmböe war, kam ganz auf die Fähigkeiten dessen an, der die Schleuse bediente.
Als sich das Rolltor über ihnen öffnete, wurde die Luft nach oben gesogen und ließ den Kunststoff ihrer Schutzanzüge flattern. Wer auch immer heute am Bedienpult der Schleuse sitzen mochte, es war offensichtlich eine eher ungeduldige Natur: Er öffnete das innere Schott, obwohl der Druck in der Luftschleuse noch niedriger war als auf dem Deck. Die Silhouette der Sulaco zeichnete sich vor dem durch die Glaskuppel des Flugdecks sichtbaren Sternenhimmel ab, als das Schiff langsam herabgelassen wurde und schließlich mit einem überraschend leisen metallischen Geräusch auf dem Deck zu stehen kam.
Der Arbeitstrupp errichtete in atemberaubender Geschwindigkeit ein Gerüst. Anscheinend waren hier heute nur die besten Leute im Einsatz. Das hieß vermutlich auch, dass Jackson eine hohe Meinung von ihm hatte, aber Tully war immer noch sauer, dass sie ihm den freien Tag verdorben hatte. Jackson war nirgendwo zu sehen. Vielleicht machte sie gerade den ungeduldigen Schottöffner zur Sau.
Die Marines ließen ihn Jacksons Abwesenheit mehr als vergessen. Es war nicht ungewöhnlich, dass zu einem Erkundungstrupp auch ein paar Marines gehörten – aber normalerweise nicht so viele. Noch dazu schien Jackson die größten verfügbaren Muskelprotze angefordert zu haben. Tully gegenüber hatte sie nichts von alldem erwähnt. Vielleicht hatte sie befürchtet, dass er dann gar nicht erst aufgetaucht wäre. Zu Recht. Und tatsächlich wünschte er sich jetzt, er wäre zu Hause geblieben.
Seinem Vertrag zufolge durfte niemand von ihm verlangen, unter »übermäßig widrigen, außergewöhnlichen oder extremen Bedingungen«, bei denen er um sein Leben fürchten musste, zu arbeiten. Bis heute hatte er dieser Klausel keine besondere Beachtung geschenkt. Er würde zwar niemandem glaubhaft versichern können, dass ihn die Anwesenheit riesiger und bis an die Zähne bewaffneter Marines um sein Leben fürchten ließ – doch er war versucht, es darauf ankommen zu lassen.
Der links neben ihm aufragende Marine grinste auf ihn herab.
»Auf in den Kampf«, sagte der Marine, der seinem Namensschild zufolge Skyre hieß, über den Helmfunk. »Und das meine ich durchaus wörtlich.« Er zwinkerte Tully zu und drehte sich dann um. Tully folgte seinem Blick und entdeckte eine Hubarbeitsbühne, die gerade auf sie zugerollt kam.
Pass bloß gut auf mich auf, flehte Tully Skyre im Stillen an, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie man deinen Namen richtig ausspricht.
Zu Tullys Entsetzen gehörte er zur ersten Gruppe, die nach oben zur Luftschleuse befördert wurde. Ein Marine schloss die Außenluke mithilfe eines elektronischen Dietrichs auf. Dann öffnete er auch die innere Luke und machte Skyre ein Zeichen. Ein anderer Marine, auf dessen Namensschild »Ocampo« stand, folgte ihm. Schließlich trat auch Tully in die Luftschleuse, blieb stehen und blinzelte in die Dunkelheit.
Jemand gab ihm einen Stups in den Rücken. »Nur weiter. Keine Sorge, ich bin gleich hinter Ihnen.«
Tully drehte sich um und sah zu einem Marine namens Nenge auf. Sein gelassener Gesichtsausdruck ließ es Tully kalt den Rücken herunterlaufen, während er vorwärtsschlich und darauf wartete, dass endlich das Licht anging. Aber nichts passierte.
»Was ist mit dem Licht los?«, fragte er mit zitternder Stimme.
»Nur die Ruhe. Entspannen Sie sich«, sagte Ocampo. Tully gelang es auch etwa eine halbe Sekunde lang, diesem Ratschlag zu folgen. Im Lichtstrahl von Ocampos Pulsgewehr wurde vor ihnen ein Schott sichtbar. Das Metall war schwarz vor Ruß und wies lange, tiefe Furchen auf, die aussahen, als stammten sie von Krallen. Sehr großen Krallen.
»Mann, sieh dir das an! Hier war aber ganz schön was los.« Ocampo schien es beinahe zu bedauern, dass er nicht dabei gewesen war.
»Was los?« Tullys Stimme klang matt. »Hatte ich erwähnt, dass ich allergisch gegen ›was los‹ bin?«
»Ach wirklich?« Ocampo drehte sich um und leuchtete Tully mit seiner Lampe ins Gesicht. »Was zum Teufel haben Sie dann überhaupt hier verloren?« Er klang wie Tullys Sportlehrer früher in der Schule.
Tully atmete tief durch und stellte sich mit aller Würde, die er aufbringen konnte, möglichst gerade hin. »Ich bin hier, um in der Tiefe des Alls eine neue Heimat für die Menschheit zu erschaffen«, antwortete er in einem Tonfall, der Typen wie diesen Ocampo üblicherweise zum Ausrasten brachte. Wenn der Marine ihn hier und jetzt dafür um die Ecke brachte, konnte er sich wenigstens wieder hinlegen.
Ocampo war kein bisschen beeindruckt.
Tully nahm sein Messinstrument vom Gürtel und hielt es Ocampo hin. »Und um die Luft hier zu testen«, fügte er weniger herausfordernd hinzu. Er drückte mit dem Daumen auf einen Knopf, woraufhin ein Geräusch ertönte, das in etwa so klang wie ein schmatzender Kuss seiner Großmutter – nur wesentlich lauter. Na toll, dachte er. Warum müssen seriöse wissenschaftliche Instrumente nur so dämliche Geräusche von sich geben? Kein Wunder, dass Labortechniker so oft Prügel einsteckten.
Seltsamerweise entlockte er Ocampo damit fast ein Lächeln. »Okay, Professor. Dann ›testen‹ Sie mal schön.« Der Marine drehte sich wieder um und ließ seinen Lichtstrahl durch die Dunkelheit schweifen. Tully spürte wieder Nenges starke Hand auf seiner Schulter, die ihn weiter in die Sulaco hineinschob, während das restliche Team an Bord kam.
Tully seufzte. Warum bekam man nie Prügel, wenn man sie ausnahmsweise mal wirklich gut gebrauchen konnte?
Die Marines verteilten sich mit den Waffen im Anschlag in dem Raum. Die an den Waffenläufen befestigten Lampen kamen kaum gegen die Dunkelheit an. Nenges starke Hand schob Tully immer weiter. Es fehlte nicht viel, und er hätte ihn regelrecht geschubst. Eine Wahl ließ er Tully jedenfalls nicht.
Erst als sie den Raum mit den Schlafkapseln erreichten, sprang endlich eine dämmrige Beleuchtung an. Ein paar Lampen flackerten. Tully hätte gern jemanden gebeten, die Steuerungseinheit ausfindig zu machen, damit er die Beleuchtungsstärke von Club-Lounge zu Mittagssonne ändern konnte. Aber lieber nicht Ocampo, der würde ihm nur wieder sagen, er solle die Klappe halten und »schön weiter seine Tests« machen. Er betrachtete das Messinstrument und schwor sich insgeheim, einen Schalldämpfer dafür zu entwickeln.
Die Stimme des kommandierenden Offiziers auf dem Kanal des Erkundungstrupps ließ ihn zusammenzucken. »Labortechniker Tully, begeben Sie sich in die Kälteschlafkammer, falls Sie nicht schon dort sind, und nehmen Sie Luftproben. Labortechniker Tully, sofort Luftproben in der Kälteschlafkammer nehmen.«
Skyre richtete seinen Lichtstrahl auf Tully. »Das ist Ihr Einsatz, Professor. Nur zu!«
Was soll’s, dachte Tully, vielleicht bringe ich damit wenigstens Ocampo zum Lachen. Er drückte wieder auf den Knopf des Messinstruments. Dieses Mal klang das Geräusch eher wie die rückwärts abgespielte Aufnahme eines Furzkissens, aber Ocampo sah ihn nicht einmal an. Seine ganze Aufmerksamkeit war auf eine der Schlafkapseln gerichtet.
»Der Marine hier muss dringend medizinisch versorgt werden.« Ocampo winkte die beiden ihnen am nächsten stehenden Marines herbei. »Auf die Krankenstation mit ihm, sofort!«
Die Soldaten machten sich daran, die Schlafkapsel aus ihrer Halterung zu heben. Dann klappten sie ein Metallgestell mit Rädern auf der Unterseite aus und rollten sie aus dem Raum. Tully sah ihnen einen Augenblick lang nach und fragte sich dabei, wie sie die Kapsel auf die Hubarbeitsbühne bekommen wollten. Als er sich wieder umdrehte, stand Skyre neben einer anderen Kapsel, in der ein kleines Mädchen lag. Sein Gesichtsausdruck war unerwartet mitfühlend, und Tully senkte den Blick, weil er sich plötzlich wie ein Störenfried vorkam.
Ocampo entdeckte den dritten Passagier – eine Frau, die fast so weiß war wie ihre Schutzanzüge – und sah sich dann mit besorgter Miene um. Offensichtlich überlegte er, ob er auf zwei weitere Marines verzichten konnte, um sie ebenfalls sofort in die Krankenstation bringen zu lassen, oder ob er lieber noch warten sollte, bis sie hier fertig waren und sich auf den Rückweg machten.
Skyre wollte etwas sagen, stattdessen gab er aber ein grässliches Würgegeräusch von sich und zitterte am ganzen Körper. Instinktiv machte Tully einen Schritt nach vorn, um ihm zu Hilfe zu eilen, dann erstarrte er.
Mitten auf Skyres Brust erschien ein roter Fleck, der sich schnell ausbreitete. Dann wurde ein langes schwarzes Ding sichtbar, eine furchterregende Spitze, die, glänzend vor Blut, durch seinen Oberkörper brach.
Tully blieb vor Schreck der Mund offen stehen. Dieses entsetzliche schwarze Ding, das nun aus Skyres Brust ragte, war zu stark gekrümmt für eine Machete oder ein Schwert und zu breit für eine Sense. Es war auch nicht aus Metall, sondern wirkte vielmehr wie der Dorn einer Pflanze, nur dass ein Dorn üblicherweise nicht derart gekrümmt und schon gar nicht lang genug war, um einen großen, muskulösen Marine vollständig zu durchbohren und auf der anderen Seite dann verschmiert mit Blut, Gewebe und noch mehr Widerlichem aus ihm herauszuragen. »Oh Gott, oh Gott, oh Gott!«, schrie jemand immer wieder, als würde das irgendetwas nützen.
Skyre zappelte und krümmte sich, während er vor Höllenqualen schrie. Und dann erhob er sich plötzlich in die Luft.
Tully nahm gerade so noch wahr, wie Skyres Schutzanzug mit immer mehr Blut besudelt wurde, danach war er zu keinem klaren Gedanken mehr fähig. Ihm wäre es nur recht gewesen, wenn ihm auch gleich alle Sinne geschwunden wären, aber der Marine schwebte immer weiter in die Höhe, als wäre er das Opfer eines sadistischen Zaubertricks.
Plötzlich löste sich eine schwarze Peitsche von der Decke, durchschnitt die Luft und wickelte sich mehrmals um Ocampos Hals. Der Marine zerrte verzweifelt daran, während er sich ebenfalls in die Luft erhob.
Jemand stieß Tully grob zu Boden. Im Raum hallten nun Schüsse wider, die sich mit lauten Befehlen, Angstschreien und Schmerzensgebrüll vermischten. Tullys Kehle war so trocken, dass er nicht mehr als ein raues Krächzen herausbekam. Dann wurde ihm klar, dass er derjenige war, der die ganze Zeit geschrien hatte. Er rappelte sich auf die Knie, sah nach oben und entdeckte direkt über sich eine schwarze Gestalt, die ihre Hand nach ihm ausstreckte.