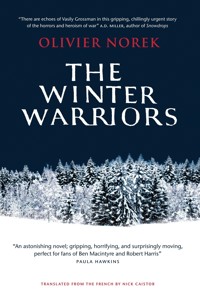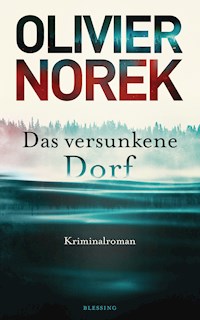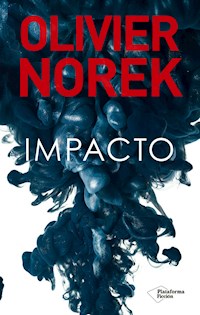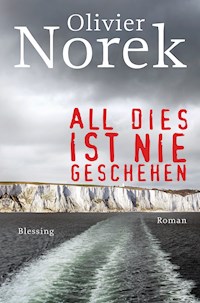
17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Adam Sarkis arbeitet im Untergrund gegen Assad. Als seine Tarnung aufzufliegen droht, flieht er über Libyen und das Mittelmeer nach Calais. Doch in dem Flüchtlingslager, das alle nur den „Dschungel“ nennen, findet er nicht seine Frau und seine Tochter, die wenige Wochen vor ihm die Flucht angetreten haben. Er verzweifelt. Um nicht, wie so viele hier, verrückt zu werden, beschützt er ein sudanesisches Kind vor der allgegenwärtigen Gewalt. Ein junger französischer Polizist unterstützt ihn dabei mit hohem Risiko, zieht seine anfangs widerstrebenden Kollegen, ja die eigene Familie mit in die illegalen Bemühungen ein.
In Form eines authentischen, auf Tatsachen beruhenden Spannungsromans stellt Olivier Norek ungeschönt das Leben in einem der bedeutendsten Flüchtlingslager dar, dessen Auflösung auch das Ende dieses Romans bildet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Adam Sarkis ist Angehöriger der Rebellengruppe der Freien Syrischen Armee und als Maulwurf bei Assad eingeschleust. Man hat einen anderen Angehörigen der FSA aufgegriffen, Adams Tarnung droht aufzufliegen. Also schickt er seine Frau Nora, seine Tochter Maya und deren geliebtes Stofftier auf die Flucht über Libyen und das Mittelmeer nach Calais, wo er sie, falls er überlebt, wiedertreffen will, um gemeinsam mit ihnen nach England zu fliehen. Der Rebellenfreund Adams hält bis zum Tod dicht, doch die Flucht von Frau und Tochter läuft nicht wie geplant. Das Kind erkältet sich, und trotz der Warnungen des Mittelsmanns entscheidet Nora sich, gemeinsam mit ihrer Tochter auf das Schlepperboot zu steigen. Noras Tochter Maya hustet laut, und die Schlepper fürchten, dass sie damit später den ganzen Schmuggel gefährden könnte. Sie soll im Meer ertränkt werden.
Zum Autor
Olivier Norek, geboren 1975 in Toulouse, arbeitete drei Jahre für Pharmaciens sans frontières und wurde Police Lieutenant in Seine-Saint-Denis. Seine Erfahrungen im Polizeidienst verarbeitete er 2013–2016 in den drei Kriminalromanen der Capitaine-Coste-Trilogie, die ihn zu einem Star der französischen Krimiszene machten. Er wurde u.a. mit dem Prix Le point du polar européen und mit dem Grand Prix des Lectrices de ELLE-Policiers ausgezeichnet.
OlivierNorek
Roman
Aus dem Französischen übersetztvon Alexandra Hölscher
Blessing
Angesichts der Grausamkeit der Realität wollte ich es mir nicht erlauben, eine Geschichte zu erfinden.
Nur der Verlauf der hier geschilderten polizeilichen Ermittlungen ist fiktiv, denn diese beruhen auf wahren Ereignissen.
Ich danke den Polizeibeamten von Calais, den Geheim- und Nachrichtendiensten, den Calaisiens, das heißt den Bewohnern von Calais, den Journalisten, meinen Ratgebern im Forschungszentrum Centre national de la recherche scientifique (CNRS) und im Institut d’études politiques de Paris (Sciences Po) sowie den ehrenamtlichen Helfern.
Insbesondere danke ich jedoch den Männern und Frauen, die vor den Schrecken der Kriege geflohen sind und bereit waren, mir ihre Geschichte zu erzählen.
Für meinen Großvater Herbert Norek,
schlesischer Vertriebener,
der französischer Staatsbürger wurde.
Das Kind
Irgendwo auf dem Mittelmeer.
Er beschleunigte und nutzte das Aufheulen des alten Motors, um die nächsten Worte zu übertönen und keinen Aufruhr, keine Panik aufkommen zu lassen.
»Wirf sie über Bord.«
»Jetzt?«
»Auf hoher See können wir uns die Kleine leichter vom Hals schaffen als auf einer Autobahnraststätte. Sie hustet doch schon, seitdem wir abgelegt haben. Wir sollten es wirklich nicht riskieren, erwischt zu werden, wenn wir sie in Italien in die Lastwagen laden.«
Im Boot befanden sich zweihundertdreiundsiebzig Menschen jeglichen Alters und Geschlechts, unterschiedlichster Herkunft und Hautfarbe. Durchgeschüttelt, nass bis auf die Knochen, halb erfroren, seekrank, in Todesangst.
»Ich glaub, das schaffe ich nicht. Mach du es.«
Entnervtes Seufzen. Der andere ließ das Steuerrad los und näherte sich entschlossen der Frau, die sich mit ihrem kranken Kind im Heck des Bootes verbarg.
Im Vorbeigehen rempelte er achtlos andere Passagiere an, die ihm in dem Gedränge angstvoll Platz machten. Als die Frau ihn näher kommen sah, schlang sie die Arme noch fester um das Kind, drückte ihm eine Hand auf die kalten Lippen und betete inständig, dass es aufhörte zu husten. Das verängstigte Kind ließ sein abgewetztes und lilafarbenes Plüschkaninchen fallen, und der Mann trat achtlos drauf.
Dann sprach er die Mutter an.
»Deine Kleine. Wirf sie über Bord.«
Der Verrückte
Flüchtlingslager in Calais. Oktober 2016.
Letzter Tag der Räumung des Camps.
Die Bagger fraßen sich unersättlich durch die Hütten und Zelte und zerlegten sie in ihre Einzelteile, die in der Nähe zu Plastik-, Stoff- und Kleiderhügeln aufgehäuft wurden. Das Feuer würde sie vernichten, sobald der Wind sich gelegt hatte.
Nichts blieb übrig von dem, was die Hoffnung auf dieser Brache gebaut hatte.
Wieder hob der Bagger sein Mahlwerkzeug und begann, sich seinen weiteren Weg durch das Niemandsland der Zerstörung zu bahnen. Der Motor heulte auf, das Fahrzeug wurde auf dem unebenen, gefrorenen Boden hin und her geworfen und hielt geradewegs auf sein nächstes Ziel zu, eine alte Hütte aus Holzpaletten mit Pappdach. Eine der letzten, die hier noch standen.
Einige Jahre zuvor hatten sich eine Müllkippe und ein Friedhof diese Fläche geteilt. Dann hatte der Staat die Geflüchteten hier zusammengepfercht, die von England träumten. An diesem Morgen kam die Müllkippe wieder zutage. Und als die kräftigen Zähne des Baggers sich in die Erde gruben, wurde auch der Friedhof wieder sichtbar.
Drei Arme hatte der Bagger zur Hälfte freigelegt, und die Arbeiter vermuteten, dass mindestens zwei Leichen in diesem Loch waren, das sich am äußersten Rand des Camps befand. Einer der Arme war so kurz, dass es sich um ein Kind handeln musste. Über Walkie-Talkie wurde der Baustellenleiter informiert.
In rund zwanzig Metern Entfernung huschte ein Schatten an der ersten Baumreihe entlang, die den Dschungel säumte, und hatte das Treiben der Fahrzeuge fest im Blick. Die Arbeiter selbst bildeten einen Kreis um den Schauplatz und starrten wie hypnotisiert auf das Grauen.
Da hob einer von ihnen den Blick und sah, wie eine undeutliche Erscheinung aus dem Wald hervortrat: zerlumpt, mit langen, fettigen Haaren, die Haut schwarz, braun oder einfach nur dreckig. Ein Mann mit einer rostigen Machete in der Hand, die er dicht an seinem Bein hielt. Er kam langsam näher, wobei er jeden mit misstrauischen Blicken bedachte und die Klinge bei jedem Schritt gegen sein Bein schlug. Keiner traute sich, ihm den Weg zu versperren, die meisten traten sogar einige Schritte zurück.
Als er am Loch angekommen war, kniete sich der unheimliche Fremde hin und begann, mit bloßen Händen die Erde wegzukratzen, die die Leichen noch bedeckte. Seine zunächst hektischen Bewegungen, die er mit einem animalischen Knurren untermalte, wurden allmählich ruhiger. Er berührte ein Bein, streichelte eine Hand, als wäre Leben in ihr. Er griff nach dem Kindesarm, führte ihn an sein Gesicht und schnupperte daran, bevor er ihn wieder fallen ließ. Wegen der Totenstarre blieb der Arm einige Sekunden in der Luft stehen, bis sein eigenes Gewicht ihn langsam wieder hinunterdrückte.
Sogar am helllichten Tag blieb der Mann ein undeutliches Erscheinungsbild. Er verschwand unter einem vor Dreck starrenden Kleiderhaufen, steckte mit seinen Armen tief in einem Massengrab, und als hätte er plötzlich jegliche Hoffnung verloren, hörte er auf, darin herumzuwühlen. Er stand auf, blickte verstört um sich und machte ein paar Schritte rückwärts. Mit der Machete in der Hand verschwand er wieder im Wald.
Der Polizist, der als Erster konkrete Informationen vorliegen hatte, übermittelte sie telefonisch dem Oberstaatsanwalt; der zögerte jedoch, sich selbst vor Ort ein Bild zu machen.
»Der Erkennungsdienst spricht von sieben Leichen.«
»Erwachsene?«
»Nicht nur.«
»Sind die Leichen vollständig?«
»Nicht alle.«
Nachdem der Polizist seinen Bericht abgeliefert und das Telefonat beendet hatte, erlaubte sich sein Partner eine Bemerkung.
»Warum hast du ihm nichts von dem komischen Typen mit der Machete gesagt?«
»Das spar ich mir für den Kommissar auf. Der ist doch der Einzige, der sich für diese Scheiße hier interessiert. Abgesehen davon, wenn ich dem Staatsanwalt von einem komischen Typen mit Machete erzähle, dann müssen wir auch einen komischen Typen mit Machete finden. Ein Spaziergang durch den Wald, wenn es dunkel wird, macht mich gerade nicht so an.«
»Na ja, außerdem gucken wir seit fast zwei Jahren weg, warum sollten wir das ausgerechnet heute ändern.«
ERSTER TEIL
Die Flucht
1
Damaskus, Syrien. Juni 2016.
Sektor 215 – Militärischer Geheimdienst.
Verhörraum im Gefangenenlager.
Mit dem letzten Hieb platzte der Augenbrauenbogen, ohne dass die Schreie des Mannes, der nackt auf einem Stuhl gefesselt saß, durch die dicken Mauern des Kellers dringen konnten. Sein Blut floss auf den staubigen ockerfarbenen Boden eines fensterlosen Raumes. Adam packte den Gefangenen am Nacken und drückte seine Stirn gegen die eigene, sodass der Schweiß des Schlägers und des Geschlagenen sich miteinander vermischten.
»Du wirst reden. Nichts ist die Schmerzen wert, die noch auf dich warten. Ist dir das klar?«
Weiter hinten stellte Salim eine von der Hitze verformte Wasserflasche zurück auf den Holztisch und wischte sich den Mund mit dem Ärmel ab. Er stand auf und nahm sich ein dickes schwarzes Kabel, das aus einem Geflecht aus elektrischen Drähten bestand. Schwer und stabil, effektiver als ein Schlagstock. Er begann, um den gefesselten Mann herumzulaufen, und schimpfte mit Adam:
»Deine Sätze sind zu lang, und du stellst keine Fragen. Man merkt, dass du sonst am Schreibtisch sitzt. Der Typ weiß genau, was wir hören wollen. Es bringt nichts, mit ihm zu reden.«
Das Prügelkabel landete auf dem linken Knie, das schon geschwollen war und aus einer offenen Wunde blutete. Das andere Knie war noch unversehrt. Zweimal holte er mit dem Kabel aus, das jedes Mal auf der gleichen Stelle landete, und die Nervenenden lagen jetzt frei. Der Schmerz war so durchdringend, dass der Gefangene nicht mal schreien konnte. Er krümmte sich und murmelte immer und immer wieder den gleichen Satz aus einem Gebet, das an Gott gerichtet war. Und da sie den gleichen Gott hatten, ging es Salim gehörig auf die Nerven.
»Mit Prügeln erreichen wir sowieso nichts. Wir sollten mit Säure weitermachen, das sage ich dir schon seit einer Stunde.«
»Willst du Antworten bekommen, oder willst du ihn einfach nur übel zurichten?«, fragte Adam. »Von der Säure werden die ohnmächtig. Foltern bedeutet auch, dass wir Pausen machen müssen, sonst funktioniert das nicht. Säure hört nicht einfach auf, die Haut zu zersetzen. Dann macht es für sie keinen Unterschied mehr, ob du sie folterst oder eine Pause machst.«
Salim wirkte überrascht.
»Du machst das wirklich zum ersten Mal, was? Ich dachte, ihr von der Verwaltung erledigt nicht gern die Drecksarbeit.«
»Der hier, der ist besonders. Der gehört mir. Ich will bei allem dabei sein«, antwortete Adam und näherte sich wieder dem Gefangenen.
Er legte die Hand auf dessen Schulter und murmelte ihm ins Ohr: »Hörst du mich? Ich lass dich nicht fallen.«
Salim warf einen Blick auf seine Uhr und beschloss, dass es Zeit für eine Zigarettenpause war. Als er zurückkehrte, hatte er seinen Vorgesetzten im Schlepptau.
Dieser klagte darüber, dass das Verhör zu lange dauere, und entließ Adam, ohne ihn eines Blickes zu würdigen.
»Sagen Sie dem Ministerium, dass wir keinen Aufpasser brauchen. Der wird schon noch reden, genau wie die anderen, ob Sie jetzt dabei sind oder nicht. Mit Ihren Fäusten werden wir ihn außerdem ganz bestimmt nicht kleinkriegen.«
Adam wurde auf Anordnung zur Tür geleitet. Bevor sie sich hinter ihm schloss, riskierte er eine letzte an Salim gerichtete Frage:
»Säure?«
»Nein. Basat al-reeh.«
Sie würden den Gefangenen auf ein Brett fesseln, die Füße hochbinden, sodass der Kopf frei nach unten baumelte. Im Laufe der nächsten Stunde würde sich das Blut in seinem Kopf stauen und Druck auf den Schädel ausüben, sodass es sich so anfühlte, als ob seine Augen jeden Moment aus den Höhlen hervortreten und explodieren würden.
Und wenn er dann immer noch nicht redete, würde die Säure wohl den Rest erledigen. Bei Säure bleibt niemand standhaft.
Ein geheimer Aufzug, mit dem man ausschließlich zu den unter Tage liegenden Einheiten des Gebäudes gelangte, beförderte Adam nach oben. Wieder an der frischen Luft auf der Straße atmete er so tief wie möglich ein, um die schlechte Luft, die seine Lungen noch verpestete, loszuwerden. Aber so sehr er sich auch anstrengte, der Geruch von Blut und säuerlichem Schweiß haftete an seiner Uniform.
Nur ein paar Dutzend Meter vor ihm sah er das prachtvolle Gebäude der Medizinischen Fakultät und Geisteswissenschaften, das sich in einem quasi intakten und vom Regime kontrollierten Viertel in Damaskus befand.
Er dachte an Aleppo, das weiter im Norden und nur dreihundertfünfzig Kilometer entfernt war, an die zerstörten Häuser, die den Blick auf das Innere der Zimmer freigaben und dadurch wie Puppenhäuser wirkten. Die meisten Gebäude waren nur noch Ruinen, maximal zwei Etagen hoch. Verbrannte oder explodierte Autos an den Straßenrändern, so weit das Auge reichte, und in diesem Chaos, inmitten von Polizei, Militär und den Motorengeräuschen der allradbetriebenen Militärfahrzeuge und Panzer, lebten Menschen in Angst. Sie hatten sich ihrem Schicksal ergeben und führten ein Leben, das einem russischen Roulette glich.
Damaskus. Adam befand sich im richtigen Teil des Landes, auf der richtigen Seite von Recht und Ordnung. Über fünfzehn Jahre war er Polizist gewesen und diente jetzt als loyaler Beamter der Militärpolizei unter Bachar el-Assad. Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, ihm zu misstrauen. Vielleicht gelang es ihm sogar, seine Frau und seine Tochter in Sicherheit zu bringen, bevor er umgebracht wurde. Ihm blieb nur noch sehr wenig Zeit.
Er winkte ein Taxi herbei und setzte sich auf den Rücksitz.
»Muhajirin, Hauptstraße.«
»Die Straße ist lang«, erwiderte der Fahrer.
»Unten am Hügel bitte.«
Adam vertraute niemandem mehr und verspürte nicht die geringste Lust, einem Fremden seine genaue Adresse mitzuteilen.
2
Vor sechs Jahren, beim Kauf der Wohnung in einem dieser typischen Mittelklasseviertel in Damaskus, hatte Adam dem Namen des Viertels keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Muhajirin. Die auf Reisen gehen. Die Migranten.
Zweimal musste er den Schlüssel im Türschloss drehen, bevor er wie ein heftiger Windstoß in den Flur stürmte. Nora hörte ihn von der Küche aus und bekam auf der Stelle Herzklopfen. Ihr Mann kehrte heute ungewöhnlich früh heim. Noch bevor sie sein Gesicht gesehen hatte, wusste sie, dass der Moment gekommen war. Der Moment, auf den sie sich lange vorbereitet hatten. Ihr Leben hing davon ab, dass sie jetzt alles richtig machten.
»Und?«, fragte sie.
»Man hat ihn in Sektor 215 gebracht. Das wird er nicht lange durchstehen. Wo ist Maya?«
»In ihrem Zimmer.«
»Du weißt, was du zu tun hast. Zwei Koffer. Für jede einen. Ich lass dich kurz allein, ich muss telefonieren.«
Nora küsste Adam auf den Mund. Ihre Lippen waren noch feucht vom Tee. Seine waren trocken vor Angst. Er wandte sich von ihr ab und ging zurück in den Eingangsflur. Dort entfernte er die Holzplatte vor dem Warmwasserspeicher, ließ seinen Arm ganz tief unter den Tank gleiten und löste ein Handy aus einer Halterung mit zwei breiten Klebebändern. Er wählte eine Nummer und sparte sich die Begrüßung.
»Heute Abend. Nora und Maya. Ist das immer noch möglich?«
»Wirst du sie nicht begleiten?«
»Ich würde sie nur unnötig in Gefahr bringen. Tarek ist geschnappt worden.«
»Ich weiß. Glaubst du, dass er reden wird?«
»Natürlich wird er reden. Und wer sollte es ihm verübeln? Wo sie schon mal einen von der FSA1 zwischen ihren Fingern haben, werden sie sich schön Zeit lassen.«
»Wissen sie, dass wir für die Operation Pavel verantwortlich sind?«
»Ich hoffe nicht. Ich war heute bei Tarek im Folterkeller, und er hat noch standgehalten und nichts preisgegeben. Damit hat er mir das Leben gerettet. Aber sobald sie ihn brechen, und ich verspreche dir, das werden sie, wird er ihnen meinen Namen sagen, und dann werde ich zur neuen Zielperson. Und meine Frau und meine Tochter auch. Sie müssen ohne mich gehen. Ich werde nachkommen. Dafür mache ich alles nur Menschenmögliche.«
»Inch’Allah2.«
»Ja, das rate ich Ihm.«
…
In weniger als einer Minute hatte Nora ihren Koffer gepackt und schickte sich an, ihn vor die Wohnungstür zu stellen. An der Stelle, wo sich die zwei schmalen Flure ihrer Wohnung kreuzten, stieß sie gegen die Kommode im Eingangsbereich. Ein eingerahmtes Foto, das darauf stand, fiel zu Boden, und das Glas zersplitterte. Erinnerungen wirbelten auf, als hätte nur das Glas sie zurückgehalten.
2015. Mayas sechster Geburtstag.
Nora mit ihren langen schwarzen, perfekt geglätteten Haaren, die sich wie ein Bach aus schwarzer Tinte über ihre Schultern ergossen. Maya, die wissbegierig und begeistert in die Welt schaute. Ein Kind, das niemals stillhalten konnte, nicht mal für ein Foto. Und Adam, der so groß und breit war und beide umarmte. Für seinen athletischen Körperbau war er während seiner Ausbildungszeit in der Polizeischule besonders geschätzt worden. Dieselbe Polizeischule, die von einem als Polizist verkleideten Mitglied des Islamischen Staats in die Luft gejagt wurde, ein Attentat, das über zwanzig Todesopfer forderte. Adam hatte Körperteile seiner Kollegen und ehemaligen Lehrer sowie einiger Zivilisten aufgesammelt.
Bis zu diesem Zeitpunkt war er das Musterbeispiel eines Polizisten gewesen, der gut ausgebildet war und seinem Land und seinen Führer vertraute. Als mit dem Arabischen Frühling ein Hauch von Demokratie über Syrien wehte, war er voller Hoffnung gewesen. Wie in Tunesien oder Ägypten hatte das Volk auch in Syrien auf einmal begriffen, dass es möglich war, für seine Freiheit zu kämpfen.
Aber diese Bewegung, die eigentlich ehrenwerte Ziele verfolgte, endete bald in einem Blutbad, dem Tausende von Demonstranten zum Opfer fielen, und brachte einen Bürgerkrieg über das Land. So wie ein Virus sich über einen geschwächten Körper hermacht, profitierte der Islamische Staat von der Schwachstelle des Landes und trieb seine Krallen der Gewalt und Fortschrittsfeindlichkeit noch tiefer hinein. Von da an gab es unter zwei Henkern ein und dasselbe Opfer. Der Diktator Bachar el-Assad und der Wahnsinn des sogenannten Islamischen Staats malträtierten beide das wehrlose syrische Volk.
Nachdem dieser friedliche Aufstand von der Armee zerschlagen worden war konnte Adam dem Todeskampf seines Landes nicht länger einfach so zuschauen, und schloss sich einer Rebelleneinheit der Freien Syrischen Armee an. Er wurde auf die denkbar riskanteste Weise zum Widersacher des Staates: Indem er ihn durch die Militärpolizei infiltrierte.
Ob es eine Art chemische Reaktion war, wie bei Tieren, die Angst riechen können, oder ob es intuitiv war, wie bei Menschen, die einem nah sind und die man ohne Worte versteht, jedenfalls folgte Maya ausnahmsweise konzentriert dem Rhythmus des Geschehens. Obwohl sie noch so jung war, konnte sie spüren, dass etwas Schlimmes passiert sein musste und dass sie sich ihre Launenhaftigkeit und Fragen besser für einen anderen Tag aufsparte. Von ihrem Zimmer aus hörte sie die Stimme ihres Vaters.
»Ihr bleibt heute Nachmittag bei Elyas. Im Laufe des Abends wird er euch über die Militärstraße nach Beirut fahren, und von da nehmt ihr einen Nachtflug nach Tripolis in Libyen. Das wird noch der einfachste Teil der Reise. Hol Maya, ich rufe jetzt ein Taxi.«
»Fahren wir zu Onkel Elyas?«
Nora drehte sich zu ihrer Tochter um, die geschäftig ihren Koffer aus dem Zimmer schleppte; sie war so klein und unschuldig, und vor ihr lag eine Reise, die ins Ungewisse führte.
Adam ging ins Wohnzimmer zum Bücherschrank und musste sich, trotz seiner beachtlichen Größe, auf die Zehenspitzen stellen, um die drei Bände der Fantômas-Gesamtausgabe im französischen Original vom höchsten Regalbrett herunterzuholen. Paris, die Stadt voller Geheimnisse und Intrigen, die aus der Feder von Souvestre und Allain stammten, pro Band ein Reisepass. Zwei gab er Nora, seinen eigenen steckte er in die hintere Hosentasche. Von jetzt an konnte es jederzeit passieren, dass sie Hals über Kopf fliehen mussten.
Sie gingen den Hügel, auf dem sich das Muhajirin-Viertel ausgebreitet hatte, hinunter, die Koffer klebten an ihren Beinen wie wohlerzogene Hunde, und Adam spielte im Geist noch einmal durch, was Nora zu tun hatte. Mehr um sie zu beruhigen als aus Notwendigkeit, denn Nora kannte die Anweisungen in- und auswendig. Gemeinsam warteten sie auf das Taxi. Maya war ungewöhnlich still, und ihren Eltern fiel auf, dass ihre Tochter auf einmal älter wirkte. Vernünftiger. Entschlossener. Beide fragten sich gerade, wie viel sie wohl von der ganzen Situation mitbekam. Da weiteten sich Mayas Augen plötzlich und füllten sich mit schicksalsergebenem Kummer.
»Maya, was ist?«, fragte Nora besorgt.
Das Mädchen zögerte. Ihr Vater würde es bestimmt für eine Kinderei halten, aber dann sprudelte es doch aus ihr raus.
»Monsieur Bou!«
Da weit und breit noch kein Taxi zu sehen war, ließ Adam sich von dem verzweifelten Blick seiner Tochter erweichen. Er hetzte die Treppen wieder hoch, nahm dabei mehrere Stufen auf einmal und stand schließlich nach Luft ringend in dem kleinen, in Pastelltönen gehaltenen Zimmer. Hastig wühlte er die Bettlaken durch und fand Monsieur Bou, einen alten Hasen aus lilafarbenem Plüsch, dessen Fell schon ganz abgewetzt war, schließlich zwischen zwei Kissen.
Von Mayas Geburt an hatte Adam seine Tochter Arnouba genannt. Mein Häschen. Irgendwann hatte sie sich dann einen echten Hasen gewünscht, aber da Nora eine Tierhaarallergie hatte, kam Arnouba der Plüschhase zum Trost und hatte ihre Arme seitdem nicht mehr verlassen. Und wie Kinder eben dazu neigen, Namen zu verdrehen, wurde aus Arnouba, dem kleinen Hasen, Monsieur Bou. Es war naiv, aber Adam hoffte, dass Monsieur Bou Maya auf ihrer Reise durch die gefährlichsten Länder der Welt beschützen würde.
Als das wenige Gepäck im Kofferraum verstaut war und Maya schon auf der Rückbank des Taxis Platz genommen hatte, küssten Nora und Adam sich zum Abschied und versuchten, diesem Kuss nicht zu viel Bedeutung zu geben. Es sollte ein normaler Kuss sein, um erst gar nicht die Vorstellung zuzulassen, dass es keine weiteren Küsse geben könnte. Nora konnte die Tränen jedoch nicht zurückhalten und machte ihr Vorhaben zunichte. Sie hatten schreckliche Angst umeinander.
»Ich komme nach«, versprach Adam, als er ihr die Autotür aufhielt. »Ruf mich an, sobald ihr in Tripolis im Hotel angekommen seid.«
Maya hauchte gegen das Fenster und zeichnete ein Herz auf das beschlagene Glas. Als das Taxi losfuhr, las sie ein lautloses »Ich liebe dich« auf den Lippen ihres Vaters.
Reiseplan von Nora und Maya
Damaskus–Beirut
113 km, Militärstraße
2 Stunden Fahrt
Beirut–Amman
238 km
1 Stunde 10 Minuten Flugzeit
Amman–Tripolis
2147 km
3,5 Stunden Flugzeit
Tripolis–Pozzallo
450 km
1 bis 3 Tage übers Meer
Pozzallo–Richtung Calais
2585 km
Mehrere Tage oder Wochen.
3
Tripolis – Libyen.
Hotel Awal – Stadtzentrum.
Drei Uhr morgens.
»Wie ist das Hotel?«, fragte Adam. Nora hatte Maya direkt nach ihrer Ankunft vor den Flachbildfernseher gesetzt, aber es hatte keine zehn Minuten gedauert, bis die Kleine von den hektisch-bewegten Videos des Musiksenders gelangweilt war. Sie stand auf und versank mit ihren Füßchen im flauschigen Teppich, dann begann sie, das anspruchsvoll ausgestattete Zimmer des Viersternehotels zu inspizieren. Die seidenglatten Bettlaken, die riesige Badewanne, die großen Fenster, durch die sie jetzt in der Nacht die Lichter des Nationalmuseums von Saraya zur Rechten und die Beleuchtung des dreistöckigen osmanischen Uhrturms zur Linken sah. Irgendwo in der Stadt ertönte eine lange Maschinengewehrsalve, die zwischen den Häusern und Gebäuden widerhallte. Ein europäisches Kind hätte Knallfrösche oder Feuerwerk vermutet, aber Maya wich schnell vom Fenster zurück, sie wusste, dass der Lärm von Explosionen herrührte.
Sie setzte ihren Erkundungsrundgang fort und gelangte zum Schlafzimmer mit dem Doppelbett, wo ihre Mutter die wenigen Sachen ausgepackt hatte, die sie für eine kurze Nacht benötigen würden. Als Maya hineingehen wollte, schob Nora, die das Handy zwischen Ohr und Schulter geklemmt hielt, kurzerhand mit dem Fuß die Tür zu und telefonierte weiter.
»Das Hotel? Das ist erste Klasse. Aber dieser ganze Luxus ist irgendwie seltsam. Also, wenn man bedenkt, was uns noch erwartet.«
»Geht es Maya gut?«, fragte Adam besorgt.
»Ja, einigermaßen. Aber ich glaube, dass sie sich bei der Zwischenlandung in Amman im Wartebereich des Flughafens erkältet hat. Über zwei Stunden haben wir in der voll klimatisierten Halle gesessen. Seitdem wir Amman verlassen haben, hat sie nicht aufgehört zu husten.«
»Ich hätte euch nie allein auf diese Reise schicken sollen. Aber ich musste euch in Sicherheit bringen, raus aus Damaskus und so weit weg wie möglich von mir. Es tut mir so leid.«
»Ich will so etwas nicht hören, houbbi*. Du tust alles, was du kannst, und zwar für uns.«
Adam rief sich ins Gedächtnis, wie sie vor drei Monaten die Operation Pavel auf die Beine gestellt und auch sachlich ausgearbeitet hatten, was zu tun sei, falls ihr Vorhaben misslänge. Dann musste seine Familie in Sicherheit gebracht werden.
»Warum nicht die Türkei?«, hatte Nora vorgeschlagen und mit dem Finger auf die entsprechende Stelle auf der Landkarte getippt. Von Damaskus nach Aleppo, dann von der Türkei weiter Richtung Balkanstaaten. »Da holen wir uns unterwegs keine nassen Füße, und nach Europa wäre es dann auch nicht mehr so weit.«
»Hast du eine Ahnung, wie viele Checkpoints es von Norden nach Süden zwischen Damaskus und Aleppo gibt?«, hatte Adam zurückgefragt. »Dutzende. Da sind die Kontrollstellen der Regierung, die des IS und noch viele andere willkürliche Kontrollen. Ob wir zu dritt fliehen oder du aus gegebenem Anlass nur mit Maya fliehst, es ändert nichts an den Fakten: Ich bin Offizier der syrischen Regierung, und sobald wir vom IS kontrolliert werden, wird man mich umbringen. Und Maya und du, ihr …«
Es fiel Adam schwer, den Satz zu Ende zu bringen. Im Vergleich zur anderen Option erschien der Tod als die denkbar angenehmere Lösung.
»Ihr fliegt also nach Tripolis in Libyen, und von dort geht’s weiter übers Mittelmeer nach Italien. Ab da durchqueren wir Europa und schlagen uns zu deinem Cousin nach England durch. Wenn jedes Jahr einer halben Million Menschen die Flucht gelingt, warum sollten wir das nicht auch schaffen? Wir haben aber ein Problem, weil ich für die Assad-Regierung arbeite, das bedeutet nämlich, dass wir von Frankreich niemals Visa erhalten werden.«
»Aber du kämpfst doch gegen die Regierung!«
»Ja, von innen heraus und so diskret wie möglich, damit man mir nichts nachweisen kann. Um es bis nach England zu schaffen, bleibt uns also nur die illegale Variante über Calais. Das wird zwar dauern, aber wir haben keine andere Wahl. Im Internet ist die Rede von einem Ort, wo man so lange warten kann, hast du das gesehen? Sie nennen ihn den ›Dschungel‹.«
»Aber das sieht wie ein Flüchtlingslager aus.«
»Mag sein, aber zumindest gibt es da geschützte Unterkünfte nur für Frauen und Kinder. Ich werde uns einen Schleuser suchen, der uns von da Plätze in einem Auto oder einem Lastwagen organisiert, und dann setzen wir mit der Fähre über oder fahren durch den Eurotunnel. Dein Cousin wird uns auf der anderen Seite des Ärmelkanals erwarten. Er hat versprochen, dass er uns hilft.«
»Ich weiß, du würdest lieber in Frankreich bleiben.«
»Wir haben da ja nicht mal Verwandtschaft. Und ich glaube, dass Frankreich nicht mehr das Land ist, das ich mal gekannt habe. England wird für uns genau das Richtige sein.«
In der Hitze ihres Wohnzimmers hatten sie die Köpfe über der Landkarte zusammengesteckt, im Hintergrund lief Mayas Einschlaflied, und der Fluchtplan war ihnen realistisch vorgekommen.
Jetzt aber, da Nora mit der Kleinen allein in Tripolis war, hatte sie große Angst und war sich gar nicht mehr so sicher, ob sie sich für die richtige Fluchtroute entschieden hatten.
»Hast du Tarek noch mal gesehen?«
»Morgen, am späten Nachmittag. Ich habe eine neue Anfrage gestellt, um beim Verhör dabei zu sein. Ich hoffe nur, dass ich niemandem aufgefallen bin. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass mich alle angucken, und merken, wie sehr ich mit ihm leide.«
»Houbbi, das ist normal, dass du an Verfolgungswahn leidest, du bist das Huhn im Fuchspelz unter Wölfen.«
»Ich selbst hätte mich nie so beschreiben dürfen, aber du reißt jetzt Witzchen darüber«, sagte Adam und lachte.
* Houbbi bedeutet meine Liebe, mein Lieber [zurück]
4
Garabulli, Hafenstadt in Libyen.
Fünf Uhr morgens.
Wenige Stunden unruhigen Schlafs voller Albträume später rüttelte Nora ihre Tochter sanft an der Schulter wach und küsste sie.
»Wir müssen aufstehen, Liebes. Heute werden wir das Mittelmeer überqueren.«
Maya stand endlich auf und schlurfte wie ein Zombie ins Badezimmer. Monsieur Bou baumelte kopfüber an ihrer Hand herunter.
Sie packten wieder ihren Koffer, aus dem sie nur wenige Sachen für die Nacht genommen hatten.
Eine knappe halbe Stunde später wurden sie von einem Taxi abgeholt, auf das sie in der Empfangshalle gewartet hatten, und fuhren die vierzig Kilometer von Tripolis nach Garabulli. Das Taxi setzte sie pünktlich zum verabredeten Zeitpunkt dort ab.
Bei Tagesanbruch standen sie allein nur wenige Meter von einem Strand entfernt, der weder Anfang noch Ende zu haben schien. Weiße Sanddünen wechselten sich mit felsigeren Abschnitten ab, an denen die Wellen brachen. Eine herrliche Landschaft, wenn man die Geschichte dazu nicht kannte. Denn es war gerade mal ein halbes Jahr her, dass es auf einem Schiff, das aus Ägypten kam, eine Rebellion von Geflüchteten gegen ihre Schlepper gegeben hatte, wodurch sie wenige Kilometer vor der libyschen Küste Schiffbruch erlitten. Mit den Wellen waren zweihundertfünfundvierzig Leichen an den Strand von Garabulli geschwemmt worden, als hätte die Natur sie wieder der Dummheit der Menschen übergeben.
Adam hatte einen Kontaktmann namens Ferouz ausfindig gemacht, der Nora und Maya schon seit einer Stunde warten ließ. Sorgenvoll musterten sie die wenigen Menschen, die sich um diese frühe Uhrzeit hierher verirrten, bei jedem Passanten keimte die Hoffnung auf, dass dieser auf sie zugehen und sie wie vereinbart mit ihren Vornamen ansprechen würde. Vergeblich.
In einiger Entfernung kündigte eine Staubwolke über der mit Schlaglöchern übersäten Straße einen Geländewagen an, auf dessen Ladefläche ein imposantes Maschinengewehr montiert war, rings herum saßen eine Handvoll Soldaten. Als das Militärfahrzeug auf sie zufuhr, hatte Nora schon dafür gesorgt, dass Maya hinter ihr stand, und sich das Kopftuch zurechtgerückt, um ihre Haare ordentlich bedeckt zu halten. Seit ihrer Hochzeit mit Adam hatte sie diese Handbewegung nicht mehr gemacht. Der Geländewagen fuhr an ihnen vorbei, doch auch wenn Nora den Blick gesenkt hielt, war ihr klar, dass man sie von Kopf bis Fuß musterte und genau überprüfte.
Um 6.15 Uhr wurde der Tag offiziell durch die ausländischen Arbeiter eingeläutet, die größtenteils Nigerianer waren und sich auf den Weg zu den Baustellen und Aushilfsjobs machten, wo man sie gnadenlos ausbeutete. Zur gleichen Zeit öffnete das erste Café seine Türen, und Nora und Maya setzten sich hinein. Wenn Nora jetzt Adam anrief, würde er sich nur unnötig Sorgen machen, und da ihnen nicht viel anderes übrig blieb, beschloss sie, sich weiterhin zu gedulden.
Um sieben Uhr ging ein übergewichtiger Mann um die sechzig ein erstes Mal am Café vorbei und schien nach jemandem Ausschau zu halten. Er sah müde aus, seine Jahre und sein Gewicht würden ihm mit zunehmender Hitze des Tages immer mehr zusetzen. Als er ein zweites Mal suchend vorbeiging, stand Nora auf und trat aus dem Café. Aber zuvor hatte Maya schwören müssen, sich nicht vom Tisch zu rühren. Die Kleine beobachtete ihre Mutter durch das Schaufenster. Diese stand zunächst in respektvollem Abstand vor dem Unbekannten, dann stemmte sie die Fäuste in die Hüften und steckte sich zweimal eine widerspenstige Haarsträhne unter ihr Kopftuch. Maya kannte diese Gesten und Haltung nur zu gut und folgerte daraus, dass sie auf ihrer Reise auf ein Hindernis gestoßen waren. Schließlich kam Nora zurück ins Café, ließ sich auf den Stuhl fallen und kramte in ihrer Tasche nach dem Handy.
»Fahren wir doch nicht weg?«, fragte Maya.
»Später, Maya, ich muss deinen Vater anrufen.«
Adam stand unter der Dusche, als sein Handy klingelte. Sie hatten vereinbart, dass Nora anrufen würde, sobald sie den Kontaktmann in Garabulli getroffen hatte. In einer Wolke aus Wasserdampf stieg er triefend aus der Dusche, und aus Angst, den Anruf zu verpassen, nahm er sich nicht die Zeit, in einen Bademantel zu schlüpfen. Er setzte sich nackt aufs Sofa, nahm ab und legte das Handy an die nassen Haare.
»Das Schiff, das die Überfahrt machen sollte, ist gestern von der italienischen Küstenwache konfisziert worden«, teilte Nora ihm mit.
»Verdammter Mist!«, fluchte Adam auf Französisch.
Um Maya nicht frühzeitig an grobe Ausdrücke und Schimpfworte zu gewöhnen, hatte Adam irgendwann angefangen, auf Französisch zu fluchen, und diese Marotte beibehalten.
»Ferouz bietet mir alternativ an, heute Abend in einem Schlauchboot mitzufahren. Er kennt die Leute. Vertraust du ihm, Adam?«
»Ferouz? Ich vertraue dem, der ihn mir vorgestellt hat, und jetzt? Wird Ferouz dich anderen Leuten vorstellen. Das ist ja nicht so ein Boot, wie wir es eigentlich ausgesucht hatten. Ich wollte, dass ihr innen sitzt, damit ihr bei Schlechtwetter geschützt seid, und während der gesamten Überfahrt bis nach Italien sollte jemand auf euch achtgeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach so, von heute auf morgen, zwei Plätze auf einem halbwegs ordentlichen Boot gefunden hat.«
»Er hat mir erklärt, dass die Typen mit dem Schlauchboot falsch gerechnet und zu viele Afghanen dabeihaben.«
»Und das ist ein Problem?«
»Offensichtlich. Sie versuchen, die Nationalitäten gut durchzumischen. Wenn es während der Überfahrt Schwierigkeiten gibt, neigen Passagiere aus einem Herkunftsland dazu, Gruppen zu bilden, um zu rebellieren und die Kontrolle an Bord an sich zu reißen. Sie werden also zwanzig Afghanen rausschmeißen, und stattdessen suchen sie jetzt noch Sudanesen oder Syrer. Das Gute an der Sache ist, dass sie ab Italien auch die Fahrt durch Europa bis nach Calais organisieren. Ich könnte dann vielleicht in dem berühmt-berüchtigten Dschungel auf dich warten, wo Frauen und Kinder geschützt sind? Das wäre sicherer, als in Italien zu bleiben, wo das Risiko besteht, dass ich kontrolliert und wieder nach Syrien zurückgeschickt werde. Es heißt, dass es im Lager von Calais keine Polizei gibt. Also, zumindest laut Ferouz.«
Nora hörte Adam am anderen Ende des Hörers vor Ratlosigkeit und Verdrossenheit laut atmen. Sie konnte sich bildlich vorstellen, wie er dasaß und angestrengt nachdachte.
»Nein«, entschied er schließlich. »Das bedeutet zu viele Veränderungen, zu viel Unvorhersehbares. Geh zurück ins Hotel und warte dort auf meinen Anruf. Ich werde etwas anderes finden.«
»Das wird schon gut gehen. Mach dir keine Sorgen um uns.«
»Das ist unmöglich, Nora.«
Adam wollte sich noch nach Maya erkundigen, da klingelte es an der Haustür, und sein Herz blieb kurz stehen.
»Ich muss jetzt los. Ich bitte dich inständig, mach keinen Umweg, geh direkt zurück ins Hotel, nimm nichts von niemandem an und hüte dich vor allem und jedem. Ich rufe dich in einer Stunde an.«
Beim zweiten Klingeln wickelte sich Adam ein Handtuch um die Hüften und beim dritten öffnete er die Tür. Ein uniformierter Soldat niedrigeren Ranges stand vor ihm.
»Hauptmann Sarkis?«
Adam nickte von oben herab, um seine Rolle zu wahren.
»Sie werden in Sektor 215 erwartet.«
Tarek. Hatte er gestanden? Folter hält kein Mensch durch. Sogar Unschuldige gestehen unter Folter Verbrechen, die sie gar nicht begangen haben. In Adams Kopf arbeitete es auf Hochtouren, aber er ließ sich nichts anmerken.
»Zwei Minuten. Ich ziehe mir die Uniform über.«
Er schloss die Tür. Dann entfernte er die Holzplatte vorm Warmwasserspeicher so vorsichtig wie möglich, um keine Geräusche zu machen, und holte sein geheimes Handy hervor. Nur wenige Zentimeter von ihm entfernt, wartete der Soldat auf der anderen Seite der Tür auf ihn. Mit angehaltenem Atem befestigte Adam die Platte vorsichtig wieder an ihrem Platz, eilte in die Küche und entfernte im Gehen die SIM-Karte aus dem Handy. In der Küche angekommen, öffnete er die Mikrowelle, legte die SIM-Karte hinein, stellte den Timer an und die Maximalleistung ein. Innerhalb von vier Sekunden begann die Karte sich zu verformen, schlug Funken, und sämtliche Informationen, die sich darauf befanden, wurden durch achthundert Watt vernichtet. Daraufhin warf er sie in den Mülleimer und zog seine Uniform an. Für den Fall, dass der Tag ein schlechtes Ende nahm, würde niemand diese Telefonleitung nachverfolgen können, die ihm den Kontakt mit seiner Zelle der Freien Syrischen Armee ermöglicht hatte.
Dann steckte er sein normales Handy ein und warf einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel, bevor er die Tür wieder öffnete.
»Ich bin bereit.«
5
Sektor 215 – Militärischer Geheimdienst.
Kommandozentrale.
Man hatte ihn nicht an diesen Ort zitiert, sondern hierher eskortiert. Ein feiner Unterschied. Hinzu kam, dass Tareks Verhör laut Plan nicht vor siebzehn Uhr begann, es aber noch nicht mal zehn Uhr war, als sie durch die ersten Kontrollschranken des Regierungsgebäudes in der Rue du 6 Mai in Damaskus fuhren.
Um sie herum Hotels, Boutiquen und gut besuchte Einkaufszentren, als gäbe es den ganzen anderen Rest nicht oder als handelte es sich um urbane Legenden. Ein Foltergefängnis? Mitten in der Stadt? Wer würde das für möglich halten?
Der obligate militärische Gruß. Passkontrolle. Ein Soldat musterte mit einem Teleskopspiegel die Unterseite des Wagens, um sicherzustellen, dass nirgendwo ein Sprengkörper angebracht war, während ein anderer den Innenraum inspizierte, bevor das Militärfahrzeug weiterfahren durfte. Sogar als der Wagen nicht den Weg zum Verhörraum einschlug, sondern zu den Büros der Offiziere und unteren Dienstgrade abbog, bewahrte Adam einen kühlen Kopf.
Die Eskorte, die falsche Uhrzeit und das falsche Ziel, zu viele Unstimmigkeiten, die insgesamt betrachtet ein unheilvolles Szenario ergaben. Für einen kurzen Moment sah Adam vor seinem geistigen Auge, wie er seine Pistole zückte, dem Fahrer eine Kugel in den Kopf verpasste, sich hinters Lenkrad warf und in der Hoffnung, dem Kugelhagel zu entkommen, in Richtung Ausgang bretterte. Während er den allerletzten Notfallplan so durchspielte, wurde ihm bewusst, dass er immer noch im Besitz seiner Waffe war. Vertraute man ihm doch noch genug, dass er sie behalten durfte? Wenn sie auch nur den geringsten Zweifel an ihm hätten, wäre er nicht schon am Eingang unschädlich gemacht worden? Adam versuchte, ruhiger zu atmen und sich nur noch auf seine Atmung zu konzentrieren.
Am Ziel angekommen, bedeutete der Soldat Adam, ihm zu folgen. Sie durchquerten mehrere Flure und Büros, bevor Adam sich im Warteraum des Generals wiederfand, der den Sektor 215 – eines der effizientesten Folterzentren des Landes – leitete und der vierundzwanzig Stunden zuvor Adam befohlen hatte, angesichts seiner mäßig erfolgreichen Methoden den Verhörraum zu verlassen.
Unter dem offiziellen Porträt des syrischen Präsidenten saß Adam auf einem unbequemen metallenen Stuhl und zählte die Sekunden, die jede für sich eine kleine Ewigkeit darstellten, bis sich die Tür zum Büro öffnete.
»Hauptmann Sarkis!«
Adam sprang wie von der Tarantel gestochen auf, korrigierte seine Haltung und antwortete:
»Zu Ihren Diensten, General Khadour.«
Der Ranghöhere reichte ihm als Antwort auf seine Begrüßung die Hand, strahlte ihn aus diesem heiteren und gutmütigen Gesicht mit rosigen Wangen an. Sein praller Bauch zeugte von einem Leben in Wohlstand.
»Nehmen Sie doch Platz in meinem Büro, Hauptmann Sarkis, wir haben uns viel zu erzählen, nicht wahr?«
Die Rollläden waren heruntergelassen, eine Zigarette schwelte im marmornen Aschenbecher, und an der hinteren Wand hing ein riesiges Schwarz-Weiß-Foto von Damaskus in den 1960er-Jahren. Adam blieb keine Zeit, mehr Einzelheiten im Raum auszumachen.
»Wenn ich den Bericht, den ich bekommen habe, richtig verstehe, wollen Sie beim Verhör eines Gefangenen anwesend sein?«, fragte Khadour.
»Das stimmt, mein General. Tarek Jebara.«
Der General kräuselte mit angewidertem Gesichtsausdruck die Nase, als hätte der Raum soeben eine Ladung Gülle abbekommen.
»Sie geben dem Gefangenen aber eine besondere Bedeutung, wenn Sie ihn beim Namen nennen. Gefangener 465, das klingt doch besser, oder?«
All diese Fragen dienten ausschließlich dem Zweck, ihn auszuhorchen, und Adam erkannte, dass der sympathische und herzliche Mann vor ihm nur seine Arbeit tat. Seit Monaten oder Jahren ging das so, mit jedem Gefangenen, Fragen wurden gestellt, Antworten mithilfe von Einschüchterung, Drohung und Gewalt herausgepresst, immer und immer wieder. Und heute war er dran.
»465, natürlich, mein General. Das Verhör ist heute Nachmittag, wenn ich richtig informiert bin.«
»Ja, das sind Sie. Hieb- und stichfeste Informationen haben Sie da«, fuhr der General belustigt fort. »Ihr Gefangener, der hatte solche allerdings weniger. Wir haben sein Verhör aus organisatorischen Gründen vorverlegt. Er hat es nicht überlebt. Ärgerlich, nicht wahr?«
Vor Adams Augen spielten sich zwei mögliche Varianten ab, wie sich seine Zukunft gestalten könnte. Entweder Tarek hatte geredet, oder er hatte dichtgehalten. Entweder Adam würde leben, oder er würde die nächsten Tage damit verbringen, General Khadours Fragen zu beantworten. Das Herz schlug ihm vor Angst bis zum Hals, seine Hände lagen auf den Armlehnen des Sofas, damit sie nicht verräterisch zitterten, aber er blieb weiterhin in seiner Rolle.
»Hat er wenigstens die Informationen ausgespuckt, nach denen wir gesucht haben?«, fragte Adam.
»Leider nicht wirklich. Der war ganz schön standhaft und zäh, hat mich beeindruckt. Er ist sogar in den Genuss einer Sonderbehandlung gekommen. Diese Ehre wird nur besonderen Gefangenen zuteil. 465 wäre ein Mann gewesen, den ich gern auf meiner Seite gewusst hätte. Obwohl wir uns so viel Mühe gegeben haben, hat er uns nur eine Sache gebeichtet.«
Der Satz hörte hier auf, und zum ersten Mal endeten seine Worte nicht mit einer Frage. Als wüsste er Bescheid.
Er wusste es, Adam war sich sicher.
»Da 465 jetzt tot ist, haben Sie wieder etwas mehr Luft in ihrem Zeitplan, und das würde ich mir gern zunutze machen. Sie haben doch nichts dagegen?«
Bevor Adam antworten konnte, ließ der General erst gar keine Zweifel an der Hackordnung aufkommen.
»Keine Sorge, ich habe Ihren Vorgesetzten schon verständigt. Sie stehen … Wie hat er es noch ausgedrückt?«
Er tat kurz so, als würde er nach Worten suchen, dann rief er aus: »… mir zur Verfügung! Genau! Er hat gesagt: ›Der Hauptmann steht Ihnen voll und ganz zur Verfügung.‹«
Das Schweigen, das nun einsetzte, war unerträglich. Der General zog einen Ordner zu sich heran, blätterte ihn von vorn bis hinten durch, bis er bei einem Dokument stoppte, an dessen obere Ecke ein Foto von Adam geheftet war.
»Der Vater Diplomat, Militärattaché für die französisch-syrischen Beziehungen«, las er vor, als würde er Adams Lebenslauf zum ersten Mal sehen. »Sechzehn Jahre bei der Polizei, davon zehn Jahre als Offizier. Dann bitten Sie 2012 um Ihre Versetzung zur Militärpolizei, der Sie seit vier Jahren die Ehre erweisen. Mehrere Auszeichnungen, eine Tapferkeitsmedaille sowie eine Verletzung während eines Einsatzes. Sie können stolz auf Ihre berufliche Laufbahn sein.«
Unbewusst strich Adam sich mit der Hand übers Gesicht, genau über die Stelle, wo eine tiefe Narbe in Form eines Kommas auf der linken Wange eingekerbt war. Ein Granatsplitter, stand in seiner Akte. Die Wirklichkeit war nicht weit davon entfernt gewesen. Ein mit einer Sprengladung versehenes Auto, während Adam gerade einen Kaffee zum Mitnehmen bestellte, die Explosionswelle drückte das Schaufenster ein, das Glas zerbarst und verwandelte sich in lauter Miniharpunen. Es gab sechs Tote. Er war Polizist. Und alles verlangte nach einem Helden für die Pressenachrichten des nächsten Tages. Von heute auf morgen wurde Adam zum Hauptmann befördert. Er war weder stolz auf seine Medaille noch auf seinen Dienstgrad geschweige denn auf seine Verletzung.
»Wissen Sie, was mich noch mehr beunruhigt als eine militärische Akte voller Suspendierungen, Tadel oder Mahnungen?«, fuhr der General fort. »Eine Akte, in der nichts dergleichen zu finden ist. Ich mag die Streber, die Klassenersten, die Lieblinge nicht. Hinter ihnen stecken oft Manipulatoren. Und zu allem Überfluss sind Sie auch noch ein Christ.«
»Zumindest können Sie sicher sein, dass ich kein Soldat des Islamischen Staats bin.«
General Khadour hob erstaunt eine Augenbraue und prustete vor Lachen los. Dabei ließ er Adam nicht aus den Augen. Mit prüfendem Blick fragte er ihn schließlich:
»Was wissen Sie über die Operation Pavel, Hauptmann Sarkis?«
Als Adam den Namen der Operation hörte, die er ins Leben gerufen hatte, legte er eine Selbstbeherrschung an den Tag, die ihn selbst überraschte, und mit gefasster Stimme antwortete er:
»Der Kommandant Pavel Oljenko ist ein militärischer Berater, den uns die mit uns verbündeten Russen geliehen haben. Eine der aktiven Zellen der Freien Syrischen Armee hat vor zwei Wochen versucht, ihn zu entführen, wir konnten jedoch nur eine Person identifizieren und festnehmen, und zwar Tarek … Entschuldigen Sie. Den Gefangenen 465. Ihre Einheit hat alles gemacht, um ihn zum Reden zu bringen. Bis heute Morgen.«
Adam erwähnte nicht den Teil, den er nicht wissen durfte. Dass Pavel Oljenko nämlich die Operationen der Russen in Tschetschenien geleitet hatte, Experte für chemische Waffen war und die syrische Regierung von seinem Wissen profitieren ließ. Wenn es ihnen gelungen wäre, Oljenko zu entführen und ihm vor laufender Kamera Geständnisse zu entlocken, dann hätten sie mit einem fulminanten Schlag der internationalen Öffentlichkeit beweisen können, dass Bachar el-Assad »schmutzige« Waffen gegen Rebellen und die Zivilbevölkerung einsetzte. Es wäre nur noch schwer vertretbar gewesen, seine Regierung weiterhin zu unterstützen. Wie ein Leprakranker wäre der Tyrann isoliert gewesen und seine Herrschaft wäre ins Wanken geraten. Das war der vielleicht etwas utopische Grundgedanke, der hinter der Operation Pavel steckte.
»Sie sind von Anfang an bei den Ermittlungen zur Entführung dabei gewesen«, fuhr Khadour fort. »Wie mir berichtet wurde, auf eigenen Wunsch. Was sich mir jedoch nicht erschließt, ist Ihr Ersuchen, bei den Verhören anwesend zu sein. Es kommt nicht oft vor, dass ein Offizier der Stabsleitung sich bis in die Kellergewölbe des Sektors 215 begibt.«
Seitdem Adam hier war, jonglierte er mit Kettensägen. Er wägte jedes Wort genau ab.
»Ihre Männer sind dafür bekannt, dass sie etwas übereifrig sind. Mein Ziel ist es nicht zu foltern, sondern Informationen zu bekommen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die eigentliche Informationsbeschaffung in den Hintergrund gerät. Bei allem nötigen Respekt Ihnen und Ihren Soldaten gegenüber, mein General.«
»Das ist der einzige Grund?«
Auf dem Schwarz-Weiß-Foto, das hinter seinem Vorgesetzten an der Wand hing, entdeckte Adam zwischen den ganzen verewigten Schaulustigen ein Pärchen, das sich bei der Hand hielt. Das Bild erinnerte nicht im Entferntesten an das Bild Le baiser von Robert Doisneau, das sein Vater ganz besonders mochte, aber es reichte aus, um ihn an Nora zu erinnern, die, wenn sie auf ihn gehört hatte, jetzt in ihrem Hotel in Tripolis in Sicherheit war.
»Hauptmann Sarkis?«
Adam war eine Sekunde zu lang abgedriftet.
»Ja, ich wüsste keinen anderen.«
Schweigend stand der General auf, und Adam tat es ihm gleich. Als sie das Büro verließen, warteten zwei bewaffnete Wächter auf sie. Adam berührte die Innentasche seiner Jacke und spürte die Wölbung seines Handys. Es würde nicht mehr lange dauern, bis der General seine Gutmütigkeit ablegte und sich wieder so zeigte, wie er ihn am Vortag kennengelernt hatte. In der Zwischenzeit war Adams Wohnung sicherlich von Soldaten durchsucht und auf den Kopf gestellt worden, stand der Name Sarkis auf sämtlichen Fahndungslisten und gefährdete somit Nora und Maya. Sie konnten es sich nicht mehr erlauben, auf ihn zu warten. Ein Anruf. Einen einzigen Anruf musste er machen, damit sie, koste es, was es wolle, so schnell wie möglich Nordafrika verließen.
Als sie wieder draußen standen, wartete der Wagen, der sie auch hierhergebracht hatte, mit laufendem Motor auf sie. Die Soldaten setzten sich nach vorn, nachdem sie ihren Offizieren die Türen geöffnet hatten. Adam und der General, die hinten saßen, hatten das Gespräch immer noch nicht wiederaufgenommen, falls man diese kryptischen Wortwechsel überhaupt als Gespräch bezeichnen konnte.
»Militärflughafen«, befahl Khadour.
Ein Geländewagen fuhr vor ihnen und einer hinter ihnen. Der General war immer mit mindestens zwei Wagen Geleitschutz unterwegs. So fuhren sie im Konvoi und mit heulenden Sirenen die zweiundzwanzig Kilometer bis zu ihrem Ziel.
Auf einem der Rollfelder, die kein Ende zu haben schienen und auf denen vereinzelt Gräser sprossen, bremste der Fahrer vor einem geschlossenen Hangar, der etwa dreißig Meter lang und zehn Meter breit war. Es war so heiß, dass der Horizont Wellen schlug, wie Benzinausdünstungen, die kurz davor sind, in Flammen aufzugehen. Ein kleiner Vorgeschmack auf die Hölle.
Der General stieg aus dem Auto, und als Adam es ihm gleichtun wollte, stellte er fest, dass seine Tür verschlossen war. Im Gleichschritt folgten die zwei Soldaten ihrem Vorgesetzten, und Adam blieb allein im Auto eingesperrt zurück. Seine Chancen, das Ende des Tages noch zu erleben, schätzte er gleich null ein, und er konzentrierte sich jetzt auf Nora und Maya. So unauffällig wie möglich tastete er in seiner Jacke nach dem Handy, zog es heraus und tippte eine SMS.
»Hör auf Ferouz. Verschwindet. So schnell wie möglich. Geht nach Calais. Setz dich mit deinem Cousin in Verbindung. Er wird wissen, was zu tun ist. Ich liebe dich.«
Dann drückte Adam einige Tasten und löschte aus Sicherheitsgründen sämtliche Nummern und Nachrichten auf seinem Handy. Gerade als er es wieder einsteckte, öffnete sich die Tür auf seiner Seite. Gluthitze wie aus einem Backofen strömte ins Autoinnere. Ein Soldat forderte Adam auf, ihm zu folgen.
Sie hielten vor einem metallenen Wandschrank, der vorm Hangar angebracht war und vier Reihen mit nummerierten Spinden beherbergte. Während der Soldat den ihm nächsten Spind öffnete, hielt Adam vergeblich nach dem General Ausschau.
»Pistole und Handy, mein Hauptmann.«
Adam leistete dem Befehl Folge, dann öffneten sich die zwei Tore des Hangars mit einem metallischen Knarzen in einer Langsamkeit, die Adam sehr entgegenkam. Er warf einen Blick auf seine Uhr. 11.35 Uhr. Um diese Uhrzeit war Maya geboren. Er dankte dem Himmel für das Leben, das er geschenkt bekommen hatte, wie auch immer es zu Ende gehen würde.
6
Hafenstadt Garabulli – Libyen.
14 Uhr.
Nora hatte Maya nur gesagt, dass ihr Vater später nachkommen würde, und die Kleine hatte mit Blick auf die bleiche Gesichtsfarbe ihrer Mutter so getan, als würde sie es glauben.
Dieses Mal wartete Ferouz in dem Café auf sie, wo sie sich früher am Morgen getroffen hatten. Er schwitzte und trank mit einem Zug das Glas Wasser aus, das zusammen mit dem dampfenden Tee serviert worden war, verschluckte sich und bekam erst nach zwei unschönen Rülpsern wieder richtig Luft. Zu seinen Füßen stand eine prall gefüllte Plastiktüte. Nora stöpselte einen Kopfhörer in ihr Smartphone, steckte die Ohrstöpsel in Mayas kleine Ohren und stellte A vava inouva auf Dauerschleife, das Lied, das Maya schon durch ihre ganze Kindheit musikalisch begleitete.
»Sie sehen schlecht aus«, bemerkte Ferouz besorgt.
Nora antwortete nicht darauf.
»Ich habe die Bestätigung erhalten«, redete er weiter. »Es geht am frühen Abend bei Sonnenuntergang los. Ein Schlauchboot aus den Armeebeständen der libyschen Armee mit Platz für zweihundert Personen.«
»So viele?«, fragte Nora besorgt.