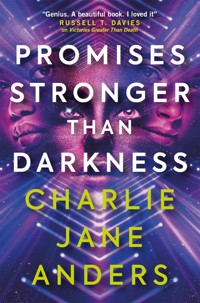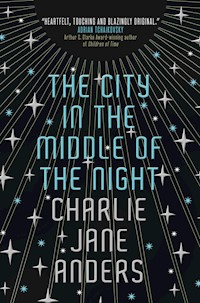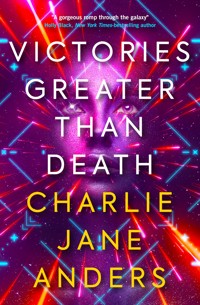12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Tor
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
›Alle Vögel unter dem Himmel‹ von Charlie Jane Anders ist vieles: ein magischer Science-Fiction-Roman, eine unvergessliche Liebesgeschichte zwischen einer Hexe und einem Nerd – und eine feinsinnige Bestandsaufnahme des modernen Lebens. Patricia Delfine merkt früh, dass sie eine Hexe ist. Schließlich kann sie mit den Vögeln sprechen – oder konnte es früher zumindest einmal (an jenem warmen Sommertag). Laurence Armstead ist ein Nerd: Schon als Highschool-Schüler erfindet er in seinem Kinderzimmer eine Zeitmaschine, die es ihm erlaubt, zwei Sekunden in die Zukunft zu reisen. Obwohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten, werden sie schnell Freunde. Gegen Ende der Schulzeit verlieren sie sich aus den Augen, nur um sich einige Jahre später in San Francisco wiederzutreffen: Doch der Zeitpunkt ist denkbar ungünstig: Die Welt wird gerade von einer ökologischen Katastrophe heimgesucht: Ganze Regionen versinken im Meer, Flüchtlingsströme durchziehen die Welt. Wissenschaftler wie Hexen suchen nach einem Ausweg, können sich jedoch nicht einigen. Laurence und Patricia finden sich auf unterschiedlichen Seiten der Auseinandersetzung wieder und müssen sich fragen: Wem können wir trauen, wenn die Welt aus den Fugen gerät, dem Verstand oder dem Gefühl? »Was für ein großartiges Buch! Eine wunderbare Synthese aus Magie und Technik, Freude und Leid, Romantik und Weisheit. Ein absolutes Muss.« Lev Grossman Für Leser von Michael Chabon, Jonathan Lethem und Armistead Maupin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Charlie Jane Anders
Alle Vögel unter dem Himmel
Roman
Über dieses Buch
Wem können wir trauen, wenn die Welt aus den Fugen gerät: dem Verstand oder dem Gefühl?
Patricia ist eine Hexe, die mit Tieren sprechen kann, und Laurence ist ein Computergenie, das schon in der Highschool eine Zeitmaschine erfindet. Beide sind Außenseiter (»Emo-Bitch!«, »Nerd!«) und werden schnell Freunde fürs Leben. Als einige Jahre später die Welt von einer ökologischen Katastrophe heimgesucht wird und nicht nur die Wissenschaftler, sondern auch die Hexen nach einem Ausweg suchen, finden sie sich jedoch auf unterschiedlichen Seiten der Auseinandersetzung wieder. Ist ihre Freundschaft stärker als alles andere? Birgt sie gar den Schlüssel dafür, die Krise zu überwinden? Eine ebenso kluge wie gefühlvolle Geschichte über das Ende der Welt – und den Beginn einer neuen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Charlie Jane Anders ist eine US-amerikanische Bloggerin, Autorin und Redakteurin für das Internet-Magazin io9. Für ihre Kurzgeschichte ›Six Months, Three Days‹ wurde sie mit dem Hugo-Award ausgezeichnet. ›Alle Vögel unter dem Himmel‹ ist ihr erster Roman.
Sophie Zeitz übersetzt unter anderem John Green, Lena Dunham und Marina Lewycka. Sie lebt in Berlin.
Weitere Informationen finden Sie auf www.tor-online.de und www.fischerverlage.de
Inhalt
Widmung
Motto
Buch eins
Kapitel 1
Kapitel 2
Buch zwei
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Buch drei
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Buch vier
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Danksagung
Für Annalee
Beim Spiel des Lebens und der Evolution sitzen drei Spieler am Tisch: die Menschen, die Natur und die Maschinen. Ich bin entschieden auf der Seite der Natur: Die Natur aber ist, vermute ich, auf der Seite der Maschinen.
GEORGE DYSON, Darwin im Reich der Maschinen
Buch eins
Kapitel 1
Als Patricia sechs Jahre alt war, fand sie einen verletzten Vogel im Wald. Flatternd saß der Spatz im nassen roten Laub, das sich in der Kuhle zwischen zwei Wurzeln gesammelt hatte, und schwenkte den gebrochenen Flügel. Er schrie in einem Ton, der fast zu hoch für Patricias Ohren war. Sie blickte den Sperling an und sah die Angst in seinen schwarz umrandeten Augen. Mehr als Angst – Verzweiflung, als wüsste er, dass ihm der Tod bevorstand. Patricia hatte zwar noch nicht verstanden, wie das Leben für immer aus einem lebenden Wesen weichen kann, aber sie verstand, dass sich dieser Vogel mit allem, was er hatte, dagegen wehrte.
Patricia gelobte von ganzem Herzen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um den Vogel zu retten. Und das führte dazu, dass Patricia eine Frage gestellt bekam, auf die es keine richtige Antwort gab, was sie fürs Leben zeichnete.
Sie hob den Spatz ganz vorsichtig mit einem trockenen Blatt auf und setzte ihn in ihren roten Plastikeimer. Die schräge Nachtmittagssonne fiel auf die Eimerwand und badete den Vogel in rotes Licht, so dass er radioaktiv zu strahlen schien. Der Vogel flatterte immer noch, versuchte, mit einem Flügel wegzufliegen.
»Ganz ruhig«, flüsterte Patricia. »Ich hab dich. Alles wird gut.«
Patricia hatte schon öfter Tiere in Not gesehen. Roberta, ihre ältere Schwester, fing gern Waldtiere ein und spielte mit ihnen. Sie warf Frösche in den rostigen Mixer, den ihre Mutter ausrangiert hatte, oder steckte Mäuse in ihren selbstgebauten Raketenwerfer, um zu sehen, wie weit sie flogen. Aber dies war das erste Mal, dass Patricia ein leidendes Tier anschaute und seine Not wirklich sah, und jedes Mal, wenn sie ihm ins Auge blickte, gelobte sie wieder, den Vogel unter ihren Schutz zu nehmen.
»Was hast du da?«, fragte Roberta, die in der Nähe durchs Unterholz trampelte.
Beide Schwestern hatten blasse Haut, Stupsnasen und dunkelbraunes Spaghetti-Haar, egal, was sie damit anstellten. Aber Patricia war ein scheuer Wildfang mit einem runden Gesicht, grünen Augen und ewigen Grasflecken an den Knien ihrer zerrissenen Latzhose. Sie war jetzt schon auf dem besten Weg, eins der Mädchen zu werden, neben denen niemand sitzen wollte, weil sie zu rastlos war, schräge Witze machte und bei jedem geplatzten Luftballon zu heulen anfing (nicht nur bei ihren eigenen). Roberta hatte braune Augen, ein spitzes Kinn und die perfekte Haltung, wenn sie in ihrem makellosen weißen Kleid ohne zu zappeln auf einem Erwachsenenstuhl saß. Eigentlich hatten ihre Eltern sich Jungs gewünscht, und sie hatten die Namen schon vor der Geburt ausgewählt. Dann hatten sie bei beiden einfach ein -a angehängt.
»Ich hab einen verletzten Vogel gefunden«, sagte Patricia. »Er hat einen gebrochenen Flügel und kann nicht mehr fliegen.«
»Ich wette, ich kann ihn fliegen lassen«, entgegnete Roberta, und Patricia wusste, dass sie an ihren Raketenwerfer dachte. »Gib ihn her. Ich mach ihm Feuer unterm Hintern.«
»Nein!« Patricia schossen die Tränen in die Augen und sie rang nach Luft. »Das darfst du nicht!« Dann rannte sie los, schlingernd, mit dem Eimer in der Hand. Hinter sich hörte sie ihre Schwester, das Knacken der Äste. Patricia rannte, so schnell sie konnte, nach Hause.
Das Haus war vor hundert Jahren eine Gewürzhandlung gewesen, und es roch immer noch nach Zimt und Kurkuma und Safran und Knoblauch und ein wenig nach Schweiß. Händler aus Indien, China und dem Rest der Welt hatten die perfekt gebeizten Dielen betreten und Gewürze aus aller Herren Länder gebracht. Wenn Patricia tief einatmete und die Augen schloss, sah sie vor sich, wie mit Folie ausgeschlagene Holzkisten hereingetragen wurden, mit Stempeln aus Städten wie Marrakesch und Bombay. Ihre Eltern hatten das Haus gekauft, nachdem sie in einer Designzeitschrift einen Artikel über das Renovieren alter Kolonialgebäude gelesen hatten, und jetzt schimpften sie ständig, bis die Adern auf ihrer Stirn anschwollen, dass Patricia nicht herumrennen und das perfekte Eichenfurnier zerkratzen durfte. Patricias Eltern gehörten zu den Leuten, die gleichzeitig stinksauer und bester Laune sein konnten.
Patricia blieb auf einer kleinen Lichtung kurz vor dem Gartentor stehen. »Ganz ruhig«, sagte sie zu dem Vogel. »Ich nehme dich mit nach Hause. Auf dem Dachboden steht ein alter Vogelkäfig. Ich weiß, wo er ist. Es ist ein hübscher Käfig mit einer Stange und einer Schaukel. Da setze ich dich rein und sage meinen Eltern Bescheid. Falls dir irgendwas passiert, halte ich die Luft an, bis ich tot umfalle. Ich passe auf dich auf. Das verspreche ich dir.«
»Nein!«, tschilpte der Vogel. »Bitte nicht! Sperr mich nicht ein. Dann bring mich lieber gleich um.«
»Aber …«, stotterte Patricia, mehr überrascht, dass der Vogel protestierte, als dass er zu ihr sprach. »Ich passe doch auf. Ich bringe dir Käfer und Körner oder andere Sachen.«
»Für jemand wie mich ist Gefangenschaft noch schlimmer als der Tod«, zwitscherte der Vogel. »Hör zu. Du verstehst mich, wenn ich rede, oder? Das heißt, du bist ein besonderer Mensch. Eine Hexe! Oder so was Ähnliches. Und das heißt, du hast die Pflicht, das Richtige zu tun! Bitte.«
»Oh.« Patricia musste sich erst mal setzen. Sie fand eine knorrige Baumwurzel, deren dicke Rinde sich feucht anfühlte und fast wie schroffer Fels. Auf der nächsten Lichtung hörte sie Roberta mit einem gegabelten Stock auf Gebüsch und Boden einschlagen und fürchtete sich, was passierte, falls Roberta sie entdeckte. »Aber«, flüsterte Patricia leise, damit Roberta sie nicht aufspürte, »dein Flügel ist gebrochen, und ich muss etwas tun; sonst bist du verloren.«
»Hm.« Der Spatz schien einen Moment nachzudenken. »Du weißt nicht zufällig, wie man einen gebrochenen Flügel heilt, oder?« Er hielt den verletzten Flügel hoch. Auf den ersten Blick hatte der Vogel graubraun gewirkt, doch als Patricia näher hinsah, bemerkte sie rote und gelbe Streifen an seinen Flügeln, sein Bauch war milchweiß, und der Schnabel war dunkel und leicht gezahnt.
»Nein. Keine Ahnung. Tut mir leid.«
»Schon gut. Du kannst mich auf einen Ast setzen und das Beste hoffen, aber wahrscheinlich werde ich gefressen oder verhungere.« Er wackelte mit dem Kopf. »Oder … na ja. Es gibt noch eine Möglichkeit.«
»Welche?« Patricia starrte ihre Knie durch die ausgefransten Löcher ihrer Latzhose an und fand, sie sahen aus wie seltsame Eier. »Welche Möglichkeit?« Der Spatz im Eimer musterte sie mit einem Auge, als versuchte er abzuschätzen, ob er ihr vertrauen konnte.
»Also«, tschilpte der Vogel, »du könntest mich zum Parlament der Vögel bringen. Die können Flügel reparieren, kein Problem. Und wenn du mal eine Hexe werden willst, ist es sowieso gut, wenn du sie kennenlernst. Es sind die klügsten Vögel weit und breit. Sie treffen sich auf dem stattlichsten Baum im Wald, und die meisten sind schon über fünf Jahre alt.«
»Ich bin älter!«, sagte Patricia. »Ich bin fast sieben. Noch vier Monate. Oder fünf.« Sie hörte, dass Roberta näher kam, also packte sie den Eimer und rannte weiter, tiefer in den Wald hinein.
Der Sperling, der Dirrpidirrpiwheepalong hieß – oder kurz Dirrp –, versuchte, Patricia so gut es ging den Weg zum Parlament der Vögel zu erklären, aber er konnte in seinem Eimer nichts sehen, und die Orientierungspunkte, die er nannte, ergaben für Patricia keinen Sinn. Sie musste an die gemeinschaftsbildenden Übungen in der Schule denken, bei denen sie völlig versagte, seit ihre einzige Freundin Kathy weggezogen war. Irgendwann nahm sie Dirrp auf den Finger, und er hüpfte auf ihre Schulter.
Die Sonne ging unter. Der Wald war so dicht, dass man Mond und Sterne kaum sah, und Patricia stolperte mehrmals und fiel hin, schürfte sich Hände und Knie auf und machte ihre Latzhose noch schmutziger. Dirrp klammerte sich so fest an den Latzhosenträger, dass sich seine Krallen in ihre Haut bohrten. Er wusste immer weniger, wo es langging, auch wenn er glaubte, der große Baum stünde in der Nähe eines Bachs oder vielleicht eines Felds. Auf jeden Fall war er überzeugt, dass der Baum besonders dick war und ein wenig abseits der anderen Bäume stand, und wenn man ihn aus dem richtigen Winkel ansah, wirkten die zwei mächtigen Äste, die er zum Himmel streckte, wie ausgebreitete Schwingen. Außerdem konnte Dirrp die Richtung ganz einfach am Stand der Sonne ablesen. Nur dass die Sonne längst untergegangen war.
»Wir haben uns verirrt«, stellte Patricia schaudernd fest. »Wahrscheinlich kommt ein Bär und frisst uns auf.«
»Ich glaube nicht, dass es hier Bären gibt«, gab Dirrp zurück. »Und falls doch einer kommt, kannst du versuchen, es ihm auszureden.«
»Kann ich mit allen Tieren sprechen?« Die Fähigkeit wäre nützlich, zum Beispiel um Mary Fenchurchs Pudel zu überreden, Mary zu beißen, wenn sie wieder mal fies zu Patricia war. Oder falls das nächste Kindermädchen, das ihre Eltern einstellten, ein Haustier hätte.
»Keine Ahnung«, antwortete Dirrp. »Mir erklärt ja keiner was.«
Patricia beschloss, auf den nächsten Baum zu klettern und sich von oben umzusehen. Vielleicht entdeckte sie einen Weg. Oder ein Haus. Oder irgendeinen Orientierungspunkt, der Dirrp bekannt vorkam.
In der Krone der alten hohen Eiche, die Patricia hochgekraxelt war, war es viel kälter als am Boden. Der Wind fuhr ihr unangenehm unter die Kleidung. Dirrp hatte den Kopf unter den gesunden Flügel gesteckt, und sie musste ihn überreden, sich umzusehen. »Wenn es sein muss«, tschilpte er. »Mal sehen, was ich erkenne. Auch wenn das hier keine Vogelperspektive ist. Die Vogelperspektive ist viel, viel höher. Das hier ist höchstens Eichhörnchenperspektive.«
Dirrp sprang von ihrer Schulter und hüpfte von Zweig zu Zweig, bis er einen Baum entdeckte, den er für einen Wegweiser zum Parlament der Vögel hielt. »So weit ist es gar nicht.« Er klang schon etwas fröhlicher. »Aber wir müssen uns beeilen. Meistens tagen sie nicht die ganze Nacht, außer sie führen eine schwierige Debatte. Oder es ist Fragestunde. Aber hoffen wir für dich, dass nicht Fragestunde ist.«
»Was ist Fragestunde?«
»Das willst du nicht wissen«, zwitscherte Dirrp.
Von einem Baum herunterzuklettern ist viel schwieriger als hinaufzukommen, was Patricia unfair fand. Mehrmals verlor sie fast den Halt, und es ging an die vier Meter hinunter.
»Hey, Vogel!«, rief eine Stimme aus der Dunkelheit, als Patricia wieder festen Boden unter den Füßen hatte. »Komm her, Vogel. Ich will nur mal beißen.«
»Auch das noch«, piepste Dirrp.
»Ich verspreche dir auch, dass ich nicht zu lang mit dir spiele«, sagte die Stimme. »Es macht Spaß. Du wirst sehen.«
»Wer ist das?«, fragte Patricia.
»Tommington«, sagte Dirrp. »Der Kater. Er wohnt bei Menschen, aber er kommt immer in den Wald und tötet viele meiner Freunde. Im Parlament haben sie schon oft darüber debattiert, was sich gegen ihn tun lässt.«
»Oh«, sagte Patricia. »Ich habe keine Angst vor einem Kätzchen.«
Im selben Augenblick sprang Tommington wie eine haarige Rakete von einem Ast auf Patricias Rücken. Mit ausgefahrenen Krallen. Patricia schrie auf und fiel fast vornüber. »Runter von mir!«, rief sie.
»Gib mir den Vogel!«, sagte Tommington drohend.
Der dicke schwarze Kater mit dem weißen Bauch wog fast so viel wie Patricia. Mit gebleckten Zähnen fauchte er ihr ins Ohr und kratzte sie.
Instinktiv legte Patricia die Hand um den armen Dirrp, der sich verzweifelt an ihrem Hosenträger festklammerte, dann beugte sie sich mit Schwung nach vorn, bis sie mit der Nase fast die Knie berührte. Keifend flog der Kater von ihrem Rücken.
»Halt die Klappe und lass uns in Ruhe«, erklärte Patricia.
»Du kannst sprechen! Ich habe noch nie einen sprechenden Menschen gesehen. Her mit dem Vogel!«
»Nein«, sagte Patricia. »Ich weiß, wo du wohnst. Ich kenne deine Besitzer. Wenn du böse bist, sag ich ihnen Bescheid. Ich erzähle ihnen alles.« In Wirklichkeit bluffte sie nur. Sie wusste überhaupt nicht, wem Tommington gehörte. Aber vielleicht wusste es ihre Mutter. Und wenn Patricia zerkratzt und zerbissen nach Hause käme, wäre ihre Mutter stinksauer. Auf Patricia, aber auch auf Tommingtons Besitzer. Und es war nicht schön, Patricias Mutter gegen sich zu haben. Sie war häufig wütend, und sie war gut darin.
Tommington war auf den Füßen gelandet, das Fell gesträubt, die Ohren wie Pfeile aufgestellt. »Gib den Vogel her!«, fauchte er.
»Nein!«, rief Patricia. »Böser Kater!« Sie warf einen Stein nach ihm. Er jaulte. Dann warf sie noch einen Stein, und er rannte davon.
»Komm«, sagte sie zu Dirrp, der wenig tun konnte. »Lass uns verschwinden.«
»Der Kater darf auf keinen Fall erfahren, wo der Parlament-Baum ist«, flüsterte Dirrp. »Es wäre eine Katastrophe, wenn er uns folgt und ihn findet. Wir müssen im Kreis gehen und so tun, als hätten wir uns verirrt.«
»Wir haben uns verirrt«, gab Patricia zurück.
»Ich habe eine gute Ahnung, wo wir ungefähr hinmüssen«, sagte Dirrp. »Jedenfalls so eine Art Gefühl.«
Plötzlich raschelte es hinter einem großen Baum in der Nähe, und im Mondlicht leuchtete ein Augenpaar im Gebüsch auf, gerahmt von weißem Pelz mit einer Halsbandmarke.
»Wir sind geliefert!«, fiepte Dirrp verzweifelt. »Der Kater wird uns ewig nachschleichen. Du kannst mich gleich deiner Schwester ausliefern. Wir können nichts dagegen tun.«
»Warte mal.« Patricia erinnerte sich an etwas, das sie mal über Katzen und Bäume gelernt hatte. Etwas, das in einem Bilderbuch stand. »Halt dich fest, Vogel. Halt dich gut fest, ja?« Statt einer Antwort krallte sich Dirrp fester in Patricias Latzhosenträger. Patricia suchte sich einen Baum aus, dessen Äste stark genug aussahen, und fing zu klettern an. Jetzt war sie noch müder, und ihre Füße rutschten ein paarmal ab. Einmal zog sie sich mit beiden Händen auf den nächsten Ast, und dann war Dirrp verschwunden. Sie bekam einen Riesenschreck und beruhigte sich erst, als der Spatz nervös das Köpfchen über ihre Schulter reckte und klarwurde, dass er sich nur weiter hinten am Träger festgehalten hatte.
Dann waren sie endlich oben im Wipfel, der sich im Wind wiegte. Tommington war ihnen nicht gefolgt. Patricia sah sich zweimal in alle Richtungen um, bis sie seine runde, pelzige Gestalt am Boden in der Nähe des Baumstamms entdeckte.
»Blöder Kater!«, rief sie ihm zu. »Blöder Kater! Du kriegst uns nicht!«
»Du bist der erste sprechende Mensch, der mir begegnet«, miaute Tommington. »Und du denkst, ich wäre blöd? Grraah! Gleich lernst du meine Krallen kennen!«
Der Kater, der das Klettern wahrscheinlich an einem Kletterbaum im Wohnzimmer gelernt hatte, krallte sich in den Stamm, sprang auf den ersten Ast und dann auf den nächsten. Es dauerte nicht lang, und er war fast oben.
»Wir sitzen in der Falle! Was hast du dir bloß dabei gedacht?«, zwitscherte Dirrp.
Patricia wartete, bis Tommington die Baumkrone erreichte, dann schwang sie sich auf der anderen Seite hinunter, ließ sich von Ast zu Ast gleiten, so schnell, dass sie sich fast die Schulter auskugelte, und landete schließlich ächzend auf dem Hinterteil am Boden.
»Hey«, rief Tommington aus der Baumkrone, wo seine großen Augen das Mondlicht reflektierten. »Wo seid ihr? Kommt zurück!«
»Du bist ein gemeiner Kater«, antwortete Patricia. »Du bist ein Fiesling, und deshalb bleibst du, wo du bist. Denk darüber nach, was du getan hast. Es ist nicht nett, gemein zu sein. Ich sorge dafür, dass morgen jemand kommt und dich holt. Aber heute Nacht kannst du da oben bleiben. Ich habe zu tun. Auf Wiedersehen.«
»Wartet!«, rief Tommington verzweifelt. »Ihr könnt mich doch nicht hierlassen. Es ist zu hoch! Ich hab Angst! Kommt zurück!«
Aber Patricia blickte sich nicht mehr um. Tommingtons Geschrei war noch lange zu hören, bis sie eine große Baumlinie überquerten. Danach verirrten sie sich noch zweimal, und Dirrp weinte in seinen gesunden Flügel, doch dann stolperten sie endlich über den Weg, der zu dem geheimen Baum führte. Es ging einen steilen, anstrengenden Pfad hinauf, voller heimtückischer Wurzeln.
Patricia sah erst die Krone des Parlament-Baums, dann schien er aus der Landschaft zu wachsen, und je näher sie kamen, desto größer und überwältigender wurde er. Wie Dirrp gesagt hatte, sein Umriss erinnerte an einen Vogel, der statt Gefieder dunkle, knorrige Äste hatte mit Laubwedeln, die bis zum Boden reichten. Der Baum ragte vor ihnen in den Himmel wie eine Kathedrale. Oder wie eine mittelalterliche Burg. Patricia hatte noch nie eine mittelalterliche Burg gesehen, aber genauso stellte sie sich eine vor.
Bei ihrer Ankunft flatterten hundert Paar Flügel auf, dann wurde es plötzlich ganz still. Vögel in den verschiedensten Formen und Farben zogen sich ins Laub zurück.
»Alles ist gut«, rief Dirrp. »Der Mensch gehört zu mir. Ich habe mir den Flügel gebrochen. Sie hat mich hergebracht, um mich zu retten.«
Die Antwort war ein langes Schweigen. Dann erhob sich aus der Nähe des Wipfels ein Adler mit weißgefiedertem Kopf, gekrümmtem Schnabel und blassen, stechenden Augen. »Du hättest sie nicht herbringen dürfen«, rief der Adler.
»Tut mir leid, Ma’am«, gab Dirrp zurück. »Aber sie ist gut. Sie kann sprechen. Sie kann wirklich sprechen.« Dirrp drehte den Kopf und flüsterte Patricia ins Ohr: »Zeig’s ihnen. Los, zeig’s ihnen!«
»Ähem … hallo«, sagte Patricia. »Tut mir leid, wenn ich störe. Wir brauchen eure Hilfe!«
Als die Vögel den Mensch sprechen hörten, fingen alle an, laut durcheinanderzuzwitschern, zu kollern und zu krähen, bis eine große Eule, die nicht weit von der Adlerin saß, mit einem Stein auf den Ast klopfte und »Ruhe, Ruhe!« rief.
Die Adlerin reckte den flauschigen Kopf, um Patricia näher anzusehen. »Du sollst wohl die neue Hexe des Waldes werden, oder?«
»Ich bin keine Hexe.« Patricia nagte an ihrem Daumen. »Ich bin eine Prinzessin.«
»Hexe wäre besser.« Der große dunkle Körper der Adlerin verlagerte das Gewicht. »Sonst hätte Dirrp gegen das Gesetz verstoßen, als er dich herbrachte, und müsste bestraft werden. Und dann könnten wir natürlich nicht seinen Flügel heilen.«
»Oh«, sagte Patricia. »Dann bin ich wohl doch eine Hexe. Glaube ich.«
»Aha.« Die Adlerin schnalzte mit dem gekrümmten Schnabel. »Das musst du erst beweisen. Oder ihr werdet beide bestraft, du und Dirrp.«
Das klang nicht gut. Andere Vögel meldeten sich und riefen: »Verfahrensfrage«, und eine nervöse Krähe zählte wichtige Punkte des parlamentarischen Protokolls auf. Ein Vogel war so hartnäckig, dass die Adlerin dem Ehrenwerten Herrn der Breiten Eiche den Ast überlassen musste – der allerdings inzwischen vergessen hatte, was er sagen wollte.
»Wie soll ich beweisen, dass ich eine Hexe bin?« Patricia überlegte, ob sie weglaufen konnte. Doch Vögel flogen ziemlich schnell, oder? Wahrscheinlich war es schwer, einen ganzen Vogelschwarm abzuhängen, vor allem wenn die Vögel wütend waren. Und über übersinnliche Fähigkeiten verfügten.
»Nun ja.« Auf einem der unteren Äste saß ein riesiger Truthahn. Die roten Hautlappen unter seinem Schnabel erinnerten an das Rüschenhemd eines Richters. Er richtete sich auf und schien ein paar Zeichen in der Baumrinde zu studieren, bevor er sich umdrehte und ein lautes gelehrtes »Glrp« kollerte. »Nun ja«, wiederholte er, »die Literatur erkennt verschiedene Methoden an. Da gibt es mehrere Todesproben, aber die sollten wir vielleicht erst mal überspringen. Dann gibt es gewisse Rituale, aber dafür ist ein Mindestalter nötig. Ach ja, das hier ist gut. Wir stellen ihr die Unendliche Frage.«
»Ohooh, die Unendliche Frage«, gackerte ein Raufußhuhn. »Wie aufregend.«
»Ich hab noch nie gehört, dass jemand die Unendliche Frage beantworten musste«, krächzte ein Habicht, »das ist ja besser als Fragestunde.«
»Äh«, mischte sich Patricia ein, »dauert das mit der Unendlichen Frage lange? Meine Eltern machen sich bestimmt schon Sorgen.« Ihr war siedend heiß eingefallen, dass es längst nach Bettzeit war, und sie war ohne Abendessen hier draußen im eiskalten Wald, ganz davon abgesehen, dass sie sich verirrt hatte.
»Zu spät«, rief das Raufußhuhn.
»Wir stellen dir die Frage«, sagte die Adlerin.
»Hier kommt die Unendliche Frage«, kollerte der Truthahn. »Ist ein Baum rot?«
»Hm«, sagte Patricia. »Könnt ihr mir einen Tipp geben? Puh. Meint ihr ›Rot‹, die Farbe?« Die Vögel antworteten nicht. »Kann ich mehr Zeit haben? Ich verspreche euch, dass ich antworte, aber ich brauche Zeit zum Nachdenken. Bitte. Ich brauche mehr Zeit. Bitte?«
Das Nächste, woran Patricia sich erinnerte, war, dass ihr Vater sie in die Arme schloss. Er hatte sein Kartoffeldruck-T-Shirt an, und sein roter Bart kitzelte sie im Gesicht, und er ließ sie mehrmals beinahe fallen, weil er mit den Händen versuchte, komplizierte Bewertungsformeln aufzuzeichnen, während er sie trug. Doch es war so tröstlich und wunderbar, von ihrem Papa nach Hause getragen zu werden, dass es Patricia nichts ausmachte.
»Ich habe sie gleich hier am Waldrand gefunden«, sagte ihr Vater zu ihrer Mutter. »Sie muss sich verirrt haben, aber dann hat sie den Weg anscheinend selbst gefunden. Es ist ein Wunder, dass ihr nichts passiert ist.«
»Du hast uns zu Tode geängstigt. Wir haben dich gesucht, und alle Nachbarn auch. Glaubst du, ich habe nichts Besseres zu tun? Deinetwegen habe ich die Deadline für eine Manager-Produktivitätsanalyse versäumt.« Patricias Mutter trug ihr dunkles Haar in einem straffen Knoten, wodurch ihr Kinn und ihre Nase noch spitzer aussahen. Sie hatte die knochigen Schultern fast bis zu den antiken Ohrringen hochgezogen.
»Ich würde einfach gern verstehen, was hier los ist«, sagte ihr Vater. »Was haben wir falsch gemacht, dass du dich so benimmst?« Roderick Delfine war ein genialer Immobilien-makler und arbeitete viel von zu Hause, um sich um Roberta und Patricia zu kümmern, wenn das Kindermädchen wieder mal gekündigt hatte. Dann saß er am Frühstückstresen und vergrub das breite Gesicht in seinen Gleichungen. Patricia war auch nicht schlecht in Mathe, nur dass sie zu oft über die falschen Dinge nachdachte, wie zum Beispiel die Tatsache, dass die 3 wie eine halbe 8 aussah, und zwei mal 3 deshalb eigentlich 8 sein müsste.
»Sie testet ihre Grenzen aus«, sagte Patricias Mutter. »Und sie testet unsere Autorität, weil wir zu gutmütig sind.« Belinda Delfine war früher Turnerin gewesen, und ihre Eltern hatten den Druck von mehreren Ozeanen ausgeübt, um sie zu Höchstleistungen anzuspornen. Aber Belinda hatte nie verstanden, warum es Schiedsrichter geben musste, wenn sich doch alles mit Kameras und Lasern messen ließ. Dann hatte sie Roderick kennengelernt, der zu all ihren Wettkämpfen kam, und zusammen hatten sie ein absolut objektives Turn-Bewertungssystem entwickelt, das niemand wollte.
»Sieh sie dir an. Sie lacht uns aus«, sagte Patricias Mutter, als würde Patricia nicht vor ihr stehen. »Wir müssen ihr zeigen, dass wir es ernst meinen.«
Patricia hatte nicht gelacht, glaubte sie zumindest, und plötzlich bekam sie Angst, sie hätte so ausgesehen. Sie versuchte, ein besonders ernstes Gesicht zu machen.
»Ich würde nie einfach weglaufen«, bemerkte Roberta, die die drei eigentlich in der Küche allein lassen sollte, aber hereinkam, um sich ein Glas Wasser zu holen und ihre Schadenfreude auszukosten.
Patricia bekam eine Woche lang Stubenarrest. Das Essen schoben sie ihr unter der Tür durch. Allerdings blieb dabei jeweils die oberste Essensschicht an der Türkante hängen. Zum Beispiel bei einem Sandwich die obere Scheibe. Kein schöner Gedanke, dass die Tür immer den ersten Biss bekam, aber wenn man Hunger hatte, war es einem egal.
»Denk darüber nach, was du angestellt hast«, sagten ihre Eltern.
»Ich kriege sieben Jahre lang ihren Nachtisch«, sagte Roberta.
»Nein, kriegst du nicht«, gab Patricia zurück.
Die Geschichte vom Parlament der Vögel verblasste in ihrer Erinnerung. Sie dachte höchstens noch in Träumen und Gedankenschnipseln daran. Ein- oder zweimal fiel ihr in der Schule ein, dass ihr die Vögel eine Frage gestellt hatten. Aber sie erinnerte sich nicht mehr richtig an die Frage, oder ob sie sie beantwortet hatte. Während des Stubenarrests hatte sie außerdem die Fähigkeit, mit den Tieren zu reden, verlernt.
Kapitel 2
Er hasste es, Larry genannt zu werden. Er konnte den Namen nicht ausstehen. Und deswegen nannten ihn natürlich alle Larry, manchmal sogar seine Eltern. »Ich heiße Laurence«, sagte er, den Blick auf den Boden geheftet. »Mit au, nicht mit aw.« Laurence wusste genau, wer er war und was ihn antrieb, doch die Welt weigerte sich, ihn zu verstehen.
In der Schule nannten sie ihn Larry Barry oder Larry Fairy. Oder wenn er wütend wurde, Scary Larry, ein seltener Fall des Gebrauchs von Ironie seitens seiner hirnamputierten Mitschüler, denn Larry war kein bisschen zum Fürchten. Meistens ging ein vor Sarkasmus triefendes »Oooh« voraus, um auch dem Dümmsten klarzumachen, dass sie ihn verarschten. Nicht, dass Laurence zum Fürchten sein wollte. Er wollte nur in Ruhe gelassen werden, und falls unbedingt jemand mit ihm sprechen musste, dann sollte er ihn wenigstens mit seinem richtigen Namen anreden.
Laurence war klein für sein Alter und sein Haar hatte die Farbe von spätherbstlichem Laub. Er hatte ein längliches Kinn, und seine Arme waren dünn wie Schneckenhälse. Seine Eltern kauften seine Kleider immer eineinhalb Nummern zu groß, um Geld zu sparen und weil sie täglich mit einem Wachstumsschub rechneten. Also stolperte er über seine zu langen, zu weiten Jeans, die Hände tief in den Pulloverärmeln vergraben. Selbst wenn Laurence zum Fürchten hätte aussehen wollen, wäre es ihm mit unsichtbaren Händen und Füßen schwergefallen.
Der einzige Lichtblick in Laurence’ Leben waren die ultrabrutalen PlayStation-Spiele, in denen er Tausende von imaginären Feinden ausradierte. Bis Laurence im Internet auf eine andere Art von Spielen stieß – Rätsel, für deren Lösung er Stunden brauchte, und Online-Rollenspiele, in denen er komplizierte Feldzüge anführte. Es dauerte nicht lang, bis Laurence seinen eigenen Code schrieb.
Auch Laurence’ Vater hatte sich einmal gut mit Computern ausgekannt. Aber dann wurde er erwachsen und nahm einen Job bei einer Versicherung an, wo er immer noch viel rechnen musste, aber nichts mehr davon interessant war. In letzter Zeit unkte er ständig, die Firma würde ihn bald rauswerfen, und dann würden sie alle verhungern. Laurence’ Mutter hatte Biologie studiert und an ihrer Doktorarbeit gearbeitet, bis sie schwanger wurde und ihr Doktorvater sie sitzenließ, und danach hatte sie eine Auszeit genommen und war nie an die Uni zurückgekehrt.
Beide machten sich ständig Sorgen, weil Laurence jede wache Minute am Computer verbrachte und sich damit als genauso sozial gestört erwies wie sein Onkel Davis. Also meldeten sie ihn bei unzähligen Kursen an, damit er unter Menschen kam: Judo, Ausdruckstanz, Fechten, Wasserball für Anfänger, Schwimmen, Improvisationstheater, Boxen, Fallschirmspringen und das allerschlimmste: Survival-Wochenenden in der Wildnis. Jedes Mal musste Laurence eine zu weite Uniform anziehen, während die anderen riefen: »Mach uns den Larry!«, bevor sie ihn unter Wasser drückten, zu früh aus dem Flugzeug warfen oder zwangen, Witze zu erzählen, während sie ihn an den Füßen hochhielten.
Laurence fragte sich, ob es irgendwo auf der Welt einen Jungen namens Larry gab, der cool blieb, wenn man ihn über einem gottverlassenen Hügel im Nirgendwo abwarf. Vielleicht in einem Paralleluniversum, und Laurence müsste nur alle Sonnenenergie, die auf die Erde traf, fünf Minuten lang bündeln, um in der Badewanne einen Riss im Raum-Zeit-Gefüge zu erzeugen, damit er Larry aus dem anderen Universum hierherbringen konnte. Und dann würde Larry losziehen und sich quälen lassen, während Laurence zu Hause blieb. Der schwierige Teil war, dass er für das Loch im Universum nur zwei Wochen Zeit hatte, bevor das Judoturnier begann.
»Hey, Larry Fairy«, rief Brad Chomner in der Schule, »weißt du was?«
Eine der hohlen Fragen, die Laurence nicht verstand. Sollte er mit ja antworten? In der Regel wussten Leute, die »weißt du was« fragten, viel weniger als man selbst. Und sie fragten immer dann, wenn sie vorhatten, noch einen Beitrag zur allgemeinen Verblödung zu leisten. Doch egal, was Laurence zu antworten vorhatte, meistens kam er nicht dazu, denn schon in der nächsten Sekunde traf ihn irgendwas Unangenehmes im Gesicht und er musste aufs Jungsklo gehen, um sich zu waschen.
Aber eines Tages stieß Laurence im Internet auf einen Schaltplan, den er sich ausdruckte und hundertmal las, bis ihm zu dämmern begann, was er bedeutete. Und als er den Schaltplan mit dem Solar-Batterie-Entwurf kombinierte, den er in einem alten Forumpost fand, hatte er das Gefühl, dass er an einer interessanten Sache dran war. Er klaute die alte wasserdichte Armbanduhr seines Vaters und verdrahtete sie mit ein paar Teilen, die er aus verschiedenen Mikrowellen und Handys ausgebaut hatte. Und mit ein paar Kleinigkeiten aus dem Elektronikladen. Als er fertig war, hatte er eine funktionierende Zeitmaschine, die man am Handgelenk tragen konnte.
Das Gerät war simpel: Es gab nur einen kleinen Knopf. Wenn man ihn drückte, sprang man zwei Sekunden in der Zeit nach vorn. Das war alles. Der Zeitraum ließ sich nicht verlängern, und rückwärts ging es auch nicht. Laurence versuchte, sich mit seiner Webcam zu filmen, und stellte fest, dass er, wenn er den Knopf drückte, für einen oder zwei Augenblicke vom Bildschirm verschwand. Allerdings konnte man das Ding nur ab und zu benutzen, sonst wurde einem unglaublich schwindelig.
Ein paar Tage später rief Brad Chomner: »Weißt du was?«, und Laurence wusste was.
Er drückte den Knopf an seinem Handgelenk. Der weiße Kloß, der in Laurence’ Richtung flog, landete mit einem Klatschen vor seinen Füßen. Alle starrten erst ihn an, dann den Brei der nassen Klopapierrolle auf dem Boden, und dann wieder ihn. Laurence stellte seine »Uhr« auf Schlafmodus, damit niemand daran herumspielen und sie auslösen konnte, aber die Vorsichtsmaßnahme war überflüssig, denn alle dachten, Laurence wäre dem Geschoss mit übermenschlichen Reflexen ausgewichen. Mr Grandison kam aus dem Klassenzimmer gestürmt und fragte, wer die Klorolle geworfen habe. Alle zeigten auf Laurence.
Zwei Sekunden zu überspringen konnte ziemlich nützlich sein, wenn man die richtigen zwei Sekunden auswählte. Zum Beispiel beim Abendessen, wenn seine Mutter stichelte, weil sein Vater wieder nicht befördert worden war, was zuverlässig dazu führte, dass er kurz aber heftig ausrastete. Man brauchte ein gottgleiches Zeitgefühl, um den genauen Moment zu erwischen, an dem der Pfeil abgeschossen wurde. Es gab einhundert Vorzeichen: den Geruch von angebranntem Auflauf, ein kurzes Abfallen der Zimmertemperatur. Das Ticken des abkühlenden Ofens. Dann ließ man die Realität für zwei Sekunden hinter sich und kam erst wieder, wenn der Schmerz nachließ.
Es gab noch jede Menge andere Gelegenheiten. Wenn Al Danes ihn vom Klettergerüst in den Sand warf. Er übersprang einfach den Moment des Aufpralls. Wenn ein hübsches Mädchen auf ihn zukam und so tat, als wäre sie nett, um ihn später mit ihren Freundinnen auszulachen. Wenn ein Lehrer eine besonders langweilige Tirade losließ. Zwei kleine Sekunden machten einen Unterschied. Niemand schien mitzukriegen, dass er kurz verschwand, vielleicht weil ihn nie jemand ansah. Laurence wünschte, er könnte die Uhr häufiger benutzen als ein paarmal am Tag, ohne Kopfschmerzen zu bekommen.
Doch das Überspringen der Zeit unterstrich nur ein anderes grundlegendes Problem: Laurence hatte nichts, auf das er sich freute.
Bis er eines Tages das Bild einer schlanken, in der Sonne schimmernden Form entdeckte. Er starrte die spitz zulaufenden Kurven an, den perfekten Nasenkegel, die kraftvollen Triebwerke, und etwas in ihm begann sich zu regen. Ein Gefühl, das er seit Ewigkeiten nicht gehabt hatte: Aufregung. Diese privat finanzierte selbstgebaute Weltraumrakete würde dank des unkonventionellen Tech-Investors Milton Dirth und einigen seiner Ingenieursfreunde und MIT-Studenten in den Orbit fliegen. Der Start fand in wenigen Tagen in der Nähe des MIT-Campus in Boston statt, und Laurence musste einfach dabei sein. Nie in seinem Leben hatte er etwas so gewollt, wie den Start dieser Rakete mit eigenen Augen zu sehen.
»Dad«, sagte Laurence. Der Zeitpunkt war schlecht. Sein Vater starrte den Laptop an, die Hände unter der Nase verschränkt, als wollte er seinen Schnauzer schützen, dessen Enden in den tiefen Falten über seinen Mundwinkeln versanken. Zu spät. Laurence konnte nicht mehr zurück. »Dad«, wiederholte er. »Da ist ein Raketentest, am Dienstag. Hier ist der Artikel darüber.«
Eigentlich wollte sein Vater ihn gleich wegschicken, aber dann schien er sich auf irgendeinen halbvergessenen Elternvorsatz zu besinnen. »Oh.« Es fiel ihm sichtlich schwer, den Blick von der Tabelle auf dem Bildschirm zu reißen, doch schließlich klappte er den Laptop zu und schenkte Laurence ein Maß an Aufmerksamkeit, das für seinen Vater als ungeteilt durchging. »Ach ja. Ich habe davon gehört. Dieser Dirth. Hm. Eine Art leichtgewichtiger Prototyp, oder? Mit dem man irgendwann auf der dunklen Seite des Monds landen können soll. Ich habe davon gehört.« Dann machte Dad einen Witz über eine alte Band namens Floyd und Marihuana und ultraviolettes Licht.
»Ja.« Laurence unterbrach seinen Gedankenstrom, bevor ihm das Gespräch ganz entglitt. »Genau. Milton Dirth. Und ich möchte echt gern hinfahren und zusehen. So eine Chance gibt’s nur einmal im Leben. Ich dachte, wir könnten vielleicht so eine Vater-Sohn-Unternehmung daraus machen.« Eine Vater-Sohn-Unternehmung konnte sein Vater ihm nicht abschlagen – dann könnte er gleich zugeben, dass er ein schlechter Vater war.
»Oh.« Sein Vater sah ihn mit tiefliegenden Augen hinter der eckigen Brille verlegen an. »Da willst du hin? Am Dienstag?«
»Ja.«
»Aber … ich meine, ich muss arbeiten. Ich habe ein Projekt, das ich besonders gut abschließen muss, sonst bin ich geliefert. Außerdem würde es deiner Mutter nicht gefallen, wenn ich dich Schule schwänzen lasse. Und, ich meine, du kannst dir den Start doch im Internet ansehen. Es gibt bestimmt eine Liveübertragung mit einer Webcam oder so was. Du weißt doch, in echt sind solche Sachen viel langweiliger. Man steht nur rum, und meistens wird der Start verschoben. Außerdem siehst du nichts, wenn du dort bist. Die Kamera hat einen viel besseren Blickwinkel.« Laurence’ Vater klang, als versuchte er vor allem, sich selbst zu überzeugen.
Laurence nickte. Es hatte keinen Sinn zu diskutieren, wenn sein Vater anfing, Gegenargumente aufzuzählen. Also hielt Laurence die Klappe und trat den geordneten Rückzug an. Dann ging er hoch in sein Zimmer und studierte den Busfahrplan.
Ein paar Tage später, als seine Eltern noch schliefen, schlich Laurence auf Zehenspitzen nach unten, wo er auf dem Tischchen an der Haustür Moms Handtasche fand. Er öffnete vorsichtig den Verschluss, als rechnete er damit, dass ihm ein lebendiges Tier entgegensprang. Jedes Geräusch im Haus war zu laut: die Kaffeemaschine mit Timer, die gerade warm lief, das Brummen des Kühlschranks. Er fand das lederne Portemonnaie und zog fünfzig Dollar heraus. Er hatte noch nie in seinem Leben gestohlen und war sich sicher, dass jeden Moment die Polizei hereinstürmte und ihm Handschellen anlegte.
Für den zweiten Schritt seines Plans musste Laurence seine Mutter auch noch anschwindeln, nachdem er sie gerade bestohlen hatte. Sie kam gerade aus dem Bett und wirkte noch ganz verschlafen in ihrem goldgelben Bademantel, als er ihr erklärte, er hätte einen Schulausflug und brauche ihre Unterschrift, und vielleicht blieben sie über Nacht. (Laurence hatte schon eine Universalwahrheit im Leben gelernt, nämlich dass Leute nie Papiere sehen wollten, wenn sie zuerst nach Papieren gefragt wurden.) Laurence’ Mutter griff nach ihrem kurzen ergonomischen Kuli und kritzelte ihre Unterschrift unter die Erlaubnis. Ihr Nagellack war abgeplatzt. Laurence versprach anzurufen, falls sie über Nacht blieben. Sie nickte nur, und ihre roten Locken hüpften.
Als Laurence zur Bushaltestelle lief, hatte er einen kurzen Anfall von Nervosität. Er begab sich ganz allein auf eine große Reise, niemand wusste, wo er war, und er hatte nur fünfzig Dollar in der Tasche, plus eine falsche römische Münze. Was, wenn jemand hinter den Müllcontainern lauerte und Laurence überfiel? Was, wenn jemand ihn in einen Transporter zerrte und Hunderte Kilometer fuhr, bevor er Laurence in Darryl umbenannte und ihn zwang, so zu tun, als wäre er der Sohn seiner Entführer? Laurence hatte im Fernsehen mal so eine Geschichte gesehen.
Aber dann erinnerte Laurence sich an die Survival-Wochenenden und daran, dass er frisches Wasser und essbare Wurzeln gefunden und sogar das Streifenhörnchen verjagt hatte, das ihm das Studentenfutter stibitzen wollte. Laurence hatte jede Sekunde gehasst, aber wenn er so was überlebte, dann konnte er auch mit dem Bus nach Boston fahren und das Raketenstartgelände finden. Er war der unerschütterliche Laurence aus Ellenburg. Nichts und niemand konnte ihn aus der Ruhe bringen.
»Ich bin unerschütterlich«, sagte er zu dem Busfahrer. Der zuckte die Achseln, als hätte er sich auch einst für unerschütterlich gehalten, sei aber eines Besseren belehrt worden.
Laurence hatte reichlich Proviant dabei, aber nur ein Buch, ein dünnes Taschenbuch über den letzten großen interplanetarischen Krieg. Er hatte es nach einer Stunde ausgelesen, und dann hatte er nichts mehr zu tun, als aus dem Fenster zu starren. Die Bäume neben dem Highway sahen aus, als würden sie beim Näherkommen langsamer, und sobald sie vorbei waren, zischten sie davon. Eine Art Zeitverzerrung.
Als er in Boston aus dem Bus stieg, suchte Laurence die U-Bahn-Station. Chinatown war voller Straßenhändler und in den Fenstern der Restaurants standen riesige Aquarien, aus denen die Fische sich ihre potentiellen Esser ansahen, als hätten sie die Wahl. Laurence überquerte den Charles River und sah das Wissenschaftsmuseum, das in der Morgensonne strahlte und seine Stahl- und Glasarme nach ihm ausstreckte, als wollte es ihn mit Gewalt ins Planetarium holen.
Erst als Laurence den Campus des Massachusetts Institute of Technology im Stadtteil Cambridge erreichte und vor einem Fischrestaurant stehen blieb, um den Gebäudeplan zu studieren, fiel ihm auf, dass er keine Ahnung hatte, wo der Raketenstart stattfinden sollte.
Laurence hatte sich das MIT wie eine größere Version seiner Grundschule vorgestellt, mit einer Treppe zum Haupteingang und einem Schwarzen Brett, wo die aktuellen Veranstaltungen angeschlagen waren. Doch in die ersten paar Gebäude kam er nicht einmal hinein. Dann fand er zwar ein Schwarzes Brett, an dem Zettel mit Nachhilfeangeboten, Beziehungstipps und der Ankündigung des Ig-Nobelpreises hingen. Aber von Hinweisen auf den Raketenstart fehlte jede Spur.
Am Ende setzte sich Laurence in ein Café, aß einen Muffin und kam sich vor wie ein Versager. Hätte er eine Internetverbindung, könnte er vielleicht rauskriegen, was er tun sollte, aber seine Eltern erlaubten ihm kein Smartphone, und erst recht keinen Laptop. Im Hintergrund lief ein schwermütiger Oldie nach dem anderen: Janet Jackson sang von Einsamkeit, Britney Spears gestand, sie hatte es schon wieder getan. Laurence pustete in seine heiße Schokolade und versuchte, sich eine Strategie zu überlegen.
Laurence’ Buch war weg. Das Buch, das er im Bus gelesen hatte. Er hatte es eben neben den Muffin auf den Tisch gelegt, und jetzt war es weg. Nein, halt – eine Frau hatte sein Buch in der Hand. Sie war vielleicht Anfang zwanzig, hatte lange braune Zöpfe, ein breites Gesicht und einen roten Pullover, der so fusselig war, dass er aussah, als hätte er Haare. Ihre Hände waren schwielig, und sie trug Arbeiterstiefel.
»Tut mir leid«, sagte sie. »Ich erinnere mich an dieses Buch. Ich habe es in der Schule ungefähr drei Mal gelesen. Es geht um das binäre Sternensystem, das in den Krieg gegen die AIs zieht, die den Asteroidengürtel besiedelt haben. Oder?«
»Äh, ja«, stammelte Laurence.
»Gutes Buch.« Jetzt musterte sie Laurence’ Handgelenk. »Hey. Das ist eine Zwei-Sekunden-Zeitmaschine, oder?«
»Äh, ja«, sagte Laurence wieder.
»Cool. Ich habe auch so eine.« Sie hielt ihr Handgelenk hoch. Ihre Uhr sah fast genauso aus wie die von Laurence, nur dass sie ein bisschen kleiner war und einen Taschenrechner hatte. »Ich habe ewig gebraucht, bis ich die Onlinepläne kapiert hatte. Es ist wie ein Test deiner technischen Fähigkeiten, deines Wissens und deiner Entschlossenheit, und zur Belohnung kriegst du ein kleines Gerät, das für tausend Sachen gut ist. Kann ich mich zu dir setzen? Wenn ich so vor dir stehe, komme ich mir vor wie eine Lehrerin.«
Laurence nickte. Es fiel ihm schwer, etwas Vernünftiges zu dem Gespräch beizutragen. Die Frau setzte sich ihm und den Krümeln seines Muffins gegenüber. Jetzt, wo sie auf Augenhöhe war, sah er, dass sie irgendwie attraktiv war. Sie hatte eine hübsche Nase und ein rundes Kinn. Sie erinnerte ihn an die Sozialkundelehrerin, in die er letztes Jahr verknallt gewesen war.
»Ich bin Isobel«, stellte sie sich vor. »Ich bin Raketenforscherin.«
Wie sich herausstellte, war sie auch wegen des Raketenstarts hier, der allerdings wegen irgendwelcher Probleme und des Wetters und so weiter in letzter Sekunde verschoben worden war. »Wahrscheinlich passiert es in den nächsten Tagen. Du weißt ja, wie solche Sachen laufen.«
»Oh.« Laurence starrte in den Schaum seiner heißen Schokolade. Das war’s also. Er würde gar nichts sehen. Irgendwie hatte er sich eingeredet, wenn er zusehen könnte, wie die Rakete in den Himmel schoss – wie sich etwas vor seiner Nase von der Schwerkraft unseres Planeten befreite –, dann wäre auch er befreit. Er würde zurück zur Schule gehen, aber es wäre nicht mehr schlimm, weil Laurence nun eine direkte Verbindung in den Weltraum hätte.
Doch jetzt war er bloß der Spinner, der wegen nichts die Schule geschwänzt hatte. Er starrte das Umschlagbild des Taschenbuchs an: ein klobiges Raumschiff mit einer nackten Frau, die statt Brüsten Augen hatte. Er fing nicht zu heulen an, aber er war kurz davor. Auf dem Taschenbuch stand: »SIE REISTEN BIS ANS ENDE DES UNIVERSUMS – UM EINE GALAKTISCHE KATASTROPHE ZU VERHINDERN!«
»Mist«, sagte Laurence. »Danke, dass Sie mir Bescheid gesagt haben.«
»Kein Problem«, sagte Isobel. Sie erzählte ihm mehr über den Raketenstart, wie revolutionär das neue Design war, Dinge, die er schon wusste, bis ihr irgendwann auffiel, wie elend er aussah. »Hey, ist doch nicht so schlimm. Der Start wird nur um ein paar Tage verschoben.«
»Schon«, sagte Laurence, »aber dann bin ich nicht mehr hier.«
»Oh.«
»Ich bin anderweitig beschäftigt. Ich habe Termine.« Laurence stotterte ein bisschen. Er knetete den Tischrand, bis die Haut auf seiner heißen Schokolade Falten schlug.
»Du bist bestimmt ein vielbeschäftigter Mann«, sagte Isobel. »Sieht aus, als hättest du einen vollen Terminkalender.«
»Na ja«, sagte Laurence. »Jeder Tag ist irgendwie gleich. Außer heute.« Und dann kamen ihm doch die Tränen. So ein Mist.
»Hey.« Isobel setzte sich neben ihn. »Hey. Hey. Alles wird gut. Wissen deine Eltern, wo du bist?«
»Nicht genau …« Laurence schniefte. »Eigentlich nicht.« Am Ende erzählte er ihr die ganze Geschichte – wie er seiner Mutter fünfzig Dollar geklaut hatte, wie er die Schule schwänzte und den Bus genommen hatte und dann die U-Bahn. Während er redete, bekam er plötzlich ein schlechtes Gewissen, dass seine Eltern sich Sorgen machten, und ihm wurde mit wachsender Gewissheit klar, dass er so was nie wieder durchziehen können würde. Jedenfalls nicht in ein paar Tagen.
»Okay«, sagte Isobel. »Puh. Na ja, ich schätze, ich rufe mal besser deine Eltern an. Aber sie werden eine Weile brauchen, bis sie hier sind. Vor allem mit der komplizierten Wegbeschreibung zum Raketenstartgelände, die sie von mir kriegen.«
»Zum Raketenstartgelände? Aber …«
»Da wirst du nämlich auf sie warten müssen.« Sie tätschelte ihm die Schulter. Gottseidank weinte er nicht mehr und schaffte es, sich wieder zusammenzureißen. »Komm, ich zeige dir die Rakete. Ich führe dich rum und stelle dich ein paar Leuten vor.«
Isobel stand auf und hielt Laurence die Hand hin. Er nahm sie.
Und so sollte Laurence ein rundes Dutzend der coolsten Raketen-Nerds der Welt kennenlernen. Isobel lud ihn in ihren nach Zigaretten stinkenden roten Mustang, wo Laurence die Füße zwischen die Chipstüten stellte. Im Autoradio hörte Laurence zum ersten Mal MC Frontalot.
»Hast du mal was von Heinlein gelesen? Ist vielleicht ein bisschen zu erwachsen, aber ich wette, seine Jugendbücher würden dir gefallen. Hier.« Sie kramte auf dem Rücksitz und reichte ihm ein zerfleddertes Taschenbuch mit dem Titel Raumjäger und einem sympathisch grellen Cover. Sie sagte, er könne es behalten, sie habe es doppelt.
Nach dem Memorial Drive nahmen sie eine endlose Reihe identisch aussehender Schnellstraßen und Autobahnbrücken und Tunnel, und Laurence verstand, was Isobel gemeint hatte: Seine Eltern würden sich zwangsläufig verfahren, wenn sie ihn abholen kamen, selbst wenn sie die perfekte Wegbeschreibung bekämen. Seine Eltern jammerten sowieso immer, wie kompliziert das Straßennetz von Boston sei. Wolken zogen herauf, und der Nachmittag wurde trüb, aber Laurence war es egal.
»Siehe!«, verkündete Isobel, »eine einstufige Weltraumrakete! Ich bin den ganzen Weg von Virginia mit dem Auto hergefahren, um mit anzupacken. Mein Freund ist schrecklich eifersüchtig.«
Die Rakete war zwei- bis dreimal so groß wie Laurence und stand in einem Schuppen nicht weit vom Meer. Sie schimmerte, weil ihre blasse Metallhülle das Licht auffing, das in Streifen durch die Schuppenfenster fiel. Isobel führte Laurence herum und zeigte ihm alle coolen Besonderheiten, darunter die Isolierung aus Kohlenstoff-Nanofasern und die ultraleichte Silikat/organische-Polymer-Verschalung der Triebwerke.
Laurence streckte die Hand aus und berührte die Rakete, betastete mit den Fingerspitzen ihre genoppte Haut. Ein paar Leute kamen rüber und wollten wissen, wer der Junge war und warum er ihre kostbare Rakete anfasste.
»Das sind empfindliche Geräte.« Ein dünnlippiger Mann im Rollkragenpullover verschränkte die Arme vor der Brust.
»Wir können nicht irgendwelche Kinder in unserem Raketenschuppen herumrennen lassen«, sagte eine kleine Frau im Overall.
»Laurence«, sagte Isobel. »Zeig sie ihnen.« Er wusste, was Isobel meinte.
Er griff mit der linken Hand zum rechten Handgelenk und drückte den kleinen Knopf. Es fühlte sich an wie immer, als würde er einen Herzschlag oder einen Atemzug aussetzen, und schon waren zwei Sekunden vergangen und er stand immer noch vor der wunderschönen Rakete, umringt von Menschen, die ihn anstarrten. Alle klatschten. Laurence fiel auf, dass sie alle ähnliche Geräte am Handgelenk trugen, als wäre es eine Mode oder so was. Oder ein Abzeichen.
Von da an behandelten sie ihn wie einen der Ihren. Er hatte ein kleines Stück Zeit erobert, und sie eroberten ein kleines Stück Raum. Es war eine Anzahlung, für sie und für ihn. Eines Tages würden sie oder ihre Nachkommen einen größeren Anteil des Kosmos besitzen. Man feierte die kleinen Siege und träumte von den großen.
»Hey, Junge«, rief ein haariger Mann in Jeans und Sandalen. »Sieh dir an, was ich mit der Schubdüse gemacht habe. Das könnte dir gefallen.«
»Was wir gemacht haben«, berichtigte ihn Isobel.
Der Rollkragenmann war älter, Mitte dreißig oder vierzig, vielleicht sogar fünfzig, mit dünnem graumelierten Haar und struppigen Augenbrauen. Er löcherte Laurence mit Fragen und tippte Notizen in sein Smartphone. Zweimal musste Laurence seinen Namen buchstabieren. »Erinner mich daran, dass ich dich anrufe, wenn du achtzehn bist, Junge«, sagte er. Jemand brachte Laurence Limonade und eine Pizza.
Als Laurence’ Eltern schließlich ankamen, weichgekocht nach all den Autobahndreiecken und Highways und Tunneln, war Laurence zum Maskottchen der Einstufigen-Raketen-Gang geworden. Und deshalb hörte Laurence seinen Eltern kaum zu, als sie ihm auf der langen Heimfahrt eine Strafpredigt hielten, das Leben sei kein Abenteuer, Herrgott nochmal, sondern eine ewige Plackerei und eine lange Liste von Verantwortungen und Anforderungen. Wenn Laurence alt genug sei, um zu tun, was ihm Spaß machte, wäre er alt genug, um zu verstehen, dass man nicht tun konnte, was einem Spaß machte.
Die Sonne ging unter. Sie hielten an einer Raststätte, bestellten Hamburger und predigten weiter. Doch Laurence’ Blick glitt immer wieder unter den Tisch, wo er die aufgeschlagene Ausgabe von Raumjäger auf dem Schoß hatte. Er war schon zur Hälfte durch.
Buch zwei
Kapitel 3
Von den Klassenzimmern auf der Westseite des blassen Beton-Mausoleums der Canterbury Academy sah man den Parkplatz, die Sportplätze und die zweispurige Schnellstraße. Durch die Fenster nach Osten sah man einen matschigen Hang, der zu einem Bach hin abfiel, und die unregelmäßige Baumreihe dahinter, deren Wipfel sich im Septemberwind wiegten. In der stickigen, nach Marshmallow riechenden Schulluft stellte Patricia sich vor, wie sie den Hang hinunter in die Wildnis lief.
Patricia hatte in der ersten Woche als Talisman ein Eichenblatt in der Rocktasche gehabt, das sie betastete, bis es zwischen ihren Fingerspitzen zerbröselte. In Mathe und Englisch, den Fächern, die ihr den Blick nach Osten gewährten, starrte sie den Waldrand an. Und wünschte, sie könnte fliehen und ihr Schicksal als Hexe annehmen, statt hier zu sitzen und alte Reden von Präsident Rutherford B. Hayes auswendig zu lernen. Ihre Haut juckte unter dem neuen Sport-BH, dem kratzigen Pullover und dem Trägerkleid der Schuluniform, während die anderen um sie herum miteinander texteten und quatschten: Hat Casey Hamilton Traci Burt gefragt, ob sie mit ihm geht? Wer ist in den Sommerferien mit wem wie weit gekommen? Patricia kippelte mit ihrem Stuhl, vor und zurück, vor und zurück, bis er mit einem Knall auf dem Boden landete und alle an ihrem Gruppentisch erschraken.
Sieben Jahre war es her, dass die Vögel zu Patricia gesagt hatten, sie sei etwas Besonderes. Seitdem hatte Patricia jedes Zauberbuch gelesen, jeden mystischen Leitfaden im Internet, den sie finden konnte. Sie hatte sich mit Absicht im Wald verlaufen, immer wieder, bis sie jeden Stock und jeden Stein in der ganzen Gegend kannte. Sie hatte immer ein Erste-Hilfe-Kit dabei für den Fall, dass ein verletztes Tier Rettung braucht. Doch nie wieder richtete eine wilde Kreatur das Wort an sie, und nichts Übersinnliches passierte. Als wäre das Ganze nur ein Streich gewesen. Oder als hätte Patricia, ohne es mitzukriegen, in einem Test versagt.
Nach der Pause ging Patricia über den Schulhof, den Blick zum Himmel gerichtet, um mit einem Schwarm Raben Schritt zu halten, der über die Schule flog. Die Raben schwatzten, doch sie ließen Patricia nicht mitreden, genauso wenig wie ihre Mitschüler, wobei die ihr egal waren.
Patricia hatte versucht, Freunde zu finden, weil sie es ihrer Mutter versprochen hatte (und Hexen hielten ihre Versprechen, glaubte sie jedenfalls). Doch sie war in der achten Klasse neu auf die Schule gekommen, und die anderen kannten sich schon seit Jahren. Gestern stand sie neben Macy Firestone und ihren Freundinnen am Waschbecken im Mädchenklo, und Macy beschwerte sich, dass Brent Harper ihr in der Cafeteria die kalte Schulter gezeigt hatte. Macys greller Lipgloss bildete den perfekten Kontrast zum Capri-Gelb ihrer gefärbten Haare. Als Patricia sich mit der öligen grünen Kunstseife die Hände wusch, hatte sie plötzlich das Gefühl gehabt, dass von ihr ein witziger unterstützender Kommentar über den Reiz und die tragische Bescheuertheit von Brent Harper erwartet wurde, der funkelnde Augen und gegeltes Haar hatte. Also stammelte sie, Brent Harper sei ein Volldepp – woraufhin sich die Mädchenclique sofort vor ihr aufbaute und wissen wollte, was für ein Problem sie mit Brent Harper habe. Hatte er ihr was getan? Carrie Danning plusterte sich so auf, dass ihr fast die Haarspange aus der perfekten blonden Mähne sprang.
Die Raben flogen in keiner Formation, die Patricia erkennen konnte, auch wenn es in der ersten Woche an der neuen Schule hauptsächlich darum gegangen war, Muster zu erkennen. Muster, um die Multiple-Choice-Tests zu lösen, um lange Texte auswendig zu lernen, um Struktur in ihr Leben zu bringen. (Das war das berühmte Saarinen-Programm.) Doch Patricia sah die Raben an, geschwätzig in ihrer ziellosen Eile, und konnte kein Muster finden. Dann kehrte der Schwarm noch einmal zurück, als hätten sie Patricia doch bemerkt, bevor sie schließlich über die Straße davonflogen.
Warum hatten die Vögel zu Patricia gesagt, dass sie eine Hexe sei, um sie dann allein zu lassen? All die Jahre?
Bei der Verfolgung der Raben vergaß Patricia, auf den Weg zu achten, bis sie plötzlich in jemanden hineinlief. Sie spürte den Aufprall und hörte den Schrei, bevor sie sah, wen sie umgerannt hatte: einen schlaksigen Jungen mit sandfarbenem Haar und langem Kinn, der gegen den Schulhofzaun flog und dann ins Gras fiel. Er rappelte sich hoch. »Pass doch auf, wo du …« Er warf einen Blick auf das Ding an seinem linken Handgelenk, das keine Uhr war, und fluchte viel zu laut.
»Was ist denn?«, fragte Patricia.
»Du hast meine Zeitmaschine kaputtgemacht.« Er hielt ihr das Handgelenk hin.
»Du bist Larry, oder?« Patricia sah sich das Gerät an, das eindeutig kaputt war. Das Gehäuse hatte einen gezackten Riss, und ein säuerlicher Geruch drang aus dem Inneren. »Tut mir echt leid. Soll ich dir eine neue kaufen? Ich habe Geld. Ich meine, meine Eltern.« Sie dachte an das Gesicht ihrer Mutter: noch so eine Katastrophe, die sie ausbügeln musste.
»Eine Zeitmaschine kaufen!« Larry schnaubte. »Und wie willst du das anstellen? Ins Kaufhaus gehen und nach der Zeitmaschinen-Abteilung fragen?« Er roch leicht nach Preiselbeeren, vielleicht ein Deo oder so was.
»Sei nicht sarkastisch«, sagte Patricia. »Sarkasmus ist was für Flachmaten.« Sie hatte Schwachmaten sagen wollen, und in ihrem Kopf hatte es viel tiefsinniger geklungen.
»Tut mir leid.« Er blinzelte seine kaputte Uhr an, dann zog er vorsichtig das Armband von seinem knochigen Handgelenk. »Ich schätze, ich kann es reparieren. Ich heiße übrigens Laurence. Niemand nennt mich Larry.«
»Patricia.« Laurence hielt ihr die Hand hin, und sie schüttelte sie dreimal. »Das ist wirklich eine Zeitmaschine?«, fragte sie. »Kein Witz oder so?«
»Ja. Na ja. Es war keine tolle Zeitmaschine. Ich wollte sie sowieso bald wegwerfen. Eigentlich sollte sie mich retten. Aber stattdessen hat sie mich zu einer Art Zirkuspferd gemacht.«
»Besser ein Zirkuspferd als ein Esel.« Patricia sah wieder zum Himmel. Die Raben waren längst weg, und alles, was sie sah, war eine einzelne Wolke, die sich langsam auflöste.
Danach sah Patricia Laurence öfter. Sie hatten sogar ein paar Fächer zusammen. Ihr fiel auf, dass Laurence frische Brennnesselstriemen an den Armen hatte und an der Wade unter dem Hosenbein einen roten Stich, den er in Englisch immer wieder inspizierte. In den offenen Seitentaschen seines Rucksacks steckten ein Kompass und eine Landkarte, und an der Unterseite waren Gras- und Erdflecken.
Ein paar Tage nachdem sie Laurence’ Zeitmaschine kaputtgemacht hatte, saß Laurence nach der Schule auf der hinteren Treppe vor dem großen Abhang und beugte sich über die Broschüre eines »Großen Abenteuer-in-der-Wildnis-Wochenendes«. Patricia war begeistert: zwei Tage weg von allen Menschen und ihrem Müll. Zwei Tage die Sonne im Gesicht! Patricia schlich sich bei jeder Gelegenheit in den Wald hinter dem Gewürzhaus, aber ein ganzes Wochenende hätten ihre Eltern ihr nie erlaubt.
»Das sieht cool aus«, sagte sie, und Laurence zuckte zusammen, als er merkte, dass sie ihm über die Schulter sah.
»Mein schlimmster Albtraum«, antwortete er, »außer dass es echt ist.«
»Hast du so was schon mal gemacht?«
Statt zu antworten, zeigte Laurence auf ein unscharfes Foto auf der Rückseite der Broschüre, wo eine Gruppe von Kindern mit Rucksäcken neben einem Wasserfall um die Wette strahlte, bis auf einen finster dreinblickenden Jungen im Hintergrund: Laurence unter einem lächerlichen grünen Anglerhut. Der Fotograf hatte genau in dem Moment auf den Auslöser gedrückt, als Laurence etwas ausspuckte.
»Das ist doch spitze!«, sagte Patricia.
Laurence stand auf und schlurfte zur Tür zurück.
»Hey«, rief ihm Patricia hinterher. »Ich wollte nur … ich hab jemanden zum Reden gesucht. Auch wenn niemand versteht, was ich erlebt habe. Aber ich wäre froh, jemand zu kennen, der auch eine Verbindung zur Natur hat. Warte. Geh nicht weg. Laurence!«
Er drehte sich um. »Du hast dir meinen Namen gemerkt.« Er sah sie blinzelnd an.
»Natürlich. Du hast ihn mir doch gesagt.«
»Hm.« Er wälzte den Laut im Mund herum. »Und was ist so toll an der Natur?«
»Sie ist echt! Sie ist chaotisch! Sie ist nicht wie die Menschen.« Dann erzählte sie Laurence von den wilden Truthähnen, die sich bei ihr im Garten versammelten, und von den Concord-Trauben, deren Reben die Friedhofsmauern am Ende der Straße überwucherten, die Früchte noch süßer durch die Nähe zu den Toten. »Im Wald wimmelt es von Rotwild, und es gibt sogar Elche. Die Rehe haben so gut wie keine natürlichen Feinde mehr. Ein ausgewachsener Hirsch wird so groß wie ein Pferd.«
Laurence sah erschrocken aus. »Klingt grauenhaft«, sagte er. »Und du … du stehst wirklich auf Natur und so was?«
Patricia nickte.
»Ich hab eine Idee, wie wir uns gegenseitig helfen können. Wir machen einen Deal: Du hilfst mir, meine Eltern zu überzeugen, dass ich genug Zeit in der Natur verbringe, damit sie aufhören, mich ständig in irgendwelche Survival-Ferienlager zu schicken. Und ich gebe dir zwanzig Dollar.«
»Du willst, dass ich deine Eltern anlüge?« Patricia war sich nicht sicher, ob ehrenhafte Hexen so etwas tun durften.
»Ja«, sagte er. »Ich will, dass du meine Eltern anlügst. Dreißig Dollar, okay? Das sind meine ganzen Ersparnisse für einen Supercomputer.«
»Ich brauche Bedenkzeit«, sagte Patricia.
Sie stand vor einem ernsthaften moralischen Dilemma. Es war nicht nur das Lügen, sondern auch die Tatsache, dass sie Laurence um eine wichtige Erfahrung bringen würde, die seine Eltern ihm zugedacht hatten. Patricia konnte nicht in die Zukunft sehen. Vielleicht würde Laurence dank der Wildnis-Wochenenden eine neue Art von Windmühle erfinden, die ganze Städte antrieb, weil er die Flügel einer Libelle beobachtet hatte. Patricia stellte sich vor, wie Laurence in ein paar Jahren den Nobelpreis entgegennahm und in seiner Rede erklärte, er habe alles den »Großen-Abenteuer-in-der-Wildnis-Wochenenden« in seiner Jugend zu verdanken. Andererseits wäre Patricia mit schuld, falls Laurence an einem dieser Wochenenden in einen Wasserfall stürzte und ertrank. Außerdem konnte sie die dreißig Dollar gut gebrauchen.
In der Zwischenzeit versuchte sie weiter, andere Freunde zu finden. Dorothy Glass war ein zurückhaltendes, sommersprossiges Mädchen. Sie turnte, wie Patricias Mutter einst, und schrieb auf ihrem Smartphone Gedichte, wenn sie dachte, keiner sah zu. Patricia setzte sich in der Schulversammlung neben sie, als der stellvertretende Rektor Mr Dibbs über das neue Roller-Verbot an der Schule sprach und erklärte, warum Auswendiglernen die beste Methode sei, die kurze Aufmerksamkeitsspanne der durch Facebook und Videospiele verdorbenen Jugendlichen wieder auf Zack zu bringen. In der Zwischenzeit unterhielten sich Patricia und Dorothy flüsternd über den Internet-Comic mit dem Pfeife rauchenden Pferd, den alle lasen. Patricia sah einen Hoffnungsschimmer – bis sich Dorothy in der Cafeteria zu Macy Firestone und Carrie Danning setzte und später im Flur so tat, als wäre Patricia Luft.
Am Ende ging Patricia an der Bushaltestelle zu Laurence und erklärte: »Abgemacht. Ich bin dein Alibi.«
In seinem Kinderzimmer baute Laurence tatsächlich an einem Supercomputer, den er hinter einem Wall aus Actionfiguren und Taschenbüchern versteckte. Er hatte das Ding aus tausend Teilen zusammengebastelt, darunter die Graphikprozessoren von einem Dutzend pQ-Spielkonsolen, die in den drei Monaten, die sie auf dem Markt waren, die modernste Vektorgraphik und die komplexesten narrativen Strukturen hatten, die es je gab. Außerdem hatte sich Laurence in die ehemaligen Räume eines pleitegangenen Spiele-Entwicklers geschlichen und ein paar Festplatten, Hauptplatinen und ausgewählte Router »gerettet«. Das Ergebnis wucherte inzwischen aus dem geriffelten Metallregal, und hinter einem Haufen Krimskrams blinkten LEDs. Das alles führte Laurence Patricia vor und erklärte ihr seine Theorien über neuronale Netzwerke, heuristisches Context-Mapping und die Gesetze der Interaktion, wobei er sie an ihr Versprechen erinnerte, niemandem davon zu erzählen.
Beim Abendessen mit Laurence’ Eltern (Pasta mit Knoblauchsauce) erzählte Patricia ausführlich, wie Laurence und sie im Wald klettern gegangen waren und aus nächster Nähe einen Fuchs gesehen hatten. Fast hätte sie gesagt, der Fuchs habe Laurence aus der Hand gefressen, aber sie wollte nicht zu dick auftragen. Laurence’ Eltern waren überglücklich und überrascht, als sie hörten, wie gut Laurence auf Bäume klettern konnte, obwohl sie beide nicht aussahen, als hätten sie in den letzten Jahren einen Wald von innen gesehen. Aber sie schienen irgendwie unter dem Komplex zu leiden, dass Laurence zu viel Zeit vor seinem Computer verbrachte, statt seine Lungen mit frischer Luft zu füllen. »Wie schön, dass Laurence eine Kameradin hat«, sagte Laurence’ Mom, die eine Katzenaugenbrille trug und unanständig rotgefärbte Locken hatte. Laurence’ Dad, der mürrisch und bis auf ein braunes Haarbüschel fast kahl war, nickte und bot Patricia mit beiden Händen noch mehr Knoblauchbrot an. Laurence’ Familie lebte in einer schäbigen Doppelhaushälfte am Ende einer hässlichen Sackgasse, und alle Möbel und Haushaltsgeräte waren alt. Der Teppich war so verschlissen, dass man den Estrich darunter sehen konnte.