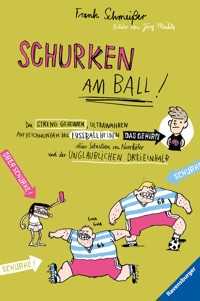7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Allein unter Dieben
- Sprache: Deutsch
DIE LUSTIGSTE CHAOTENTRUPPE SEIT DER OLSEN-BANDE! Eine herrlich verrückte Familiengeschichte voller skurriler Charaktere und umwerfender Situationskomik: Die Käsebiers sind die lustigste Verbrecherfamilie der Welt! Eduard ist dreizehn Jahre alt und ein Meisterdieb. Das glaubt jedenfalls seine verrückte Verbrecher-Familie. Leider hat Eduard andere Pläne: Er möchte ehrlich werden. Eine Katastrophe für den Käsebier-Clan! Doch kaum hat Eduard seinen ersten ehrlichen Nebenjob angetreten, wird er von seinem fiesen Chef erpresst. Eduard soll für ihn einen riesigen Diamanten klauen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Frank Schmeißer
Allein unter Dieben – Meine verrückte Verbrecherfamilie und ich
FISCHER E-Books
Inhalt
Kapitel 1Wie alles begann
Mein Name ist Eduard Käsebier. Ich bin 13 Jahre alt. Ich bin ein Meisterdieb. Gut, eigentlich bin ich kein Meisterdieb. Ich bin ein ganz normaler Dieb. Für einen Meister hält mich nur meine Familie. Die ist bärenstolz auf mich. Aber nur, weil ich nicht so ein kolossaler Tollpatsch wie mein Bruder bin oder ständig Nasenbluten kriege, wenn ich etwas stehle, wie mein Vater. Also, noch mal. Mein Name ist Eduard Käsebier. Ich bin 13 Jahre alt. Ich bin ein Dieb. Dies ist mein Geständnis.
Der ganze Schlamassel fing an Weihnachten an. Genauer gesagt an Heiligabend. Es war wirklich ein schönes Fest, das ich mit meiner ganzen Familie feierte. Wir hatten einen großen Tannenbaum mit echten Kerzen, aus den Lautsprechern plätscherte Weihnachtsmusik, und im Kamin knisterte ein behagliches Feuer. Für meinen Bruder Franz und mich gab es heiße Schokolade mit Sahne, in die wir köstliche selbstgebackene Schokokekse tunkten. Meine Eltern standen nebeneinander, einen Arm um die Hüfte des anderen geschlungen. Sie tranken Champagner aus ganz feinen Gläsern, die so dünn waren, dass man sie kaputtpusten konnte. Weil Papa die elektrischen Kerzen wieder abmontiert hatte, um echte Kerzen für den Weihnachtsbaum zu verwenden, trank Oma sicherheitshalber keinen Alkohol. Sie stürzte sich stattdessen aus einem großen Pott Fluten von Kaffee in den Kopf.
»Falls irgendein Käsebier-Tollpatsch mal wieder eine Katastrophe verursacht, werde ich rechtzeitig fliehen«, erklärte sie und sah dabei Papa an. Der schluckte die Bemerkung mit eingefrorener Miene und einem ganzen Glas Champagner runter, während Mama ihm aufmunternd zuzwinkerte und ihn kurz an sich drückte.
Ich war als Weihnachtsmann verkleidet, weil mein Vater so aufgeregt war, dass die Gefahr von Nasenbluten bestand. Und damit er nicht den schönen weißen Bart versaute, musste ich ins Kostüm schlüpfen. Ich weiß nicht genau, ob Elefanten Weihnachten feiern. Aber falls sie es tun, wäre das rotweiße Zelt, das ich trug, das perfekte Kostüm für sie.
Die Hose war so weit, dass ich dreimal reinpasste, und die Jacke ging mir fast bis zu den Knien. Ich stopfte sie tief in den Bund, damit die Hose nicht so rutschte, was mir außerdem einen weihnachtsmann-mäßig dicken Bauch verschaffte. Meine Stiefel waren so riesig und schwer, dass ich mich mit den Zehen darin festkrallen musste, damit ich nicht bei jedem Schritt versehentlich aus den Schuhen schlüpfte. So stapfte ich, eine Hand zur Sicherheit an der Hose, um nicht auf einmal ohne dazustehen, wie ein betrunkener Troll umher und verteilte die Geschenke. Ho ho ho. Meiner Mutter überreichte ich einen schönen Pullover, den Papa für sie ausgesucht hatte. Einen ganz feinen aus ganz weicher Wolle. Sie schlüpfte gleich hinein und streichelte ihn selig. Eigentlich konnten wir uns so was Feines gar nicht leisten. Unsere normalen Klamotten bestanden vollständig aus billigen Plastikfasern. Was zur Folge hatte, dass wir alle ständig elektrostatisch aufgeladen waren. Immerzu standen uns die Haare zu Berge, als hätten wir gerade in die Steckdose gefasst.
Und egal was oder wen wir berührten, immerzu bekamen wir einen elektrischen Schlag. Bei uns zu Hause blitzte es öfter als auf dem roten Teppich in Hollywood.
Mein Bruder Franz bekam seinen ersten eigenen Dietrich geschenkt. Mit einem Dietrich kann man, mit ein bisschen Übung und ein bisschen Geschick, jedes Schloss knacken. Für Franz, der weder Übung noch Geschick besaß, würden die Türen also weiterhin verschlossen bleiben. Trotzdem freute er sich wie Bolle und begann sofort, im Schloss der nächstgelegenen Tür herumzustochern.
Mein Vater bekam von Mutter eine Hose, die ihm viel zu groß war, und von meiner Oma Anne Testosteronpflaster und ein Buch. »Heimwerken für Dummies«. Was die Pflaster sollten, verstand ich nicht. Oma meinte nur, dann würden ihm endlich Haare auf der Brust wachsen. Gibt es da draußen tatsächlich Leute, die so was wollen? Das Buch war aber definitiv nicht nett gemeint. Papa freute sich deshalb auch nicht wirklich. Schließlich verbrachte er täglich etliche Stunden in seinem Keller und baute und schraubte ständig neue Gerätschaften zusammen, die uns in eine strahlende Zukunft katapultieren sollten. Oma hielt das für Unfug und kolossale Zeitverschwendung. Ehrlich gesagt, hatten uns seine Basteleien bislang auch noch nirgendwohin katapultiert. Nicht mal das echte Katapult, das er letzten Sommer aus seiner Werkstatt geschleppt hatte. Das brach einfach in der Mitte durch und begrub meinen Bruder unter sich, der damit eigentlich auf unser Dach geschossen werden sollte. Mit diesem Katapult wollten mein Vater und Franz in ein Museum einbrechen und kostbare Gemälde klauen. Ihr Plan war, über das Dach einzusteigen. Theoretisch hätte man sich auch über ein Vordach und Regenrinnen nach oben schwingen können. Theoretisch. Nur war mein Bruder alles andere als eine Sportskanone. Der kam ja selbst auf dem Spielplatz kaum unfallfrei ein Klettergerüst für Kinder hoch.
Ich war, ehrlich gesagt, ganz froh darüber, dass sein Katapult nicht funktionierte. Erstens hätte jemand dabei draufgehen können, und zweitens war ein Einbruch in ein Museum für uns mindestens eine Nummer zu groß. Wenn nicht sogar zwei oder drei.
Meine Oma bekam Badezusätze. So Wellness-Zeug, das nicht nur ewige Jugend versprach, sondern auch eine glückliche und friedliche Stimmung. Aber ich bezweifelte stark, dass das Öl Oma wirklich in einen netten Menschen verwandeln konnte. An ihrer Biestigkeit würde selbst ein Schwimmbad voll miefendem Badeöl nichts ändern.
Als wir alle unsere Geschenke ausgepackt hatten – ich bekam ein Paar Fußballschuhe und zwei Unterhosen –, stellten wir uns vor den Weihnachtsbaum und schossen ein Foto.
Normalerweise haben wir keinen so großen Baum. Und ein kuscheliges Feuer gibt es bei uns nur, wenn mal wieder eine Erfindung von Papa explodiert. Wir sind eher arm. Aber dieses Jahr sollte Geld endlich mal keine Rolle spielen. Daher feierten wir auch nicht bei uns zu Hause, sondern waren alle zusammen bei der sehr reichen Familie Schönemann. Blöderweise kam die aber früher aus dem Skiurlaub zurück als erwartet.
»Was zum …«, stammelte Herr Schönemann.
Sein riesiger Schnauzbart begann zu zittern. Sein Kopf wurde immer röter. Seine Frau stand nur stumm und mit weitaufgerissenem Mund da, während ihr Sohn sich weiter ungerührt Pralinen in den Schlund stopfte. Vater bekam sofort Nasenbluten, Oma Anne schlich langsam rückwärts Richtung Terrassentür, Franz hatte nichts von alldem mitbekommen und popelte weiter mit seinem Dietrich im Schloss rum, und ich rief: »Na, das ist ja mal eine Überraschung! Frohe Weihnachten!«
Schönemanns Sohn zeigte auf die Unterhosen, die ich immer noch in der Hand hielt. Er schmatzte mit vollen Backen: »Das sind meine Unterhosen!«
»Und das ist mein Pullover!«, schrie Frau Schönemann, als sie Mutter entdeckte. »Diebe! Einbrecher! Ruf die Polizei, Günter!«
Frau Schönemann zerrte am Ärmel ihres Mannes. Ohne uns aus den Augen zu lassen, nahm der sein Handy aus der Jackentasche. Als im Hintergrund der Weihnachtsbaum in Flammen aufging, weil niemand auf die Kerzen geachtet hatte, nutzten wir routiniert die Chance und hauten ab.
Meine Eltern drängten sich an den Schönemanns vorbei und türmten durch die Haustür. Franz und ich folgten Oma über die Terrasse in den Garten. Wir rannten blitzschnell über den Rasen, sprangen geschickt über Beete, kämpften uns durch Büsche und kletterten flink wie Äffchen über den Gartenzaun rüber zu den Nachbarn. Zumindest taten das meine Oma und Franz. Ich stolperte und stürzte dank der riesigen Weihnachtsmannstiefel durch die Rabatten, knallte einmal frontal gegen einen Baum, weil mir die verkackte Weihnachtsmannmütze ständig vor die Augen rutschte, eierte herum und verhedderte mich schließlich mit dem Weihnachtsmannmantel und dem angeklebten Rauschebart in der Hecke. Ich war gefangen wie eine Fliege im Spinnennetz. Es war ein Elend. Ich sah zurück, ob die Schönemanns die Verfolgung aufgenommen hatten. Kein Mensch weit und breit. Es sah alles normal und friedlich aus. Wenn man mal vom brennenden Weihnachtsbaum absah, der in einem hohen Bogen aus der Terrassentür geflogen kam. Dann sah ich Herrn Schönemanns Kopf herausschauen. Aber statt gemütlich zu mir zu schlendern und mich zu packen, während ich im Busch rumzappelte wie ein Fisch an Land, schloss er einfach die Terrassentür und verschwand. Die Schönemanns waren wohl immer noch viel zu geschockt, um uns hinterherzuhetzen. Vielleicht hielten sie mich aber auch für einen gefährlichen Irren, den man lieber abhauen lässt, auch wenn er einem ein Weihnachtsmannkostüm und die Unterhosen geklaut hat. Ich zerrte an meinem Mantel und versuchte verzweifelt, den verknoteten Bart aus dem Gestrüpp zu befreien. Ich verlor die Geduld und riss mich los. Die Hälfte meines Barts ließ ich zurück. Ich kletterte den Zaun hoch, nur noch ein kleiner Sprung, und ich hätte das Ärgste hinter mir. Ich hatte schon einen Fuß auf dem Zaun, als ich abrutschte. Verdammte Stiefel. Ich sackte weg, blieb mit dem locker um meine Hüfte schlackernden Gürtel am Zaun hängen und kippte kopfüber in den Nachbargarten. Ich hing fest. Den Kopf ein paar Zentimeter über dem Boden, die Beine in der Luft. Ich fummelte am Gürtel rum, löste ihn und machte einen Köpper ins Gemüsebeet. Schnell rappelte ich mich wieder auf und lief weiter zur Straße. Dort verschnaufte ich kurz und schloss den Gürtel. »Geschafft!«, dachte ich, als eine Haustür aufgerissen wurde.
»Da sind Sie ja endlich!«, brummte eine Stimme hinter mir und eine große Hand patschte mir auf die Schulter. Ich blieb wie angewurzelt stehen.
»Wurde auch Zeit«, brummte die Stimme weiter. »Wir warten schon eine Ewigkeit!«
Ich drehte mich um und sah in die Augen eines etwa 40-jährigen Mannes, der so aussah, als würde er alles verstehen, nur keinen Spaß. Er war blass, trug eine Sturmfrisur und hatte dicke Ringe unter den Augen. Den sollte sich echt mal ein Arzt angucken.
»Los, schnell rein, bevor die Kinder total ausflippen.«
»Was? Ich … nein, ich glaube, Sie verwechseln mich … ich …« Ich war so überrumpelt, dass ich nur noch stammeln konnte. Allerdings vergeblich. Der Mann drehte mich um und schob mich vor sich her in ihr Wohnzimmer. Schon im Flur konnte ich das Geschrei wütender Kinder und das Gezeter einer Frau hören.
»Ben, hör auf, deiner Schwester an den Haaren zu ziehen! Und du, leg die Streichhölzer weg, Lea!«
Ben und Lea waren ungefähr vier Jahre alt. Sie waren fein angezogen und drehten gerade ziemlich am Rad. Ben raste schreiend wie ein Irrer immer um den Weihnachtsbaum. Seine Mutter hinter ihm her. Wenn er an seiner Schwester vorbeikam, griff er blitzschnell ihren langen Zopf und zog daran wie an einer altmodischen Klospülung. Seine Schwester schrie kurz laut auf und schlug nach ihm. Dann fummelte sie weiter ungerührt ein Streichholz nach dem anderen aus der Packung und versuchte, es anzuzünden. Bis Ben wieder vorbeikam und ihr an den Haaren zog. Es war ein nicht enden wollender Alptraum, mit dem ich nichts zu tun hatte und auch nichts zu tun haben wollte.
»Entschuldigung«, sagte ich. »Aber ich bin wirklich nicht der, für den Sie mich halten. Ich muss auch weg und so.«
Der Vater ignorierte meine Einwände. Er sah mich nur hilfesuchend an und rief: »Schaut mal, der Weihnachtsmann ist da!« Dann schubste er mich nach vorne, mitten hinein ins Chaos.
Ben legte eine Vollbremsung hin und Lea die Streichhölzer weg. Sie stemmte ihre kleinen Hände in die Hüften und keifte: »Das ist kein Weihnachtsmann. Das ist ein Weihnachtszwerg!«
Wie bitte? Zwerg? Ich war sauer. Für mein Alter war ich fast normal groß.
»Nein, Lea, mein Schätzchen. Das ist der Weihnachtsmann. Ganz bestimmt. Manche Weihnachtsmänner sind halt etwas kleiner geraten. Geradezu winzig«, versuchte die Mutter Lea zu beruhigen.
Aber die ließ sich nicht täuschen. »Außerdem ist er potthässlich und sein Bart ganz zerzaust.«
»Moment mal! Wer ist hier potthässlich? Wer so einen behämmerten Zopf trägt, der …« Weiter kam ich nicht. Denn in diesem Moment kam Leas Bruder Ben in vollem Spurt angerast und umarmte mich derart stürmisch, dass ich nach hinten umkippte. Ben lag auf meinem gut gepolsterten Bauch und trommelte mit seinen kleinen Fäustchen auf meiner Brust herum.
»Geschenke! Geschenke!! Geschenke!!! Geschenke!!!! Wo sind meine GESCHENKE!?!?!?!«, schrie er.
»Lass mich! Geh sofort runter von mir«, ächzte ich. Ich schob ihn nach links, drehte mich nach rechts und zog mich am Tisch mühsam hoch. Als ich das offensichtliche Missverständnis aufklären wollte – »Ich hab keine Gesch…« –, kam der Vater mit einem großen braunen Sack um die Ecke.
»Ich glaube, hier im Sack des Weihnachtsmanns sind bestimmt noch ein paar Geschenke für euch!«
Die Kinder hüpften jubelnd hin und her, und die Mutter stellte einen Stuhl hinter mich. »Setzen!«, befahl sie mir zischend. Und ich setzte mich.
»Aber wenn ihr eure Geschenke wirklich haben wollt, müsst ihr jetzt brav sein«, ermahnte die Mutter die beiden Quälgeister.
»Ganz genau. Brav und still. Mucksmäuschenstill!«, ergänzte ich, weil meine Ohren von dem ganzen Geschrei schon klingelten.
»Setzt euch bitte auf den Schoß vom Weihnachtsmann, damit er euch die Weihnachtsgeschichte erzählen kann.«
»Genau«, sagte ich und: »Wie bitte?«
Ich sollte die Weihnachtsgeschichte erzählen? Ich zweifelte, ob ich die überhaupt zusammenbekam. Lea und Ben hopsten auf meine Beine. Lea links und Ben rechts. Erwartungsvoll sahen sie mich an. Die Aussicht auf Geschenke ließ die beiden offensichtlich zur Ruhe kommen. Das ist bei meiner Mutter genauso. Wenn die sich über Papa ärgert, bekommt sie auch immer was zum Auswickeln und beruhigt sich wieder.
»Ja. Äh. Die Weihnachtsgeschichte. Gut. Im Grunde kennt die ja jeder«, fing ich an und dachte: jeder außer mir. »Also, Weihnachten ist die Zeit, … äh … da feiern wir Weihnachten.« Himmelherrgott nochmal. Ich hatte einen totalen Blackout. Ich wusste auf einmal nichts mehr. Mein Gehirn war leer. Warum zum Teufel feierten wir überhaupt Weihnachten? Ging es dabei um den heiligen Tannenbaum? Die Erfindung der Kerze? Streitereien in der Familie? Ich hatte es vergessen. Mein Gesicht nahm langsam aber sicher die Farbe meines Mantels an.
»Äh, Weihnachten. Wird ja auch das Fest der Diebe … äh Liebe genannt und das, weil … äh.«
Weiter kam ich nicht. Es war, wie in Mathe an der Tafel zu stehen. Die ganze Klasse kennt die Lösung, und mir fallen keine Formeln, sondern nur die englischen Vokabeln ein, die mir eine Stunde zuvor beim Vokabeltest den Hintern gerettet hätten. Ich stammelte weiter.
»Äh … Kinder. Ich frage euch: Was feiern wir an Weihnachten?«
Beide riefen gleichzeitig: »Die Geburt von Jesus!«
»Genau! Mann, bin ich bescheuert. Jesus. Natürlich. Das war es! Hatte ich glatt vergessen.« Ich war erleichtert. Die Eltern nicht. Die Mutter legte ihr Gesicht in Falten und sah ihren Mann fragend an. Der zuckte nur verzweifelt mit den Schultern. Gut, ich wusste nun wieder, um wen es ging, und konnte mich auch grob an den Rest der Weihnachtsgeschichte erinnern. Sehr grob. Damit die Geschichte nicht schon nach fünf Sekunden zu Ende erzählt war, musste ich etwas improvisieren. Aber das sollte doch zu machen sein. Während die Blagen auf meinem Schoß rumzappelten und mich mit Schokolade vollsabberten, gab ich mein Bestes. Und das war nicht besonders gut, fürchte ich.
»Also. Vor langer, langer Zeit wurde Jesus geboren. Die Dinosaurier waren da aber schon ausgestorben. Da hatte Jesus aber Glück gehabt, was?«
Ich lachte den Kindern auf meinem Schoß aufmunternd zu. Die sahen mich aber an, als hätte ich nicht alle Tassen im Schrank. Mit Humor kam ich hier nicht weiter. So viel war klar. Die Nummer musste ich wohl bierernst und ohne Publikumsbeteiligung durchziehen.
»Die Eltern von Jesus waren Maria und Josef. Josef war Schreiner. Er baute Tische, Regale und diese kleinen Keile, die man unter die Tür schiebt, damit sie nicht zufällt. Was Maria beruflich machte, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich irgendwas mit Medien. Auf alle Fälle bekamen sie ein Baby, das nicht von ihnen war. Also, Maria hatte keinen anderen Mann oder so, aber irgendwie auch schon. Aber der andere Mann war kein normaler Mann wie euer Vater oder eure Mutter … äh … nicht eure Mutter. Also, es war Gott, versteht ihr? Also, das Kind war von Gott. Äh. Deshalb war Josef auch nicht sauer auf Maria. Und weil irgendwer das mit Gott und so spitzgekriegt hatte, hat er sie bei den Bull… der Polizei oder dem Jugendamt verpfiffen. Deshalb mussten sie alle Fingerabdrücke beseitigen, ihren Esel satteln und abhauen. Dann wurde es aber langsam dunkel, und sie brauchten ein Hotel. Die waren aber alle ausgebucht. Wahrscheinlich weil es ein Konzert in der Stadt gab oder eine Kirmes. Und daher blieb ihnen nichts anderes übrig, als in einer Scheune zu übernachten. Und weil es immer so ist, dass wenn man mal Pech hat, auch noch Unglück dazukommt, bekam Maria das Baby in der Scheune. Zwischen all den Tieren. Da gab es Esel, Schafe, Kühe, Ziegen, Gänse, Hühner, Schweine, Hasen, äh … Hamster, Meerschweinchen, Dackel, Bären, Echsen, Elefanten, Giraffen, Erdmännchen, Mücken, Hummeln, äh … Heringe, Wale, Haie, Quallen, … Einhörner, Drachen …«
»Sagen wir einfach, da waren viele Tiere«, unterbrach die Mutter meine Aufzählung. Sie lächelte mich an. Allerdings nur mit dem Mund. Ihre Augen lächelten so gar nicht. Auch der Vater schien nicht ganz zufrieden. Er zeigte mir einen Vogel.
»Genau. Da waren ganz viele Tiere«, fuhr ich fort. »Und weil das Baby ja Jesus war, Gottes Sohn, kamen auch drei Könige vorbei. Gefunden hatten die Könige die Scheune, weil ihnen ein Stern den Weg gewiesen hatte. Man kann sich den Stern in etwa so vorstellen wie ein Schild auf der Autobahn.«
»Die Könige kamen aber nicht mit leeren Händen! Nein! Sie kamen, um Geschenke abzuliefern. So ein bisschen wie die Typen, die immer die Pizza bringen. Nur, dass Maria und Josef nix bezahlen mussten. Ich meine, für die Geschenke! Ob die Scheune was gekostet hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich schon. Wo war ich stehengeblieben? Ah. Ja. Und weil Jesus Geschenke bekam, bekommt ihr jetzt auch Geschenke und …«
»Und das ist das Ende der Geschichte!«, sagte die Mutter und sprang von der Couch auf.
»Ja. Gut«, sagte ich. »Soll ich jetzt noch die Geschenke …«
»Nein, nein … das wird nicht nötig sein«, sagte die Mutter und hob Lea von meinem einen Bein, während der Vater Ben dabei half, von meinem anderen runterzurutschen.
»Das übernehmen wir. Vielen Dank«, sagte die Mutter. Ben drehte sich um. »Blöde Geschichte!«, motzte er und trat mir volle Lotte vors Schienbein. Autsch! Der Vater packte mich am Kragen. Er zog mich hinter sich her durch den Flur, drückte mir kurz vor der Haustür einen Geldschein in die Hand und schubste mich nach draußen.
Ich sah mir den Schein an. Zwanzig Euro.
»Ist der für mich?«
»Ja. Und komm nie mehr wieder!« Er knallte die Tür zu.
»Frohe Weihnachten!«, rief ich noch und sah mir den Schein noch mal an. Zwanzig Euro. Gar nicht so schlecht, dachte ich. Mein erstes auf ehrliche Weise verdientes Geld. Das fühlte sich komischerweise ziemlich gut an.
»Jederzeit wieder«, flüsterte ich und steckte den Schein ein.
»Tag, Kollege. Und ho, ho, ho!« Ein anderer Weihnachtsmann stakste an mir vorbei und tippte zum Gruß mit seinem Zeigefinger freundlich an seine rote Mütze. Er war groß und kugelig und sah genauso aus, wie man sich einen Weihnachtsmann vorstellt. Fröhlich pfeifend klingelte er an der Tür.
Als der Vater öffnete, begrüßte ihn der Weihnachtsmann mit »Ho, ho, ho, der Weihnachtsmann ist da! Entschuldigen Sie bitte die Verspätung, aber ich wurde mit Keksen und Würstchen vollgekotzt und musste mich umziehen.«
Der Vater verharrte verdutzt einen Moment, dann sah er zu mir rüber. Dann wieder zum echten Weihnachtsmann. Dann wieder zu mir. Sein Kopf fuhr hin und her, als würde er ein Tennisspiel gucken. Seine Blässe verschwand. Seine Augen weiteten sich. Er hatte endlich kapiert, was ich ihm von Anfang an sagen wollte: Ich bin der falsche Weihnachtsmann. Aber anstatt drüber zu lachen und mir Komplimente zu machen, als totaler Weihnachtsmann-Anfänger die Situation so prima gemeistert zu haben, wurde er jetzt richtig wütend.