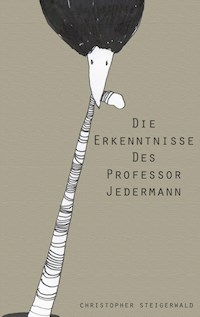Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ich war nicht glücklich gewesen. Aber es hatte diesen Ort gebraucht, um es zu realisieren. Glück war die Absenz von Sorgen geworden, vielleicht war es auch nie etwas anderes gewesen. Jemals. Ich wusste, ich hatte genug zu essen für den nächsten Tag, genug zu trinken und würde es warm haben. Das war Glück. Und wenn es das nicht war, fühlte es sich jedenfalls genauso an. Ein Roman über die eigene Endlichkeit, Eskapismus und den Wunsch nach einem einfachen Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
"Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, dass das, was wir Wirklichkeit getauft haben, eine noch größere Illusion ist als die Welt des Traumes."
- Salvador Dali
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel I
Abschnitt 1
Abschnitt 2
Abschnitt 3
Abschnitt 4
Abschnitt 5
Abschnitt 6
Abschnitt 7
Abschnitt 8
Abschnitt 9
Abschnitt 10
Abschnitt 11
Abschnitt 12
Abschnitt 13
Abschnitt 14
Abschnitt 15
Abschnitt 16
Abschnitt 17
Abschnitt 18
Abschnitt 19
Abschnitt 20
Abschnitt 21
Abschnitt 22
Abschnitt 23
Abschnitt 24
Abschnitt 25
Abschnitt 26
Abschnitt 27
Kapitel II
Abschnitt 28
Abschnitt 29
Abschnitt 30
Abschnitt 31
Abschnitt 32
Abschnitt 33
Abschnitt 34
Abschnitt 35
Kapitel III
Abschnitt 36
Abschnitt 37
Abschnitt 38
Abschnitt 39
Abschnitt 40
Abschnitt 41
Abschnitt 42
Abschnitt 43
Abschnitt 44
Abschnitt 45
Abschnitt 46
Abschnitt 47
Abschnitt 48
Abschnitt 49
Abschnitt 50
Abschnitt 51
Epilog
Abschnitt 1
Abschnitt 2
Prolog
Vor einigen Jahren war ich mit meinen Eltern und meinem Onkel zum Essen verabredet. Es war ein lauer Sommerabend und wir saßen im Hinterhof eines griechischen Restaurants. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wie es hieß, oder was ich gegessen habe – Überhaupt wäre es eigentlich ein ziemlich belangloser Abend geblieben, hätte mein Onkel nicht diesen einen Satz gesagt, an den ich seitdem immer wieder denken muss und der sich so tief in mir eingenistet hat, dass ich mir sicher bin, dass er sich immer wieder in mein Bewusstsein drängen wird, auch wenn meine Haut schon schlaff an mir herunterhängen würde.
Wir waren gerade erst angekommen und wurden von einem Kellner an einen Tisch in einer Ecke des Hofs geleitet. Die Sonne war noch nicht ganz untergegangen und tauchte alles in sanfte Wohligkeit, wie sie es nur in dieser einen Stunde vermochte, bevor sich die Nacht endgültig über das Land legte.
Wir nahmen Platz und ich legte die Serviette, die auf dem Teller vor mir drapiert war, zur Seite.
Meine Eltern, die nicht in der Stadt wohnten, waren mit dem Auto gekommen, mein Onkel wohnte nur wenige Straßen von dem Restaurant entfernt. Ich hatte an diesem Abend die Bahn genommen, da ich keine Lust hatte einen Parkplatz zu suchen und außerdem gerne ein paar Gläser Wein trinken wollte.
Der Kellner brachte kurz darauf die Speisekarten und reichte sie, wie es die Etikette erforderten, den Herren zuletzt. Es fiel mir auf, nicht weil ich diesem Gehabe etwas abgewinnen konnte, ganz im Gegenteil, fühlte ich mich in ungezwungenen Atmosphären wohler, aber ich wusste, dass es neben meiner Welt auch noch eine gab, in der feine Damen pikiert die Nase rümpften, bekäme ihr Gatte die Karte vor ihnen gereicht. Gepflogenheiten aus einer Zeit, aus der wir uns das meiste abgewöhnt hatten, aber manches schien zäh und war noch nicht bereit nur noch eine Notiz in einem Geschichtsbuch zu werden.
Während ich die verschiedenen Weine, die zur Auswahl standen, studierte, begann mein Vater über die Mühen der Anreise zu sprechen. Ich hörte nur mit einem Ohr zu, aber er regte sich über sein Navigationsgerät und seinen Kampf mit selbigem auf, erzählte, dass er einmal falsch abgebogen war, weil er sich sicher gewesen war, das Navigationsgerät läge falsch, ein Gedankengang dessen Absurdität mich innerlich den Kopf schütteln ließ. Er schloss damit, dass er wegen einer Baustelle auf der Strecke weitere zehn Minuten verloren hatte. Er tat dies mit einer Selbstverständlichkeit, die offenbarte, dass es nie einen Zeitpunkt in seinem Leben gegeben hatte, zu dem er auch nur darüber nachgedacht hatte, ob es überhaupt möglich war, Zeit zu verlieren.
Auf die Nachfrage meines Onkels, warum er denn überhaupt diesen Weg gewählt hatte, entgegnete ihm mein Vater, dass dies der schnellste Weg gewesen wäre.
Ich hatte mich für Chardonnay entschieden, was eigentlich schon klar gewesen war, bevor ich die Karte aufgeschlagen hatte. Ich betrachtete dennoch jedes Mal die ganze Auswahl, bevor ich mich dafür entschied, was ich immer nahm. Der Mensch ist ein seltsames Geschöpf, dessen Fähigkeit, Offensichtlichem zuwider zu handeln, im Tierreich einmalig ist.
Ich legte die Karte zur Seite und zündete mir eine Zigarette an.
Mein Onkel antwortete meinem Vater und sagte diesen einen Satz, diese eine Frage, die so simpel und beiläufig daher kam, dass sie mir ungehört und unverstanden wie Luft durch die Finger hätte rauschen können und ich bin mir sicher, dass meine Eltern keine Erinnerung mehr daran haben, scheiternd an der Flüchtigkeit der Worte, deren Fassbarkeit mit jedem mehr gesprochenen immer weniger wird, aber ich hatte sie festgehalten in diesem Moment. Vielleicht haben sie aber auch mich festgehalten.
Ich bin mir nicht sicher, ob es einen Unterschied macht. Ich glaube schon.
Schon früh war ich mir der Tatsache gewahr, nicht nur niemals alles, sondern im Gegenteil nur ausgesprochen wenig sein zu können. All meine Wünsche, all meine Hoffnungen waren winzige Fragmente aller möglichen Wünsche und Hoffnungen. Im Laufe meines Lebens begriff ich, dass Zeit, die verstrichen war, vor allem eine Ansammlung von Dingen war, die ich nicht getan hatte. Wie in einer Rutsche schoss ich durch meine eigene Existenz hindurch und konnte nicht nach rechts oder links greifen und erst recht nicht zurück. Die Anzahl der möglichen Varianten meiner Selbst war mit jedem Tag kleiner geworden. Sozusagen schrumpfte ich seit dem Tag meiner Geburt immer weiter dem letzten Ich, das ich sein sollte, entgegen und alle Phantasmen, nach denen ich gegriffen und nicht vermocht hatte festzuhalten, hatten sich am Wegesrand danieder gelegt und waren zu Abzweigungen geworden, die ich nie beschreiten sollte.
Es dauerte bis zu dem Tag, als ich sah, wie sich das Licht im Gefieder einer Krähe brach, bis ich glaubte, alles verstanden zu haben. Ich war die Summe aus allem was ich war und was ich nicht war. Und das einzige was es benötigte, um glücklich zu sein, war ein weiterer Tag.
I
1
Es war ein tiefes In-mich-gekehrt-sein, das von mir Besitz ergriff. Es war nicht viel um mich herum und selbst das wenige, ein großer Holztisch, ein Ofen, ein Bett, verschwamm, während ich es ansah und gleichzeitig durch es hindurch starrte.
All die Jahre hatte ich mich vorbereitet, auf etwas, auf das man sich wahrscheinlich nicht vorbereiten konnte. Doch jetzt, da es tatsächlich passiert war, fühlte ich mich trotzdem überrumpelt. Eine Sekunde, die alles veränderte. Und wenn man es noch so oft durchgespielt hatte, wie ein Film, deren eigener Regisseur und Hauptdarsteller man war, die Realität lässt jede noch so detaillierte Fiktion so klein, so fern erscheinen. Als würde ein Speer die Blase, die einen umschloss, zum Platzen bringen und einen durchbohren.
Ich hatte mir eine Blase konstruiert im letzten Jahr. Es war anstrengend gewesen, voller Entbehrungen. Vielleicht war es auch nur ein Versuch gewesen, sich nicht schuldig zu machen. Aber war ich genau das, weil ich nichts getan habe? Weil ich nicht gekämpft habe, außer mit mir selbst? Ich wusste ja, dass es passieren würde. Es war nicht eine Frage des ob, sondern des wann.
Und wann war offensichtlich heute. Ich konnte die Asche riechen.
2
Ich weiß nicht, wie lange ich ins Nichts geblickt hatte. Das Pfeifen des Teekessels riss mich aus meinen Gedanken. Ich stand auf und nahm ihn vom Ofen herunter. Ich schüttelte ihn und stellte fest, dass sich kaum noch Wasser darin befand. Wie lange hatte ich ihn nicht wahrgenommen?
Ich musste lachen. Es war die perfekte Metapher.
3
Ich hatte mir noch nicht einmal die schweren Stiefel ausgezogen, als ich zurückgekommen war. Ich band die Schnürsenkel des linken neu zusammen, richtete mich wieder auf und spürte die Schmerzen in meinem Rücken. Seit dem Sturz war er nie wieder so geworden wie vorher. Wann immer ich mich bückte, quittierte er es mit minutenlangen pulsierenden Schmerzen. Und hier oben, oder besser, hier draußen musste man sich oft bücken.
Aber das war jetzt auch egal.
Ich nahm meine Jacke vom Haken neben der Tür und band mir den Schal so um, dass er mein Gesicht bis oberhalb der Nase abdeckte. Es war verflucht kalt draußen und ich wollte mir nicht den Tod holen. Bei dem Gedanken musste ich so laut lachen, dass mir alles wieder verrutschte und ich von vorne beginnen musste, den Schal um mich zu wickeln.
Ich musste nicht nach meinem Schlüssel suchen, wie ich es früher immer getan hatte, denn ich hatte keinen. Es gab kein Schloss an der Tür. Wozu auch? Hier war ja niemand.
Ich drehte noch einmal um und ging zur Truhe neben meinem Bett. Die hatte ein kleines Schloss und auch einen kleinen Schlüssel, stand aber trotzdem immer offen.
Ich musste nicht lange in ihr kramen, um die drei Gegenstände, die ich mitnehmen wollte, darin zu finden. Ich war ein ordentlicher Mensch. Ich war es geworden. Noch nicht einmal aus einer Notwendigkeit heraus. Eigentlich hätte es mir in meinem früheren Leben mehr geholfen als heute. Aber heute hatte ich auch viel weniger Dinge, was es einfacher machte, alles an seinem vorgesehenen Platz zu belassen.
4
„Verflucht Julia, sagen Sie ihm einfach, dass er sich noch fünf Minuten gedulden muss. Das ist doch Wahnsinn hier! Alle dreißig Sekunden klingelt das Telefon! Ich werde verrückt!
Sagen Sie jedem, der irgendetwas mit der Presse zu tun hat, dass er sich sein Handy nehmen, es sich in den Hintern schieben und darauf warten soll, dass ich ihn irgendwann zurückrufe. Dann hat ihr Handy wenigstens etwas mit uns gemeinsam!“, brüllte ich das zierliche Gesicht an, das durch einen Spalt in der Tür in mein Zimmer lugte.
Julia sah mich entgeistert an. Sie war noch nicht lange genug dabei, um zu wissen, dass es sich dabei um ganz normale Umgangsformen handelte. Hier zumindest. Unter diesen Umständen.
Das Telefon klingelte erneut. Ich warf ihm einen wütenden Blick zu, erkannte die Nummer auf dem Display und griff sofort nach dem Hörer.
Ich wedelte mit der Hand in Julias Richtung, um sie aus dem Raum zu scheuchen. Ihr Gesichtsausdruck sah aus, als hätte sie, ohne anzuklopfen das Zimmer ihrer Eltern betreten und sie beim Sex erwischt.
Als sie die Tür hinter sich zugezogen hatte, nahm ich die Hand von der Muschel.
„Hallo? Hallo...?“, rief mir Michaels Stimme entgegen.
„Scheiße, Michael, ich hör dich doch!
Seit wann weißt du es? Und noch wichtiger, von wem?“
Ein paar Sekunden Stille in der Leitung. Die Finger meiner linken Hand spielten mit einem Bleistift. Ich schmiss ihn quer durch das Zimmer, als ich mir dessen gewahr wurde. Er prallte von einer Flasche Whisky ab, die auf der kleinen Bar neben dem Aquarium stand. Ich spürte das Verlangen nach Alkohol, aber ich brauchte einen klaren Kopf. Wenn der ganze Wahnsinn vorbei war, würde ich mich so heftig mit Whisky betrinken, dass ich hoffentlich alles vergessen würde, was damit zusammenhing.
„Beruhige dich! Es gibt kein Leck. Noch nicht.“
„Von wem, Michael?“ Ich musste es wissen.
„Ist das wichtig?“
„Natürlich ist das wichtig. Ich habe keine Zeit für so einen Scheiß! Sag mir, von wem, oder ich lasse dich erschießen!“ Ich meinte es nicht wirklich ernst. Sonst hätte ich es nicht in ein mittelmäßig abhörsicheres Telefon gesagt. Aber ich hätte an diesem Tag nicht die Hand dafür ins Feuer gelegt, dass der ganze Mist, nicht den einen oder anderen das Leben kosten würde.
„Sarah hat mich gebrieft. Zufrieden?“
Ich spürte, wie ich mich entspannte. Ich hatte sogar die Zähne zusammengepresst. Ich lehnte mich im Stuhl zurück und legte die Beine auf meinen Tisch. Eigentlich hatte sich das Problem dadurch nicht im Geringsten gebessert, aber es fühlte sich ein kleines bisschen bewältigbarer an.
Die Tür öffnete sich nach einem kurzen Klopfen erneut. Julias Gesicht – schon wieder. Ich schmiss die Kaffeetasse, die auf meinem Schreibtisch stand nach ihr. Sie zerplatzte an der Wand. Schon während des Flugs hatte sie dir Tür wieder zugezogen. Es blieb aber genug Zeit, um das Entsetzen, das ihr ins Gesicht geschossen war, wahrzunehmen.
„Die ganze Scheiße kriegen wir doch niemals zwei Wochen lang totgeschwiegen. Ich habe den ganzen Morgen darüber nachgedacht und mir sind eigentlich nur zwei Lösungen eingefallen: Entweder wir gehen selbst damit an die Öffentlichkeit, dann aber heute noch, vielleicht hat es die Hälfte der Idioten bis zum Wahltag schon wieder vergessen Ich hielt kurz inne, um mir eine Zigarette anzuzünden.
„Und was ist die zweite Möglichkeit?“, fragte Michael.
„Wir finden noch eine größere Leiche bei ihm im Keller, so dass sich keiner mehr für das hier interessiert.“ Michael schnaufte ins Telefon. Dann war es kurz still. Ich konnte beinahe hören, wie es in seinem Kopf ratterte. Wie er Optionen durchdachte und Sekundenbruchteile später wieder verwarf.
„Das ist doch beides nichts! Beziehungsweise funktioniert wahrscheinlich nur beides zusammen. Das kriegen wir niemals auf die Schnelle hin.
Wir müssen das einfach zwei Wochen unter Verschluss halten. Es ahnt doch niemand etwas, oder?“
„Ob jemand etwas ahnt? Bist du bescheuert, Michael? Wir arbeiten jetzt seit zehn Jahren zusammen und das ist wahrscheinlich das dümmste, was du je gesagt hast. Und du hast mir schon einen Vortrag über Bürgerrechte gehalten, während du Koks von der Arschbacke einer Nutte geleckt hast, die wir uns aufs Zimmer geholt haben. Erinnerst du dich noch? Wie hat sie sich genannt? Mary? Maria?“
„Florence!“
„Richtig! Das war ein Abend!
Und der Ausschlag erst, weißt du noch, wie -“ Ich hatte den Abend noch vor dem inneren Auge, als wäre es erst ein paar Wochen her, dabei waren es Jahre. Aber ich hatte Michael von Anfang an gemocht. Er war ein bisschen seltsam, ein bisschen verrückt, aber absolut fleißig, loyal und seriös. Zumindest wenn er 'im Dienst' war. Wenn er es nicht war, war er stattdessen höchst seltsam, höchst verrückt und nicht im Geringsten fleißig, loyal oder seriös. Ich schätzte beide Seiten an ihm. Er war die Versinnbildlichung des Mottos 'alles zu seiner Zeit'.
„Das ist doch egal jetzt“, unterbrach er mich. „Wie viele Leute wissen es?“
„Du, ich. Sarah. Tim vermutlich. Das ist nicht das Problem. Alles war wir herausfinden, kann auch jeder andere herausfinden. Das weißt du selbst am besten.“
Erneut Stille in der Leitung.
„Wir brauchen eine Ablenkung. Eine beschissene Nebelkerze. Oder besser gesagt, ein ganzes Feuerwerk aus Nebelkerzen“, fuhr ich fort.
„Oder wir gehen halt doch in die Offensive und hoffen, dass es nicht so schlimm wird, wie wir vermuten.“
„Was wenn doch? Was wenn wir am Arsch sind danach? Ich weiß, dass ich es selbst vorgeschlagen habe. Und ja, die Leute sind Idioten mit dem Gedächtnis eines dementen Goldfischs, aber...“ Ich konnte mich nicht mehr wirklich auf das konzentrieren, was ich eigentlich sagen wollte, weil meine Gedanken sprunghaft durch die Gegend huschten, nach Lösungen forsteten.
„Aber?“, fragte Michael. Seine Stimme riss mich zurück in den Moment.
„Ja, Michael, was wenn nicht? Was, wenn sie es doch nicht vergessen? Was dann?“
„Dann sind wir am Arsch, ja!“
„Dann sind wir am Arsch!“, wiederholte ich die Erkenntnis erneut. Langsamer als er, betonte jedes Wort, als wäre es ein eigener Satz.
„Wir brauchen einen Vierzehntage-Plan! Und zwar schnell! Wir müssen uns zusammensetzen. Wann kannst du hier sein?“
„Ich weiß nicht. Ich kann versuchen, heute noch einen Flug zu bekommen. Wann ist der späteste Termin, an dem du mich brauchst?“
„Gestern!“
5
Das Erste, das mir auffiel, als ich aus dem Auto stieg und den Pfad zur Hütte ging, war, dass es überhaupt nicht so still war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Allerlei Vögel zwitscherten durcheinander, irgendwas raschelte in den bereits längst zu Boden gefallenen Blättern. Bis zum ersten Schnee würde es wohl nicht mehr lange dauern. Es wäre wohl besser gewesen, erst im Frühjahr herzukommen, aber ich wollte nicht warten. Ich konnte nicht warten.
Ich hatte die Hütte gekauft, ohne sie jemals vorher gesehen zu haben. Auf Fotos, ja, aber ich war nicht selbst hier gewesen. Ich hatte mir angesehen, wo sie liegt, das hatte mir genügt. Der Mann, der sie mir verkauft hatte, hatte mich ungläubig angesehen, das weiß ich noch. Er hatte gesagt, dass einiges daran gemacht werden müsste, das Dach sei an einer Stelle undicht und das Geländer an der Veranda morsch. Und so weiter. Er hörte gar nicht mehr auf zu reden und es wirkte eher so, als versuchte er alles, um mir die Hütte nicht verkaufen zu müssen. Irgendwann hatte ich ihm nicht mehr zugehört. Ich war mir bewusst gewesen, dass ich es wahrscheinlich noch bereuen würde, aber in dem Moment war es mir egal gewesen.
Es musste schnell gehen, bevor irgendjemand mitbekam, wohin ich mich zurückgezogen hatte.
Es dauerte über eine Stunde bis ich den Pick-Up entladen hatte. Dabei sortierte ich noch nicht mal einen Bruchteil davon ein, sondern stelle das meiste einfach dort ab, wo Platz war.
Erst als ich fertig war, hielt ich kurz inne und schaute mich um. Ich kam mir vor wie ein Zeitreisender. Hier gab es keine Heizung, keinen Strom, noch nicht einmal fließend Wasser. Ich war mir in diesem Moment bereits sicher, dass ich all die Annehmlichkeiten irgendwann schmerzlich vermissen würde, aber als ich mich auf einem der beiden Stühle, die an einem schlichten Holztisch standen, niederließ, war ich froh darüber, all das hinter mir gelassen zu haben.
Ich zündete mir eine Zigarette an. Eines der ganz wenigen Laster, die ich auch hier nicht loswerden wollte. Ich hatte sie stangenweise in einen der Kartons gestopft. Ich rauchte noch nicht einmal besonders viel, aber ich wollte dennoch nicht komplett darauf verzichten. Ich stand auf, ging in den Bereich der Hütte, den man als Küche bezeichnen konnte und durchsuchte Schubladen und Schränke nach einem Aschenbecher. Erfolglos. Ich nahm stattdessen eine Tasse und setzte mich wieder auf den Stuhl. Er knarzte. Es klang wie ein Seufzen. Als wäre er von meinem Gewicht überfordert und hoffte, dass ich bald wieder aufstehen würde.
Ich war nicht fett, aber ein bisschen Speck befand sich eigentlich an meinem ganzen Körper. Ich hatte all die Jahre so viel gearbeitet, dass ich weder genügend Zeit für vernünftiges Essen, noch für Sport gehabt hatte. Irgendwann rächte sich das eben. Ich trug noch einen Gürtel an meinen Hosen, aber eigentlich war er längst zum Accessoire verkommen.
Ich schälte mit einem Fuß den anderen aus dem Schuh und umgekehrt. Danach legte ich die Beine auf den Tisch. Er kippte zu einer Seite weg, weil das eine Bein einfach nachgab, als wäre es ein kontrolliert gesprengtes Hochhaus. Die Tasse, die ich als Aschenbecher zu missbrauchen gedachte, nahm Fahrt auf und rutschte die Schräge hinunter, entleerte ein paar Flocken Asche auf den Boden, schlitterte noch ein paar Meter weiter und kam dann zum Stillstand. Sie sah unbeschädigt aus.
Ich musste laut lachen. Fast ein bisschen hysterisch. Es dauerte fast eine Minute, bis ich mich wieder so weit unter Kontrolle hatte, dass ich aufstehen und die Tasse aufheben konnte. Ich drückte meine Zigarette in ihr aus und ging zurück zum Tisch, der schräg auf dem Boden lehnte.
„Scheiße!“, war das einzige Wort, das meine Lippen verließ.
Ich beschloss ihn zu reparieren.
6
Ich drehte den Tisch so, dass er die verbliebenen drei Beine in die Luft streckte wie ein toter Käfer. Ich wackelte an ihnen. Sie schienen mir recht stabil, hatten kaum Spiel. Auch das Holz bröselte nicht.
Ich suchte die Kiste, in der sich die Werkzeuge befanden, was mich einige Minuten kostete, da ich sie nicht beschriftet hatte. Nachdem ich sie unter anderem Kram zu Tage gefördert hatte, nahm ich mir einen der größeren Hämmer und schlug den Stumpf, der wie ein fauler Zahn aus der Platte ragte, mit zwei, drei Schlägen ab. Es war nicht schwer, das Holz wehrte sich kaum.
Ich sammelte die Trümmer zusammen und schmiss sie in den Ofen, der eingestaubt in einer Ecke stand. Ich strich mit dem Finger über die Oberfläche und hinterließ einen deutlich sichtbaren Strich darauf.
Ich würde ihn noch vor dem Abend verwenden müssen, da der Mann im Radio gesagt hatte, dass eine sternenklare und kalte Nacht vor uns lag.
Bei dem Gedanken fiel mir ein, dass es auch einen Schuppen gab, wenige Meter hinter der Hütte, in dem sich angeblich hauptsächlich trockenes Feuerholz befände.
Ich leerte den Karton mit den restlichen Werkzeugen und allem anderen einfach auf den Boden und ging mit ihm nach draußen. Die Wiese, die sich hinter der Hütte erstreckte, bis sie vom Wald verschluckt wurde, stand hoch und sah aus, als wäre sie entweder noch nie gemäht worden, oder zuletzt vor Jahren. Ich sah mich um.
Bäume, Gras. Das war's. Der leichte Wind bewegte beides hin und her. Die letzten Bienen schwirrten scheinbar willkürlich umher.
Ich entdeckte die Hütte am Rand der Wiese. Es war ein kleiner Verschlag aus Holz mit einem Dach aus Wellblech, von dessen Kanten Moos herabhing. Ich schlug mir den rechten Fuß an einem Stein an, den ich unter dem Gras nicht gesehen hatte. Ich fluchte erneut laut.
Ich erreichte den Schuppen ohne weitere Zwischenfälle und stellte den Karton neben der Tür ab. Als ich an ihr zog, bewegte sie sich kein Stück. Ich rüttelte fester daran, fast ohne Effekt. Ich sah sie mir genauer an. Eine metallene Klinke, von der bereits eine der ursprünglich vier Schrauben, die sie im Holz hielten, fehlte. Im Geiste fügte ich den Umstand meiner To-Do-Liste hinzu. Mit den Füßen versuchte ich das Gras davor platt zu treten. Nach einer Weile stellte ich fest, dass die Erde mit der Zeit über die Schwelle gewuchert war. Ich hatte keine Schaufel mitgenommen.
Ich fuhr mir mit der linken Hand über die Stirn und strich mir die Haare aus ihr. Für einige Momente stand ich einfach nur da und sah durch die Tür hindurch.
Nach einem Seufzen ging ich auf die Knie und begann mit meinen Händen Erde zur Seite zu schaffen. Es war mühselig und ich riss mir einen Fingernagel halb ab, als ein spitzer Stein sich in ihn bohrte und verfing. Erst spürte ich nichts, doch nach ein paar Sekunden begann es höllisch weh zu tun. Der ganze Finger pochte im Rhythmus meines Herzschlags. Ich grub nur noch mit der anderen Hand und nach einer weiteren Viertelstunde hatte ich genug Erdreich entfernt, dass ich einen weiteren Anlauf starten wollte.
Ich zog kräftig an der Tür und sie schnellte auf, so dass ich selbst nach hinten gerissen wurde, blieb dann an einem Stein hängen, den ich übersehen hatte, was mich nach vorne schleuderte und mit der Stirn an der Türkante aufschlagen ließ. Es war nicht sonderlich schlimm, aber es überstrahlte ein paar Sekunden den Schmerz in meinem Finger. Ich tastete meine Stirn ab. Kein Blut.
Es war der erste von vielen Momenten, in dem ich froh war, ganz alleine zu sein. Niemand, der mich sah, der sich über mich lustig machen konnte. Über mein tölpelhaftes Verhalten. Ich überlegte, wie es ausgesehen haben musste. Vermutlich wie eine Szene aus einem drittklassigen Slapstickfilm.
Ich warf einen Blick in die Hütte. Sie war nicht sonderlich groß. Vielleicht zwei auf fünf Meter. Höchstens. Im hinteren Bereich waren Holzscheite gestapelt. Sauber aufgeschichtet und trocken. Ich bezweifelte zwar, dass sie länger als ein paar Wochen vorhalten würden, aber besser als nichts.
An der linken Wand hingen eine Axt, eine Sense und eine Schaufel. Natürlich. Eine Schaufel.
Ich holte den Karton und schmiss ein paar Scheite hinein, hob ihn hoch, stellte fest, dass er leichter war, als erwartet und trug ihn zurück in die Hütte. Ich stellte ihn neben dem Ofen ab, ging zurück zum Schuppen und nahm die Axt von der Halterung. Sie schien in überraschend gutem Zustand. Ich strich vorsichtig mit dem Finger über die Klinge. Sie war scharf. Ich stellte sie kurz ab, um mir eine Zigarette anzuzünden und schlenderte daraufhin in Richtung des Waldes, auch wenn diese Wortwahl eigentlich eine Übertreibung war, da es ja noch nicht einmal hundert Meter dahin waren. Ich ertappte mich dabei, dass ich eine Melodie pfiff. Ich hatte es noch nicht mal gemerkt. Ich hatte gute Laune. Der Tisch war kaputt, mein Finger schmerzte und ich hatte gute Laune. Und pfiff, ohne es gemerkt zu haben. Als wären es meine Lippen, die mir mitteilten, dass ich mich wohl fühlte. Trotz allem.
Als ich die ersten paar Bäume hinter mir gelassen hatte, Laubbäume hauptsächlich, sah ich mich um. Ich konnte mich nicht erinnern, wirklich einmal in der Natur gewesen zu sein in den letzten Jahren. Also so richtig. Der Stadtpark war das höchste der Gefühle. Und auch meine Joggingrunden waren immer seltener geworden im Laufe der Zeit. Die Luft war eine andere. Dichter irgendwie. Meine Schritte erzeugten ein Rascheln oder Knacksen, je nachdem ob ich auf Laub oder einen kleinen Ast trat. Vor einer Eiche war ein breites Loch am Boden. Es hatte mindestens den Durchmesser eines Basketballs. Ich vermutete, dass es ein Fuchsbau war und eine Weile später sollte sich diese Annahme bestätigen. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir sollten einander erst später kennenlernen.
Als ich meinen Blick nach oben wandern ließ, fiel mir ein Ast, den ich erreichen konnte auf, der die perfekte Dicke hatte, um als Tischbein zu enden. Außerdem war er relativ gerade. Ich stellte mich direkt darunter, umfasste den Stiel der Axt mit beiden Händen und schwang sie. Ein Stück Holz sprang durch die Luft und verschwand irgendwo im Laub. Ich löste die Axt, die sich schon beim ersten Schlag einige Zentimeter ins Holz gefressen hatte und holte ein zweites Mal aus. Ich konnte den verletzten Baum riechen. Es roch gut, was ein perverser Gedanke war, wie ich fand, aber so war es nun einmal. Harz quoll aus der Wunde wie Blut.
Ich schlug noch ein paar Mal meine Axt in den Ast, dann gab er unter seinem eigenen Gewicht nach und knickte nach unten. Raschelnd berührten die Blätter den Boden. Mit einem letzten Schlag löste ich ihn vom Baum. Irgendwie musste ich an einen Chirurgen denken, der eine Amputation durchführt. Ob er es auch 'lösen' nannte? 'Als nächstes lösen wir das Bein vom Torso'. Der Begriff klang so harmlos. Auch wenn der Vergleich ein wenig unfair war. Uns Menschen wuchs ja kein neues Bein nach, nachdem man das alte gelöst hatte. Noch nicht einmal an einer anderen Stelle. So richtig widerstandsfähig war der Mensch eigentlich nicht. Der einzige evolutionäre Vorteil gegenüber jeder anderen Kreatur, seinen Verstand, hatte er sich beinahe gänzlich abgewöhnt.
Sonst wäre ich nicht hier. Nicht mitten im Nichts, dabei einen Ast zurecht zu hacken und in Richtung der Hütte zu tragen. Ich wäre woanders. Ich wäre jemand anders. Und ich hätte noch Hoffnung.
7
Ich hatte Kaffeepulver mitgenommen. Und eine kleine silberne Kanne, in der man Kaffee brauen konnte. Nur Strom gab es keinen. Ich wollte den Ofen nicht benutzen, nur für ein paar Tassen. Kaffee musste also warten.
Ich betrachtete den Ast. Ich kam mir ein wenig vor wie ein Eroberer. Ich hatte etwas mit meiner eigenen Körperkraft geleistet. Nach all den Jahren, in denen das Anheben einer schweren Akte das anstrengendste war, das ich vollbracht hatte. Retrospektiv wirkte all das surreal. Ich hatte mitgespielt. Nicht nur das eigentlich. Ich hatte das verdammte Spiel gelenkt. Es gab hunderte Hände am Steuer, aber meine waren zwei davon gewesen. Und nun freute ich mich darüber, einen Ast abgeschlagen zu haben.
Aber es war, was nun zählte. Keine Telefonkonferenzen, keine Sekretärin, die sich gutmütig für einen Hungerlohn demütigen ließ, keine dummen Arschlöcher mehr, denen man nicht sagen durfte, dass sie welche waren.
Ich nahm den Ast und hielt ihn auf die Tischplatte, an der Stelle, an der sich sein morscher Vorgänger befunden hatte. Er war immer noch viel zu lang. Alle kleinen Ästchen hatte ich bereits abgehackt. Es ging nur noch um die richtige Länge und wie ich ihn am besten an der Platte befestigen würde.
Ich hatte kein Maßband. Es war der erste Gegenstand, den ich vermissen sollte. Er blieb nicht der letzte.
Ich war schlecht vorbereitet. Das war mir sogar bewusst gewesen. Wie schlecht ich es tatsächlich war, sollte ich aber erst lernen. Und es sollte schmerzhaftere Momente geben, als diesen. Ein fehlendes Maßband war zu verkraften.
Also kramte ich einen Stift aus der Innentasche der Jacke, die ich auf der Herfahrt getragen hatte, heraus, hielt den Ast direkt neben eines der Beine und markierte die Stelle, an der ich ihn abzusägen gedachte. Eine Säge hatte ich dabei.
Es war reiner Zufall, dass ich eine hatte. Wobei -
Ich hatte mir zumindest nie eine gekauft. Wozu auch? Erstens lebte ich in einem kleinen Haus in der Vorstadt, ohne größeren Garten, zweitens zur Miete und drittens ausgestattet ohne jedes Vergnügen an jeder Form von Heimwerkern. Es gab keinen Grund sich eine Säge zu kaufen.
Mein ehemaliger Schwiegervater fand es jedoch offenbar notwendig, mir immer wieder alles mögliche Werkzeug zu schenken, weil man kein richtiger Mann war, wenn man kein Werkzeug besaß. Rückblickend war ich ihm dankbar, allerdings aus Gründen, die sein kleingeistiger Verstand nicht vorausgesehen haben konnte. Wie es ihm und der Hexe, die er geheiratet hatte, gelungen war, eine liberale und halbwegs intellektuell aufgeschlossene Person großzuziehen, habe ich nie verstanden. Wahrscheinlich konnten sie nichts dafür.
Seiner geistigen Grobschlächtigkeit und ihrem mit den Jahren immer weniger subtil dargebotenen Rassismus hatte sich meine Frau zu entziehen vermocht.
Sie waren gut situiert und gehörten zu der Art Leute, die es auch nicht verbargen. Zu allen Familienessen, denen