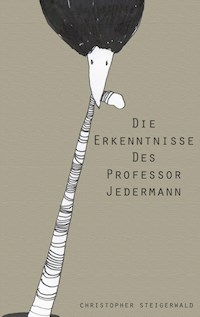
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Professor Jedermann hat es sich eigentlich in seinem Leben gemütlich gemacht, weitgehend frei von Sorgen und Überraschungen. Bis zu dem Moment, als ihn seine Frau von einem auf den anderen Tag verlässt. Mit der Situation überfordert, setzt er sich in sein Auto und fährt einfach drauf los. Der Beginn eines Roadtrips ohne Ziel, der ihm unerwartete Begegnungen und Erkenntnisse beschert. Eine skurrile Geschichte, die dem Leser viele Fragen stellt, ohne sie zu beantworten. "Ich war es leid, Pläne zu machen. Mein ganzes Leben hatte ich nichts auf mich zukommen lassen, sondern mir ausgesucht, auf was ich zu kam. Ich glaube nicht, dass es mich glücklicher gemacht hat."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
I do recall that some time in the 70's, the revolutionary Yippie Abbie Hofman said to me over a drink: „Tomorrow isn't promised!“; reminding me that if we move one grain of sand, the earth is no longer excactly the same.
- David Bowie
Inhaltsverzeichnis
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Teil II
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Teil III
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Teil IV
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Kapitel 81
Kapitel 82
Teil V
Kapitel 83
Epilog
I
1
Es ist gar nicht mal so, dass ich mein Leben nicht leiden kann. Vielmehr ist es das Leben, als solches, als Konstrukt. Ich fühle mich einfach nicht wohl darin. Das hat nichts mit meiner individuellen Existenz zu tun. Dieser Organismus Menschheit, der sich parasitär, wie ein Pilz, oder eine Flechte über den ganzen Planeten walzt und alles unter sich begräbt, unter einem Teppich aus Beton, irgendwie ist er mir fremd. Niemand scheint Herr seiner Geschicke, alle scheinen nur kafkaeske Rädchen zu sein, die auf unerklärliche Weise ineinander greifen und dem ganzen Organismus auf dem Weg zu seinem unheilvollen Zenit zuarbeiten.
Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob das nun eine Erkenntnis ist, oder bloß eine Theorie.
Vielleicht ist es auch nur ein Versuch das eigene Scheitern zu verarbeiten, sich davon freizusprechen.
Als mir meine Frau sagte, dass sie, wie ich auch, auf Frauen stehe und mich deshalb verlassen müsse, hatte ich mich gefragt, ob das wirklich ein Grund sei. Geschlafen hatten wir ohnehin schon eine Ewigkeit nicht mehr miteinander. Aber vielleicht ja deshalb. Andererseits ist das ja auch in Ehen, in denen die Frau nicht lesbisch ist, nicht ungewöhnlich. Es gibt ja auch andere Gründe nicht miteinander zu schlafen. Deshalb trennt man sich doch nicht gleich!
Ich weiß noch, dass ich sie gefragt habe, seit wann sie lesbisch sei. Sie hat mir geantwortet, dass sie es nie nicht gewesen sei. Wieso sie mich dann geheiratet habe, wollte ich wissen. Sie wollte Kinder haben und ich wäre ein guter Kerl gewesen. Sie fand mich nett. Auf eine seltsame Art und Weise fand ich das einleuchtend.
Sie war ja eine kluge Frau, Ärztin. Dass sie Ärztin war, spielte eigentlich keine Rolle. Und sie war auch ein guter Kerl.
Das mit den Kindern sei ja nun ohnehin vorbei, meinte sie. Wir würden ja nun wirklich keine weiteren bekommen wollen.
Unsere Tochter habe sie bereits informiert. Sie sei überrascht gewesen.
Ob ich keine Fragen an sie hätte?
Ich überlegte kurz, stellte dann aber fest, dass ich keine hatte.
Dann fragte ich sie doch, warum sie mich denn deshalb gleich verlassen müsse. Wie ich mir das denn vorstelle, wollte sie von mir wissen. Wahrscheinlich erwartete sie nicht wirklich eine Antwort darauf. Ich gab ihr keine.
Ich habe mir schon lange nichts mehr vorgestellt. Ich habe es verlernt. Sich etwas vorstellen heißt, sich etwas auszudenken, wie es sein könnte. Man malt sich die eigene Zukunft in den buntesten Farben an und baut ein Schloss neben dem anderen.
Ich habe nie einen Sinn darin gesehen. Ich sehe, was ist. Alles was ist, hat es irgendwie geschafft zu sein. Unumstößlich, nicht mehr rückgängig zu machen. Es wird für immer gewesen sein. Ich respektiere das, es ist beachtlich. Ich denke nicht an Dinge, die noch nicht so weit sind, zu sein. Was wenn sie gar nicht werden? Ich finde das müßig.
Wie ich mir das vorstelle?
Ich sagte ihr wie immer.
Wie immer?
Wie immer.
Sie schüttelte den Kopf und ging. Sie nehme den Honda, rief sie mir noch zu, bevor sie die Tür von außen ins Schloss zog.
2
Auf dem Weg zur Universität hielt ich bei einem Bäcker. Er hatte einen Drive-In-Schalter. Ich nutzte ihn nicht. Nicht wegen Entschleunigung, oder so einem Quatsch. Wovon sollte ich noch entschleunigen? Ich fühlte mich nicht gehetzt oder getrieben von meinem Alltag. Eher im Gegenteil. Was auch immer das war.
Ich aß ein Stück Kuchen, das zu meiner Überraschung hervorragend schmeckte. Ich aß ein zweites. Der Mann, der mir den Kuchen brachte, bemerkte nicht, dass meine Frau lesbisch war. Wie auch? Man sieht es einem Mann nicht an, wenn seine Frau lesbisch ist. Ich überlegte, wie vielen anderen Männern wohl das gleiche passiert war. Ob es Gemeinsamkeiten gab?
Ich bezahlte und fuhr weiter. Mein Telefon klingelte. Es war Elisabeth, meine Tochter. Sie wollte wissen, wie es mir gehe. Ich sagte ihr, wie immer. Ob ich sie nicht besuchen kommen wolle? Am Wochenende? Ich erfand Gründe, weshalb ich nicht kommen könne. Ich sagte ihr, dass ich auflegen müsse, und, dass ich sie bald anrufen würde. Sie seufzte noch ein „Papa“ in den Hörer und legte auf.
Ich benutze häufig dehnbare Begriffe wie bald, demnächst, oder vermutlich. Oder mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ich bin kein Freund von Definitivem. Die Menschen sind immer so sicher, was passieren wird, was sie machen werden. Dass sie am nächsten Morgen aufstehen und zur Arbeit gehen. Ich denke mir dann immer, dass man das doch noch gar nicht wisse. Sie wollen immer alles kontrollieren. Vor allem sich selbst. Nichts kontrollieren sie und tief verschüttet in ihnen drin, wissen sie das auch.
So wie meine Frau, die lesbisch ist. Das wollte sie ja auch nicht. Oder vielleicht wollte sie es sogar, das weiß ich nicht. Aber sie hat es nicht zu verantworten, sie hat es nicht bestimmt.
Ich parkte den Wagen, wo ich ihn immer parkte. Ich ging in mein Büro. Ich bin Professor für Geschichte, aber das ist nicht wichtig. Stellen sie sich mich gar nicht erst vor. Ich sehe aus wie sie wollen, es spielt keine Rolle.
Ich erledigte, was zu erledigen war. Ich hielt eine Vorlesung vor leeren Gesichtern und beschloss dabei, dass ich meine Tochter besuchen würde. Nicht, dass es mich zu ihr zog, aber es sprach auch nichts dagegen. Ich mochte sie gut leiden und sie wollte es so.
3
Als ich zu Hause ankam, leerte ich den Briefkasten, überflog die Briefe, deren Bedeutungslosigkeit ich bereits an den jeweiligen Absendern erkannte, und legte sie ungeöffnet beiseite. Die ganze Arbeit, die hinter diesem Papierkrieg steckt. Irrsinn! Einer, der sich alles ausdenkt, einer, der es druckt, einer, der es verpackt, einer, der es zustellt – und wofür – dass ich es in den Papierkorb werfe.
Ich nahm ein Bad. Ich weiß nicht mehr, warum ich das tat. Ich badete nie. Aber wie ich so durch das leere Haus schlenderte, nichts mit mir anzufangen wusste, dachte ich mir, dass baden auch nicht schlechter sei, als schlendern.
Das Wasser war heiß. Es dampfte. Meine Frau hatte sämtliche Duschwässerchen und Cremes mitgenommen. Alle bis auf eines. Es stank fürchterlich. Ich würde einkaufen gehen müssen.
Nach meinem Bad durchsuchte ich das Haus akribisch. Ich schrieb eine Liste, auf der ich vermerkte, welche Dinge mit meiner Frau gegangen waren, die ich ersetzen wollte. Es war ein perfider Rundgang. Andererseits auch ein sehr pragmatischer.
Ich fragte mich, ob es wohl schwerer zu akzeptieren wäre, wäre meine Frau nicht lesbisch geworden und hätte sie mich aus einem anderen Grund verlassen. Wegen mir. So brauchte ich mir immerhin keine Vorwürfe zu machen. Oder geloben mich zu ändern, zu bessern, um Vergangenes zurückzubringen. Womit hätte ich meine Frau zurückgewinnen sollen? Ich war nun mal ein Mann. Das ist auch keine Charakterfrage. Ich war ohne eine Vagina geboren worden.
Auch wenn ich nicht glaube, dass das Vorhandensein einer Vagina die Situation verändert hätte.
Ich beschrieb bereits die dritte Seite meines Blocks. Ich verlor die Lust. Ich setzte mich auf einen Sessel im Wohnzimmer und schaute mich um. Den Fernseher hatte sie mir gelassen. Ich sehe nie fern. Ob es wohl einen Sender für Lesben gibt? Ich wollte den Fernseher anschalten, um es herauszufinden. Ich bekam ihn nicht zum Laufen.
Ich blickte auf die Uhr. Die an meinem Arm, nicht die an der Wand. Der Sessel war nicht auf sie ausgerichtet. Außerdem ging sie ein paar Minuten vor. Meine Frau hatte das so gewollt. Alle Uhren im Haus gingen vor. Sie hatte gesagt, es helfe ihr, pünktlich zu sein. Ich habe das Konzept nie verstanden. Sie wusste doch, dass die Uhren vorgingen! Schließlich hatte sie sie selbst vorgestellt. Ich rechnete stets im Kopf zurück. Ganz automatisch. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich war immer pünktlich. Sie war es nie.
Ich stellte alle Uhren im Haus auf die richtige Zeit. Als ich fertig war, hatte meine Zeit die meiner Frau eingeholt. Wir waren wieder gleichauf. Beide vergingen schleppend. Es war erst Nachmittag, aber der Tag hatte bereits keine Aufgaben mehr für mich.
Ich wollte eine Flasche Rotwein öffnen.
Ich trinke selten Alkohol. Ich mag das Gefühl, das er im Kopf erzeugt nicht. Die Leute reden immer dummes Zeug, wenn sie betrunken sind. Ich finde es nicht erstrebenswert dummes Zeug zu reden. Zumindest nicht absichtlich. Die Leute wissen ja, was passieren würde. Sie trinken schließlich oft genug. Oder trinken sie, um dummes Zeug reden zu können? Nüchtern ist das ja verwerflicher. Wenn sie trinken, haben sie zumindest eine Ausrede.
Der Korkenzieher war nicht mehr an seinem Platz. Ich schrieb ihn auf die Liste. Der Kugelschreiber war leer. Ich nahm einen anderen und schrieb 'Kugelschreiber' auf die Liste.
Ich trank Whisky. Den bekam ich auf.
Ich blickte aus dem Fenster. Irgendwann schlief ich ein.
4
Ich wurde von dem Geräusch unserer Klingel geweckt. Es benötigte jedoch ein erneutes Klingeln, bis ich es überhaupt realisierte und verstand, dass es mir galt. Ich warf einen Blick auf die Uhr, es war halb acht. Ich versuchte einen klaren Gedanken zu fassen, während ich aufstand. Mein Blick streifte die zur Hälfte geleerte Flasche Whisky. Auf dem Weg zur Tür klingelte es erneut. Ich wollte etwas in Richtung Tür rufen, stattdessen musste ich husten.
Ich warf noch einen Blick in den Spiegel, bevor ich die Klinke drückte. Ich sah genauso aus, wie ich mich fühlte.
Das rundliche Gesicht meiner Nachbarin erschien in der Tür. Sie sah aus wie eine Tante. Es war die beste Beschreibung, die mir einfiel. Ihr Blick war betreten, als sie mir sagte, sie wisse 'es'.
Ich drehte mich um und ging zurück ins Haus. Sie faselte irgendetwas vor sich hin. Ich hörte nicht zu.
Ich schlief mit ihr. Oder sie mit mir. Wahrscheinlich eher das. Auf jeden Fall schliefen wir nicht miteinander.
Danach ging sie.
Ich begab mich wieder ins Wohnzimmer und trank den restlichen Whisky. Er entfaltete seine Wirkung. Es war mir egal. Es war ja niemand hier, dem ich dummes Zeug hätte erzählen können. Nur müde wurde ich nicht.
Ich beschloss mich für die restliche Woche krank zu melden. Seit über acht Jahren hatte ich keine meiner Vorlesungen ausfallen lassen. Es war nicht meine Art. Ich wurde ja dafür bezahlt. Es wurde von mir erwartet. Nicht, dass es mir wichtig wäre, Erwartungen zu erfüllen. Überhaupt nicht. Ich habe kein besonders ausgeprägtes Pflichtbewusstsein. Es gibt bald 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Welchen Unterschied macht es, ob dreihundert davon eine Vorlesung über den Prager Fenstersturz hörten, oder nicht, bildeten sie doch nur 0,0000000375 Prozent der Gesamtbevölkerung? Sieben Nullen. Nach dem Komma.
Zahlen sind mir an sich nicht wichtig. Auch wenn sie übersichtlich sind. Und unumstößlich. Aber selbst wenn ich das Leben eines meiner Schüler verändert oder bereichert hätte, was ich obendrein für unwahrscheinlich halte, wäre das statistisch ohne Wert. Selbst wenn es hunderte wären.
Früher, als ich während meiner Vorlesungen in dem riesigen Hörsaal gestanden war, hatte ich häufig in Gedanken auf mich herab geblickt. Ich schwebte sozusagen als neutraler Beobachter über mir. Dann entfernte ich mich immer weiter von mir, bis ich auf die ganze Stadt, das ganze Land und irgendwann die ganze Erde herabsah.
Mit jedem Kilometer, den ich mich von mir entfernte, wuchs das Gefühl, dass alles bedeutungslos sei, was ich tue. Und das ist es auch.
Ich finde das gar nicht schlimm. Nur ein Narzisst hat ein Problem mit der eigenen Unwichtigkeit. Ich habe mich damit arrangiert. Eigentlich macht es viele Dinge auch einfacher, Gedanken obsolet.
Ich rief meine Frau an. Sie nahm nicht ab. Ich ging ins Bad und schluckte eine Schlaftablette. Ich legte mich ins Bett und schlief.
5
Ich erwachte spät und erschöpft. Ich hatte ein pelziges Gefühl im Mund. Das Fenster stand offen, die Sonne schien herein. Sie stand bereits ziemlich hoch. Es war warm. Mein Nachbar mähte den Rasen. Er war ein Idiot. Nicht deshalb. Grundsätzlich.
Ich erhob mich mühsam und schloss das Fenster. Ich putze meine Zähne und wusch mich. Meine Zahnbürste wirkte einsam in ihrem Becher.
Ich kramte den letzten Koffer, den mir meine Frau noch gelassen hatte heraus und füllte ihn. Ich beschloss nicht viel mitzunehmen. Es war ja nur für ein paar Tage. Zwei Hemden, zwei Hosen, zwei Paar Socken. Von allem zwei. Es war wie eine Bekleidungs-Arche.
Ich ging die Treppen hinab, den Koffer in der Hand. Im Foyer stand eine Dogge. Sie war schwarz. Ich war irritiert. Sie schaute mich an. Sie war nicht irritiert. Die Haustür stand offen. Meine Frau kam aus der Küche. Sie sagte, dass dies Maria sei. Ich dachte, sie meinte den Hund. Sie meinte aber die Frau, die nach ihr aus der Küche kam. Meine Frau fragte, ob sie besser hätte klingeln sollen, sie wolle nur noch einige Dinge einpacken. Ich dachte an meine Liste. Ich schüttelte den Kopf, dachte aber das Gegenteil. Die Dogge, die nicht Maria hieß, starrte mich an.
Ich sagte, ich nehme den Volvo.
6
Als ich das Lenkrad in beiden Händen hielt, fühlte ich mich besser. Es tat gut in Bewegung zu sein. Die Häuser zogen an mir vorbei. Keines nahm ich einzeln wahr. Es verschwamm alles zu einem Brei. Ich fuhr nicht schnell. Ich ließ die ganze Vorgartenidylle an mir vorüber ziehen.
Wenn man in einem Zug sitzt, der noch im Bahnhof steht und ein anderer Zug vom gegenüberliegenden Gleis anfährt, ist man sich manchmal für einen Moment nicht sicher, ob es nicht doch der eigene ist, der sich bewegt.
Ich war mir sicher, dass ich es war, der sich bewegte.
Ich schaltete das Radio ein. Es lief America. A horse with no name. Ich mochte den Song. Ich ließ das Fenster zu meiner linken herab und der Wind fuhr mir durch die Haare. Es war ein seltsames Gefühl von Grenzenlosigkeit, das mich durchfuhr. Aber es fühlte sich gut an. Obwohl ich ein Ziel hatte, kam es mir nicht vor, als steuerte ich darauf zu. Für einen kurzen Moment überlegte ich, ob ich wirklich meine Tochter besuchen, oder nicht einfach weiter fahren sollte. Das Ziel mich finden lassen. Ich verwarf den Gedanken, er war absurd.
Ich passierte die Stadtgrenze und wechselte auf eine Landstraße. Grün dominierte die Kulisse. Links und rechts standen Apfelbäume. Sie blühten nicht mehr, aber die Früchte waren noch klein. Sie wirkten unbeeindruckt von der ständigen Lärmkulisse und wiegten sich stattdessen geduldig im Wind. Hinter den Bäumen lagen Wiesen. Das Gras stand hoch. Ein Hirtenhund sprang vor einer Herde Schafe her. Es wirkte unwirklich. Wie aus einer anderen Zeit ausgeschnitten und über unsere geklebt. Während hochtechnisierte Roboter winzig kleine Microchips unter Aufsicht perfekt ausgebildeter Facharbeiter in weißen Kitteln in steriler Umgebung anfertigten, schlenderte gleichzeitig ein Hirte hinter seinen Schafen her. Er trug einen Hut und Gummistiefel. Gummistiefel!
Ich ertappte mich dabei, dass ich den Takt auf dem Lenkrad mitklopfte. America war mittlerweile von Journey's Don't stop believing abgelöst worden. Ich öffnete den obersten Knopf meines Hemdes und krempelte die Ärmel nach oben.
Ich fuhr schneller. Nicht weil ich früher ankommen wollte. Eigentlich war das Gegenteil der Fall. Es fühlte sich einfach besser an.
Ich schmunzelte über mich selbst. Gestern noch hatte mich meine Frau nach über zwanzig Jahren Ehe verlassen. Und ich schmunzelte. Über Apfelbäume, über Wiesen, über Hirten. Über mich.
Zwischendurch fragte ich mich immer wieder, warum ich nicht traurig war. Ich hatte meine Frau geliebt. Ich liebte sie immer noch. Und doch fehlte mir in diesem Moment nichts. Vielleicht würde das noch kommen. Wahrscheinlich. Es war dennoch eher dem Gefühl ähnlich, das man hat, wenn man etwas, an dem man lange gearbeitet hat, endlich fertig gestellt hat. Ein Bild, eine Modelleisenbahn, eine Dissertation.
Ich hatte meine Frau fertig gestellt. Und sie mich.
Ich sah eine Tankstelle und bog ab. Ich aß etwas. Ich war der einzige Kunde. Der Mann an der Kasse arbeitete gemütlich. Als ich bezahlte, wies er mich darauf hin, dass das Wetter ja endlich gut sei. Ich stimmte ihm zu. Er wünschte mir einen schönen Tag, ich erwiderte, dass ich diesen bereits hätte. Er wirkte irritiert. Dann drehte er sich weg und sortierte weiter Zigaretten ein. Dabei fiel mir ein, dass ich nie auch nur eine Zigarette geraucht hatte. Ich sagte ihm, er solle mir ein Päckchen geben. Er fragte mich welche Sorte. Ich hatte keine Ahnung. Worin lag der Unterschied? Ich fragte ihn, ob er rauche. Er bejahte. Ich sagte ihm, er solle mir einfach ein Päckchen der Marke, die er rauche geben. Ich bezahlte.
Ich setzte mich in den Wagen und schaute ungläubig die kleine Schachtel an. Ich startete den Motor. Wieder blickte ich auf das Päckchen. Ich öffnete es und suchte den Zigarettenanzünder. Nach einer Weile fand ich ihn. Ich steckte mir eine Zigarette an und fuhr los. Sie schmeckte widerlich. Mir wurde schwindelig. Ich fuhr den Wagen an den Straßenrand, bis ich wieder klar denken konnte.
Ich zündete mir eine weitere an.
7
Ich genoss die Zigaretten auf eine Art, die nichts mit ihnen als solche zu tun hatte. Es war vielmehr das, wofür sie standen. Ich rauchte, weil es egal war ob ich es tat, oder nicht. Ich hatte die freie Wahl, zu rauchen, oder es zu lassen. Für beide Seiten gab es keine Argumente. Zumindest keine, die den Grund betrafen, warum ich es tat. Natürlich ist rauchen ungesund. Das war mir selbstredend klar. Aber darum ging es ja gar nicht. Es fühlte sich richtig an. In diesem Moment. Darum ging es.
Ich fuhr so vor mich hin. Ich kam durch Dörfer, Städte, aber hauptsächlich umschloss mich Landschaft. Manchmal soweit ich blicken konnte. Ich genoss jede Minute. Ich fuhr absichtlich nicht die schnellste Route, sondern die, nach der mir war. Ich kam mir vor wie Dennis Hopper in Easy Rider.
In einem kleinen Ort hielt ich an. Es war Nachmittag. Ich fragte eine Fußgängerin, ob es hier ein Café gäbe. Sie beschrieb mir den Weg. Ich fand es rasch, es war nicht zu verfehlen.
Ich ging hinein und bestellte. Zwei Tische weiter saß ein älteres Ehepaar. Zumindest vermutete ich, dass sie eines waren. Ansonsten war niemand zu sehen.
Er las Zeitung. Sie stocherte in einem Stück Torte. Sie schwiegen. Ich war mir sicher, dass sie noch nie darüber nachgedacht hatte, ob sie möglicherweise lesbisch sein könnte. So etwas gab es in ihrer Generation nicht. Also, natürlich gab es das auch in ihrer Generation schon. Aber man machte es nicht öffentlich. Lebte es nicht aus. Es schickte sich nicht.
Beide waren korrekt gekleidet. Er trank Kaffee, schwarz. Sie trank ihn mit Milch und Süßstoff.
Er grunzte, hielt ihr die Zeitung vor die Nase und deutete auf einen Artikel. Sie nickte zustimmend. Er nahm die Zeitung wieder zu sich. Sie kamen mir vor wie ein Stillleben.
Sie wirkten beide sehr geduldig. Mit sich und dem anderen. Als wüssten sie, dass es für die meisten Dinge für sie ohnehin zu spät war. Der Gedanke klang hart, als er in meinem Kopf nachhallte. Und überheblich. Aber ich denke, er entsprach der Wahrheit. Sie hatten ihren Frieden damit geschlossen.
Ich verabschiedete mich und wünschte beiden noch einen schönen Tag. Sie nickten mir zu, ohne sich auch nur einen Zentimeter zu viel zu bewegen.
Als ich wieder im Wagen saß, zündete ich mir eine Zigarette an, fuhr aber noch nicht los. Ich überlegte, wie lange ich noch fahren sollte, bis ich mir eine Übernachtungsmöglichkeit suchen würde. Ich beschloss, dass die Entscheidung noch warten konnte. Ich war es leid, Pläne zu machen. Und einzuhalten. Mein ganzes Leben hatte ich nichts auf mich zukommen lassen, sondern mir ausgesucht, auf was ich zu kam. Ich glaube nicht, dass es mich glücklicher gemacht hat.
Ich fuhr noch eine Weile. Das Gefühl, alles richtig zu machen, war immer noch da. Ich fühlte mich beschwingt. Ich fuhr weiterhin schnell. Die Sonne stand bereits tief. Sie streichelte die Baumwipfel, nur um sie bei jedem Luftzug wieder kurz loszulassen.
Es war ein seltsamer Tag. Ein Tag, an dem ich nichts geleistet hatte. Nichts messbares, nichts was die Gesellschaft anerkannt hätte. Ich saß ja auch nur da und fuhr.
Als die Sonne gerade noch über der Szenerie hervor lugte, erreichte ich einen kleinen Ort. Die Häuser waren sich alle sehr ähnlich. In einem Vorgarten stand ein Schild mit der Aufschrift 'Zimmer frei'. Ich hielt. Ich ging zur Tür. Vorher öffnete ich noch ein kreischendes Eisentor. Ich klingelte. Nach einiger Zeit öffnete ein älterer Herr. Er trug keinen Hut. Es entwickelte sich ein Gespräch, das keine Erwähnung wert war. Er hatte noch ein Zimmer.
Ich stellte meine Tasche in dem Zimmer ab. Es war unstimmig eingerichtet. Das fiel sogar mir auf. Als hätte man einfach hineingestellt, was man noch hatte. Es war mir nicht wichtig. Es hatte ein Bett, das war alles, was für mich zählte. Es war von IKEA. Ich bemerkte es auf den ersten Blick.
Ich fragte den alten Mann, ob man in der Nähe etwas essen gehen könne. Er bejahte.
Ich aß, mäßig gut, kehrte zurück und legte mich schlafen. Ich warf noch einen letzten Blick auf mein Handy. Niemand hatte geschrieben oder angerufen. Warum auch.
8
Ich erwachte früh. Ich hatte mir keinen Wecker gestellt. Ich hatte ja alle Zeit der Welt. Es war still. Ich öffnete das Fenster. Mein Blick fiel auf einen Hinterhof, eine kleine Hütte. Ungepflegte Beete. Ein riesiger Strauch Salbei ragte aus allerlei Unkraut hervor. Eine Amsel pickte auf einem Regenwurm herum. Er wand sich. Er begriff seine Ausweglosigkeit nicht. Sonst hätte er still gehalten. Und es ertragen.
Ich zog ein frisches Hemd an und verstaute das alte in meinem Koffer, schloss ihn, schulterte ihn und ging nach unten. Der alte Mann war schon wach. Es gab Brote und Spiegelei. Ich aß reichlich. Dazu starken Kaffee. Ich trank ihn schwarz. Immer. Ich mag diese Mischgetränke nicht. Ich finde sie seelenlos.
Ich gab dem Mann ein großzügiges Trinkgeld. Ich stieg in mein Auto und wollte den Schlüssel herumdrehen, hielt aber inne. Irgendetwas war ungewöhnlich gewesen an dem Wagen, als ich um ihn herumgegangen war. Es war mir nicht sofort aufgefallen. Nur unterbewusst. Ich stieg wieder aus. Ich sah es sofort. Der linke Hinterreifen war platt. Ich schaute ihn einige Zeit fasziniert an.
Reifen wechseln war etwas, das ich nicht beherrschte. Ich habe mir immer jemanden gerufen, der es konnte.
Ich klingelte bei dem alten Mann und schilderte ihm knapp mein Problem. Ob er jemand wüsste, der mir helfen könne, fragte ich ihn. Er sagte mir, ich solle kurz warten, er würde seine Tochter anrufen. Ich runzelte die Stirn. Seine Tochter also. Sofort ärgerte ich mich über meinen eigenen, reaktionären Reflex. Spuckte mein über die Jahre sukzessive träger gewordenes Gehirn wirklich nur noch derart simpel strukturierte Zusammenhänge aus? Was war so seltsam an dem Gedanken, dass mir eine Frau beim Reifen wechseln helfen könnte?
Der Mann sagte mir, sie käme in ein paar Minuten. Sie sei Automechanikerin. Ich bemühte mich einen Gesichtsausdruck zu haben, der frei von Erstaunen war. Der vielmehr sagen sollte, dass das für einen aufgeklärten Mann wie mich nichts überraschendes sei. Es war viel verlangt von einem Gesichtsausdruck. Ich beschloss am Auto zu warten.
Tatsächlich bog schon wenige Minuten später ein Wagen um die Ecke und hielt neben mir. Eine junge Frau stieg aus. Ihre langen braunen Haaren hatte sie zu einem Zopf zusammen gebunden. Er fiel ihr über die Schultern. Sie war groß gewachsen. Ich schätzte sie auf Anfang zwanzig. Sie war bezaubernd. Ich ärgerte mich erneut darüber, dass ich überrascht war.
Sie trug ein sommerliches Kleid, das ihr grade so an die Knie reichte. Ich erlaubte mir zumindest diese Tatsache ungewöhnlich zu finden. Es erschien mir unpraktisch für einen Mechaniker, gleich welchen Geschlechts.
Außerdem war sie schwanger.
Sie lächelte, als sie auf mich zukam. Ich lächelte zurück. Sie stellte sich mir als Luisa vor und streckte mir ihre Hand entgegen. Ich sagte ihr meinen Namen und griff nach ihrer Hand. Sie war rau, der Druck bestimmt.
Ich zeigte ihr den Reifen. Sie wollte wissen, ob ich ein Ersatzrad dabei hätte. Hatte ich. Sie ging zu ihrem Wagen und kam kurz darauf mit einem Schraubenschlüssel und einem Wagenheber zurück. Sie lächelte noch immer. Sie hielt mir beides hin und ließ mich wissen, dass sie mir erklären würde, was ich zu machen hätte. Sie sei etwas eingeschränkt in der Ausführung. Sie strich sich wie zur Verdeutlichung mit der freien Hand über den Bauch. Ich nickte.
Eigentlich würde sie schon gar nicht mehr arbeiten, sagte sie zu mir. Ich entschuldigte mich. Sie winkte ab. Ich wechselte den Reifen unter ihrer Anleitung.
Es ist, wie bei so vielem, nicht besonders schwierig, wenn man weiß, wie es geht.
Sie verstaute ihr Werkzeug und kam noch einmal zurück. Ich zückte meine Brieftasche und fragte sie, was sie dafür bekäme. Sie schüttelte den Kopf. Ich insistierte. Sie insistierte mehr.
Ob ich sie wenigstens zu einem Kaffee oder, nach einem Blick auf ihren Bauch, einen Tee einladen dürfe, fragte ich sie. Sie lächelte und fand die Idee prima.
Wir gingen zu Fuß zu einem Bäcker. Man konnte draußen sitzen, was wir taten. Die Luft war klar.
9
Sie bestellte sich einen Milchshake. Ich blieb beim Kaffee. Die Bedienung brachte einen Aschenbecher. Mir fiel wieder ein, dass ich rauchte. Ich fragte Luisa, ob es sie stören würde. Sie behauptete, es würde ihr nichts ausmachen.
Ich steckte mir eine Zigarette an und blies den Rauch weg von ihr. Der Wind wehte ihr den größten Teil der Schwade ins Gesicht. Ich entschuldigte mich. Wir tauschten die Plätze. Ich bestellte Windbeutel, auch wenn ich eigentlich gar keinen Hunger hatte. Auch sie bestellte.
Woher ich käme, wollte sie wissen, und aus welchem Grund ich hier sei. Nur, falls ich es erzählen wolle, fügte sie an. Ich wollte nicht, tat es aber dennoch. Ich erzählte ihr, dass mir meine Frau gestanden hatte, dass sei lesbisch sei. Sie hatte es mir streng genommen nicht gestanden. Vielmehr mitgeteilt. Dann fasste ich zusammen, was danach passiert war. Ich brauchte nicht lange. Es war ja auch nicht viel geschehen. Sie unterbrach mich zu keinem Zeitpunkt. Sie sah mich einfach nur an, sah mir in die Augen. Die ganze Zeit. Als ob sie mich nach einer Lüge durchleuchten wollte. Ich war es ja gewohnt, dass man mich ansah, während ich sprach. Hunderte Augenpaare waren in den Vorlesungen auf mich gerichtet. Es fühlte sich dennoch anders an. Unmittelbarer.
Sie wirkte sehr interessiert. Ich fragte mich, warum.
Die Windbeutel wurden gebracht. Sie hatte Pfannkuchen bestellt. Wir aßen schweigend. Als ich fertig war, säuberte ich meine Hände an der Serviette. Sie klebten nichtsdestotrotz. Ich fragte sie, wann es soweit sei. Sie schaute mich verständnislos an. Ich deutete auf ihren Bauch. In etwa zwölf Wochen, ließ sie mich wissen. Ich nickte. Ich wusste keine weitere Frage, die daran angeknüpft hätte.
Ich gab vor die Ulme zu betrachten, die wenige Meter von uns entfernt ihr Dasein fristete. So ganz ohne andere Bäume. Sie wirkte einsam. Nun betrachtete ich sie tatsächlich.
Ich war nicht gut in derlei Gesprächen. Im Plaudern. Es machte auch keinen Sinn. Man redet ja nur um nicht zu schweigen. Zeitverschwendung.
Als hätte sie es gemerkt, begann sie von sich aus zu erzählen. Von ihrem Mann, der an seiner Karriere feilte und meist spät am Abend nach Hause kam. Er war ein paar Jahre älter als sie, wie alt genau, ließ sie unerwähnt. Er war Führungskraft in einem großen Chemieunternehmen. Sie ersparte mir Details. Wie sie sich manchmal frage, ob sie zu häufig allein sein würde mit ihrem Sohn, erzählte sie mir. Ob er genug Zeit mit seinem Vater würde verbringen können.
Sie winkte die Bedienung herbei und ich dachte, sie wollte die Rechnung gebracht bekommen. Jedoch bestellte sie stattdessen nun wirklich einen Tee.
Sie schaute mich wieder an. Ob sie meine Zeit stehle, wollte sie wissen. Diesmal war ich es, der lächeln musste. Ich verneinte und sagte, dass mir die Zeit nicht gehöre und sie man mir somit auch nicht stehlen könne.
Ich stelle es mir eigentlich immer so vor, dass einem die Zeit vielmehr geliehen wurde. Von was oder wem auch immer. Da hat ja jeder seine eigene Vorstellung. Keine ist blöder oder klüger als eine andere, denn letztlich sind sie alle eben nur eins: Vorstellungen.
Man vergnügt sich also eine Weile mit der geliehenen Zeit, oder verbringt sie, bis entschieden wird, dass es genug sei.
Vermutlich ist das alles Unsinn. Ich gebe an sich wissenschaftlichen Erklärungen den Vorzug. Sie wirken nachvollziehbarer, begreifbarer auf mich. Sie sind jedoch wenig charmant.
Sie erzählte dies und das. Merkwürdigerweise war es stets interessant. Dennoch empfand ich die Situation als zunehmend seltsam. Da saß ich also, mit einem jungen Mädchen, am helllichten Morgen in einem Café, zudem an einem Tag, an dem ich eigentlich in der Universität hätte sein müssen. Schuldig fühlte ich mich nicht. Wem gegenüber auch? Aber alles wirkte wie ein Gemälde von Dali. Verzerrt und unwirklich.
Sie löste ihren Zopf und der Wind bewegte ihr Haar. Sie sah so noch hübscher aus. Sie musste bemerken, dass ich sie förmlich anstarrte. Sie verzog keine Miene.
Wie es sich anfühle, nach so langer Zeit wieder Single zu sein, fragte sie mich plötzlich. Ich überlegte. Single? Allein das Wort klang merkwürdig. Nicht weil es kein Wort meiner Generation war. Ich hätte vermutlich alleinstehend dazu gesagt. Vor einer Woche hätte ich nicht gedacht, dass dieses Wort nochmal im Zusammenhang mit mir fallen würde. Aber sie hatte ja recht. Ich war Single. Noch nicht auf dem Papier. Aber an sich schon.
Ich hatte noch gar nicht darüber nachgedacht, wie es sich anfühlte. Ich hatte noch überhaupt nicht so viel nachgedacht seit diesem Tag. Nicht darüber. Ich hatte versucht in Bewegung zu bleiben. Aber grade saß ich ja, konnte der Frage nicht entkommen. Und es war nicht sie, die sie mir stellte, sondern ich selbst.
Ich musterte erneut die Ulme. Meine Frau war lange an meiner Seite gewesen. Es war stets großartig gewesen, sich mit ihr zu unterhalten. Sie war klug, das sagte ich bereits. Aber sie war auch gewitzt. Jeden Streit, den wir geführt hatten – und es waren nicht viele – hatte sie gewonnen. Ich weiß, es geht ja nicht darum, wer einen Streit gewinnt.
Trotzdem.
Ich versuche Streitigkeiten an sich aus dem Weg zu gehen. Ich finde sie zermürbend. Man streitet und streitet. Die meiste Zeit geht es noch nicht mal um den eigentlichen Grund. Man pirscht sich wie ein Rudel Löwen an seine Beute an, in immer enger werdenden Kreisen, bis man der tatsächlichen Ursache so nahe kommt, dass sie einen bemerkt. Mir ist das zu anstrengend. Wenn ich wütend bin, sage ich es. Und ich sage warum. Es scheint mir einfacher, zielführender.
Nicht einmal hatte ich den Streit mit meiner Frau gesucht, ihn vom Zaun gebrochen. Nicht einmal. Ich wusste ja, was gefolgt wäre. Ich hatte nie das Gefühl gehabt, dass es das wert gewesen wäre.
Wie fühlte es sich an Single zu sein? Nach all den Jahren? Es fühlte sich gar nicht an. Es hatte sich auch vorher nicht angefühlt verheiratet zu sein.





























