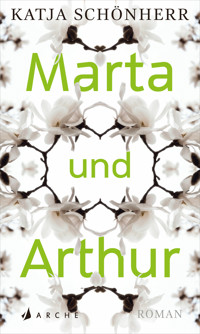11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arche Literatur Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Generationen zwischen Verantwortung und individueller Freiheit ›Alles ist noch zu wenig‹ erzählt rasant und mit entwaffnender Menschenkenntnis von allgegenwärtigen Gräben zwischen Stadt und Land, Ost und West, Alt und Jung. Dabei geht es immer wieder um die Erwartungen, die wir an unsere Familie stellen – und den Widerwillen, selbst Verantwortung zu übernehmen. Weil seine Mutter Inge nach einem Sturz nicht mehr gut laufen kann, beschließt Carsten, mit seiner fünfzehnjährigen Tochter Lissa für ein paar Wochen zu Inge in die ostdeutsche Provinz zu fahren. In der Enge des Dorfes und im Alltag ihrer seltsamen Wohngemeinschaft kollidieren unterschiedliche Lebenserfahrungen und Vorstellungen. Wo zunächst nur Unverständnis herrscht, sind Großmutter, Sohn und Enkelin schließlich gezwungen, einander neu kennenzulernen. Denn eine gemeinsame Sprache sprechen sie seit Jahren nicht: Inge schmollt lieber, als um Hilfe zu bitten. Carsten schiebt Dienstreisen vor, um Reißaus nehmen zu können. Und Lissa fühlt sich allein mit ihren Ansichten von einer gerechteren Welt. In ›Alles ist noch zu wenig‹ schreibt Katja Schönherr federleicht und gleichzeitig beeindruckend feinsinnig von überzogenen Erwartungen, bissigem Schweigen und vorsichtiger Annäherung. Dabei umkreist sie eine Frage, die drängender nicht sein könnte: Was schulden wir unseren Nächsten – und was uns selbst?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Katja Schönherr
Alles ist noch zu wenig
© 2022 Arche Literatur Verlag, ein Imprint der Atrium Verlag AG, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Designbüro Lübbeke Naumann Thoben unter Verwendung eines Motivs von © Natalia Baykalova
Die Arbeit an diesem Werk wurde unterstützt von der Stadt Zürich sowie der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich. Die Autorin dankt herzlich.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03790-135-9
www.arche-verlag.com
www.facebook.com/ArcheVerlag
www.instagram.com/arche_verlag
Für E. und für A.
Obwohl sie die Treppe in ihrem Haus seit über achtzig Jahren mehrmals täglich hoch- und runtersteigt, obwohl sie diese Treppe in- und auswendig kennt, hat Inge Ruck dieses eine Mal während des Hinuntergehens angefangen, über die Anzahl der verbleibenden Stufen nachzudenken. Noch sechs oder noch fünf?, fragte sie sich.
Und in diesem Moment stürzte sie.
Inges Bettnachbarin schnarcht. Sie schnarcht immer, egal ob am Tag oder in der Nacht: Sie schnarcht. Inge findet das beinahe zermürbender als die Schmerzen, die sich mit Tabletten wenigstens beruhigen lassen. Das Schnarchen dieser Frau kann man nicht abstellen.
Mindestens zwei Wochen lang muss Inge im Krankenhaus bleiben. Oberschenkelhalsbruch. Inge hatte vorher noch nie gehört, dass ein Oberschenkel einen Hals hat. Sie hat auch nach wie vor nicht verstanden, was nun genau gebrochen ist. Aber sie wagt es nicht, bei der Ärztin nachzuhaken. Die muss dringendere Fälle behandeln als mich, denkt Inge. Kluge junge Frauen wie diese Ärztin schüchtern sie ein.
Was Inge aber verstanden hat, ist, dass sie vielleicht nicht mehr ohne Hilfe wird gehen können. Immer wieder stellt sie sich vor, wie sie einen Rollator vor sich herschiebt, wie sie mit gekrümmtem Rücken geht und vornüberhängendem Kopf, alle drei Meter eine Pause einlegt, ausgelaugt und aus der Puste auf den Inhalt des am Rollator befestigten Drahtkörbchens schaut. Bei diesem Gedanken kneift Inge die Augen zusammen und verzieht ihr Gesicht, angewidert. Dieses Drahtkörbchen! Nur dazu da, die Einsamkeit der Alten zur Schau zu stellen! Wenn Inge mit ihrer Nachbarin Ulrike in der Stadt ist, beobachtet sie manchmal, was die Alten darin nach Hause schieben: eine Tafel Schokolade, eine Dose Kondensmilch, eine Fernsehzeitschrift, eine Mandarine, höchstens zwei.
Langsam entspannt Inge ihr Gesicht, öffnet die Augen, blickt auf das Bild ihr gegenüber an der hellgelb gestrichenen Zimmerwand: der Druck eines Ölgemäldes mit Seerosen.
Inge ist vierundachtzig Jahre alt.
Früher war ihr Gesicht voller und glatt und ohne Flecken und ihr Haar dunkel; kein Färben. Und ihre rechte Hand konnte stillhalten, ganz stillhalten, während Inge heute immerzu damit auf den Tisch tippen muss oder, wie jetzt, auf ihren unter der Krankenhausdecke ruhenden Bauch. Inge erinnert sich, dass ihre Zähne früher nicht nacheinander wegbrachen, die Wurzeln nicht brannten (Wenn sie so darüber nachdenkt: Die Scherereien mit den Zähnen sind eigentlich die schlimmsten) und sie keine Schmerzen in den Knien hatte und keine im Kreuz und auch keine Krampfadern – Regenwürmer unter der Haut – und nicht dieses dunkle Mal auf der Unterlippe. Sie erinnert sich, dass ihre Brüste zwar auch früher nicht straff waren, aber immerhin nicht so lang und leer und nutzlos wie jetzt. Sie erinnert sich, dass ihre Füße früher in elegante Sandalen passten. Heute wölbt sich das Grundgelenk der großen Zehen dermaßen knorrig hervor, dass es jeden neuen Schuh verformt, sofern Inge überhaupt hineinkommt.
Natürlich weiß Inge, dass sie alt geworden ist. Wie hätte ihr das auch entgehen sollen? Aber richtig alt ist sie noch nicht. Richtig alt, findet sie, das sind die anderen. Richtig alt sind die, bei denen das Alter den ersten Eindruck ersetzt. Die, bei deren Anblick man nichts anderes mehr denkt als: »Die ist alt!«, »Der ist alt!«. Kein: »Das ist aber eine hübsche Frau.« Auch kein: »Was für ein eingebildeter Lackaffe!« Keine Besonderheiten, nur noch: alt. Richtig alt.
Schon in ihrer Jugend fiel Inge auf, dass sich mit den richtig alten Leuten im Dorf niemand unterhalten mochte. Wenn sie am Zaun standen, vielleicht auf die Schneeschaufel oder einen Besen gestützt, wechselten die Jüngeren rechtzeitig die Straßenseite. Inge tat das auch immer. Weil diese richtig Alten – damals waren Sechzigjährige schon richtig alt – so viel redeten. Und viel zu leise oder, häufiger, viel zu laut. Weil Schnapsgeruch aus ihnen wehte. Weil weiße Spucke in ihren Mundwinkeln klebte. Weil sie ungefragt von etwas erzählten, das niemanden mehr interessierte. Dafür hatten die jungen Leute weiß Gott keine Zeit. Junge Leute wie Inge, die schon damals, tief in sich drinnen, geahnt haben, dass sie später auch einmal allein am Zaun stehen würden. Und noch viel häufiger säße Inge allein im Haus, gelangweilt, und die einzigen Geräusche, die durch ihre Küche liefen, stammten von ihr selbst.
Inge wendet ihren Blick zu der Frau im Nachbarbett. Mindestens zehn Jahre älter als ich, denkt Inge. Die ist richtig alt. Wie kann man nur so laut schnarchen? Nicht einmal Richard, Inges Mann, hat so geschnarcht, als er noch lebte und schlief.
Inge greift nach dem Wasserglas auf ihrem Nachttisch. Es steht zu weit weg, sie kommt nicht ran. Sie ist unbeweglich, ihr Arm hängt am Tropf.
Und die Schwester hat ihr noch immer kein Wasser mit Kohlensäure gebracht.
Und die Bettnachbarin schnarcht weiter.
Und heute Nacht werden wieder die Kröten in dem Klinikteich vorm Fenster knattern.
Und Carsten lässt sich nicht blicken. Carsten lässt sich einfach nicht blicken.
Unmöglich könne er seine Dienstreise abbrechen, hat er am Telefon gesagt. Er sei in Brüssel – mal wieder. Gerade gehe es »um alles«.
Bei ihm geht es immer um alles. Um alles außer Inge.
Wenn sie Carsten um etwas bittet, fühlt sie sich, als würde sie an einer Tür klingeln und wissen, dass jemand zu Hause ist, doch keiner macht ihr auf.
Jens, den »Großen«, hat sie gar nicht erst angerufen. Wer weiß, wie teuer das ist, vom Krankenhaustelefon aus nach Amerika zu telefonieren. Und womöglich wäre es dort dann mitten in der Nacht; ob sie sechs Stunden vorzählen muss oder zurück, nie kann sie sich das merken.
Carstens Herzlosigkeit hat Inge zwar nicht überrascht, aber doch verletzt. Verletzen kann Carsten gut. Carsten ist der »Kleine«, zwei Jahre jünger als Jens. Und insgeheim war er ihr immer ein bisschen lieber. Zwar hat Inge unentwegt versucht, diese Neigung beiseitezuschieben, trotzdem war es von Anfang an so: Carsten wärmte die leeren Stellen in ihr, die Jens nie erreichte. Unvergesslich für sie, wie Carsten vor dem Spiegel mit seinem kleinen, speckigen Zeigefinger das erste Mal auf seinen Bauch tippte und »Ich!« sagte. Überhaupt: wie früh er »ich« deutlich aussprechen konnte – sie hätte das als Omen verstehen sollen. Stattdessen blieb sie blind für Carstens Egoismus, sah immer nur seine strahlenden Augen mit dem betont langen Wimpernaufschlag. Irgendwie fühlte sich bei Carsten alles viel besser an als bei Jens: ihn zu füttern, zu baden, ins Handtuch zu wickeln und dann an sich zu drücken. Ihm über den Hinterkopf zu streichen, der so perfekt in ihre gewölbte Handfläche passte. Carstens lebendiger Blick hob Jens’ verschlossenes, abweisendes, bockiges Naturell erst so richtig hervor.
Von Jens erwartet sie schon lange nichts mehr, von Carsten hingegen schon.
Es ist Carstens Schuld, dass ich im Krankenhaus liege, denkt Inge.
Carsten hat gelogen. Er ist nicht auf Dienstreise. Er ist daheim in Berlin. Und joggt.
Die Abendsonne leuchtet weich. Sämtliche Grünflächen sind mit lichthungrigen Leuten gesprenkelt, die, wie er, den Tag am Schreibtisch verbracht haben. Grillrauch durchzieht den Park.
So recht findet Carsten keinen Atemrhythmus heute. Er muss anhalten, ein paar Schritte gehen, er fasst sich an den Bauch. Seitenstechen; das hat er sonst nie.
»Jetzt aber!«, sagt er sich und nimmt seinen Lauf erneut auf.
Seine Lüge war ein Reflex, der übliche Reflex. In unangenehmen Situationen sagt er immer, er sei geschäftlich unterwegs, in Brüssel: »Ich kann leider nicht. Ich fliege morgen nach Brüssel.« Oder: »Ich bin gerade in Brüssel. Ich muss jetzt auflegen, ein wichtiger Termin.«
In Wirklichkeit muss Carsten nur ein-, zweimal im Jahr nach Brüssel.
Am häufigsten lügt Carsten gegenüber seiner Ex-Frau Sabine, gegenüber seiner Tochter Lissa, gegenüber lästig gewordenen Liebschaften und natürlich gegenüber seiner Mutter. All den Frauen, die nie müde werden, über ihn zu verfügen, ihn zu verpflichten. Mit jeder neuen Forderung wickeln sie – so empfindet Carsten das – eine weitere Lage Beklemmung um die Rippen. Eine Enge aus schwerem schwarzen Tuch.
Vor sechs Jahren hat Sabine sich von Carsten getrennt. Seither verbringt Lissa jedes zweite Wochenende bei ihm. Als Sabine ihn neulich bat, Lissa nach dem Wochenende noch bei sich zu behalten, hat er auch wieder so reagiert: Enge im Brustkorb, kaum Luft. »So kurzfristig? Das ist ungünstig«, sagte er. Er müsse am Montag nach Brüssel, in aller Herrgottsfrühe.
Seit er mit dieser Schwindelei angefangen hat, benutzt er den Manneken Pis auf sämtlichen Plattformen als Profilbild.
Carsten fragt sich manchmal selbst, wieso er so panisch reagiert. Oft macht er es sich mit dem Abblocken schwerer als mit einem einfachen Ja. Die Diskussionen dauern länger, die Zudringlichkeiten von außen werden vehementer. Und trotzdem gelingt es Carsten nicht, seinen Brüssel-Automatismus zu unterdrücken.
Es wäre überhaupt kein Problem gewesen, Lissa ein paar Tage länger zu nehmen. Er hatte nichts vorgehabt, und Lissa ist fünfzehn. Sich um sie zu kümmern, bedeutet keine Arbeit. Es bedeutet in erster Linie, sich nicht auf Umwelt- oder Geschlechterdiskussionen ein- und sie in Ruhe zu lassen. Aber allein die Tatsache, dass seine Ex-Frau etwas von ihm verlangte, bereitete Carsten einmal mehr dieses Unbehagen.
An jenem Sonntag mit seiner Tochter packte er sogar seinen Trolley, damit die Lüge nicht aufflog. Im Laufe des Tages erwähnte er gegenüber Lissa mehrfach: »Morgen geht’s in aller Herrgottsfrühe los.« Er seufzte und zog dabei die Haut seines glatt rasierten Kinns in die Länge. Tat so, als würde er überlegen, was er noch mitnehmen müsste. »Ohrenstöpsel!«, fielen ihm ein. »Na klar!« Schließlich liege sein Hotel mitten in der Altstadt.
Lissa verdrehte die Augen hinter ihrer klugen Brille.
Langsam laufen, gleichmäßig atmen, sagt Carsten zu sich. Es soll bloß nicht wiederkommen, das Seitenstechen. Seine Schuhe hätte er etwas lockerer schnüren sollen.
Heute Vormittag, nach einem ermüdenden Meeting, hat ihn seine Mutter angerufen. Carsten saß am Schreibtisch in seinem Büro und trank gerade einen Kaffee. Einen Kapselkaffee, den Lissa, selbstredend, über alle Maße verachtet. Sie besitzt sogar ein T-Shirt mit George Clooney darauf. Er hält ein Espressotässchen in der Hand, und darüber steht: »How dare you!«
Carsten hat Lissa nie erzählt, dass er im Büro täglich mindestens vier dieser Kapseln verbraucht – und darauf besteht, dies auch weiterhin tun zu dürfen, und zwar so lange, bis die von seiner Tochter erträumte Ökodiktatur tatsächlich errichtet ist.
»Ich bin die Treppe runtergefallen«, sagte seine Mutter am Telefon.
Carsten überflog nebenher die E-Mail einer Kollegin, hörte nicht genau hin und unterschätzte deshalb den Ernst der Lage. »Kann ja mal passieren«, antwortete er lapidar, zumal er als Fünfjähriger auch einmal gestürzt war. Die Wunde an seinem Kopf musste genäht werden. Aber mehr noch als der Sturz blieb ihm der darauffolgende Streit seiner Eltern in Erinnerung. Carsten und sein Bruder Jens lagen in ihren Betten, hörten, wie ihr Vater Inge vorwarf, nicht aufgepasst zu haben. Sie weinte und schrie: wie zum Teufel sie auf die Jungs aufpassen solle, wenn sie gleichzeitig Essen kochen, Wäsche waschen, bügeln, putzen, einkaufen und ihm seine überall herumliegenden Pantoffeln hinterhertragen müsse?
Seine Eltern stritten sonst nie. Vor allem weinte und schrie Inge nie. Zwar schmollte sie oft, aber sein Vater ging darauf nicht ein, weil er es gar nicht bemerkte. Eine herbeigeschwiegene Harmonie lag sonst über dieser Ehe. Und so war der laute Krach zwischen Mutter und Vater, der zu Carsten und seinem Bruder ins dunkle Kinderzimmer hinaufdrang, etwas sehr, sehr Ungewöhnliches.
Jens flüsterte: »Ob die sich auch streiten würden, wenn ich gefallen wäre?«
»Wahrscheinlich nicht«, antwortete Carsten kühl. Er befühlte, wieder und wieder, das Pflaster, das am Hinterkopf zwischen seinen Haaren klebte, drückte darauf. Ein dumpfer, blutiger Schmerz.
Am nächsten Tag fiel es Carsten ein – einfach so kam ihm das in den Sinn –, seinen Eltern zu erzählen, es sei Jens gewesen. Jens habe ihn geschubst. Wegen ihm sei er die Treppe hinuntergestürzt.
Sosehr Jens es auch bestritt: Es passte zu gut zu seinen Wutanfällen. Inge erteilte ihm Hausarrest.
Carsten war in den Winterferien die Treppe hinuntergestürzt, und damals fiel im Winter noch Schnee, viel Schnee, und blieb tagelang liegen. Die Alten im Dorf schaufelten morgens, mittags und abends. Man müsse dranbleiben, sagten sie, man dürfe nicht nachlassen, sonst habe der Schnee gewonnen. Sie fühlten sich von ihm bedroht. Die Kinder aber liebten den Schnee. Am Straßenrand wuchsen weiße Berge, und die Kinder erklommen sie. Der Feuerlöschteich gefror, und die Kinder schlitterten auf ihm herum. Sie lutschten Eiszapfen, die von Dachvorsprüngen spitz nach unten hingen. Sie seiften einander ein. Sie zogen einander mit dem Schlitten. Und sie bauten ein Iglu.
Das Iglu bei ihm im Garten zu errichten, sodass Jens es vom Kinderzimmer aus unmöglich übersehen konnte, war Carstens Idee.
Der Schnee jenes Winters war besser als jeder Sommer.
Als Jens endlich rausdurfte, hatte Tauwetter eingesetzt. Die Schneereste lagen in den Ecken wie dreckige Lappen. Die Krähen konnten ihre Nüsse wieder über der Scheffelstraße abwerfen, um sie von einem der hin und wieder vorbeifahrenden Autos knacken zu lassen. Carsten hingegen hatte sich nicht knacken lassen. Er hatte seine falsche Anschuldigung nicht zurückgenommen. Und seine Mutter hatte ihre Unnachgiebigkeit einmal mehr unter Beweis stellen können. Prinzipien rangierten bei ihr schon immer vor Augenmaß.
»Kann ja mal passieren? Jetzt werd nicht unverschämt!«, sagte Inge am Telefon. Sie liege im Krankenhaus, sie werde nachher operiert, eine aufwendige Operation, sie bekomme ein neues Hüftgelenk. Er möge bitte sofort herkommen.
Das schwarze Tuch zog sich zusammen, begann, Carsten die Luft zu nehmen. Er schwitzte. »Ich bin in Brüssel«, sagte er. Gerade gehe es um alles. Aber danach werde er sie besuchen, so schnell wie möglich. Carsten starrte auf die Lamellenvorhänge an seinem Bürofenster, während er das sagte, dann auf den Gießanzeiger der Hydrokulturpflanze.
Nach dem Telefonat ging er zur Toilette, um sich das Gesicht kalt abzuwaschen. »Scheiße!«, fluchte er. Er fluchte flüsternd. »Scheiße! Scheiße! Scheiße!« Mit nassen Händen gelte er sich das Haar nach hinten, zog so seine Stirn glatt. Ein verzweifelter Blick in den Spiegel.
Ja, es ist scheiße, dass er sie angelogen hat.
Es ist scheiße, dass er ihr Bett nicht längst ins Erdgeschoss gestellt hat und sie nachts immer diese Treppe hinuntermuss, um ins Bad zu kommen.
Es ist scheiße, dass er es hinauszögert, sie zu besuchen. Er weiß doch genau, wie sehr sie auf ihn wartet, lauert; sie hat ja nichts anderes zu tun. Als zu warten.
Und was soll er machen, wenn sie ein Pflegefall wird? Dass sie in kein Heim geht, hat sie ihm schon oft erklärt.
Seit sein Vater tot ist, bereitet seine Mutter ihm unentwegt ein schlechtes Gewissen. Als bestünde ihr Daseinszweck nun ausschließlich darin, ihm, Carsten, auf die Pelle zu rücken. Nie ist es genug. Dies soll er noch machen, und jenes soll er noch machen. Und das auch noch schnell, bevor er geht. Und das noch besorgen. Und öfter herkommen. Und überhaupt, am besten gleich wieder bei ihr einziehen.
Das Seitenstechen ist zurück. Carsten verlangsamt sein Tempo. Der Typ, der seit einer Weile penetrant hinter ihm trabt, joggt an ihm vorbei; ein albernes Stirnband trägt er. Carsten verlässt den Pfad und läuft auf einen Baum zu, stemmt die Hände gegen den Stamm, spürt dessen rissige Rinde, diese raue Haut, lässt seinen Kopf nach unten hängen und keucht.
Mit seiner Lüge hat Carsten Zeit gewonnen, mehr nicht. Es wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als zu seiner Mutter zu fahren. Ein paar seiner heiligen Urlaubstage wird er opfern müssen.
Du musst mir mein Bett runterbringen.« Wie oft hat Inge das zu ihm gesagt? »Im Dunkeln ist mir die Treppe zu gefährlich.«
»Mach dir doch Licht an«, war seine Antwort.
»Davon werde ich hellwach und kann nicht wieder einschlafen.«
»Wie wär’s mit einem Nachttopf?«, sagte er daraufhin. Frech.
Inge zeigte ihm einen Vogel. Nachts dreimal in die Hocke gehen und wieder hochkommen – was hat er bloß für Vorstellungen? Auch wenn sie noch nicht richtig alt ist: Sie ist keine vierzig mehr.
Carsten seufzte. »Ich kann dir doch nicht mal eben das Haus umräumen. Dafür muss ich mir ein paar Tage freinehmen.«
»Dann nimm dir ein paar Tage frei!«
Entnervt erklärte er ihr, dass er keinen Urlaub mehr übrig hätte, was wahrscheinlich sogar stimmte, weil er gerade erst für drei Wochen verreist gewesen war. Nach Thailand oder Taiwan.
Immerhin brachte er ihr bei einem seiner Besuche ein Nachtlicht mit, das von der Steckdose aus den Flur ein wenig erhellte.
»Damit ist die Sache aber nicht erledigt«, sagte Inge.
Und Carsten versprach ihr, sich nächstes Jahr darum zu kümmern.
Aber inzwischen ist nächstes Jahr dieses Jahr. Inzwischen ist Juni. Und sie ist gestürzt und liegt im Krankenhaus neben dieser schnarchenden Frau. Und kriegt das Bild von sich selbst mit einem Rollator nicht mehr aus dem Kopf.
Noch am Tag des Unfalls wurde Inge operiert. Jetzt hat sie ein neues Hüftgelenk.
Morgen soll Inge das erste Mal wieder aufstehen, meinte die kluge junge Ärztin vorhin und schaute dabei aus dem Fenster in den wolkenverschmierten Himmel statt in Inges Gesicht. Inge glaubt, mit ihrem Blick nach draußen versuchte die Ärztin, sich von dem hässlichen Fleck auf Inges Lippe abzulenken, den sie sonst unentwegt hätte anstarren müssen.
Es klopft. Die Schwester kommt ins Zimmer. Warum klopft sie überhaupt an? Man hätte ohnehin keine Zeit, sich zurechtzumachen. In dem Moment, in dem sie klopft, öffnet sie bereits die Tür. Der Bewegungsablauf muss ihr über die Jahre in Fleisch und Blut übergegangen sein: mit der linken Hand klopfen, mit der rechten die Klinke runterdrücken.
Auf weichen Turnschuhsohlen steuert sie Inges Bett an, nimmt Inges Arm und befreit ihn vom Tropf. Ohne ein Wort zieht sie die Injektionsnadel heraus, klebt ein Pflaster darauf und schiebt den Infusionsständer in die Ecke. Sie spricht weiterhin nicht, was Inge verunsichert. Deshalb traut sie sich nicht, erneut um Wasser zu bitten. Vor ein paar Stunden hat sie schon einmal danach gefragt. Sie sehnt sich nach Mineralwasser, nach Mineralwasser mit Kohlensäure, nach diesem Reiz im Rachen.
Federnd verlässt die Schwester den Raum, einige Zeit später kehrt sie zurück und beginnt, die Bettnachbarin mit Brei zu füttern. Jetzt schnarcht die Frau nicht, aber wach scheint sie auch nicht zu sein. Ihre langen, weißen Haare kleben auf dem Kissen. Die Augen nur halb geöffnet, wird sie gefüttert, viel zu schnell. Inge will wegschauen, aber es geht nicht. Es kommt ihr vor, als beobachte sie ein Verbrechen.
Inge muss an den Spruch denken, den sie schon so oft gehört hat: Alte Leute werden wieder zu Kindern. Sie findet nicht, dass er stimmt. Kinder können irgendwann selbstständig essen, laufen, reden, alles können sie irgendwann ohne Hilfe. Sie werden ein Jemand, ihr Leben liegt vor ihnen. Vor den Alten aber liegt nur das Sterben.
Inge hängt nicht an ihrem Leben. Tot sein will sie trotzdem nicht. Das Totsein kennt sie nicht.
Die Schwester kratzt die letzten Breireste zusammen und schiebt sie der Frau mit dem Löffel unter den Gaumen. Dann stellt sie das Bett wieder flacher und sagt: »Sie bekommen auch gleich.«
Erst nachdem die Schwester das Zimmer verlassen hat, wird Inge klar, dass sie gemeint war.
Die Schwester kommt zurück, auf Inge zu, platziert das Essen auf ihrem Nachttisch und stellt das Bett aufrecht. »Guten Appetit«, nuschelt die Schwester und nimmt die Haube vom Tablett. Sauerbraten mit Kartoffelpüree und Möhren.
Inge will ansetzen, um nach dem Wasser zu fragen. Aber ehe sie ihre Stimme gefunden hat, ist die Schwester schon wieder verschwunden.
Die Klimaanlage seines Autos kam gegen den Schweiß nicht an. Carsten muss das Hemd wechseln, ehe er seiner Mutter unter die Augen treten kann.
Die ganze anderthalbstündige Fahrt über hat Carsten laut Musik gehört und mitgesungen, mitgebrüllt. Wenn er die Liedzeile gerade nicht kannte, brüllte er einfach irgendwas, mehrheitlich Schimpfwörter. Entgegen seiner Gewohnheit fuhr er aber nicht zu schnell. Er duldete es sogar, sich von sämtlichen Landeiern überholen zu lassen. Carsten hatte es nicht eilig herzukommen.
Nun schaut er vom Parkplatz aus auf das Kreiskrankenhaus: ein typisches ostdeutsches Vorzeigeprojekt der 1990er-Jahre, das trotz seines Alters mit »Neubau« weiterhin am besten beschrieben ist. Flachdach. Weiße Fassade. Blaue Metallfensterrahmen als heiterer Akzent. Davor ein paar Bäume, die offenbar bloß dazu gedacht sind, den Parkplatz einzurahmen, und nicht dazu, Schatten zu spenden. Jedenfalls sind sie noch genauso mickrig – unten: dünne Stämme, die den Namen kaum verdienen, oben: Kronen, die den Namen ebenso wenig verdienen, in Tropfenform – wie vor sechs Jahren, als Carsten das letzte Mal hier war. Seinem Vater wurde ein Stent eingesetzt. Genutzt hat es nicht viel: Zwei Monate später ist Richard gestorben. In seinem Sessel ist er gestorben. Als Inge aus der Küche kam, saß er da, »genauso faul wie immer«. Aber sie habe sofort gewusst, dass er weg war. So erzählt ihm seine Mutter das bis heute: »Er saß da, genauso faul wie immer. Aber ich wusste sofort, dass er weg war.«
Am Tag der Beerdigung seines Vaters herrschten Minusgrade. Eisblumen am Fenster seines einstigen Kinderzimmers. Carsten fragte sich, ob die Totengräber überhaupt ein Loch aus der festgefrorenen Erde hatten ausheben können.
Die Beerdigung war auf den Vormittag angesetzt. Um nicht in aller Herrgottsfrühe in Berlin aufbrechen zu müssen, war Carsten mit seiner Tochter schon am Vorabend angereist.
»So könnt ihr wenigstens nicht zu spät kommen«, hatte Inge gesagt. Carstens Unpünktlichkeit ist einer der vielen Mängel, die sie ihm bei jeder Gelegenheit vorwirft.
Noch vor dem Weckerklingeln war Carsten von den emsigen Küchengeräuschen seiner Mutter aufgewacht. Er lag im Bett, blickte auf die Eisblumen. Und Inge schmierte Brote für den Leichenschmaus, stellte Teller auf den Tisch, kochte Kaffee, füllte ihn in Thermoskannen. Ihr Tun klingt noch hektischer als sonst, dachte Carsten.
Carsten weckte Lissa, indem er ihr über die aschblonden Haare strich. Und über die Wange. Sie war in der Nacht zu ihm ins Bett gekrochen, sodass er kaum noch Platz gehabt hatte zum Schlafen; dementsprechend gerädert fühlte er sich. Mehr als anhänglich war seine Tochter damals, überanhänglich; kaum eine Nacht schaffte sie allein. Dass er und Sabine sich scheiden lassen würden, wusste sie noch nicht, ahnte es aber wohl bereits. Sie hatten es ihr sagen wollen, doch dann war Richard gestorben. Zwei Hiobsbotschaften auf einmal konnten sie ihrem Kind nicht überbringen – da waren Carsten und Sabine sich ausnahmsweise einmal einig. Ein, zwei Wochen mussten sie damit noch warten.
Neun war Lissa damals und ihre Nase schon keine kleine Stupsnase mehr. Und die Lücken in ihrem Mund wurden nachbesetzt von geriffelten Zähnen, die riesig wirkten in Lissas roter, nasser Kinderschnute, die am liebsten Erdbeeren und Schokolade verschlang und zu dieser Zeit gerade anfing, jeden Genuss bezüglich Saisonalität und fairen Handlungsketten zu hinterfragen.
Lissa seufzte ob Carstens Versuch, sie streichelnd zu wecken, und drehte ihren Kopf zur anderen Seite.
Als er sagte, »Wir müssen uns jetzt fertig machen für die Beerdigung«, stand sie sofort auf. Ihre Zehen lugten unten am Saum des viel zu langen Nachthemds hervor, das sie sich von ihrer Oma geliehen hatte.
Inge hatte verlangt, dass ihre Enkelin zur Beerdigung kommt. Glücklicherweise wollte Lissa es auch. Sie hatte ihren Großvater sehr gemocht.
Es war dermaßen eisig an jenem Tag, dass sich nicht viele Dorfbewohner dazu aufrafften, ihr Haus zu verlassen. Und so standen nur er und Lissa und seine Mutter auf dem Friedhof sowie zwei Arbeitskollegen von früher und Inges Freundin, die Schäfer Jutta, mit ihrem Mann Herbert, der damals noch lebte. Lissa weinte. Carsten nahm sie hoch, obwohl sie dafür viel zu groß und schwer und alt war. Zwischendrin stromerte auch Inges Nachbarin Margit, von deren Demenz bereits alle wussten, über den Friedhof. Sie trug einen Wintermantel, an den Füßen aber nur Hauspantoletten. Hätte sie nicht diese Pantoletten angehabt, sondern richtige Schuhe, hätte Carsten sie wegschicken können, als sie sich zu ihnen ans Grabloch stellte und konzentriert hinunterblickte, als erwarte sie irgendeine Regung aus dem Sarg. Doch die Pantoletten machten die Verwirrung dieser Frau so offenbar, dass Carsten es nicht über sich brachte. Dass er Margit einfach nicht wegschicken konnte, obwohl er wusste, wie erzürnt seine Mutter über diesen Auftritt war. Er sah es daran, dass sie ihre Lippen einsog und einsog, bis ihr Mund verschwand. Er selbst wollte Margit im Grunde auch nicht dabeihaben.
Nach ein paar Minuten kam Ulrike angerannt, Margits Tochter. Sie führte ihre Mutter wortlos weg und warf Carsten einen entschuldigenden Blick zu. Er nickte.
»Hatte also auch die Nachtwey Margit wieder ihren Auftritt«, bemerkte Jutta hinterher beim Leichenschmaus.
Inge sagte nichts, sog nur abermals die Lippen ein und schenkte allen von ihrem viel zu starken Filterkaffee nach.
Lissa bekam Kakao mit so viel Pulver, dass der Löffel beinahe darin stehen blieb. »Wenn Mama das sehen könnte«, sagte Lissa zu Carsten.
Als die Gäste gegangen waren, wollte Carsten von seiner Mutter endlich wissen, was für einen Schlüssel sie ins Grab geworfen habe, ehe die Totengräber begonnen hatten, alles zuzuschaufeln.
Inge tat erst so, als wüsste sie nicht, wovon Carsten redete.
Dann pflichtete Lissa bei: »Doch! Du hast einen Schlüssel auf den Sarg geschmissen.«
»Ach so, der«, sagte Inge. »Das war der Garagenschlüssel. Richard war doch so gern in seiner Garage.«
»Es gibt hoffentlich noch einen zweiten«, sagte Carsten.
»Ich wüsste nicht, wo.«
»Spinnst du?«, entfuhr es ihm. »Da steht doch noch das Auto drin.«
»Das brauche ich nicht.«
»Nur weil du keinen Führerschein hast, musst du doch nicht gleich den Schlüssel vergraben«, schimpfte er und zeigte ihr einen Vogel. »Das ist doch bescheuert. Du …«, schrie er, und dann sah er, wie irritiert seine Tochter dreinschaute. Wie zu Hause, wenn er mit Sabine stritt. Deshalb beließ er es dabei, winkte nur ab und schüttelte missbilligend den Kopf, obwohl er durchaus Grund gesehen hätte, sich weiter zu echauffieren.
Seither steht Richards Auto ungenutzt und unverkauft in der verrammelten Garage. Ein paarmal hatte Carsten sich vorgenommen, das Schloss aufzubrechen, doch dann erschien ihm das zu rabiat. Und deswegen den Schlüsseldienst zu rufen, fand er übertrieben.
Ein warmer Windhauch weht über den Krankenhausparkplatz. Wie die schale Luft aus einer Föhnschleuse. Carsten geht zum Kofferraum seines Wagens. Am Morgen hat er noch rasch seine Hemden aus der Reinigung geholt. Er nimmt sich ein frisches, weißes und zieht es an. Dazu trägt er eine sandfarbene Chinohose, unten doppelt umgeschlagen, Sneakersocken und weiße Turnschuhe, gepimpt mit neongelben Schnürsenkeln. Carsten ist fünfundfünfzig Jahre alt.
»Je mehr du versuchst, dich hip anzuziehen, umso älter siehst du aus«, sagte Lissa neulich zu ihm, seine vorlaute, nie kleinlaute Tochter.
Daraufhin gab er ihr eine Ohrfeige, eine angedeutete natürlich nur.
Es gibt drei Möglichkeiten, wie ihn seine Mutter gleich begrüßen wird, denkt Carsten, während er die Heckklappe schließt.
Entweder mit: »Gab es die Hose nicht in deiner Größe?«
Mit: »Hast du keine ordentlichen Schuhe?«
Oder mit: »Lässt du dich also doch noch blicken.«
Jeder Satz ist gleich wahrscheinlich. Ihm wird schon wieder heiß. Er schließt den Wagen ab. Eine Daumenbewegung, die er sehr mag: das Drücken auf das Vorhängeschlosssymbol seines Autoschlüssels. Noch immer fühlt es sich für ihn nach gehobenem Lebensstandard an, keinen alten Gebrauchtwagen mehr mit einem richtigen Schlüssel abriegeln zu müssen, sondern auf diesen Knopf zu drücken und dessen leichten Widerstand zu spüren; die Bestätigung, dass er alles richtig gemacht hat. Das Schloss rastet ein. Carsten hat es zu etwas gebracht.
Im Krankenhausfoyer lässt sich Carsten eine Cola aus dem Automaten. Die Frau, die sich nach ihm bedient, grüßt er freundlich. Er sagt, bei dieser Hitze halte man es ohne Erfrischung ja gar nicht aus. Carsten kann das gut – das hat Sabine ihm immer wieder bestätigt: den strahlenden Sonnyboy spielen, am Anfang, doch sobald man ihn etwas genauer kenne, erlebe man, was für ein ungehaltener, egoistischer Arsch er sei.
Die Frau geht mit ihrer Cola nach draußen. Nachdem Carsten seine getrunken hat, weiß er nicht, wohin mit der Flasche, ohne das Pfandgeld einzubüßen. Es ärgert ihn, dass man die leere Flasche an dem Automaten nicht gleich wieder einwerfen und seine Cents zurückkriegen kann. Schließlich deponiert Carsten die Flasche auf dem Boden neben dem Automaten.
Er fährt sich richtend übers Haar, das steif und glatt anliegt. Dann sagt er sich: »Augen zu und durch!«
Zum Kotzen. Heute findet Lissa alle Menschen um sich herum einfach nur zum Kotzen:
Die dicken Männer im kurzärmeligen Hemd mit Bürstenschnitt und einer Einkaufstüte voller Billigfleisch.
Die schlanken Männer, die mehr Glück hatten, mit ihrem dunkelblauen Anzug und den weißen Turnschuhen und dem Notebook auf den Knien, die es, wie ihr Vater, für »kreative« Arbeit halten, den Leuten umweltschädlichen Kram anzudrehen, den sie überhaupt nicht brauchen.
Die schöngeduschten Frauen mit schimmernder Kordel quer über dem Oberkörper, an der ihr Smartphone hängt, und mehreren Armbändchen am zarten Handgelenk und ihrem luftig-langen Rock, auf dessen Etikett »Designed in Denmark« steht, weil das besser klingt als »Made in China«. Vor allem sie würde Lissa an Tagen wie heute am liebsten anschreien: die schöngeduschten Frauen mit ihren Zehentrenner-Sandalen und ihrer (zumindest geht Lissa davon aus) nackt rasierten Vulva und ihren schöngebadeten Kindern, vor deren Einschulung sie und ihr vollzeitarbeitender Besserverdiener-Partner schnell noch den Kiez wechseln werden – so, wie Lissas Eltern das damals gemacht haben, nicht lange bevor sie sich scheiden ließen.
Ich hätte das Fahrrad nehmen sollen, denkt Lissa. Sie hätte dem bisschen Regen trotzen und verdammt nochmal das Fahrrad nehmen sollen. Sie hätte gleich am Morgen wissen müssen, dass sie das U-Bahn-Fahren heute zu sehr runterzieht. Die stickige Luft, die klebrigen Griffe, das Rattern, die Enge, die Menschen. Die Touristenpärchen in Allwetterjacken, die es nach dem Aufwachen in ihrem Airbnb-Bett getrieben haben; jetzt gehen sie »die Stadt erkunden«.
An Tagen wie heute vergisst Lissa zwar nicht, dass sie sich eine freundlichere, friedlichere Welt wünscht. Aber sie schafft es nicht, ihr Denken auch zu fühlen. Beim Umsteigen rempelt Lissa sogar absichtlich Leute an. Als Strafe dafür, dass sie nicht so viel nachdenken wie sie. Dass sie nichts hinterfragen. Dass sie ein gutes Gewissen daraus schöpfen, Naturkosmetik in Plastiktiegeln zu kaufen und ihre Fast Fashion nach ein paar Monaten in die sogenannte Kleiderspende zu werfen. Dass sie es immer noch schaffen, die Klimakrise auszublenden.
Werden sich alle umgucken!
Wenn ihr gesunder Omega-3-Säuren-Fisch verseucht ist von toxischen Algen, die sich aufgrund der gestiegenen Wassertemperaturen massiv vermehren.
Wenn ihr Kind, gestochen von einer Asiatischen Tigermücke, am West-Nil-Fieber erkrankt.
Wenn in der Charité die ersten Zika-Babys zur Welt kommen.
Wenn sich die Menschen aus Überschwemmungsgebieten hierher flüchten.
Wenn sich die Menschen aus Dürregebieten hierher flüchten.
Wenn die Sommer vierzig Grad heiß werden und heißer.
Wenn der Himmel über Berlin weiß ist.
So schlimm wird’s schon nicht?
Denkste!
Die Ignoranz um sie herum widert Lissa an.
In Berlin geboren und aufgewachsen, sieht Lissa an einem einzigen Tag mehr Menschen, als ihrer Oma Inge je im Leben begegnet sein dürften. Lissa nennt Inge auch die »Dorf-Oma«. Umgekehrt wird Lissa »Großstadtgewächs« von ihrer Dorf-Oma genannt. Ein Vorwurf schwingt immer mit, wenn Inge »Großstadtgewächs« sagt. Dabei kann Lissa gar nichts für die Entscheidung ihrer Eltern, in Berlin zu leben. Zwar will sie niemals weg aus Berlin, unvorstellbar wäre das, trotzdem hält sie sich nicht für eines: für ein Großstadtgewächs. Viel zu sensibel ist sie dafür. Viel zu genau schaut sie hin. Echte Großstadtgewächse blenden alles aus, was sie nicht betrifft. Deren Wahrnehmung beschränkt sich auf einen sekundenkurzen Moment, der nur dazu dient herauszufinden, ob ihnen irgendetwas zum Hindernis werden könnte. Zum Hindernis auf ihrem Weg von A nach B.
Lissa kann das nicht, sie kann nicht ausblenden.
Neulich erlitt ein Mann in der Straßenbahn einen Herzstillstand, er fuhr leblos weiter. Sechs Stunden lang fiel der tote Passagier niemandem auf. Lissa meint, ihr wäre das nicht passiert. Sie hätte gemerkt, dass dort auf dem wild gemusterten Einzelplatz am Fenster ein Toter sitzt; kein Schlafender, kein Betrunkener, kein Junkie im Rausch.
Schon am Morgen wachte Lissa mit mieser Laune auf. Bis zwei Uhr nachts hatte sie gelesen. Entsprechend gerädert fühlte sie sich, als ihr Handywecker klingelte. Kein Mensch auf der Welt sollte einen Wecker brauchen! Sie drückte auf »Snooze«, sich darüber ärgernd, dass der Unterricht weiterhin so zeitig anfängt, obwohl die Studienlage eindeutig ist: Jugendliche können sich um acht Uhr in der Früh nicht konzentrieren.
Als es sich nicht länger hinauszögern ließ, stieg sie aus dem Bett, las ein paar Klamotten vom Boden auf und zog sie an. Sie hatte keine Lust auf die Schule. Sie hat nie Lust auf die Schule. Die beschränkten Lehrer*innen öden sie an, schon seit Jahren. Ihre Mitschüler*innen genauso. Gleichaltrige findet Lissa langweilig, mit ihnen verbringt sie keine Zeit. Wenn sie es sich recht überlegt, verbringt sie auch mit Andersaltrigen keine Zeit. Lissa ist lieber allein.
Yann war eine Ausnahme. Es tut immer noch weh, an ihn zu denken.
Hin und wieder fragt sich Lissa, ob sich ihre Misanthropie irgendwann auswachsen wird. Ihren Ruf als Eigenbrötlerin in der Schule hat sie jedenfalls weg. Sie versucht aber auch nicht, irgendwen vom Gegenteil zu überzeugen.
Für ein Frühstück reichte die Zeit am Morgen nicht mehr. Ohnehin war ihr nicht danach, in die Küche zu gehen. Als sie sich eilig die Schuhe zuband und den Rucksack aufsetzte, trat der Freund ihrer Mutter in den Flur.
Thom musterte Lissa und sagte: »Du bist fünfzehn, siehst aus wie zwanzig, redest wie dreißig und ziehst dich an wie ü-fünfzig.«
Ihre Mutter Sabine rief lachend aus der Küche: »Besser lässt es sich nicht zusammenfassen.«
»Und du siehst aus wie ein Vierjähriger«, blaffte Lissa zurück. Etwas Klügeres fiel ihr auf die Schnelle nicht ein. Thom trug nur ein Paar Boxershorts – mit Hubschraubern darauf.
Lissa schlug die Wohnungstür zu, rannte durchs Treppenhaus nach unten. Und weil sie im Hinterhof ein wenig Regen spürte und sich noch immer müde fühlte, machte sie den Fehler, nicht das Fahrrad zu nehmen, sondern zur U-Bahn-Station zu laufen.
Thom heißt eigentlich Thomas, nennt sich aber »Thom«, um die Banalität seines Namens, ja die seiner gesamten Person, zu übertünchen. Als Lissa einmal seinen Ausweis gesehen und den Namen laut vorgelesen hat – Thomas Andreas Schmidt –, riss er ihn ihr beleidigt aus den Händen. In diesem Moment erfuhr selbst Sabine erst, dass ihr Liebster gar nicht Thom heißt.
Thomas Andreas Schmidt ist ein Arschloch. Und zwar nicht, weil er der Freund ihrer Mutter ist. Im Gegenteil: Nichts liegt Lissa dieser Tage ferner, als Sabine ganz für sich haben zu wollen. Je beschäftigter sie ist, desto weniger geht sie Lissa auf die Nerven, desto weniger kann sie ihre Launen an ihr auslassen. Nein, Thomas Andreas Schmidt ist ganz objektiv ein Arschloch. Er mag klug aussehen mit seiner Glatze und der runden Nickelbrille. Aber er ist es wirklich nicht.
Lissa redet nur das Nötigste mit ihm, weil sie ihn nicht leiden kann. Und er redet andauernd mit ihr, weil er es nicht aushält, dass sie ihn nicht leiden kann. Sabine für ihren Teil gibt sich keine Mühe zu vermitteln. »Ist vielleicht auch besser, wenn ihr euch nicht zu gut versteht«, sagte sie einmal, als die Stimmung besonders angespannt war.
Erst kam er nur am Wochenende, inzwischen hockt er – er ist Programmierer – auch werktags in ihrer Küche an seinem Notebook und »codet«. Das nervt Lissa am meisten. Bis vor Kurzem hatte sie daheim ihre Ruhe. Der Stress ging erst los, wenn Sabine abends von der Arbeit kam. Aber jetzt ist dieser Typ dauernd da und kommentiert alles, was Lissa macht. Neulich fragte er sie sogar, ob sie ihre Hausaufgaben schon erledigt habe.
Gegen Thomas Andreas Schmidt ist sogar ihr Vater ein angenehmer Mensch. Der mischt sich wenigstens nicht in alles ein und akzeptiert es, wenn sie nicht reden mag.
Lissa zieht ihr Telefon aus dem Rucksack. Der Bildschirm ist zersplittert, seit es ihr neulich heruntergefallen ist, ansonsten funktioniert es noch. Um ein neues Gerät kann sie ihre Eltern momentan ohnehin nicht bitten; dieses hier war, als es ihr herunterfiel, keine drei Wochen alt.
Sie verschleiße Telefone wie andere Leute Zahnbürsten, hatte ihr Vater gesagt – und das, obwohl sie doch so besorgt sei um die Umwelt und gerechte Arbeitsbedingungen in aller Welt.
Touché, dachte Lissa, sagte es aber nicht.
Lissa setzt ihre Kopfhörer auf, lässt einen Podcast laufen. Die U-Bahn-Durchsagen verschmelzen mit der Englisch sprechenden Stimme in ihren Ohren. Nebenher schickt Lissa ihrem Vater ein Foto von einer an einer Plastiktüte verendeten Meeresschildkröte. Solche Bilder schickt sie ihm öfter; es gibt viele davon, weil Schildkröten Plastiktüten für Quallen halten und sie zu fressen versuchen. Dass Carsten bei Smyrna arbeitet, einem Hersteller ebensolcher Tüten, findet sie genauso verwerflich, wie wenn er bei einem Erdölkonzern angestellt wäre. Oder einem Waffenfabrikanten.
Unter das Foto tippt sie: »DAMIT verdienst du dein Geld!!!«
»Ich werde dich daran erinnern, wenn du wieder ein neues Handy brauchst, weil dir das alte ins Klo gefallen ist«, schreibt er.
»Geld ist nichts als ein Produkt menschlicher Fantasie«, antwortet Lissa.
Kurz darauf schreibt er: »Na, schlechte Laune, wa?«
Zimmer 601. Sein Herz pocht, als stünde eine Prüfung bevor. Carsten atmet tief ein, drückt die Klinke hinunter. Vorsichtig guckt er ins Krankenzimmer. Als er Inge sieht – im ersten Bett –, nickt er, wie um sich selbst zu bestätigen, dass er seine Mutter erkannt hat. Er tritt ein, schließt die Tür und geht auf Inge zu.
»Hallo, Mutti«, sagt er so laut, dass es offenbar auch die Bettnachbarin mitbekommt. Denn die setzt ihr Schnarchen aus, nur um kurz darauf weiterzuröhren.
Inge hat den Kopf in Carstens Richtung gedreht, mustert ihn von oben bis unten. An seinen Füßen verharrt ihr Blick. Sie wird also seine Schuhe kritisieren oder die umgeschlagenen Hosen.
»Keine Blumen?«, sagt sie.
Sie findet immer etwas, denkt Carsten. Sie. Findet. Immer. Irgendetwas.
»Ich sehe, du bist noch die Alte«, erwidert er.
»Meinst du, hier drinnen werde ich jünger?«
»Ich habe keine Blumen gekauft, damit du dir unten im Laden selbst einen Strauß aussuchen kannst«, fällt es Carsten ein zu sagen. In Wahrheit hat er nicht einen Moment an Blumen gedacht.
Inge drückt auf die Fernbedienung, um ihr Bett aufzurichten. Sie klopft auf die Decke und legt die Hände links und rechts neben der Hüfte ab.
In einem Winkel seines Körpers, den Carsten nicht genau verorten kann, ist er erleichtert, seine Mutter zu sehen. Die Phasen vor einer Begegnung mit ihr fühlen sich für ihn oft beklemmender an als die Begegnung selbst. In Abwesenheit bekommt seine Mutter etwas Dämonisches, das dann verpufft, sobald er auf sie trifft. Dann fällt ihm auf, wie klein diese Frau ist, wie zerbrechlich. Auch nur ein Mensch. Ein alter Mensch inzwischen mit dünnen Lippen und einem dunklen Mal darauf.
Inge sieht besser aus, als er erwartet hatte. Zwar hat sie abgenommen, was ihr Gesicht noch faltiger wirken lässt; ihre Haut neigt zu vielen, besonders kleinen Falten. Blass ist sie auch. Aber in ihren hellen Augen liegt die übliche Wachheit, die Carsten von ihr kennt. Ohne Details über ihren Zustand zu wissen, verrät ihm ihr Blick: Seine Mutter kommt wieder auf die Beine. Zart mag ihr Körper wirken, aber er ist zäh.
Carsten holt sich einen Stuhl und setzt sich zu Inge ans Bett. Er schaut sich um. Er mag Krankenhäuser nicht, aber wer tut das schon? Die andere Patientin schnarcht unablässig.
»Ganz schön laut hier«, bemerkt er.
»Es ist eine Zumutung. Die hätten sie mit einer Schwerhörigen zusammenlegen müssen«, flüstert Inge. »Die hat noch nie ein Wort gesagt, die kann nur schnarchen.«
Sie beschließen, einen Kaffee trinken zu gehen. Carsten hilft seiner Mutter beim Aufstehen. Sie will sich zurechtmachen, aber Carsten ist ungeduldig. Er überredet Inge, einfach den Morgenmantel überzuziehen. Nach der Einlieferung ins Krankenhaus hat Ulrike, die nur ein paar Häuser von Inge entfernt wohnt, ihr die wichtigsten Sachen hergebracht.
Den gesteppten Morgenmantel mit Stehkragen und Blumenmuster besitzt Inge schon, seit sie mit Carstens Bruder Jens schwanger war, seit fast sechzig Jahren. Und ein wenig beschämt es Carsten, dass sie damit hier im Krankenhaus ist. Allerhand Fäden zieht er. Zu Weihnachten hatte er ihr einmal einen neuen geschenkt. Aber entweder hat Inge ihn direkt weiterverschenkt, an irgendeine andere Frau im Dorf, oder er liegt unberührt im Kleiderschrank. Jedenfalls hat er seinen Morgenmantel bei keinem seiner Besuche je im Bad hängen sehen. Da hängt immer nur der alte. Seiner war nicht billig gewe- sen.
Neben dem Bett steht ein Rollator. Inge weigert sich, ihn zu benutzen. Stattdessen hakt sie sich bei Carsten ein. Er spürt einen leisen Ekel, für den er sich schämt. Er bekommt Gänsehaut und wendet den Kopf von seiner Mutter ab. Wie unangenehm ihm diese Nähe ist, diese Berührung. Ihr Arm an seinem Arm. Kurz schließt er die Augen, um sich zu sammeln. Langsamen Schrittes gehen sie zum Fahrstuhl.
Sie kann laufen, denkt Carsten. Immerhin, sie kann laufen!
Mit heller, begeisterter Stimme sagt er: »Super! Das klappt ja schon wieder richtig klasse!«, und fühlt sich wie ein Motivationscoach dabei.
»Du weißt doch gar nicht, wie es vorher war«, faucht Inge.
In der Kantine sagt sie: »Nur alte Leute hier. Alles richtig alte Leute.« In ihrer Stimme liegt eine kaum verborgene Ablehnung. Das ist Carsten schon früher bei seinen Großeltern aufgefallen: dieses Sprechen alter Menschen über die eigene Generation, als gehörten sie selbst nicht dazu.
Carsten hat bisher weniger auf die Patienten geachtet als auf das grün und weiß gekleidete Personal. Er fragt sich, ob es sinnstiftender ist, junge Leute zu heilen als alte, oder ob man, als jemand, der tagtäglich Gutes tut, gefeit ist vor derlei Gedanken. Medizinisches Personal schüchtert Carsten ein, schon immer. Es beschämt ihn, wie wichtig diese Leute sind.
Carsten ist Marketingleiter bei Smyrna, einem Hersteller von Gefrierbeuteln und Aluminium- und Frischhaltefolien. Seit Kurzem hat Smyrna zudem Abdeckhauben aus Frischhaltefolie im Angebot, die man dank eines elastischen Bunds direkt über einen Teller stülpen kann.
Vorhin, als eine Ärztin mit ihrem Sandwich in der Kassenschlange stand, fragte sich Carsten, wie vielen Menschen ihre Hände heute schon geholfen haben. Haben sie gerade eine Bandscheibe operiert, ohne die Wirbelsäule zu verletzen? Oder einen Tumor entfernt? Oder einen Herzschrittmacher eingesetzt? Carstens Finger tippen Tag für Tag bloß auf einer Tastatur herum, erstellen Präsentationen und schreiben E-Mails mit Aufträgen. Auch muss er gar nicht so viele strategische Überlegungen anstellen, wie er gegenüber der Geschäftsführung immer behauptet, wenn er sein Gehalt rechtfertigt. Er sucht aus den Vorschlägen anderer Leute nur aus: neues Logo, neue Packung, neues Plakat, neuer Werbeclaim, mehr SEO, ab und an ein überteuerter TV-Spot. Immerhin hat er einen guten Riecher bei der Auswahl seiner Dienstleister; das hat nicht jeder, darauf kommt es aber an. Carsten findet seine Arbeit weder besonders interessant noch bereichernd. Er hat sich schlicht daran gewöhnt. Eigentlich hätte er, karriereorientiert gedacht, in all den Jahren mindestens zweimal das Unternehmen wechseln sollen. Inzwischen hofft er, bei Smyrna bis zur Rente durchzukommen.
Inge trinkt ihren Kaffee schlürfend. Carsten schaut auf das blauschwarze Mal auf ihrer Unterlippe. Bei der Heirat hatte sie das noch nicht; auf den Hochzeitsfotos ist sie ohne zu sehen. Irgendwann danach muss es gekommen sein. Carsten kennt seine Mutter nur so. Das Mal sieht aus wie ein geschwollenes Hämatom, nur dass es nicht weggeht. Carsten meint sogar, es sei mit den Jahren dunkler geworden. Als Kind haben er und Jens manchmal gefragt, warum dort dieser Blutegel sitze. Mit ihren kleinen Zeigefingern tippten sie es an. Wenn sie nicht nah genug an den Lippen ihrer Mutter waren, deuteten sie darauf. Inge sagte: »Das ist eben so«, und drehte sich weg.
»Ah, tut das gut«, stöhnt Inge beim Absetzen der Tasse. »Das war mein erster Kaffee seit über einer Woche.«
Carsten kennt niemanden, der so gerne Kaffee trinkt wie seine Mutter. Zwei Würfel Zucker pro Tasse.
Eine seltsame Intimität, sie hier, umgeben von fremden Leuten, in diesem ollen Morgenmantel Kaffee trinken zu sehen. Außer ihm und Jens und seinem verstorbenen Vater hat wahrscheinlich niemand sie je so gesehen. Das Frühstück all die Jahre an dem für vier viel zu kleinen Küchentisch. Zu Mittag und Abend aßen sie immer im Wohnzimmer, aber morgens mussten sie sich an den kleinen Ecktisch in der Küche quetschen. Inge stürzte ihren Kaffee hinunter und sprang immer wieder auf, um sich und Richard nachzuschenken. Für Jens und Carsten gab es heiße Milch (Jens mochte die Haut obendrauf, Carsten nicht), sonntags sogar Kakao.
Jetzt trinkt Carsten einen Cappuccino. Er schmeckt genauso säuerlich, wie er es erwartet hat.
»Wahrscheinlich hast du gehofft, dass ich sterbe. Aber so leicht werde ich es dir nicht machen«, sagt Inge.
»Kein Zweifel«, erwidert Carsten.
Danach sitzen die beiden eine Weile schweigend da, schauen sich um, aber einander nicht an. Mit ihrer Hand tippt Inge unablässig auf die Tischplatte. Irgendwann hält Carsten die Anspannung nicht mehr aus, zumal er spürt, dass seine Mutter am liebsten einen ganzen Schwall von Vorwürfen über ihm auskippen würde. Er geht einen zweiten Kaffee für sie holen. Er fragt nicht, ob sie noch einen möchte. Er hofft einfach, sie damit ein wenig sanftmütiger stimmen zu können. Und sowieso ist jeglicher hemdsärmelig wirkende Aktionismus besser, als stumm mit ihr herumzusitzen.
»Oh«, sagt Inge überrascht. »Eigentlich soll ich ja gar keinen Kaffee trinken«, erklärt sie und trinkt diese Tasse noch schneller als die erste, weil sie noch verbotener ist.