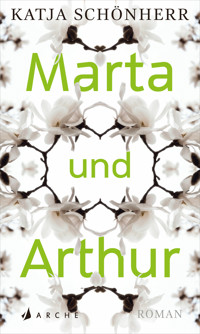
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arche Literatur Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marta ist Schülerin, Arthur Referendar. Arthur interessiert sich für die frühreife Marta, und Marta fühlt sich von Arthur angezogen, warum, weiß keiner von beiden richtig. Marta ist keine Schönheit und Arthur in seinen braunen Cordhosen auch nicht gerade ein Womanizer. Trotzdem beginnen sie eine Affäre. Nicht aus Liebe oder Leidenschaft, sondern aus Angst und Pflichtgefühl bleiben sie über 40 Jahre, bis zu Arthurs Tod, zusammen. Es ist eine Beziehung ohne Höhen, dafür mit umso mehr Tiefen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Katja Schönherr
Martha und Arthur
Für Florian
Sie kommt kaum voran in diesem Wind, auf dem weichen Sand, und die Nässe ist längst durch das Stiefelleder gedrungen. Außer Marta ist kein Mensch unten am Strand. Über den Boden verteilt liegen Hunderte von verlassenen Panzern, abgebrochenen, dünnen Beinen, angespülten Scheren; ein Schlachtfeld toter Strandkrabben. Der Wind schlägt Marta ins Gesicht, die Luft beißt kalt. Die Wellen prallen mit Wucht gegen die Felsbuhnen und brechen. Der schwere, grauschwarze Himmel drückt den Horizont ins Wasser. Auftakt eines tobenden Sturms.
Etwa auf halber Höhe zwischen Deich und Meer hat jemand einen Kreis aus Steinen in den Sand gelegt. Er ist fast vollständig zugeweht. Hier an dieser Stelle muss das damals gewesen sein, denkt Marta und bleibt stehen. Sie holt eine gefaltete Plastiktüte aus der Tasche ihres Mantels hervor. Dann geht sie in die Hocke und beginnt, mit ihren Händen Sand in die Tüte zu füllen. Der Sand ist feucht und dicht. Marta hantiert stoisch, schaufelt und schaufelt, während der Wind an ihr zerrt. Als die Tüte bis zum Rand gefüllt ist, klopft sie den Sand mit der flachen Hand oben fest. Das Geräusch wird vom Sturm verschluckt; er ist gefräßig in seinem Rausch, selbst das Geschrei der Möwen klingt bloß noch wie ein Echo.
Marta zieht einen weiteren Plastiksack aus ihrem Mantel, verliert dabei kurz das Gleichgewicht und fällt mit ihrem Hintern in den Sand. Sie flucht nicht. Umständlich begibt sie sich in die Hocke zurück und füllt auch die zweite Tüte. Aus Versehen schippt sie eine Qualle hinein. Erst nach einigen Schaufelhüben kommt Marta das verschüttete Tier in den Sinn. Sie holt es heraus – Gallertmasse, sandverklebt und von violetten Kanälen durchzogen –, wirft es beiseite und schaufelt weiter, bis nichts mehr hineinpasst. Dann steht sie auf, hebt die zwei Sandtüten an, stöhnt und läuft langsam los.
Marta Zimmermann ist neunundfünfzig Jahre alt und eine kleine Frau mit recht langen Armen. Die schweren Tüten schleifen beinahe auf dem Boden, während sie gegen den Sturm anläuft. Um sich vor Flugsand zu schützen, kneift sie die Augen zusammen. Einmal stolpert sie deswegen, fällt aber nicht hin. Einmal öffnet sie den Mund, und die Kälte pfeift durch ihre Zähne. Sie kommt an den Umkleidekabinen vorbei, schleppt die Säcke über den Dünenpfad und auf der anderen Seite den steilen Deich hinab.
Der Wind weht etwas schwächer, als sie die Straße erreicht. Die Laternen sind eingeschaltet. Sie werden wohl den ganzen Tag über an bleiben, von alleine wird es heute nicht hell. Die Tütengriffe schneiden in Martas Hände ein. An den Fingern klebt Sand, und sie kribbeln. Schweiß rinnt brustabwärts ihren Bauch entlang, unter dem dicken Mantel und der Bluse.
Marta setzt sich kleine Etappenziele, an denen sie anhält, um die Tüten für einen Moment abzustellen: Bis zu dem Hydranten. Bis zu der Mülltonne. Nur noch bis zu dem Briefkasten. Endlich erreicht sie ihre Wohnsiedlung, dann ihr Haus. Ein dreistöckiges Mietshaus mit kleinem Vorgarten. An der Eingangstür stellt sie die Tüten ab, stützt sie mit ihren Beinen und sucht nach dem Schlüssel. Während sie ihre Manteltaschen durchwühlt, starrt sie auf die in die Tür eingelassene Scheibe aus Noppenglas, die aussieht wie eine Fläche angetauter und wieder eingefrorener Eiswürfel.
Im Treppenhaus wird Marta auf einmal schwarz vor Augen. Reflexhaft greift sie mit der linken Hand ans Geländer und lässt dabei eine der Tüten los. Die Tüte fällt um; es wären nur noch fünf Stufen bis zur Wohnung gewesen. Marta lehnt sich an die Wand, drückt ihren Kopf dagegen. Den Griff der anderen Tüte hält sie verkrampft fest. Als der Schwindel nachlässt, öffnet sie die Augen und sieht, dass die umgefallene Tüte so gut wie leer ist. Erschöpft sinkt Marta auf eine Stufe nieder, die gerade zu zittern anfängt, wie sie glaubt, aber es ist Marta, die zittert, nicht die Stufe. Im oberen Stockwerk schließt jemand seine Wohnungstür von innen auf. Marta hält den Atem an.
Zum Glück bleibt es still, niemand kommt.
Nach ein paar Minuten gelingt es Marta, langsam wieder aufzustehen. Sie trägt die volle Tüte hoch, öffnet die Tür und hebt die Tüte über die Schwelle. Dann zieht sie ihre Stiefel aus und tritt in den dunklen Flur ihrer Wohnung. Sie nimmt Eimer, Kehrbesen und Schaufel und kehrt damit ins Treppenhaus zurück, um den Sand zusammenzufegen. Sie schüttet ihn in den Eimer, trägt ihn in die Wohnung. Zum Schluss holt sie noch die liegen gebliebene, leere Plastiktüte.
Eigentlich müsste ich jetzt die Treppenstufen sauber wischen, gründlich, damit sich keiner der Nachbarn beschweren kann, denkt Marta. Stattdessen aber schließt sie die Tür von innen zu und zieht, beinahe eine Erleichterung spürend, die regenfeuchte Strumpfhose von ihren Beinen.
Es ist kurz vor acht, und heute Nacht ist Martas Mann gestorben.
Streng genommen war Arthur gar nicht ihr Mann. Denn er wollte sie »auf keinen Fall« heiraten. Marta nennt ihn trotzdem »meinen Mann«; schließlich haben sie ein gemeinsames Kind und teilen sich diese Wohnung seit über vierzig Jahren. Ob Arthur sie im Gegenzug als »meine Frau« bezeichnete, sollte er je mit anderen über sie gesprochen haben, weiß sie nicht. Sie hat sich das aber oft gefragt. Bei jedem Blick auf ihr Klingelschild, auf dem zwei Namen stehen, statt nur einem, wie es sich gehört, hat sie sich das gefragt. Und wahrscheinlich wird sie sich das auch in Zukunft weiter fragen.
In der vorangegangenen Nacht war Marta vom Geläut der Kirchenglocke geweckt worden. Sie kniete im Bett, der Oberkörper aufrecht. Ihr Kissen hielt sie vor dem Bauch umklammert. Es war stockfinster. Die Kirchenglocke schlug drei Uhr. Obwohl deren Läuten Marta seit Jahrzehnten begleitete und zu den Hintergrundgeräuschen ihres Lebens gehörte, die sie kaum wahrnahm, schon gar nicht im Schlaf, war es diesmal ein markerschütterndes Dröhnen, das alles zum Vibrieren brachte. Erschien es Marta deshalb so laut, weil von Arthur plötzlich diese Ruhe ausging? Das nächtliche Röcheln seiner kranken Lunge klang sonst, als würde jemand mit harten Besenborsten über den Asphalt fegen. Aber nun war von Arthur nichts mehr zu hören. Nachdem die Glockenschläge verebbt waren, wurde es totenstill um Marta herum, die Dunkelheit wirkte noch dunkler.
Schließlich begann Marta, doch ein Geräusch wahrzunehmen, ganz allmählich drang es zu ihr durch: das ihres eigenen Atems. Er raste. Marta hat eine kleine, zarte Nase. Mit jedem Einatmen wurde die Kuhle in ihren Nasenflügeln ein wenig tiefer. Mit jedem Ausatmen hauchte sie eine neue Nebelwolke in die kalte Luft. Marta konnte den Nebel durch die Finsternis schweben sehen. Wie Geister. Vielleicht mischte sich in diesem Moment Arthurs Seele darunter, löste sich darin auf?
Martas Hände hielten verkrampft, fast spastisch und gleichzeitig zitternd das Kissen fest. Es kostete sie einige Anstrengung, den Griff zu lockern. Sie legte das Kissen an seinen Platz am Kopfende des Bettes zurück. Noch immer kniete sie. Von ihrer Bettseite aus schaute sie jetzt zu Arthur hinüber und ahnte seine Konturen: die vorne spitz in die Luft ragende Nase, den Oberlippenbart, den dünnen Mund, das kantige Kinn. Auf Schulterhöhe: der Ansatz der Daunendecke. Bewegte sie sich wirklich nicht mehr? Kein Heben, kein Senken, nicht einmal ein paar Millimeter?
Sechzehn Jahre Altersunterschied lagen zwischen Marta und Arthur. Es war immer die wahrscheinlichere Variante gewesen, dass er vor ihr starb, schon seiner kranken Lunge wegen. Aber – womöglich spielte Arthur nur tot, womöglich tat er gerade nur so. Als ob.
Marta schob ihre Hand zu Arthur hinüber, fasste unter seine Decke und stupste ihn in die Seite: Er rührte sich nicht. Sie machte eine Faust, stieß derber zu, spürte die Rippen dieses hageren Mannes: keine Reaktion. Dann boxte sie ihn mit Wucht: Zwar wackelte sein Oberkörper kurz, das spürte Marta, aber es war eine marionettenartige Bewegung ohne Nachhall. Marta riss nun ihre Hand unter der Decke hervor und schlug Arthur ins Gesicht. Sie atmete heftig. Eine ganze Schar von Schwadengeistern stieg vor ihr auf. Marta ging in Deckung, legte sich rasch hin, zog ihre Decke hoch bis zum Kinn. Und mit dem Hinlegen, mit dem Hineinfließen in ihre gewohnte Schlafposition, legte sich nach und nach auch ihre Aufregung. Ihr Herz pochte langsamer, die Schar wurde kleiner.
Der Winter fraß sich durch die Außenwand in den Raum hinein. An Martas Beinen, unter der Decke, war es warm, aber ringsum zugig, feucht und kalt. Im Schlafzimmer heizten sie nie, dabei hätte Marta es gerne ein bisschen wärmer gehabt. »Vollkommen unnötig«, hatte Arthur gesagt – und Marta hatte sich vorgestellt, wie gemütlich es wäre, über einer Textilreinigung zu wohnen, deren Dampf von unten durch den Boden zu ihr in die Wohnung stieg, der das Schlafzimmer wärmte und zugleich den Geruch von heißer, sauberer Wäsche verströmte. Ein Geruch, den Marta sehr mochte, fast so sehr wie den des Meeres. Sie schloss die Augen. Die Matratze unter ihr teilte sich. Marta versank in einem dämmrigen Zeitloch.
Als sie erwachte, war für einen kurzen Moment alles wie immer. Bis sich die Stille erneut vordrängte.
»Arthur«, flüsterte Marta.
Er antwortete nicht.
Marta überlegte: Wenn Arthur wirklich tot war, musste sie Michael anrufen, ihren Sohn. Das hier war bestimmt ein Grund, aus dem sie sich bei ihm melden durfte. »Im Notfall« durfte sie ihn anrufen, das hatte er ihr erlaubt. Aber wenn er jetzt käme, würde er ihr doch sofort ein neues Leben mitbringen, ihr Leben als Witwe. Und dafür war sie noch nicht bereit.
Von einer ungewohnten, beinahe stechenden Klarheit erfüllt, wusste Marta plötzlich genau, was zu tun war. Sie klappte ihre Decke zurück, setzte sich auf die Bettkante und fuhr in ihre Pantoffeln, die sie zunächst mit den Zehen ertasten und zu sich heranholen musste. Die Nachttischlampe schaltete sie nicht ein. Es blieb dunkel.
Ihre Kleidung von gestern hing über dem Stuhl. Marta zog sich rasch an und schlich aus dem Schlafzimmer. Ganz sachte schloss sie die Tür. Sie befürchtete weiterhin, Arthur könnte wieder erwachen, könnte sich noch einmal aufbäumen, sie doch noch einmal anherrschen; bei ihm wusste man nie. Marta zog ihre Stiefel an und den Wintermantel und steckte zwei große Plastiktüten ein. Dann lief sie hinunter zum Strand, um so viel Sand zu holen, wie sie tragen konnte. Der Wind blähte die Morgendämmerung auf.
Die Sandtüte, die im Treppenhaus nicht umgefallen ist, lehnt an der Wand. Den Eimer stellt Marta in die Mitte des quadratischen Flurs. Vom Flur gehen das Schlaf- und Wohnzimmer, die Küche, das Bad, das Kinder- und Arthurs Arbeitszimmer ab. Allesamt schlauchartige Räume mit jeweils einem Fenster, lediglich im Wohnzimmer gibt es zwei; sie betrachten einander übereck. Die Wände sind dünn. Früher konnte man durch sie hindurch hören, wenn die Nachbarn stöhnten, und heute, wenn sie husten oder fernsehen. Marta und Arthur haben die Wohnung kurz vor Michaels Geburt bezogen. Modern war sie damals, inzwischen aber lösen sich die Tapeten von den Wänden wie alte Häute. Und auch wenn Marta alles sauber hält – in jede Raumecke hat ein Schatten sein vergilbtes Segel gespannt.
Marta zieht ihren Mantel aus und hängt ihn auf den Garderobenbügel neben Arthurs Lodenjanker, der so ausgebeult ist, dass er gleichzeitig leblos und lebendig wirkt. Ihre Ohren jucken. Nach der Kälte draußen gewöhnen sie sich nur langsam an die Wärme in der Wohnung. Sie fährt in ihre Absatzpantoffeln und geht zum Schlafzimmer. Die linke Hand an der Klinke, korrigiert sie mit der rechten ihre Frisur. Für einen Moment schließt sie die Augen, holt tief Luft. Erst dann öffnet sie die Tür und lugt vorsichtig hinein.
Unter dem dicken Federbett ist Arthur kaum zu entdecken. Nur sein kleiner Kopf ragt heraus wie ein Maulwurfshügel. Höchster Punkt ist nicht Arthurs Nase, sondern das Kinn. Arthur lief immer mit erhobenem Kopf herum, was aussah, als versuchte er, Nase und Augen über Wasser zu halten. Selbst wenn er es versucht hätte – er konnte sein Kinn gar nicht senken.
Marta schleicht am Fußende des Bettes vorbei und zieht den Vorhang auf, sodass der graue Tag durch die Gardine ins Zimmer fällt. Dann dreht sie sich um, geht in Richtung Bett zurück und erschrickt: Arthur stiert mit offenen Augen an die Decke. Ein starrer, ein toter Blick. Marta flüchtet aus dem Schlafzimmer zurück in den Flur, knallt die Tür hinter sich zu und legt ihre Hand aufs Dekolleté. Bei ihrer Großmutter hat Marta sich das abgeschaut; die legte ihre Hand auch immer aufs Dekolleté, wenn sie von einem Schreck Erholung suchte.
Das Blubbern der Aquariumpumpe dringt aus dem Wohnzimmer herüber.
Nach einer Weile hat Marta sich so weit beruhigt, dass sie beschließt zu frühstücken. In der Küche setzt sie Kaffee auf und betrachtet ihre Porzellantasse so genau, als habe sie diese soeben erst geschenkt bekommen: Der Henkel zeichnet den Umriss eines Ohrs in die Luft, die Innenwand ist voller grauer Kratzspuren, die aussehen wie Bleistiftstriche. All ihre Tassen haben diese Striche, weil Arthur beim Frühstück immer in seinem Kaffee herumrührte, was er bloß tat, um Marta zu ärgern, da war sie sich sicher, denn er rührte selbst dann noch, wenn der Zucker sich längst aufgelöst hatte.
Marta schenkt sich Kaffee ein, bestreicht eine Scheibe Brot mit Marmelade und setzt sich an den Küchentisch. Morgen für Morgen Arthurs Löffelklirren, heute jedoch nur ihr eigenes Kauen – sie spürt es mehr, als dass sie es hört, dieses Kauen, das von der Mundhöhle aus nach oben steigt und ihr die Enge ihres Kopfes bewusst macht.
Die Marmelade schmeckt sauer, das Brot ist trocken. Marta spült die Krümel mit Kaffee hinunter und schaut nervös umher. Die zwei Zierteller starren von der Wand wie grimmige Augen. Der Kalender hängt schief. Und auf dem Küchentisch liegt ein Wachstischtuch, an dem Martas Unterarme, wenn sie nackt sind, immer kleben bleiben. Das sandfarbene Blumendekor wird an Arthurs Platz von ein paar Schlitzen unterbrochen, die daher stammen, dass er sich ein Stück Käse oder Wurst manchmal auf dem Tisch abschnitt statt auf dem Teller; eine Unart, die er umgekehrt Marta nie hätte durchgehen lassen. Aus den Schlitzen wachsen knorrige Fasern.
Arthurs Stuhl, von dem aus er sie gestern stundenlang beobachtete, ist bloß noch ein Gerippe. Ein Gerippe mit gebogenen, dunkelbraunen Knochen. Beim Essen saßen Marta und Arthur stets übereck: Arthur an der schmalen Seite des Tischs, Marta an der längeren mit Sicht aus dem Fenster. Der Ausblick führt auf eine Wiese mit alten Ahornbäumen, die nicht gefällt werden dürfen. Ein Ausblick, der sie stets ein wenig ablenkte, denn so musste sie Arthur nie direkt in die Augen schauen. Der dritte Stuhl am Tisch ist der von Michael. Er steht gegenüber Arthurs Platz und bleibt schon seit mehr als zwei Jahrzehnten leer. Während Martas Stuhl und Arthurs Stuhl allerhand Abnutzungserscheinungen zeigen, ist die Sitzfläche des dritten Stuhls straff und tadellos; es gibt keine Stelle, an der die Rattanfasern einzureißen drohen. Trotzdem kam es Marta nie in den Sinn, ihren oder Arthurs gegen diesen dritten Stuhl auszutauschen, geschweige denn, sich selbst auf den freien Platz zu setzen, von wo aus sie Arthur hätte frontal ins Gesicht blicken müssen. Zumal: Von ihrem Stuhl aus spürt sie immer ein wenig Zugluft durch die offene Küchentür, und das findet sie angenehm. Als stünde jemand, der sie gernhat, hinter ihr und hauchte ihr in den Nacken.
Das fehlende Löffelklirren beherrscht den Raum, bis Marta aufsteht und das Radio anschaltet. Es läuft ein Oldie. Sie gießt sich einen zweiten Kaffee ein, setzt sich wieder und nimmt sich vor, diese Tasse ganz in Ruhe zu trinken, bevor sie sich an die Arbeit macht. In den Radionachrichten wird vor einem Winterorkan gewarnt. Die Sprecherin ist beinahe heiser, räuspert sich, entschuldigt sich und sagt, an der Küste sei mit einer schweren Sturmflut zu rechnen. Marta versucht, weiter zuzuhören, und streckt den Rücken durch wie eine brave Schülerin. Konzentrieren kann sie sich trotzdem nicht.
Sie will die Kerze anzünden, die seit gestern auf dem Tisch steht. Gestern war ihr neunundfünfzigster Geburtstag. Hat Michael mir eigentlich gratuliert?, fragt sie sich. Habe ich das Telefon überhört? Bestimmt hat er mehrmals versucht anzurufen.
Marta holt eine Streichholzschachtel und öffnet sie. Nur schwarzhalsige Stäbchen liegen darin. Unzählige Angewohnheiten pflegte Arthur, und eine davon war es, ein Streichholz, nachdem er sich damit eine Zigarette angezündet hatte, in die Schachtel zurückzulegen. Marta lässt die verbrannten Streichhölzer nun allesamt zu Boden rieseln. Dann setzt sie sich wieder hin und nippt am Kaffee. Kurz darauf steht sie erneut auf, diesmal, um einen Löffel zu holen, und beginnt, damit in ihrer Tasse zu rühren, bis es genauso klingt wie bei Arthur.
»So weit die Meldungen«, sagt die Nachrichtensprecherin und wird nun, wo wieder Musik läuft, wahrscheinlich von dem zurückgehaltenen Husten übermannt.
Mit der rechten Hand rührt Marta unablässig weiter in der Tasse. Den Zeigefinger der linken steckt sie sich zum Befeuchten in den Mund, tunkt ihn ins Zuckerdöschen und lutscht anschließend die süßen Kristalle ab.
Sie hört Arthurs mahnende Stimme: »Nimm wenigstens einen Löffel!«
Daraufhin zieht Marta den Löffel aus ihrem Kaffee heraus und lässt ihn klirrend auf die Untertasse fallen. Sie kann unmöglich länger sitzen bleiben. Sie schaltet das Radio aus und liest die verkohlten Streichhölzer vom Boden auf; an ihrem Zeigefinger kleben noch ein paar weiße Zuckerkristalle, die sich mit dem schwarzen Ruß vermischen. Dann richtet sie den Kalender an der Wand und reißt den Februar ab. Jetzt ist Sonntag, erster März. Leichter Regen weht gegen die Scheiben. Bei diesem Wetter werden heute wohl nur die Hartgesottenen in die Kirche gehen. Soll ich gehen? Nein, keine Zeit. Aber es ist eigenartig: Seit über vierzig Jahren hat Marta keine Kirche mehr betreten – Arthur konnte »mit diesem Humbug nichts anfangen«, in seiner Kindheit habe er davon genug gehabt –, und trotzdem denkt sie jeden Sonntagmorgen daran, dass nun Gottesdienst ist, dass dort Menschen singend ihren Tag beginnen, dass sie gemeinsam Orgelmusik hören, sich an den Händen halten und im Chor das Vaterunser murmeln, dessen Rhythmus Marta früher jedes Mal ehrfürchtig erschaudern ließ, wenn sie mit ihrer Großmutter in einer der klapprigen Bankreihen stand.
Vater unser im Himmel,
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Sie nimmt ihre Strumpfhose, die zwar warm ist, aber noch klamm, von der Heizung. Marta hat sie zum Trocknen dort hingehängt. Sie summt den Gebetsrhythmus weiter, die Worte im Kopf.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Sie schiebt ihren engen Rock über den Hintern nach oben und zieht sich die Strumpfhose wieder an. Das Nylon glättet die blau schimmernden, gewölbten Adern, die sich um ihre Knie ranken.
»Du hast Regenwürmer unter der Haut«, spricht Arthur, sich zwischen die Gebetszeilen drängelnd, in verächtlichem Tonfall zu ihr.
Marta zupft an der Strumpfhose herum, rückt ihren Rock zurecht und streicht ihn schließlich mit beiden Händen glatt.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.
Beim »Amen« beginnt sie zu weinen. Um sich abzulenken, holt sie die Sektflasche aus dem Kühlschrank, die sie und Arthur vor ein paar Wochen von der Hausverwaltung bekommen haben, zusammen mit der Nachricht, dass alle Wohnungen saniert werden – und die Miete erhöht. Arthur tobte. Marta hört ihn auch jetzt wieder toben. Im Entkorken von Sekt hat sie keinerlei Übung. Ungeschickt öffnet sie die Flasche mit einem Knall, von dem sie selbst erschrickt, und gießt sich ein Glas ein. Der Sekt schäumt über. Marta prostet ihrer noch immer unberührten Geburtstagskerze zu, dann leert sie gierig das Glas. Sofort wird ihr angenehm warm in der Brust. Wahrscheinlich ging es ihrer Großmutter mit ihren Likörchen auch immer so, und ihrer Mutter mit dem sauren Rotwein, und ihrem Vater mit dem Schnaps. Der Sekt sprudelt in Martas Mund wie Brausepulver. Ein fauler Alkoholgeschmack setzt sich auf ihre Zunge und bleibt dort, während sie die Gratulationskarte vom Küchentisch nimmt, die ihr Arthur gestern geschenkt hat. Marta klappt sie auf. Verzerrte, metallische Kinderstimmen beginnen zu singen.
Alles Gute zum Geburtstag,
alles Gute für dich.
Alles Liebe
von ganzem Herzen
wünschen wir dir feierlich.
Noch mehrmals klappt sie die Karte auf und zu, auf und wieder zu, sodass die Kinder nie weiter kommen als bis »Alles Gu–«.
Einige Falten liegen über ihren dünn gezupften Augenbrauen auf ihrer Stirn. Ansonsten aber sieht Marta frisch aus; mit ihrer Haut hat sie Glück. Nur die Ohrläppchen sind ein wenig ausgeleiert. Schwerer Schmuck hat die Ohrlöcher über die Jahre zu Schlitzen in die Länge gezogen, und wenn Marta, wie heute, nur einen kleinen Stecker trägt, klebt dieser am unteren Rand des Läppchens, als würde er gleich abfallen. Ihr feines Haar hat sie mit vielen Nadeln locker hochgesteckt. Rotbraun gefärbt, ist der Ton um einige Nuancen dunkler als der, den ihr Haar früher hatte. Seit Marta die ersten grauen Strähnen entdeckt hat, geht sie alle drei Wochen zum Friseur. Wenn sie dort ist, vereinbart sie immer gleich den nächsten Termin. Bei ihrem Aussehen gestattet sie sich keinerlei Nachlässigkeit. Und obwohl sie manchmal Lust hätte, einfach ohne Büstenhalter durch den Tag zu laufen, tut sie das nie. Die Vorstellung, dass ihr ein Unfall passieren könnte und das Krankenhauspersonal dann feststellen müsste, dass sie ohne BH war, hält sie immer davon ab.
Es ist eine Ausnahme, dass Marta heute noch einmal dieselbe Kleidung trägt wie am Tag zuvor. Aber in der Nacht, in der Dunkelheit des Schlafzimmers, war es unmöglich, etwas anderes auszuwählen als die hautfarbene Spitzenunterwäsche, die hellbraune, fast goldene Satinbluse, in deren Vorderärmel – für alle Fälle – ein Papiertaschentuch steckt, die Nylonstrumpfhose und den engen schwarzen Rock, der ihr bis unmittelbar unter die Knie reicht und einen Ring in den weichen Bauch schneidet.
Nach dem Frühstück fühlt Marta sich etwas besser. Sie schleicht sich erneut ins Schlafzimmer, stellt sich an den Rand des Bettes und wagt es nun, Arthur länger anzuschauen. Sie betrachtet die Haarbüschel in seinen mit der Zeit deutlich größer gewordenen Ohren. Sie sieht seine vorn spitze und in der Mitte breite Nase, darunter den Oberlippenbart, den er bestimmt heute wieder gestutzt hätte. Sie sieht die porige Haut mit den trüben Altersflecken, die Bartstoppeln. An Arthurs Wange, wo gestern beim Frühstück ein Schnipsel Toilettenpapier hing, weil er sich beim Rasieren verletzt hatte, haftet jetzt ein dünner Streifen Schorf. Sein Mund ist leicht geöffnet, graue Spucke klebt in den Ecken. Auf dem Kopf trägt Arthur nur noch einen lichten Haarkranz, und oben, auf der nackten Kopfkrone, ist seine Haut gespannt und glatt und glänzend wie sonst nirgends. Sein Blick richtet sich immer noch stur gen Decke. Die Farbe seiner Augen: ein klares, kühles, fast künstliches Blau. Über all die Jahrzehnte hinweg ist es dasselbe geblieben. Während sonst alles an Arthur verblasste, hat seine Augenfarbe nichts an Intensität eingebüßt. Am Außenring der Regenbogenhaut etwas dunkler, wird das Blau zur Pupille hin immer heller und leuchtender. Marta musste früher oft an Eisbonbons denken, wenn sie ihm in die Augen schaute. Denn die haben genau dieselbe Farbe, und ihr Geschmack springt – ebenso wie Arthurs Blick – von einem Moment auf den nächsten von warmsüß zu bitterkalt.
Marta versucht, ihm die Augen zu schließen. Ihre Hände schmerzen noch vom Tragen der Sandtüten. Die Haut an den Fingerkuppen ist aufgeraut, sodass sie Arthurs Lider kaum spürt. Sie lässt die Lider los, sie klappen zurück, und Arthur stiert wieder an die Decke. Marta probiert es erneut: Wieder klappen die Lider zurück. Und auch nach dem nächsten Versuch bleiben sie nicht unten. Entschlossen nimmt Marta nun seinen Kopf in beide Hände und versucht, ihn zur anderen Seite zu drehen. Aber auch der Kopf lässt sich nicht bewegen.
»Ich kann nicht weitermachen, wenn du so guckst«, faucht sie und versucht noch einmal, den Kopf zu drehen. Es misslingt. Marta holt daraufhin ein Tuch aus der Küche und legt es ihm aufs Gesicht. »Starrkopf. Starrköpfig wie eh und je.«
Damals: Wenn Arthur sie anlächelte, musste er keinen einzigen Gesichtsmuskel bewegen, er konnte allein mit seinen Augen strahlen. Sie schnappten zu, und dann war Marta, für weniger als eine Sekunde nur, gänzlich eingehüllt wie in ein Blitzlicht.
Zum ersten Mal passierte das an einem Montagmorgen Anfang Mai. Marta war siebzehn und im letzten Schuljahr. Ihre Mutter hatte ihr in der Früh hinterhergeschrien: »Wenn du in diesen Schuhen wenigstens laufen könntest!«, während Marta in ihren Plateausandalen und dem engen, schrill gemusterten Kleid, dessen Farben sich mit dem Rotschimmer ihres Haares bissen, die Treppe hinunterhastete. Ihre Umhängetasche prallte gegen die Beckenknochen. Kalt hallten die Worte der Mutter durch den Hausflur, und als Marta in der Dorfschule ankam, echoten sie noch immer durch ihren Kopf. Marta stellte ihre Tasche im Klassenzimmer ab und ging, bemüht, es elegant aussehen zu lassen, zur Toilette. Als sie zurückkam, war ein Mann, den sie nicht kannte, gerade dabei, sich auf den Platz neben ihr zu setzen. Der Mann war groß und hager. Im Sitzen beugte er sich zur Seite und hängte seine abgewetzte Ledertasche an den Haken, der an der Kante des Tischs dafür vorgesehen war.
Alle anderen Schüler saßen bereits, und als schließlich auch Marta ihren Platz einnahm, drehte der Mann sich zu ihr: »Bei dir hier ist frei, gell?«
Da sah sie es: das Blitzlicht seiner eisbonbonblauen Augen. Es schnappte zu. Es fing sie ein. Es blendete. Marta nickte zur Antwort.
»Schön«, sagte er und schaute wieder nach vorn.
Marta wollte diese Augen unbedingt noch einmal sehen. Sie musterte den Mann eingehend von der Seite. Sein Nacken war kurz, sein Kinn zeigte schräg nach oben, und seine Nase lief vorne sehr spitz zu, in der Mitte aber war sie an einer Stelle breit und eingedrückt.
Pünktlich mit dem Stundenklingeln stolzierte die Deutschlehrerin herein. Das Klassenzimmer war ihre Bühne. Sie trug ein fliederfarbenes Kostüm und hatte sich mit einem viel zu dunklen Make-up geschminkt, das am Hals jäh aufhörte, eine Grenzlinie zwischen Wahrheit und Unwahrheit zog und die eigentliche Hautfarbe sichtbar machte. Die Lehrerin begrüßte die Klasse. Sie erklärte, das sei Herr Baldauf, der da hinten neben Marta sitze. Mit einer ausholenden, feierlich anmutenden Armbewegung und nach oben geöffneter Handfläche zeigte sie auf ihn, vielmehr: Sie präsentierte ihn – Herrn Baldauf. Mit Anfang dreißig habe er »bewundernswerterweise«, wie sie betonte, noch ein Lehramtsstudium aufgenommen, Deutsch und Geografie für die Oberstufe, und es sehr erfolgreich abgeschlossen. Er stamme aus dem Süden, lebe nun »hier bei uns im Norden« und werde den Unterricht ein paar Wochen lang von der Bank aus verfolgen, bevor er ab dem nächsten Schuljahr dann selbst unterrichte, »was aber aus dieser Klasse nur die Durchfaller miterleben werden«. Sie zwinkerte dem neuen Kollegen zu. Dieser schaute aufmerksam und mit konzentrierter Miene in den Raum. Herr Baldauf trug ein kariertes, kurzärmeliges Hemd in Rot- und Brauntönen, dazu eine dunkelgrüne Cordhose. Er sah herbstlich aus, während draußen der Frühling sprießte. Die Ginstersträucher auf dem Schulhof platzten vor Gelb.
Marta beobachtete ihren neuen Banknachbarn weiter. Auffällig weit oben hielt er sein Kinn, wodurch sein kurzes, hellblondes Haar am Hinterkopf auf dem Kragenansatz aufkam. Er wirkte streng, was nicht zuletzt daran lag, dass er den obersten Hemdknopf geschlossen trug. Der Adamsapfel darüber lag frei. Marta stellte sich vor, wie es wäre draufzudrücken. Die Vorstellung tat ihr weh. Um den imaginierten Schmerz zu lindern, strich sie sich über den Hals.
Im Verlauf des Unterrichts machte Herr Baldauf sich eifrig Notizen. Er hatte dünne, dennoch kräftig aussehende Finger und drückte zwischendurch mit dem Daumen regelmäßig auf seine Ohrknorpel. Vielleicht war er schwimmen und hat noch Wasser im Ohr, überlegte Marta. Sie wünschte, er würde wieder zu ihr schauen. Schließlich tat er es auch: Er drehte seinen Kopf nach links zu ihr und lächelte sie genauso einnehmend an wie vorhin. In diesem Moment wurde Marta von der Lehrerin aufgefordert, eine Frage zu beantworten, die sie nicht mitbekommen hatte.
Sämtliche Mädchen der Klasse begannen zu kichern, was die Lehrerin zu bestärken schien. Sie zog ihren Blazer aus, stellte sich so aufrecht hin, dass sie ins Hohlkreuz ging, und stemmte die Hände in die Hüften. Sie schickte Marta an die Tafel. Bei ihr mussten stets die Schüler schreiben, weil ihre Hände keine Kreide vertrugen. Marta ging also nach vorn, ein Kribbeln stieg in ihr hoch, und ihr Gesicht wurde heiß. Eine Viertelstunde lang diktierte die Lehrerin komplizierte Sätze voller orthografischer Fallstricke. Marta stand mit dem Rücken zur Klasse, spürte die Blicke auf sich, nervös spannte sie ihren Hintern an, die Sandalen waren unbequem. Als sie endlich zurück an ihren Platz durfte, warfen ihr die Nachbarszwillinge, die in der Nacht offenbar mit geflochtenen Zöpfen geschlafen hatten und nun so etwas wie Locken auf dem Kopf trugen, viele kleine Kussmünder zu und rieben ihre Zeigefingerspitzen knutschend aneinander. Marta setzte sich. Herr Baldauf ließ sich nicht anmerken, was er dachte. Er war in sein Notizheft vertieft. Für den Rest der Stunde zwang Marta sich, nur nach vorne zu blicken. Das Kribbeln hörte nicht auf.
Mit ihren siebzehn Jahren hatte Marta noch nie einen Jungen geküsst, noch nicht einmal Händchen gehalten mit einem. Ihr einziges Erlebnis mit einem Jungen bestand darin, dass Hansjörg aus der Parallelklasse sie mit stimmbrüchiger Stimme gefragt hatte, ob sie mit ihm gehen wollte. Er war dafür extra zu ihr nach Hause gekommen. Zum Glück war ihre Mutter nicht da. Verschüchtert saßen sie in Martas Zimmer und starrten aneinander vorbei in die Luft.
Marta sagte: »Ja.«
Hansjörg sagte: »Gut«, und schlug sich mit beiden Händen auf die Oberschenkel, wie es auch alte Männer taten, wenn sie etwas erledigt hatten. Dann stand er auf und ging.
Danach mieden sie einander, weil keiner von beiden wusste, was als Nächstes zu tun war.
Marta war eine mittelmäßige Schülerin. Kunst machte ihr Spaß, denn sie war geschickt und konnte gut zeichnen. Alles andere hingegen erledigte sie ohne besonderen Eifer. Deshalb stach sie bei den Lehrern nicht mit Wissen oder Klugheit hervor, sondern damit, dass sie im Vergleich zu gleichaltrigen Schülerinnen schon sehr erwachsen wirkte. Sie hatte eine ruhige, beobachtende Art, während die anderen Mädchen ständig kicherten. Marta konnte das gar nicht: kichern. Die Zwillinge, die dabei aneinanderlehnten und sich manchmal sogar zur Seite plumpsen ließen, hatten zwar versucht, es ihr beizubringen, aber als Marta begann, im Lachen ihre Stimme zu überschlagen, klang es furchtbar unbeholfen.
»Du jodelst«, sagten die Mädchen, zogen die jeweils rechte Augenbraue hoch – etwas, wozu Marta auch nicht in der Lage war: nur eine Augenbraue hochzuziehen – und urteilten einhellig: »Lass es bleiben. Deine Stimme ist sowieso zu tief dafür.«
Das Dorf, in dem Marta aufwuchs, war weitläufig; nach allen Seiten hin franste es aus. Die kleinen Häuser standen auf großen, koppelartigen Grundstücken und mit viel Abstand zueinander. Marta lebte mit ihrer Mutter in einer Mietwohnung in der Klinkersiedlung am östlichen Ortsrand. Die Siedlung war das einzige Areal in diesem Dorf, in dem sich mehrere Menschen vergleichsweise wenig Platz teilen mussten, und bestand aus zwei parallel angeordneten Hausreihen mit jeweils zwei Stockwerken und vier Eingängen. Sie war auf eine ebene Freifläche gebaut, wo im Herbst und im Winter die Hecken vibrierten und der Wind sehr laut pfiff. An manchen Tagen brachte der Wind den Geruch des Meeres mit, und an diesen Tagen atmete Marta zunächst mehrere Male tief ein und aus, ehe sie ins Haus ging.
Die Zwillingsmädchen wohnten gleich nebenan. Als Kind war Marta mit ihnen durch die Siedlung getobt, wild bimmelnd Fahrrad gefahren und über Hinkelkästchen gehüpft. Sie hatten zusammen »Vater, Mutter, Kind« gespielt, wobei Marta nie der Vater sein wollte, weil sie nicht wusste, wie das ging. Beim Versteckspiel hatten sie sich in einem der Hintereingänge geduckt, die von außen über eine Treppe direkt in die Keller der Häuser führten. Hunderte Male waren sie unter den Wäschestangen hindurchgerannt, an die die Frauen ihre Leine bei jeder Benutzung neu spannten. Und im Sommer hatten sie auf der Wiese zwischen den zwei Häuserblöcken ein Zelt aufgestellt, in dem sie übernachtet, sich ihr Geschlecht gezeigt und miteinander verglichen hatten. Sie hatten sich Ahornnasen ins Gesicht geklebt, Springkrautkapseln zerdrückt, vierblättrigen Klee gesucht, Kränze aus Gänseblümchen geflochten, rohe Erbsen gegessen und Löwenzahn durch die Gitter der Hasenkäfige gestopft. Sie waren von ganz oben vom Klettergerüst gesprungen, das aussah wie das Skelett einer Rakete, und nachdem Marta im Sand gelandet war, hatte sie sich immer sofort die schwarz-roten Eisenkrümel von ihren Händen geklatscht; das Klettergerüst war mit einer Kruste von Rostblasen überzogen.
Während die Zwillinge sich stritten, spielten oder kicherten, ging Marta oft heimlich in das Schlafzimmer von deren Eltern. Nicht dass es ausdrücklich verboten gewesen wäre, doch es war eben der Raum eines Ehepaars. Ein kühles Zimmer mit massivem Doppelbett, einem silbergerahmten Hochzeitsfoto auf dem Nachtschränkchen und geheimnisvollen Dingen in der Schublade, mit eingetrockneten Flecken auf dem Laken, die Marta sah, wenn sie die dicken Decken anhob, und mit diesem scharfen Schlafgeruch, der aus den Kissen strömte, sodass Marta glauben konnte, die Eltern der Zwillinge wären auch hier und freuten sich über Martas Besuch, hier in ihrer Sphäre.
An jenem Tag, an dem der neue Lehrer, Herr Baldauf, zum ersten Mal an ihrer Schule war, warteten die Zwillinge nicht auf Marta, obwohl sie normalerweise zu dritt nach Hause gingen. Marta musste rennen, um zu den Mädchen aufzuschließen. Die Zwillinge hatten den gleichen, leicht steifen Gang. Ihre Arme und Beine erinnerten an den Stellen, an denen Knochen hervortraten, am Knie etwa, an knorrige Stöcke. Die beiden besaßen eine dünne, lange Statur – ganz anders als Marta. Sie war kleiner und weich geformt. Im Gehen rieben ihre Oberschenkel aneinander, und schon mit zwölf hatte sie so viel Busen, dass es sie beim Rennen schmerzte und sie sich von ihrer Großmutter einen Büstenhalter kaufen ließ. Einen weißen aus Spitze, nicht aus besonders edler, aber immerhin aus Spitze. Marta mochte ihren BH





























