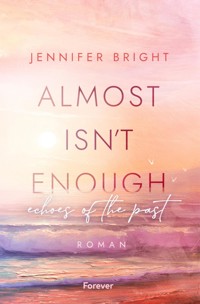
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Secrets of Ferley
- Sprache: Deutsch
Damian kann seinen Augen nicht trauen, als er eines Nachts plötzlich Hazel gegenübersteht – seiner Jugendliebe, die vor zwei Jahren aus der Kleinstadt verschwunden ist und mehr Geheimnisse mit sich rumschleppt, als sie tragen kann. Während Hazel ihrem erkrankten Großvater in der Buchhandlung aushilft, betäubt Damian seine Schuld mit Underground-Boxkämpfen, die alles von ihm abverlangen. Zwischen Hazel und Damian fliegen wieder die Funken, doch Damian kann Hazel sein gebrochenes Herz nicht verzeihen. Trotzdem kommen sie sich immer näher, bis Hazels Probleme sie einholen und alle in Gefahr bringt … »Jennifer Bright vereint alles, was es für einen Pageturner braucht: Knisternde Gefühle, Spannung bis zur letzten Seite und emotionaler Herzschmerz vom Feinsten. Dieses Buch ist ein absolutes Highlight!« Ayla Dade
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Almost isn't enough. Echoes of the Past
JENNIFER BRIGHT wurde 1993 in Hannover geboren. Zusammen mit ihrem Mann und ihrer Katze lebt sie noch heute in der niedersächsischen Hauptstadt. Sie trinkt mehr Kaffee, als es gut für sie wäre, und kann sich kein Leben ohne Katzen, Bücher und Serien vorstellen. Auf Instagram (@wort_getreu) und TikTok (@jennifer.bright) teilt sie ihre Leidenschaft dazu.
SECRETS NEVER STAY HIDDEN IN FERLEYDamian kann seinen Augen nicht trauen, als er eines Nachts plötzlich Hazel gegenübersteht – seiner Jugendliebe, die vor drei Jahren aus der Kleinstadt verschwunden ist und mehr Geheimnisse mit sich herumschleppt, als sie tragen kann. Während Hazel ihrem erkrankten Großvater in der Buchhandlung aushilft, betäubt Damian seine Schuld mit Underground-Boxkämpfen, die alles von ihm abverlangen. Zwischen Hazel und Damian fliegen wieder die Funken, doch Damian kann Hazel sein gebrochenes Herz nicht verzeihen. Trotzdem kommen sie sich immer näher, bis Hazels Probleme sie einholen und sie beide in Gefahr bringen …
Jennifer Bright
Almost isn't enough. Echoes of the Past
Roman
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2025Umschlaggestaltung: favoritbuero, München Titelabbildung: © Rudchenko Liliia / Shutterstock; © Boyan Dimitrov / ShutterstockAlle Rechte vorbehaltenDie automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.Autorenfoto: © Jennifer BrightE-Book Konvertierung powered by pepyrus978-3-95818-849-5
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Epilog
Content Note
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Für all diejenigen, die glauben, nicht gut genug zu sein. Ihr seid es!
Motto
Playlist zum Buch
Risk – Gracie Abrams
My Greatest Fear – Benson Boone
Hate you – Jung Kook
neon skies – Zach Hood
I Look in People’s Windows – Taylor Swift
Figure You Out – VOILÀ
I Don’t Wanna Leave Just Yet – Thomas Day
Stayed Strangers – Abigail Barlow & Ariza
Congrats – LANY
IF NOT FOR YOU – Måneskin
I Knew It, I Know You – Gracie Abrams
Back To Me – The Rose
Elephant In The Room – Rowan Drake
Slow It Down – Benson Boone
Half Life – Livingston
you’re just a guy (as written) – Avery Lynch
Blvd – Adam Ragsdale
Cyanide – Gigi Moss
Hinweis
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält sensible Inhalte. Deswegen findet ihr am Ende des Buches eine Content Note. Achtung: Diese enthält Spoiler für die gesamte Geschichte. Wir möchten, dass ihr das bestmögliche Leseerlebnis habt.
Eure Jennifer Bright und das Forever-Team
Prolog
Jackson WO BIST DU?
Jackson WO BIST DU, HAZEL????
Mit zittrigen Fingern halte ich das alte Smartphone in den Händen und starre auf das zersprungene Display. Blanke Panik kriecht meine Adern empor, nistet sich in meine Eingeweide ein und zerfrisst mich von innen heraus.
Meine Füße scheinen eins mit dem Asphalt zu werden, als sei ich einbetoniert und nicht in der Lage, mich zu bewegen. Ich stehe mitten in der Fußgängerzone, zwischen Klamottenläden und dem einzigen Friseursalon, den es in Ferley gibt. Menschen laufen an mir vorbei. Nur am Rande bekomme ich mit, wie ein Hund zu bellen beginnt, Kinder lachen und Leute sich unterhalten. Die Sonne strahlt, als wolle sie mich verhöhnen. Als wolle sie mir zuflüstern: Du bist zurück in dieser wunderschönen Küstenstadt, und alles könnte perfekt sein, wäre da nicht die Realität, vor der du nicht davonlaufen kannst.
Ein Kribbeln legt sich über meine Haut, lässt mich für den Bruchteil einer Sekunde zusammenzucken, ehe ich den Blick hebe und …
Strahlend grüne Augen.
Rabenschwarze Haare.
Die Arme voller Tattoos.
Einige Meter von mir entfernt steht der Mann, dessen Herz ich wissentlich in Stücke gerissen habe. Und mit einem Mal vergesse ich alles um mich herum. Die Menschen, die Straße, die Geschäfte verlieren an Farbe und Kontur. Nur er strahlt inmitten dieser verwaschenen Trostlosigkeit und brennt sich unwiederbringlich in meine Netzhaut ein. Wie das Ticken einer Zeitbombe ertönt mein Herzschlag in meinen Ohren.
Damian trägt ein helles Muskelshirt und eine schwarze, kurze Sporthose. Das Haar klebt ihm nass an der Stirn, als käme er frisch aus der Dusche. Die vollen Lippen hat er so fest aufeinandergepresst, dass seine Kieferpartie messerscharf hervorsticht.
Er sieht mich an.
Ich sehe ihn an.
Sekunden fühlen sich an wie Minuten, Stunden, Tage.
Gott, er ist noch viel schöner als in meiner Erinnerung.
Meine Sicht verschwimmt, während sich zwischen meinen Lidern ein Meer aus Tränen ansammelt. Wie Eiswasser fließen sie meine brennende Wange hinunter. Langsam öffne ich den Mund, forme seinen Namen, doch kein Ton verlässt meine Lippen.
Damians Finger umklammern den Griff seiner Sporttasche, die er sich über die Schulter geschwungen hat, bis sie plötzlich zu Boden fällt. Ich dürfte es aufgrund der Entfernung gar nicht wahrnehmen, und doch glaube ich, den Aufprall laut und deutlich zu hören. Als sei dies der Startschuss, läuft Damian auf mich zu.
Blitzschnell schiebe ich mein Handy in die Hosentasche, drehe mich um und renne.
Die Hitze des Sommertages hängt schwer über mir, während ich mich an Menschen vorbeidränge, darauf bedacht, keinen Blick über die Schulter zu werfen. Ich weiß auch so, dass er mich verfolgt. Doch ich würde es nicht ertragen, die Verzweiflung in seinen Augen zu sehen. Oder die Wut. Ich weiß nicht, was mich mehr zerstören würde.
Jeder Schritt ist ein jämmerlicher Versuch, der Realität zu entkommen. Ich wische mir die feuchten Hände an meinem Oberteil ab. Verdammt, ich benehme mich wie ein kleines Kind, das beim Kaugummistehlen erwischt wurde. Ich mache mich lächerlich. Und doch kann ich nicht stehen bleiben. Die Angst, die mich antreibt, ist stärker als der Schmerz, der mich lähmt. Kurz überlege ich, in den nächstgelegenen Supermarkt zu rennen und mich dort zwischen den Regalen zu verstecken. Doch dann erweckt eine schmale Gasse meine Aufmerksamkeit.
Meine Füße sind schwer wie Blei, und meine Lunge brennt. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt so schnell gerannt bin. Hastig sehe ich mich um. Doch auch hier gibt es keine Möglichkeit, mich zu verstecken, außer ich springe in einen der Müllcontainer.
Das Rauschen in meinen Ohren wird immer lauter. Schweiß läuft mir den Rücken hinunter. Ich rechne jeden Moment damit, dass Damian mich einholt.
Seit drei Jahren stelle ich mir vor, wie es ist, ihn wiederzusehen. Ich wusste, dass es sich nicht vermeiden lässt. Wie auch? Diese Stadt ist klein, ich habe kaum eine Chance, meiner Vergangenheit aus dem Weg zu gehen. Und obwohl ich dieses Szenario unzählige Male in meinem Kopf durchgespielt habe, ist es etwas anderes, wahrhaftig dem Mann in die Augen sehen zu müssen, der meine ganze Welt war.
Ich renne die Gasse hinauf, bis ich vor einer Mauer stehe. Scheiße! Ich rüttle an einer Tür, auf der dick und fett Zutritt verboten steht. Abgeschlossen.
Plötzlich ist da Damians Stimme, die meinen Namen ruft. Nein, nein, nein. Ich kann das nicht. Nicht jetzt. Nicht so.
Meine Finger schließen sich um einen Türgriff, und gerade als die Rufe lauter werden, gibt die knarrende Tür nach. Ich reiße sie ruckartig auf, und unbeirrt dessen, was sich dahinter verbergen mag, ziehe ich sie genauso rasch hinter mir zu. Mit wild klopfendem Herzen stehe ich mit dem Rücken zum Holz. Höre Damians Schritte, seine Stimme, seinen schnellen Atem.
Während ich in einer Art dämmrigem Flur verharre und hoffe, dass mich niemand hier erwischt, schnipse ich das Zopfgummi um mein Handgelenk immer wieder gegen die Haut. Wenn ich derart angespannt bin wie jetzt, dann ist dies die einzige Methode, die mich ins Hier und Jetzt zurückholen kann, ohne dass die Panik die Oberhand gewinnt.
Ein wutverzerrter Laut kommt Damian über die Lippen, und es bricht mir das Herz. Meine Tränen strömen unaufhaltsam meine Wangen hinab, und ich schlage die Hände vors Gesicht, um die Schluchzer abzudämpfen.
Ich dachte, ich sei stark genug. Ich könnte ihm einfach gegenübertreten und zeitgleich aus dem Weg gehen. So tun, als wäre nie etwas passiert. Doch jetzt wird mir klar, dass das nicht möglich ist. Ich kann Damian und unserer Vergangenheit nicht entkommen.
Kapitel 1
Zwei Wochen später
Die Menge tobt. Das Meer aus Stimmen verschmilzt zu einem ohrenbetäubenden Chor, während sie meinen Namen grölen und all ihr Vertrauen, all ihre Hoffnung und vor allem all ihr Geld auf mich und meinen Sieg setzen. Man könnte meinen, dass ich alles dafür tun würde, diese Menschen, die am Rand des leeren und heruntergekommenen Schwimmbeckens stehen, nicht zu enttäuschen. Doch ehrlich gesagt interessiert es mich einen Scheiß, ob sie durch mich reicher oder ärmer werden.
»Demon. Demon. Demon.«
Was für ein bescheuerter Name. Man hat ihn mir bei meinem ersten Kampf gegeben, weil keiner der Kämpfer beim echten Namen genannt werden darf. Auch wenn mein Gesicht bei Weitem kein unbekanntes ist. Erst recht nicht, seit die Schlagzeilen um die Verhaftung meines Alten überhandgenommen haben.
Mein Gegenüber hat es jedoch schlimmer getroffen. Iron Fist. Ich musste mir ein Lachen verkneifen, als er aufgerufen wurde. Außerdem bin ich mir sicher, dass er seinen Namen nicht verdient hat. Das merke ich allein schon daran, wie langsam und schwerfällig er sich bewegt. Als der Gong erklingt, stürmt er direkt auf mich zu.
Jeder Muskel, jede Sehne meiner Arme ist zum Zerreißen angespannt, als ich meine Deckung schließe und meinem Gegner duckend ausweiche. Ich kontere mit einem Schlag in seine Flanke, gefolgt von einem Aufwärtshaken, der sein Kinn so hart trifft, dass er kurz das Gleichgewicht verliert und nach hinten stolpert.
Pures Adrenalin pumpt durch meine Adern, lässt mich alles um mich herum vergessen. Dieses Gefühl, jeden Zentimeter meines Körpers zu spüren, ist mit nichts anderem zu vergleichen. Wenn ich das Boxen nicht hätte, würde ich vermutlich komplett den Verstand verlieren.
Iron Fist rappelt sich wieder auf, tänzelt um mich herum, und ich erlaube ihm, seine vermeintliche Überlegenheit auszuspielen. Anstatt meine Deckung wieder zu schließen, heiße ich seinen Schlag grinsend willkommen. So, wie ich es immer tue. Ich lande stets den ersten Treffer, lasse meinem Gegner für einen Moment die Hoffnung auf einen Sieg, bevor ich ihn dann unversehens k. o. schlage.
Ein angenehmer Schmerz zieht durch meine linke Gesichtshälfte, und für einen kurzen Augenblick schließe ich die Lider und sehe sie. Ihre braungrünen Iriden, die mich taxieren, ihre orangen Haare, die im Wind wehen. Hazel. Ein Schmerz, der mit keinem körperlichen zu vergleichen ist, durchfährt mich. Er lässt mich frösteln, obwohl ich glühe wie Eisen, das im Feuer geschmiedet wird.
Als ich die Augen wieder öffne, holt Iron Fist gerade zu einem Seitwärtshaken aus. Mein Atem kommt in schnellen, rhythmischen Stößen. Geschickt weiche ich ihm aus. Schweiß rinnt meinen tätowierten Rücken hinab. Das ist mein dritter Kampf an diesem Abend, doch ich bin nicht müde. Will immer mehr, mehr, mehr. Mehr Schmerz. Mehr Wut. Mehr Betäubung.
Es ist zwei Wochen her, dass ich Hazel in Ferley gesehen habe. Mittlerweile glaube ich fast, dass ich sie mir nur eingebildet habe. Doch ich weiß, dass sie es war. Ich würde sie immer wiedererkennen. Unter Tausenden von Menschen. Auch nach drei Jahren noch.
Plötzlich trifft mich Iron Fist mit brachialer Wucht im Gesicht. Schmerz zuckt durch meine Nervenbahnen, und ein metallischer Geschmack breitet sich in meinem Mund aus. Ich taumle nach hinten, und die Menge hält den Atem an. Fuck. Ich war unkonzentriert. Ich bin unkonzentriert. Weil sie meine Gedanken beherrscht. Nach all der Zeit vernebelt Hazel noch immer mein Hirn, und ich hasse es.
Mit einem präzisen Doppelpunch attackiert Iron Fist meine linke Flanke, als wisse er ganz genau, dass ich mir dort vor einigen Tagen eine Verletzung zugezogen habe. Verdammt. Ein höllisches Ziehen breitet sich in meiner Seite aus und lässt mich zu Boden gehen. Ich spüre die kalten Fliesen unter mir, während der Ringrichter langsam die Sekunden zählt.
Eins. Zwei. Drei. Vier.
Mein Atem geht flach.
Fünf.
Der Schmerz schickt brennende Wellen durch meinen Körper.
Sechs.
Die Zuschauer rasten vollkommen aus.
Sieben.
Meine Muskeln zittern. Weigern sich, mich aufzurichten.
Acht.
Der Geschmack von Blut klebt an meinen Lippen.
Neun.
Selbst wenn ich aufstehen könnte, ich möchte nicht.
Zehn.
Die Menge scheint den Atem anzuhalten, während der Ringrichter das Urteil fällt.
Der Kampf ist vorbei. Ich habe verloren. Und in diesem Moment erkenne ich, dass Iron Fist seinen Namen wohl doch verdient hat. Und dass Hazel mich mal wieder in die Knie gezwungen hat.
Nur mit großer Mühe bekomme ich die massive Metalltür aufgeschoben. Sofort begrüßt mich das warme Licht, das durch die riesigen, vergitterten Fenster scheint und geometrische Muster auf den glatten Betonboden malt. Die hohen Decken lassen das Loft noch weitläufiger erscheinen, während sich an den Wänden eine Reihe von Holzregalen emporstreckt, in denen sich seit meiner freiwilligen Arbeit im Moore’s Bookparadise unzählige Bücher angehäuft haben.
Wie ein mächtiger Schatten kommt Loki schwanzwedelnd angetapst. Sein schwarzes und braunes Fell glänzt in der Abendsonne. Ich knie mich zu ihm auf den Boden. Fuck, mir tut alles weh. Die Unterlippe ist aufgeplatzt, meine Rippen sind mit großer Wahrscheinlichkeit geprellt, und mein Kiefer hat heute auch einiges abbekommen. Doch ich verdränge den Schmerz und streiche Loki über den Kopf.
»Na, mein Großer. Hast du auf mich gewartet?«
Loki antwortet mir mit einem zufriedenen Schnauben, und der Blick, mit dem er mich aus seinen dunklen Augen bedenkt, erwärmt mein unterkühltes Herz.
Vor drei Monaten war ich zusammen mit Elijah auf einem Kurztrip in New York. Elijah lag mir tagelang in den Ohren, dass er niemanden hat, der die Kunstmesse mit ihm besucht, und irgendwann habe ich mich erbarmt. Dort sind wir dann in einer Seitenstraße einem Mann begegnet, der … Ich mag gar nicht daran denken, und doch habe ich die Bilder sofort vor Augen. Wie dieser elende Wichser eine Bierflasche nach seinem Hund wirft. Elijah und ich sind sofort eingeschritten und haben uns schützend vor den wimmernden Rottweiler gestellt und mit der Polizei gedroht, bis der Mann abgehauen ist und uns ein »Ihr könnt den dreckigen Köter behalten« hinterhergerufen hat. Und das haben wir dann auch getan. Seitdem ist Loki abwechselnd bei mir und bei Elijah.
Auch wenn er doppelt so groß ist wie Dexter, erinnert mich Loki an den Hund, den mir meine Erzeuger vor über einem Jahrzehnt zunächst widerwillig geschenkt und dann wieder weggenommen haben. Tag und Nacht habe ich mit Dexter verbracht, bis mein Alter ihn einfach verkauft hat. Wenn ich nun in Lokis braune Knopfaugen blicke, frage ich mich manchmal, wie es Dexter danach wohl ergangen ist.
»Lass mich kurz duschen. Dann gehen wir eine große Runde, versprochen.« Ich bücke mich nach seinem Lieblingsspielzeug und werfe die pinke Gans quer durch das Loft. Er rennt bis in die offene Küche, um kurz darauf das Kuscheltier im Maul wild hin und her zu schleudern. Über ihm erstreckt sich die Loftgalerie mit meinem Schlafzimmer, von der ein minimalistisches Geländer aus schwarzem Stahl und eine schmale Treppe mit Holzstufen herabführen.
Als ich mich wieder aufrichte, klebt das schwarze T-Shirt eng an meinem Oberkörper. Ich ziehe es langsam über meinen Kopf, bedacht darauf, die Rippen nicht zu beanspruchen. Kühle Luft trifft meine Haut, ein willkommener Kontrast zu der Hitze, die sich seit den Kämpfen in meinen Muskeln eingenistet hat.
Kaum landet das Stück Stoff auf dem grauen Betonboden, klingelt es an der Tür, und Loki kommt bellend angerannt.
»Schon gut, Großer«, beruhige ich ihn und zeige auf sein Körbchen. Sofort entspannt er sich und lässt sich darauf nieder, während ich zur Tür gehe und sie öffne.
»Hast du eine Frau erwartet?« Elijah deutet mit hochgezogenen Augenbrauen auf meinen nackten Oberkörper und drängt sich an mir vorbei. Für ihn galt schon immer das Prinzip: Mein Zuhause ist auch dein Zuhause. Zumindest seit ich aus meinem Elternhaus und in dieses Loft in einer alten Lagerhalle gezogen bin.
Elijah streichelt Loki den breiten Rücken, bevor sich beide fast zeitgleich auf die Ecke der ausladenden grauen Sofalandschaft schmeißen. Unter ihnen ein schwarzer Teppich, auf dem Lokis Spielzeuge verstreut liegen.
»Ich wollte gerade unter die Dusche«, erkläre ich meinem Kumpel und schiebe die Hände in die Taschen meiner Jeans.
»Tu dir keinen Zwang an. Ich habe Zeit.« Er rümpft die Nase. »Ehrlich gesagt bevorzuge ich auch ohnehin den frischen Damian anstatt den von Schweiß und Blut befleckten. Du siehst echt … scheiße aus.«
»Ich komme vom Boxen.«
»Was du nicht sagst. Da wäre ich niemals draufgekommen.« Er fährt sich durch das dunkle Haar. »Du warst wieder nicht bei den Vorlesungen.«
»Gut erkannt, Sherlock.« Ich lehne mich gegen die kühle Betonwand und verschränke die Arme vor der Brust. »Wenn du gekommen bist, um mir eine Moralpredigt zu halten, kannst du direkt wieder verschwinden.«
Elijah lässt seine braunen Augen von meiner aufgeplatzten Lippe bis hinunter zu den blauen Flecken an meinen Rippen gleiten. Von meinen Freunden ist Elijah der einzige, der von den illegalen Boxkämpfen weiß. Er hat mir versprochen, dieses Geheimnis für sich zu bewahren, doch in den letzten Wochen ist er immer mehr zum Aufpasser mutiert, und seine angespannte Miene verrät mir, dass er eine Rede schwingen wird in fünf … vier … drei … zwei … eins …
»Das kann so nicht weitergehen, Damian. Es ist noch nicht zu spät, um deinen Antrag auf Exmatrikulation zurückzuziehen. Wenn du Glück hast, dann wurde er noch nicht einmal bearbeitet, und du kannst …«
»Elijah. Ich weiß deine mütterliche Fürsorge zu schätzen, aber mir ist der Master … nein, mir ist dieses ganze Studium ehrlich gesagt scheißegal.« Ein kurzes Lachen entweicht mir. »Ich werde das Formular nicht zurückziehen.«
»Hör zu, ich verstehe, dass du gerade eine Phase durchmachst, in der du dich finden willst, deinen Platz im Universum, bla, bla, bla. Vor allem, wenn man bedenkt, was die letzten Jahre bei dir los war. Hazels Verschwinden. Die Verhaftung deines Dads. Ares‘ Tod. Summer verlässt die Stadt. Aber das, was du gerade abziehst, ist keine Entdeckungsreise, sondern eine Odyssee ins Verderben.«
»Wow, so etwas Poetisches hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ich dachte, Fynn sei derjenige von euch zwei Brüdern, der Philosophie studiert«, kommentiere ich trocken und setze mich auf das Sofa. »Vielleicht solltest du über eine Karriere als Ratgeber-Autor nachdenken.«
Loki, der bis eben ruhig auf der Couch gelegen hat, hebt den Kopf und wirft mir einen Blick zu, der beinahe so vorwurfsvoll ist wie der von Elijah.
»Damian, du kannst nach deinem Masterabschluss immer noch den Rebellen spielen, auf Underdog machen und deinen Lebensunterhalt mit den illegalen Boxkämpfen verdienen. Aber bitte, bitte bring das Studium zu Ende. Dann hast du wenigstens was in der Hand. Es kann doch nicht sein, dass du all die Jahre umsonst studiert hast.«
»Es war nicht umsonst. Immerhin kann ich mich jetzt Bachelor of Science in Business Administration schimpfen. Vor allem solltest du nicht so große Töne spucken, du hast doch selbst im Boxring gekämpft, nachdem dein Ex dich dort mit hingeschleppt hat, und das war nicht weniger illegal als das, was ich mache.« Loki stampft mit seinen fünfzig Kilo über Elijahs Oberschenkel und lässt sich zwischen uns beiden nieder, als würde er Angst haben, wir könnten uns ernsthaft streiten. Sein Kopf ruht auf meinem Bein, und sein Schwanz wedelt über Elijahs Schoß.
»Der Unterschied zwischen dir und mir ist aber, dass ich vor dem Boxen zur Uni gegangen bin und auch danach für sie gelernt habe. Du hingegen machst nichts anderes mehr als kämpfen, und wenn du nicht aufpasst, verlierst du alles.«
»Was habe ich schon noch zu verlieren? Mein Dad sitzt wegen zweifachen Mordes im Knast, wo ich ihn eigens hingebracht habe – und ich bereue es keine Sekunde. Meine Mom hofft inständig, dass ich die Firma übernehme und in Dads Fußstapfen trete. Meine beste Freundin ist auf der anderen Seite der Erde, weil sie die Liebe ihres Lebens an einen beschissenen Hirntumor verloren hat und …« Ich spreche nicht weiter, weil ich ihren Namen nicht erwähnen will. Weil ich ihr diesen Raum in meinem Leben nicht zugestehen will.
Er zögert einen Moment, dann sagt Elijah leise: »Du hast dich zu verlieren. Dein Potenzial. Deine Zukunft. Mann, Damian, du bist so verdammt klug. Es wäre ein echter Verlust, wenn du dein Talent im Umgang mit Zahlen und Statistiken nicht nutzen würdest.«
»Was, wenn mir das alles einfach nichts bedeutet? Was, wenn ein solcher Beruf einfach nicht mein Ding ist?«
Elijah seufzt tief. »Dann schließe wenigstens das Studium ab. Danach kannst du immer noch entscheiden, welchen Weg du gehen willst. Alter. Meinetwegen schreibe ich dir deine Masterarbeit.«
Ich werde hellhörig. »Das klingt nach einem verlockenden Angebot.«
»Bitte nimm es nicht wortwörtlich.« Elijah lacht.
»Meine Entscheidung steht. Sorry, wenn ich dich damit enttäusche, aber ich werde keinen Fuß mehr in die Fox University setzen, außer ich besuche euch auf dem Campus oder habe Lust auf einen Burrito aus dem Elios.«
Kapitel 2
Es wird das letzte Mal sein, dass ich diese eiskalte Villa betrete. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin und das so viel Schmerz für mich bereithielt, dass ich eine Gänsehaut bekomme, als ich einen Fuß über die Türschwelle setze.
Lola trägt ihre rote Kochschürze, während sie mich breit grinsend in ihre Arme zieht. Sie ist der einzig liebevolle Mensch in diesen vier Wänden und die Person, die für mich einer echten Mutter am nächsten kam.
»Mrs. Cunningham erwartet dich im Wintergarten.« Sie lässt mich los und sieht mich mit einem bemitleidenden Ausdruck an. Ihre Stirn liegt in tiefen Falten, die Lippen sind zu einem geraden Strich verzogen. Ihre Haare sind mittlerweile vollständig ergraut, und ich wünschte mir, sie würde den Job in dieser Hölle an den Nagel hängen und irgendwo, weit weg von hier, glücklich werden.
Selbst Lola würde es niemals wagen, meine Mutter beim Vornamen zu nennen. Ich kenne niemanden, der keine Angst vor Adalina Cunningham hat. Sie ist nicht nur die rechte Hand meines Vaters, sie ist zugleich auch noch die wohlhabendste Frau in Ferley und Umgebung. Jeder zollt ihr Respekt, obwohl sie keinen verdient hat.
Ich gebe Lola einen Kuss auf den Haaransatz, bevor ich den Flur entlanglaufe. Die Wände sind übersät mit teuren Gemälden, darunter reihen sich antike Möbel, die keinen anderen Zweck erfüllen, als den Reichtum meiner Erzeuger zur Schau zu stellen. Dieser Protz ist so widerwärtig. Erst recht, seitdem ich weiß, mit welch korrupten Methoden mein Alter an all das Geld gekommen ist. Ich will gar nicht wissen, wie viele Menschenleben er noch auf dem Gewissen hat.
Jeder Schritt erinnert mich an die kalten, lieblosen Jahre meiner Kindheit und Jugend. Gott, wie sehr ich es hier hasse. Der Geruch von poliertem Holz und schwerem Parfüm hängt in der Luft.
»Nichts bekommst du hin.« Die Stimme meiner Mutter trieft nur so vor Verachtung, nachdem ich meine erste schlechte Note aus der Schule mit nach Hause gebracht habe. »Geh! Dein Vater wartet auf dich!« Ich will nicht. Doch ich weiß, wenn ich ihren Worten nicht Folge leiste, wird er kommen und mich holen. Er wird mich am Kragen meines T-Shirts packen und mich über den Marmorboden bis hoch in sein Arbeitszimmer schleifen. Also gehe ich freiwillig. Bei jeder Treppenstufe, die ich nach oben nehme, erzittere ich unter dem Fausthieb, der mich gleich erwartet.
Mir wird schlecht. Die Erinnerungen sind in diesem Haus so greifbar, dass ich mich auf der Stelle übergeben könnte.
Der Wintergarten vor mir ist ein groteskes Paradebeispiel für den überzogenen Protz meiner Eltern. Überdimensionale Fenster geben den Blick frei auf makellos gepflegte Gärten. Kristallgläser hängen von der goldenen Decke herab, und in der Mitte glitzert und leuchtet ein mit Diamanten besetzter Kronleuchter in der Nachmittagssonne. Ein riesiger Kamin aus weißem Marmor dominiert eine Seite, während eine Sitzlandschaft im Barockstil den Raum füllt.
Adalina Cunningham steht mit dem Rücken zu mir. Kurz glaube ich, dass sie aus dem Fenster guckt und den Ausblick genießt. Bei dem Gedanken beginne ich beinahe zu lachen. Natürlich tippt sie auf ihrem Handy herum. Ihr glänzend schwarzes Haar ist zu einer perfekten Hochsteckfrisur gebunden. Sie trägt ein dunkles, maßgeschneidertes Kleid, das ihre schlanke Figur betont. Selbst von hinten strahlt sie so viel Autorität und Kälte aus, dass mich ein Schaudern durchfährt.
»Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du deine Mutter nicht bei der Arbeit stören sollst!«, brüllt Dad mich an, als er die Tür zu seinem Arbeitszimmer verschließt. »Sie hat mich gebeten, dir Manieren beizubringen.«
Mit schweren Schritten kommt er auf mich zu. Ich bewege mich rückwärts, stoße mit dem Rücken an seinen Schreibtisch. Heute habe ich gesehen, wie ein Kind von seinen Eltern aus der Schule abgeholt wurde. Wie beide den Jungen liebevoll in den Arm genommen haben. Der Vater hat ihn hochgehoben und lachend ins Auto getragen. Sie sahen so glücklich aus. Wie die Familien im Fernsehen. So anders als wir.
Dad hebt seinen Arm, und mit einem zischenden Geräusch landet seine flache Hand auf meiner Wange. Tränen verschleiern meine Sicht, und kurz wird mir schwarz vor Augen. Der Schlag kam so schnell und stark, dass ich das Gleichgewicht verliere und auf meine Knie sacke. Doch das reicht Dad nicht. Er brüllt und brüllt und brüllt. Und schlägt zu, schlägt zu, schlägt zu.
Ich schüttle die dunkle Vergangenheit ab. Lasse den ängstlichen, kleinen Damian hinter mir. Ich habe schon lange beschlossen, nicht mehr er zu sein. Also betrete ich mit gestrafften Schultern und erhobenem Kinn den Raum. Meine Schuhe erzeugen ein leises Echo auf dem glänzenden Marmorboden.
Sie merkt sofort, dass ich da bin, hebt ihre Hand, ohne sich zu mir umzudrehen. »Moment! Das ist wichtig!«
»Meine Zeit ist ebenfalls wichtig. Und da ich nicht viel davon mitgebracht habe, kannst du dir aussuchen, ob ich wieder gehe oder du dir Zeit für mich verschaffst.« Ich verschränke die Arme vor der Brust und lehne mich seitlich an die Wand oder besser gesagt an irgendein unglaublich hässliches Gemälde.
»Was fällt dir …« Sie dreht sich um. Ihre grünen Augen funkeln mich böse an, bis sie sie voller Entsetzen aufreißt. »Bist du von allen guten Geistern verlassen? Das kostet ein Vermögen!«
Unwissenheit vortäuschend stoße ich mich mit voller Kraft von dem Bild ab und deute mit einem Kopfnicken neben mich. »Dieses hässliche Ding?«
»Damian!« Mit einem lauten Knall haut sie ihr Smartphone auf eine verschnörkelte Kommode. Immerhin habe ich jetzt ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Dabei war sie diejenige, die mich hierherzitiert hat. »Setz dich«, fordert sie mich auf, als wäre ich ein unartiger Schüler, der gerade zum Nachsitzen verdonnert wurde.
Ich tue, wie mir geheißen, und lasse mich auf einen der opulenten Sessel fallen. Der samtige Stoff fühlt sich kratzig unter meinen Händen an.
»Du bist ein Niemand! Ein Versager! Ein Nichtsnutz!« Dads Finger haben sich fest in meine Haare gekrallt, während er meine linke Gesichtshälfte gegen das Sofa in unserem Wintergarten drückt. Angst schnürt mir den Hals zu. Mom steht am Fenster. Ihr Blick starr auf uns gerichtet. Sie hört mich wimmern. Sie hört mich weinen. Sie hört mich flehen. Sie hört mich brechen … Doch sie tut nichts. Sie starrt mich einfach nur an, während Dad seinen Gürtel aus seiner Anzughose zieht und ihn immer und immer wieder auf meinen entblößten Rücken peitschen lässt.
»Was willst du von mir? Wieso bin ich hier?«, frage ich und beiße die Zähne so fest aufeinander, dass mein Kiefer mahlt.
Meine Erzeugerin setzt sich, schlägt die Beine übereinander und wippt mit ihrem Fuß in der Luft auf und ab. Das Rot ihrer Schuhsohle blitzt immer wieder auf. »Es gibt etwas, das du wissen musst. Etwas, das deine Zukunft und die unserer Familie betrifft.«
»Unserer …« Ich lache bitter auf und sehe sie mit erhobener Augenbraue an. »… Familie? Welcher Familie bitte?«
»Stell dich nicht so dumm!«, faucht sie, und ich bin mir sicher, wäre ihre Stirn nicht voller Botox, würde sie sie jetzt runzeln.
»Raus mit der Sprache. Was willst du, Adalina?«
Sie hasst es, wenn ich sie bei ihrem Vornamen nenne, und ich genieße den kleinen Triumph.
Ein verächtlicher Laut verlässt ihre Lippen. »Du weißt, dass dein Vater im Gefängnis sitzt.«
»Ja, das ist mir nicht entgangen. Ich habe zu einem großen Teil dazu beigetragen.« Ich betrachte die silbernen Ringe an meinen Fingern und gebe mich so teilnahmslos wie nur möglich. Sie soll meine Verachtung in jeder Faser meines Körpers zu spüren bekommen.
Anstatt auf meine Worte einzugehen, verdrängt sie diese wie immer und redet einfach weiter. In ihrer Welt war es nicht ihr eigener Sohn, der mithilfe seiner Freunde seinen Vater hinter Gitter gebracht hat. »Cunningham Constructions steht auf dem Spiel, Damian. Ohne eine starke Führung drohen die Firmenteilhaber, das Ruder zu übernehmen und sich gegen die Familie zu verschwören. Sie fordern Stabilität und Kontinuität, auch in diesen schweren Zeiten. Wir sind alle davon überzeugt, dass dein Vater früher als gedacht wieder freikommt. Doch bis dahin bist du der Einzige, der in seine Fußstapfen treten kann.«
Lauter als beabsichtigt beginne ich zu lachen. Ich halte mir die Hand an den Bauch und brauche einige Sekunden, um mich wieder einzukriegen. Schon vor Dads Verhaftung habe ich mehr als einmal deutlich gemacht, dass mich diese Firma einen Scheißdreck interessiert und ich sie niemals übernehmen werde. Sie konnten mich schon damals nicht dazu zwingen, dort zu arbeiten, und heute können sie es noch viel weniger.
Ich räuspere mich, bevor ich spreche. »Nenn mir einen guten Grund, wieso ich das tun sollte.«
»Weil es deine Pflicht als Cunningham ist. Dein Vater hat Fehler gemacht, aber die Firma ist unser Erbe. Ich werde nicht tatenlos dabei zusehen, wie sie in die Hände von irgendeinem alten Sack gelangt.«
»Meine Pflicht? Ich werde keinen Fuß in diese Firma setzen, Adalina.«
»Du hast keine andere Wahl«, antwortet sie schlicht, als würde sie ihren eigenen Worten glauben. »Wenn du nicht einsteigst, werden die Vorstandsmitglieder uns zerstören. Sie werden sich die Firma unter den Nagel reißen, und alles, was dein Vater für uns aufgebaut hat, wird in sich zusammenfallen.«
Ich spüre, wie Wut in mir aufsteigt, doch ich halte sie in Schach. Dieser Frau zu zeigen, was ihre Dreistigkeit in mir auslöst, ist das Letzte, was ich will. Alles, was sie von mir verdient hat, ist vollkommene Gleichgültigkeit.
»Du wirst die Rolle des Geschäftsführers übernehmen. Es gibt bereits ein Team, das dich unterstützen wird. Du musst nur präsent sein, das Gesicht der Firma werden. Den Rest übernehme ich hinter verschlossenen Türen. Zeig den Teilhabern, dass die Cunningham-Familie auch ohne ihr Oberhaupt stark ist und alles unter Kontrolle hat.«
»Und wenn ich das nicht tue?«, frage ich leise, die Drohung schwingt in meiner Stimme mit.
Ihre Augen, die meinen so sehr ähneln, verengen sich. »Dann riskierst du, dass alles, was dein Vater für uns getan hat, umsonst war. Und glaub mir, Damian, das willst du nicht erleben.«
Ich schließe die Lider und atme tief durch. »Also, verstehe ich das richtig, ich soll die Firma übernehmen und mich wie eine Marionette von dir lenken lassen?«
»Genau!« Sie klingt, als hätte sie ernsthaft die Hoffnung, dass ich diesem absurden Vorschlag zustimme.
»Du glaubst wirklich, dass ich euch – dass ich Dad und dieser Firma, die der Grund für den Tod von Summers Eltern ist – helfen werde?«
Durch die geöffneten Flügeltüren dringt das Kreischen der Möwen und das Rauschen des Meeres. Dieser Ort könnte traumhaft, beinahe magisch sein, und doch ist er nichts weiter als ein Hexenhaus, getarnt durch Glas, Glanz und Protz.
»Hör auf, dich wie ein trotziges Kind zu benehmen«, zischt sie, und kleine Spucketropfen fliegen mir entgegen. Es ist selten, dass sie die Beherrschung verliert. »Du bist alt genug, um zu wissen, worauf es im Leben ankommt. Ohne Macht bist du wertlos. Und ohne unser Geld bist du ein Niemand.«
Ich lehne mich vor, stütze meine Ellbogen auf meine Knie, sehe ihr direkt in die kalten Augen. »Ich scheiß auf euer Geld. Nehmt mir alles weg, enterbt mich, es ist mir so was von egal. Dieses Geld ist mit Blut besudelt, und ihr solltet euch schämen und um Vergebung betteln, anstatt Pläne zu schmieden, wie ihr euer Gesicht weiterhin wahren könnt. Aber was habe ich anderes von euch erwartet?«
Adalina springt auf, ihre Augen funkeln vor Zorn. »Du wagst es, so mit mir zu reden?«
Ich erhebe mich ebenfalls, schiebe meine Hände lässig in die Taschen meiner Jeans. »Oh ja, das tue ich. Und noch etwas …« Ich mache einen Schritt auf sie zu und flüstere: »Cunningham Constructions kann zur Hölle fahren. Ich werde mit Vergnügen dabei zusehen, wie es zugrunde geht.«
Ohne auf eine Erwiderung von ihr zu warten, drehe ich mich um.
»Das wirst du bereuen, Damian!«
»Ihr seid diejenigen, die einiges zu bereuen haben«, sage ich und gehe.
Kapitel 3
Endloses, tiefschwarzes Meer breitet sich vor mir aus. Auf stürmischen Wellen reite ich, angetrieben von einem Kite, durch die Dunkelheit. Silbern glänzt der Mond am Himmel und malt schimmernde Reflexionen auf die Wasseroberfläche, wodurch ich zumindest schemenhaft meinen Kurs erkennen kann. Der Wind bläst mir Meeresluft ins Gesicht und lässt meine langen Haare wild umhertanzen. Ich atme tief durch, fülle meine Lungen mit der Frische des Ozeans und lasse den Geschmack von Salz auf meiner Zunge zergehen.
Die kalte Gischt peitscht gegen meine Haut. Geschickt bewege ich mich von Welle zu Welle. Ich balanciere, lenke, ziehe und drücke. Mein Board gleitet, hebt für einen Moment ab und landet wieder, während der Kite hoch oben im Wind tänzelt. Es ist beinahe so, als hätte ich nie etwas anderes gemacht. Als wäre es wie Fahrradfahren. Einmal erlernt, vergisst man nie, wie es geht – egal, wie lang man es nicht mehr getan hat.
Kurz schließe ich die Augen, und einen Wimpernschlag später sehe ich Summer neben mir. Wie sie an meiner Seite mühelos über das Wasser fegt, ihr lachendes Gesicht, ihre fließenden Bewegungen. Sie war es, die mir zeigte, wie man die Schlaufen richtig einstellt, wie man den Kite lenkt und das Board kontrolliert. Das Meer war ihr ganz persönlicher Spielplatz. Jeder Moment, den wir hier am Ferley Beach verbracht haben, hat sich tief in mein Gedächtnis gebrannt und hinterlässt dort nun eine heiße, schwelende Glut.
Ich verringere den Bar-Druck und ziehe den Schirm langsam herunter. Er verliert an Höhe, und ich steuere das Board mit meinen Füßen aktiv in Richtung Strand.
Wasser läuft an mir hinunter, als ich mit der Ausrüstung unter dem Arm in Richtung Kitesurfschule hinaufstapfe. Schon damals hat Mike einen Ersatzschlüssel in einem der Blumenkübel versteckt. Und so schleiche ich mich seit geraumer Zeit nachts immer wieder hier rein, leihe mir die Ausrüstung, da mir für eine eigene das Geld fehlt, und bringe danach alles wieder fein säuberlich zurück – als wäre nie etwas gewesen, als wäre ich nie da gewesen.
Die Tür öffnet sich knarrend. Es riecht nach Neopren, Surfwachs und Holz. Sorgfältig hänge ich meinen Kite an einen der Haken an der Wand, stelle das Board in den Ständer und rolle die Leinen sauber auf. Alles hat hier seinen Platz, und ich kenne jeden Winkel. Es fühlt sich an, als wäre ich nie weg gewesen, und doch ist es so anders. Weil ich anders bin, weil ich mich verändert habe.
Ohne mich abzuduschen, schlüpfe ich in meine Jeans, den alten dunkelblauen Hoodie mit dem verblassten Aufdruck der New York Yankees und meine Chucks. Gerade als ich die Kitesurfschule wieder verlassen möchte, verharre ich einen Augenblick vor dem Spiegel. Es kommt nicht mehr oft vor, dass ich sie in meinem Spiegelbild sehe. Doch in diesem Moment kann ich nicht leugnen, dass ich ihre Tochter bin. Die Tochter der wohl bekanntesten Drogensüchtigen Ferleys: Amanda Moore. Das orangefarbene Haar, das mir nass in meinem sommersprossigen Gesicht klebt, so wie ihres immer fettig an ihr hinunterhing. Hellbraune Augen, die im Licht grün wirken. Volle Lippen, die mich an jedes beleidigende Wort von ihr erinnern.
»Du wirst wie ich einsam und kaputt in der Gosse landen.«
»Ich hasse es, dich geboren zu haben.«
»Du bist mein größter Fehler.«
Ihre Stimme hallt blechern durch meinen Kopf, bis da das Bild ihrer leeren Augen erscheint. Ihre trockenen, aufgerissenen Lippen, aus denen Blut zu Boden fließt. Das, was sie am meisten geliebt hat, hat sie am Ende zugrunde gerichtet. Denn ich bin mir sicher, dass diese Frau nichts so sehr liebte wie ihre Drogen. Es gab keinen Tag, keine Stunde, keine Sekunde, in der sie in Erwägung gezogen hat, aufzuhören, mir zuliebe, ihrem Dad – meinem Grandpa – zuliebe, ihr selbst zuliebe.
Ich beiße mir auf die Wangeninnenseite, verdränge die Bilder, ihre Stimme, meine Kindheit und verlasse die Kitesurfschule. Alles, was zurückbleibt, ist eine kleine Spur aus Wassertropfen auf dem Holzboden. Doch selbst die wird in Kürze verblassen. So wie alles von mir verblasst. So wie ich verblasse.
00:00 strahlt mir die Uhrzeit auf meinem Handy entgegen. Ein altes iPhone, das seine besten Tage bereits hinter sich hat. Es hängt sich dauernd auf, der Akku hält schon lange keine zwölf Stunden mehr, und quer über das Display verläuft ein Riss, der mir das Lesen von Nachrichten erschwert.
Meersalz klebt an meiner Haut, das Adrenalin nach dem Kiten schießt noch immer durch meine Adern.
Die alten Gebäude der Stadt mit ihren pastellfarbenen Fassaden und schmiedeeisernen Balkonen stehen still und verlassen da. Die Laternen werfen Schatten an die Wände, und alles, was ich höre, ist der sanfte Wind, der durch die Straßen zieht und die Palmen rauschen lässt. Ich ziehe meinen Hoodie enger um mich und atme tief durch. Wäre ich um diese Uhrzeit allein in Boston unterwegs, würde ich die Beine in die Hand nehmen und nicht ansatzweise so entspannt sein wie jetzt. Doch hier in Ferley fühle ich mich selbst sonntagnachts sicher.
Ich erreiche den leeren Marktplatz, auf dem tagsüber das Leben pulsiert. Der Brunnen in der Mitte plätschert leise vor sich hin, und ich setze mich auf eine der Bänke, lasse meinen Blick über die alten Ziegelbauten schweifen, vorbei an der historischen Kirche, deren Turm emporragt, als wolle er den Sternen näher sein.
Ich liebe diese Ruhe, dieses Gefühl, als gehöre die Stadt mir allein. Seit ich vor gut vier Wochen zurückgekommen bin, vermeide ich es, tagsüber rauszugehen. Zu groß ist die Angst, jemandem zu begegnen, den ich kenne. Jemandem erklären zu müssen, wieso ich wortlos aus Ferley abgehauen und plötzlich wieder zurück bin, wieso ich Menschen verletzt und hinter mir gelassen habe. Zu groß ist die Angst, ihm gegenüberzustehen. Schon wieder.
Mein Herz zieht sich zusammen, als ich an den Moment denke, in dem sich unsere Blicke trafen. Die tiefschwarzen und vom Wind zerzausten Haare, die ausdrucksstarken grünen Augen, die selbst aus der Entfernung zu funkeln schienen, haben sich tief in meine Erinnerung gebrannt. Dazu diese markanten Gesichtszüge, diese Mischung aus Schock und Wut, die sich darin widergespiegelt hat. Ich dachte, ich würde sterben, weil das verräterische Ding in meiner Brust plötzlich aufgehört hat zu schlagen. Einfach so. Als hätte es vergessen, wozu es da ist.
Damian zu sehen hat all die Gefühle in mir aufgewirbelt, die ich über drei Jahre unter Verschluss gehalten habe, um zu überleben, um nicht daran kaputtzugehen, was ich den Menschen angetan habe, die ich am meisten liebe.
Ein raschelndes Geräusch reißt mich zurück in die Gegenwart. Ruckartig drehe ich mich um, schaue in Richtung der Büsche hinter mir. Mein Puls beschleunigt sich, und ein mulmiges Gefühl macht sich in meiner Magengegend breit. Beinahe bereue ich es, mich bis eben noch so sicher gefühlt zu haben.
Plötzlich bricht ein imposanter Umriss aus dem Dunkeln hervor. Ein großer Hund, dessen Fell im schwachen Licht der Straßenlaterne glänzt. Er wedelt freudig mit dem Schwanz, seine tiefbraunen Augen leuchten vor Aufregung. Ich bin mir nicht sicher, ob er mich als Spielbuddy oder Leckerli sieht.
Mit gerunzelter Stirn drehe ich mich einmal im Kreis, um Ausschau nach dem Besitzer oder der Besitzerin zu halten, doch noch immer ist weit und breit niemand zu sehen.
Langsam gehe ich in die Hocke. »Na du. Wo kommst du denn her?«
Auch wenn ich Hunde liebe, behalte ich meine Hände zunächst bei mir, um zu schauen, wie er reagiert. Eine Bisswunde wäre das Letzte, was ich gerade gebrauchen könnte. Direkt vor mir macht er Platz und stupst seine kalte Nase gegen mein Knie. Er schnüffelt einige Sekunden an mir, bis er wieder aufsteht, mit dem Schwanz wedelt und sich an mich schmiegt.
Ein Lächeln stiehlt sich auf meine Lippen. Ich lasse meine Finger über sein weiches Fell gleiten. Er sieht zu gepflegt aus, um auf der Straße zu leben, zumal er auch ein Halsband trägt. Die feinen Haare hinter seinem Ohr kitzeln meine Hand, während ich ihn dort sanft kraule. Ein tiefes, genüssliches Brummen durchbricht die Stille, und ich lache kurz auf.
»Wie lange irrst du denn schon durch die Stadt? Bist du etwa abgehauen?«, frage ich ihn, als würde er mir ernsthaft eine Antwort geben können.
Ein metallisches Glitzern zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. An seinem Halsband baumelt eine Hundemarke in Form einer Pfote. Ich neige meinen Kopf und greife vorsichtig danach. Loki steht dort eingraviert.
»Der Gott der Täuschung also«, wispere ich.
Auf der Rückseite befindet sich eine Telefonnummer. Einen Moment lang zögere ich, ob ich sie anrufen soll oder nicht. Dann ziehe ich jedoch mein Handy aus der Hosentasche, unterdrücke meine Nummer und tippe die Zahlen ein, bevor ich mich wieder erhebe. Meine abgenutzten Chucks knirschen leise auf dem steinernen Marktplatz. Ich wandere umher, in der Hoffnung, dass vielleicht jemand auf der Suche nach Loki ist, währenddessen bleibt er dicht an meiner Seite, als würde er zu mir gehören, als würden wir uns schon ewig kennen und einander vertrauen.
»Bist du etwa auf der Suche nach einem neuen Frauchen? So süß du auch bist, in meiner winzigen Wohnung ist leider kein Platz für dich.«
Als würde Loki diese Nachricht zutiefst traurig machen, jault er kurz auf.
»Hast du es so schlecht zu Hause, dass du meine Bruchbude bevorzugen würdest?«, frage ich und streichle ihm über den Kopf.
Ich werfe einen Blick auf mein Handydisplay, auf dem die Telefonnummer prangt. Ein nervöses Kribbeln steigt in mir auf, als ich auf das grüne Symbol drücke. Es ist nach Mitternacht. Nicht unbedingt die Uhrzeit, zu der man wildfremde Menschen anruft. Doch wem auch immer der Hund gehört, sie oder er wird ja wohl auf der Suche nach ihm sein und nicht friedlich im Bett liegen.
Sekunden vergehen, in denen ich nichts höre als das Tuten am anderen Ende der Leitung. Bis ein entferntes Echo von Schritten durch die nächtliche Stille hallt. Ein beklemmendes Gefühl breitet sich in mir aus. Im selben Moment, in dem ein Ton durch das Telefon zu mir dringt, höre ich dieselbe Stimme leise hinter mir. Sie ist rau, vertraut und löst eine Flut von Erinnerungen aus. Eine Stimme, die ich selbst inmitten eines Ozeans aus Stimmen immer wiedererkennen würde.
»Hallo?«, sagt er zum dritten Mal und ist plötzlich ganz nah. Viel zu nah. »Wer ist da?«
Das Herz schlägt mir bis zum Hals. Langsam drehe ich mich um. Sekunden vergehen. Alles spielt sich in Zeitlupe ab. Wie ich mein Handy vom Ohr nehme. Den Arm sinken lasse. Loki mich ein letztes Mal anstupst, bevor er zu seinem Besitzer stürmt. Meine Brust sich hebt und senkt. Meine Lider sich schließen, während ich kurz überlege, einfach zu rennen. So weit, wie meine Beine mich tragen.
Doch stattdessen öffne ich die Augen und …
Direkt unter dem schwachen Lichtschein einer Laterne steht Damian. Seine grünen Augen treffen meine. Der Moment ist aufgeladen mit einer Intensität, die Worte überflüssig macht. Alles, was zwischen uns passiert ist, alles, was wir gefühlt haben, und alles, was ich ihm genommen habe, scheint sich in diesem einen Blick zu bündeln.
Wenn mich jemand fragen würde, wie es aussieht, wenn aus Liebe Hass wird, dann würde ich der Person genau diesen Ausdruck in Damians Gesicht zeigen.
Kapitel 4
»Was …« Meine Stimme bricht.
Vielleicht sehe ich nicht richtig. Vielleicht habe ich zu viel getrunken. Vielleicht träume ich. Ein wunderschöner, bittersüßer Albtraum, der mein Herz zum Rasen bringt. Mich in einer Schockstarre gefangen hält.
Mit einem Mal ist es so kalt, dass eine Gänsehaut meinen Körper überläuft. Die Laternen des Marktplatzes werfen ein fahles Licht auf die Pflastersteine. Hazels Gestalt zeichnet sich scharf gegen die Dunkelheit ab – die dunkle Jeans, die dreckigen Chucks und … mein Hoodie.
Noch immer drücke ich mir das iPhone so fest ans Ohr, als würde ich auf eine Antwort durch das Telefon warten. Oder als wäre es mein Rettungsring, der mich über Wasser hält.
Der Wind weht Hazel das leuchtend orange Haar ins Gesicht, und plötzlich ist sie mir so nah, dass vereinzelte Haarspitzen meine Wangen kitzeln. Hazel riecht nach Meer und Neopren – so wie früher, so wie immer. Und ich weiß nicht, wann ich mich zuletzt so machtlos gefühlt habe.
Ich habe mir diesen Augenblick unzählige Male ausgemalt. Habe mir vorgestellt, wie es sein würde, wenn ich ihr wieder gegenüberstehe. Wie ich reagieren würde. Was ich sagen würde. Habe irgendwann die Hoffnung aufgegeben, dass es jemals so weit kommen wird. Habe geglaubt, sie nie wiederzusehen. Habe mir geschworen, dass ich sie nie wiedersehen will. Doch nachts, allein in meinem Bett gewusst, dass ich mich nur selbst belüge.
Und jetzt steht sie hier. Mit weit aufgerissenen Augen, den vollen Lippen, die sich zögerlich öffnen, und diesen Millionen von Sommersprossen.
So nah vor ihr zu stehen ist anders als vor zwei Wochen. Es ist realer. Schmerzhafter. Es ist der Beweis dafür, dass ich mir die Begegnung nicht nur eingebildet habe. Dass sie wirklich zurück ist. In Ferley. In meiner Stadt. In unserer Stadt. An dem Ort, wo alles zwischen uns begann und ein abruptes Ende fand.
Eine unbändige Wut lodert in mir auf. Eine Flamme, die mich von innen verzehrt, doch bevor sie Überhand gewinnen kann, ersticke ich sie, bis sie nur noch ein schwelendes Glimmen ist. Ich kann hier nicht zusammenbrechen, nicht vor ihr, nicht jetzt. Also bemühe ich mich, eine kühle Miene aufzusetzen.
Jeder Zentimeter meines Gesichts fühlt sich an, als wäre er aus Stein gemeißelt. Ich lockere meine bis eben noch zusammengezogenen Augenbrauen, presse die Lippen zu einer Linie zusammen und beiße die Zähne so fest aufeinander, dass meine Kiefermuskeln schmerzen.
»Damian?« Hazels Flüstern ist so leise, dass es beinahe vom Wind davongetragen wird, und doch schneidet ihre Stimme wie ein Skalpell durch mein Herz.
Loki, der mit ausgestreckter Zunge hechelnd neben Hazels Füßen sitzt, scheint mich mit seinem Blick verhöhnen zu wollen. Nachdem ich ein Glas nach dem anderen im Oliver’s Pub geext habe, bin ich noch eine Runde mit ihm rausgegangen. Alles war ruhig, ich bin keinem einzigen Menschen begegnet, bloß einer Katze. Als Loki sie sah, war es schon zu spät. Er ist ihr mit einer Geschwindigkeit hinterhergesprintet, dass ich mich kurz gefragt habe, ob er ein Gepard im Körper eines stämmigen Rottweilers ist.
Seit einer Stunde schon irre ich durch die Stadt und suche ihn. Dass nun ausgerechnet sie ihn findet … Wieso um alles in der Welt will mich das Schicksal so bestrafen?
Ein empörtes Schnauben entweicht mir und durchbricht die Stille zwischen uns. Ich klopfe mir auf den Oberschenkel, und keine drei Sekunden später sitzt Loki an meiner Seite, anstatt statt dass er … Ich wage es nicht, den Gedanken zu Ende zu führen. Stattdessen begehe ich einen Fehler. Ich hebe den Kopf und schaue ihr direkt in die braungrünen Augen.
Wir sehen uns an, und Sekunden vergehen, werden zu Minuten. In ihrem Blick liegt alles – all der Schmerz, der Verrat, die Lügen, die unausgesprochenen Worte und die verlorenen Jahre.
Und plötzlich möchte ich ihre Hand nehmen. Die Wärme ihrer Haut auf meiner fühlen. Mein Herz schlägt hart gegen meine Brust, und beinahe kommt es mir so vor, als würde es mich dazu auffordern, Hazel an mich zu ziehen. Sie zu umarmen, um zu spüren, dass sie real ist.
Doch ich beherrsche mich, balle die Hände zu Fäusten und drücke meine Füße so fest in den Boden, als wäre ich mit ihm verwurzelt.
»Damian …« Tränen sammeln sich in Hazels Augen, und ich könnte schwören, dass sie mich stumm anfleht, auch ihren Namen zu sagen. Und obwohl er mir auf der Zunge liegt, gebe ich ihr diese Genugtuung nicht. Stattdessen wende ich den Blick ab, löse mich von der Traurigkeit ihrer Augen und beobachte sie dabei, wie sie sich auf die Unterlippe beißt, als müsste sie sich zwingen, den Mund zu halten. Mein Körper reagiert mit einer Hitze auf ihre Nähe, die jeder Vernunft spottet. Die wenigen Zentimeter zwischen uns werden zum letzten Schutzwall meiner Selbstbeherrschung.
Als Hazel langsam ihren Arm hebt und meinem Gesicht damit bedrohlich nah kommt, vergesse ich zu atmen.
»Nicht«, presse ich hervor.
Sie zögert. Hält für einen Moment inne. Ihre Gestalt wirkt zerbrechlich im Mondlicht, ihre Haut so blass, dass ihre Sommersprossen wie verstreute Sterne erscheinen.
Ich glaube fast, dass sie auf mich hört, dass sie die Hand sinken lässt. Doch dann berühren ihre Fingerspitzen meine Wange. Lösen einen Funken aus, der zu einem Feuer entfacht. Mein Universum kollabiert. Und jeder Gedanke an Zurückhaltung verflüchtigt sich wie Rauch im Wind.
Ohne einen weiteren Gedanken, ohne einen Moment des Zögerns, verringere ich die Distanz zwischen uns. Getrieben von einem Verlangen, das seit Ewigkeiten in mir schlummert, packe ich den Saum ihres – meines – Hoodie und ziehe Hazel an mich. Sie atmet erschrocken aus, bevor ich ihr Kinn in meine Hand nehme und mit dem Daumen über ihre Unterlippe streiche.
»Damian.« Es ist nun das dritte Mal, dass Hazel meinen Namen ausspricht, und ich will, dass es das letzte Mal ist, weshalb ich kurz davor bin, meine Lippen auf ihre zu pressen und sie zum Schweigen bringen.
Sie stellt sich auf die Zehenspitzen, ihr Gesicht schwebt gefährlich nah vor meinem, und ich bin mir sicher, dass sie mich jeden Augenblick küssen wird.
Doch Lokis Wimmern durchbricht den Moment.
Und genauso plötzlich, wie die Flamme zwischen uns entzündet wurde, erlöscht sie auch wieder.
Hazel löst sich von mir, ihre Augen weit aufgerissen, ein Ausdruck des Bedauerns auf ihren Zügen. Sie sieht mich an. Atemlos. Ihre Brust hebt und senkt sich so schnell wie meine eigene. Dann, ohne ein Wort, dreht sie sich um und geht davon, ihre Schritte ein gedämpftes Echo in der Nacht.
Zurück bleibt nur das Chaos in meinem Kopf. Liebe, Wut, Schmerz, Hass – alles verschmilzt in diesem einen Moment.
Kapitel 5
Vor 12 Jahren
Das grelle Klingeln der Schulglocke ertönt und beendet den langweiligen Matheunterricht bei Mr. Sanders. Caleb ist der Erste, der aufspringt, nach seinem Rucksack greift und mich mit sich aus dem stickigen Klassenzimmer zieht. Bunte Bilder sollen die grauen Wände des Schulflures freundlicher machen, dabei ist eines hässlicher als das andere.
Mädchen und Jungs im Alter von elf bis vierzehn Jahren hasten lachend oder kreischend an uns vorbei, um Erste in der Schlange der Cafeteria zu sein und nicht mit dem letzten Rest Essen abgespeist zu werden. Dabei schmeckt der Fraß hier grauenhaft. Zum Glück schmiert mir Lola – unsere Haushälterin – jeden Morgen frische Sandwiches. Etwas, das Mom niemals tun würde.
»Hast du die Hausaufgaben in Musik gemacht?« Caleb kramt im Gehen in seinem blauen Rucksack und zieht ein Notenheft hervor. Sein blondes Haar ist mittlerweile so lang, dass er sich einen Zopf machen könnte. Seit zwei Jahren weigert er sich, sie zu schneiden, um wie ein echter Rocker auszusehen. Ich verkneife es mir jedes Mal, ihm zu sagen, dass er damit eher wie ein Märchenprinz aussieht.
»Wir hatten Hausaufgaben auf? Shit.« Entweder war ich geistig nicht anwesend während der letzten Musikstunde, oder ich war tatsächlich nicht da und habe geschwänzt. Von Hausaufgaben habe ich jedenfalls nichts mitbekommen.
»Du kannst froh sein, ein solches Musikass zum Freund zu haben! Darfst von mir abschreiben. Wenn ich dafür morgen Mathe bei dir abschreiben darf.« Er grinst frech und reicht mir sein Musikheft, das ich in meinem Rucksack verstaue. »Ich bin dein Musikass, und du bist mein Matheass. Wir ergänzen uns perfekt.«
Ich verdrehe grinsend die Augen und verdränge den Gedanken an die Aufgaben. Die kann ich auch nachher noch abschreiben, jetzt suche ich lieber … Da ist sie. Ihr oranges Haar mache ich aus hundert Metern Entfernung aus. Hazel, die zwei Jahrgänge unter mir ist, steht an der großen Flügeltür, die zum Schulhof führt, und zieht sich gerade eine Jeansjacke über, bevor sie nach draußen verschwindet.
Obwohl wir in Ferley nie Schnee haben, ist es im Winter trotzdem so kalt, dass eine einfache Jeansjacke ganz sicher nicht ausreicht. Es sollte mir egal sein, ob Hazel Moore friert. Wir sind nicht einmal befreundet. Ganz im Gegenteil. Sie ignoriert mich, wo sie nur kann. Und das schon seit der Grundschule.
Caleb und ich betreten den Schulhof, den Ort, der Freiheit in der Schule am nächsten kommt. Kleine Atemwolken steigen vor unseren Mündern in der kalten Dezemberluft auf. Ich kann mich nicht erinnern, dass es in meinen dreizehn Jahren jemals so kalt im Winter war. Alle tragen dicke Jacken, Mützen, Schals, Handschuhe. Alle außer Hazel, und aus irgendeinem Grund macht es mich wütend. Es ist kein Geheimnis, dass ihre Mutter all ihr Geld für Drogen und Alkohol ausgibt. Und jedes Mal, wenn mir die Gegensätze zwischen ihr und mir vor Augen geführt werden – das Geld, das ich habe und sie nicht –, keimt eine unerklärliche Wut in mir auf. Und doch haben wir eine Sache gemeinsam: Eltern, die sich einen Scheiß für ihre Kinder interessieren.
Hazel steht bei den alten Ahornbäumen am Ende des Hofes, als würde sie Schutz unter den kahlen Ästen suchen. Die Arme eng um ihren Körper geschlungen, blickt sie auf ihre Füße, die in dunklen Sneakern stecken. Doch kein Ort an dieser Schule, nicht der Hof, nicht der Gang vor den Lehrerzimmern und auch nicht die Toiletten bieten ihr Schutz. Und so hat sie sich irgendwann damit abgefunden. Mit den Sprüchen. Dem Rumgeschubse. Den Demütigungen.
»Ich glaube, dieses Mal habe ich wirklich die Richtigen für meine Band gefunden! Komm doch heute zu unserer Probe«, schlägt Caleb vor. Wir kennen uns seit dem Kindergarten, und das Erste, was ich über ihn gelernt habe, ist, dass durch seine Adern Musik zu fließen scheint. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er eines Tages groß rauskommen wird. Und manchmal … Manchmal erwische ich mich dabei, wie ich ihn darum beneide. Nicht, weil ich auch im Rampenlicht stehen möchte. Aber weil er einen Traum hat. Etwas, das ihn durch den Tag bringt, weil irgendwo am Ende des Tunnels dieses Ziel auf ihn wartet.
Ich bin dreizehn fucking Jahre alt und sollte mich mit Videospielen und Skateboardtricks beschäftigen, aber meine Eltern haben es schon früh geschafft, mir einzubläuen, dass man im Leben ein Ziel haben muss. Dass nichts wichtiger ist als Erfolg, Geld und Macht.
»Mal sehen. Ich gebe dir später Bescheid, okay?« Meine Worte gehen in dem tumultartigen Geschrei eines Mitschülers unter, und als ich bemerke, dass sich immer mehr Kinder Hazel nähern, beschleunigen sich meine Schritte wie von selbst.
»Damian. Du handelst dir wieder Ärger ein!«, ruft mir Caleb hinterher, obwohl er genau weiß, dass mir das egal ist.
Sie stehen um sie herum wie Hyänen um ihre Beute. Und Hazel kann mir noch eine Million Mal sagen, dass sie meine Hilfe nicht möchte, ich werde nicht weggucken. Niemals. Mit jedem Schritt, den ich näher komme, spannt sich mein Körper weiter an, und meine Hände ballen sich zu Fäusten. Ich spüre die Hämatome an den Armen, ein stummes Zeugnis der Schläge meines Vaters.
»Muddy Hazel!«, höre ich das Mädchen mit den geflochtenen Zöpfen rufen. Zwei weitere bücken sich, ihre Handschuhe graben sich in die feuchte Erde, um sie dann in Hazels Richtung zu schleudern. Die Matschklumpen verfangen sich in ihren Haaren, tropfen auf ihre Schulter und sickern in den dünnen Jeansstoff.
»Hast du deine Jacke aus dem Müll gefischt, oder wieso ist sie so dreckig, Muddy Hazel?« Ein Junge aus meiner Klasse kickt eine Pfütze, sodass schmutziges Wasser Hazels Beine benetzt.
Gelächter erfüllt die Luft, grausam und schneidend. Doch Hazel steht einfach nur da. Mit erhobenem Kinn, gestrafften Schultern und Augen, die … leer sind. Obwohl sie dasteht wie eine Kriegerin, sagt sie kein Wort und bewegt sich nicht. Als würde sie glauben, dass Widerstand alles nur verschlimmern würde.
Jacob aus meiner Parallelklasse tritt näher, hält sein Handy hoch und filmt die Szene.
Hazels Schultern zucken kurz, sie versucht sichtlich, standhaft zu bleiben, doch ihre Augen schimmern feucht, und eine Verzweiflung spricht aus ihnen, die mich die Zähne schmerzhaft aufeinanderpressen lässt.
Ich durchbreche die letzte Distanz zwischen uns, als Jacob gerade wieder ruft: »Muddy Hazel, tanz für uns im Matsch!«
Mein Herz pocht heftig gegen meine Brust. Blanke Wut sickert in meine Adern. Ich möchte den Mistkerl an der Kapuze seiner Jacke packen, und sein Gesicht könnte erneut Bekanntschaft mit meiner Faust machen. Und obwohl ich nichts lieber möchte als das, gehe ich einfach nur ruhigen Schrittes auf Hazel zu. Bleibe neben ihr stehen. Funkle jedes einzelne Kind so böse an, dass sie meine unausgesprochene Drohung verstehen.
Manche von ihnen schrecken zurück, manche drehen sich um und gehen. Nur Jacob erhebt spöttisch und herausfordernd seine Stimme. »Was willst du, Damian? Spielst du mal wieder Muddy Hazels Beschützer, oder was?«
Ich starre Jacob direkt in die Augen. »Bist du mal wieder das feige Arschloch, das Mädchen ärgert? Versuch es doch lieber bei mir.«
»Komm, lasst uns gehen«, sagt eines der Mädchen schließlich und zieht an Jacobs Arm. Und noch bevor sie sich in Bewegung setzen kann, nehme ich im selben Moment Hazels eiskalte Hand mit einer Vorsicht und Sanftheit in meine, die ich mir selbst kaum zutraue. Ihre Haut fühlt sich zerbrechlich an, wie das dünne Eis eines zugefrorenen Sees, der bei jedem Schritt auf ihm Risse bekommt. Ich spüre ihren Widerstand, und doch folgt sie mir mit langsamen Schritten und entzieht sich meiner Hand nicht. Wortlos lenke ich sie über den Schulhof, weg von den spöttischen Blicken der anderen Kinder.
Ich möchte Hazel ins Schulgebäude bringen. Ich möchte, dass sie diese Arschlöcher nicht mehr sehen muss. Ich möchte, dass sie nicht mehr friert. Ich möchte …
Plötzlich reißt sich Hazel von mir los. Ich bleibe stehen, blicke über meine Schulter zu ihr nach hinten. Ihre grünbraunen Augen flackern vor Zorn.
»Was fällt dir eigentlich ein, Damian?« Ihre Stimme durchschneidet die kühle Luft, und ihre Worte hinterlassen kleine Rauchwölkchen. Obwohl sie zwei Jahre jünger ist als ich, kommt sie mir viel reifer vor, und ich frage mich, ob es daran liegt, dass sie nie wirklich eine Kindheit hatte.
»Ich …« Es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu finden. »Ich wollte dir nur helfen.«
»Mir helfen? Wie oft muss ich dir noch sagen, dass deine Hilfe alles nur noch schlimmer macht?« Sie fuchtelt mit den Armen, als ob sie ihre Frustration in die Welt hinausschleudern will. »Sie lassen mich nie in Ruhe, wenn sie denken, ich sei schwach!«





























