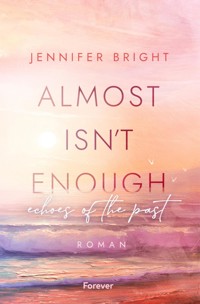12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Secrets of Ferley
- Sprache: Deutsch
Seitdem ihr Elternhaus in Flammen aufgegangen ist, wird Summer von Albträumen geplagt. Einzig beim Kitesurfen fühlt sie sich frei. Als der mysteriöse Student Ares in ihre WG in der Kleinstadt am Meer zieht, macht Ares sie wahnsinnig. Doch auch vom ersten Augenblick an fühlt Summer sich zu ihm hingezogen. Als Ares von ihren Albträumen erfährt, versteht er sie so gut wie niemand sonst. Denn niemand weiß, dass Ares ebenfalls tiefe Wunden in sich trägt. Als Summer mit Ares beginnt die Wahrheit über den Brand ihres Elternhauses aufzudecken, stoßen sie auf eine schockierende Verwicklung … »Jennifer Bright vereint alles, was es für einen Pageturner braucht: Knisternde Gefühle, Spannung bis zur letzten Seite und emotionaler Herzschmerz vom Feinsten. Dieses Buch ist ein absolutes Highlight!« Ayla Dade
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 543
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Almost isn't enough. Whispers by the Sea
Jennifer Bright wurde 1993 in Hannover geboren. Zusammen mit ihrem Mann und ihrer Katze lebt sie noch heute in der niedersächsischen Hauptstadt. Sie trinkt mehr Kaffee, als es gut für sie wäre, und kann sich kein Leben ohne Katzen, Bücher und Serien vorstellen. Auf Instagram (@wort_getreu) und TikTok (@jennifer.bright) teilt sie ihre Leidenschaft dazu.
Verdammte Scheiße, das wird nicht gut enden. Sie und ich. Zwei Gewitterwolken, die so stark aufeinanderprallen, dass sie die Welt in Schutt und Asche legen könnten.
Jennifer Bright
Almost isn't enough. Whispers by the Sea
Roman
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024Umschlaggestaltung: favoritbuero, München Titelabbildung: © Rudchenko Liliia / Shutterstock; © Boyan Dimitrov / ShutterstockAlle Rechte vorbehaltenDie automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.Autorenfoto: © Jennifer BrightE-Book Konvertierung powered by pepyrusISBN 978-3-95818-842-6
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Epilog
Nachwort
Danksagung
Content Note
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Widmung
Für all diejenigen, die sich nicht gesehen fühlen <3
Motto
Playlist zum Buch
The Tortured Poets Department – Taylor Swift
Memory Lane (Orchestral Version) – Haley Joelle
Blurry Mess – Gallipoli
Common Denominator – Dylan Dunlap
She Fell In Love In The Summer – Omar Rudberg
Two Weeks Ago – Maisie Peters
Guilty as Sin? – Taylor Swift
How Do I Say Goodbye – Dean Lewis
Forever – Lewis Capaldi
THE LONELIEST – Måneskin
I Can Fix Him (No Really I Can) – Taylor Swift
In A Perfect World – Dean Lewis, Julia Michaels
Locksmith – Sadie Jean
Wenn du da bist – Fabian Wegerer
lonely bitch – Bea Miller
Happiest Year – Jaymes Young
Dream – Imagine Dragons
All I Want – Kodaline
In The Stars – Benson Boone
A Man Like Me – Johnny Orlando
Cheap Cologne – GRAHAM
Hinweis
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält sensible Inhalte. Deswegen findet ihr am Ende des Buches eine Content Note. Achtung: Diese enthält Spoiler für die gesamte Geschichte. Wir möchten, dass ihr das bestmögliche Leseerlebnis habt.
Eure Jennifer Bright und das Forever-Team
Prolog
Damals
Knisternde, flackernde, alles zerstörende Flammen.
Sie verschlingen das Haus.
Meine Familie.
Mein Leben.
Wilde Funken steigen in den Nachthimmel. Der Rauch brennt in meinen Augen. Heiße Tränen laufen mir über die Wangen und versickern im Kragen meines Schlafanzuges. Mein Herz tut weh. So sehr, dass ich keine Luft mehr bekomme. Meine nackten Zehen krallen sich in den trockenen Rasen, den Dad erst gestern frisch gemäht hat. Jetzt ist er schwarz und kaputt. So wie alles.
Nie zuvor habe ich eine solche Angst verspürt. Nicht einmal, als ich vor ein paar Wochen bei meinem ersten richtigen Surfversuch von einer Welle erwischt wurde. Für einen kurzen Moment dachte ich, ich müsste sterben, jegliche Luft war meinen Lungen entwichen. Doch dann atmete ich wieder, und nur wenige Tage später war ich erneut im Wasser.
Dieses Mal wird es anders sein. Die Angst wird nicht einfach verfliegen. Sie frisst sich in mein Inneres. Nistet sich so tief in mir ein, dass ich jetzt – in diesem Moment – ganz genau weiß, dass mein Leben nie mehr dasselbe sein wird.
Eine dunkle Gestalt schiebt sich in mein Sichtfeld. Beinahe hätte ich den maskierten Mann vergessen, der mich eben noch aus den Flammen gerettet hat.
»Ist noch jemand im Haus?« Seine sanfte Stimme passt nicht zu seiner düsteren Gestalt.
Ich nicke heftig. »Meine … Meine Eltern«, bringe ich stotternd heraus und spüre erneut Panik in mir aufsteigen. Ich habe keine Ahnung, warum ich wie festgefroren dastehe. Wieso ich die züngelnden Flammen betrachte und kein Schrei, kein Wimmern meine Lippen verlässt. Der Gedanke, dass Mom und Dad in den heißen Flammen gefangen sind, lähmt mich.
Der Mann flucht. »Du elender Bastard! Du hast mir versichert, dass das Haus leer steht.« Ich zucke zusammen. »Willst du mich verarschen? Ich scheiß auf die Kohle. Verdammt, was soll ich jetzt machen?« Erst als ich sehe, dass er sich ans Ohr fasst, begreife ich, dass er nicht mit mir spricht.
Endlich löse ich mich aus der Starre und stürme los. Meine kleinen Beine tragen mich um den großen Mann herum, doch er ist schneller, packt mich mit beiden Armen und zieht mich beiseite.
»Warte hier! Ich hole deine Eltern und …« Seine letzten Worte dringen nicht mehr zu mir durch, verschwinden zusammen mit seinem Körper in den Flammen, als er zurück in das brennende Haus läuft.
Meine Knie geben unter mir nach, und alles in mir zieht sich schmerzhaft zusammen. Noch vor wenigen Minuten war alles gut. Klar, ich war traurig und vielleicht sogar ein wenig wütend auf Mom und Dad. Wir wollten heute eigentlich in den Urlaub fliegen, doch mein Fieber hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Diese Nachricht und die damit verbundene Enttäuschung ist nicht mit dem zu vergleichen, was ich jetzt fühle. Verzweiflung. Leere. Angst.
Ein Zittern durchfährt meinen gesamten Körper. Die Tränen hinterlassen brennende Spuren auf meiner Haut.
Mittlerweile haben sich auf der schmalen Straße am Rande Ferleys Menschen versammelt. Unsere Nachbarin hockt plötzlich neben mir und streicht mir sanft über das Haar. »Summer? Süße? Was ist passiert? Geht es deinen Eltern gut?«
Ich wünschte, ich könnte ihr antworten.
Ich wünschte, ich wüsste es.
Wie lange ist der Mann schon im Haus? Drei Minuten? Fünf? Oder sogar zehn? In der Ferne sind Sirenen zu hören, und gerade als ein kleiner Funken Hoffnung in mir entfacht, ertönt eine ohrenbetäubende Explosion. Das Geräusch geht mir durch Mark und Bein.
Nun schreie ich doch.
Ich schreie, schreie, schreie.
Und höre nicht mehr damit auf.
Kapitel 1
Diese Stadt kotzt mich jetzt schon an. Dabei habe ich gehofft, dass Ferley der perfekte Ort sei, um mich zurückzuziehen. Es stellt sich jedoch heraus, dass es in einer pulsierenden Großstadt um einiges leichter ist, zu verschwinden … in der Menge unterzugehen und einfach ein Niemand zu sein.
Hier hingegen falle ich auf wie ein bunter Hund. Daran ändern auch meine schwarzen Klamotten nichts und auch nicht die Basecap, die ich mir auf dem Marktplatz tief ins Gesicht gezogen habe. Im Gegenteil, ich wurde angestarrt wie ein Eindringling oder gar ein Schwerverbrecher. Jedes Flüstern, jeder Blick schien auf mich gerichtet.
Ein tiefes Seufzen entrinnt meiner Brust, während ich mich, nur wenige Schritte von der Brandung entfernt, in den heißen Sand setze. Mit den Handflächen stütze ich mich nach hinten auf und bereue sofort, kein T-Shirt angezogen zu haben.
»Ich hätte bei Dad bleiben sollen«, murmle ich und ziehe mir das schwarze Langarmshirt über den Kopf, bevor ich es achtlos neben meine Lederjacke fallen lasse. Mein eigentlicher Plan war es, mich an meinem ersten Wochenende in der neuen Stadt bei Dad zu verkriechen – bis wir heute Morgen mal wieder aneinandergeraten sind. Ein weiteres Glied in einer Kette endloser Auseinandersetzungen. Jedes Gespräch zwischen uns endet seit Monaten in einer Diskussion, und ich kann es ihm nicht einmal übel nehmen. Er will das Beste für mich. Das Problem an der Sache ist nur, dass wir beide unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was das Beste ist.
Zwei Jungs laufen lachend an mir vorbei ins Meer, und ich hasse alles daran. Vielleicht bin ich auch einfach rausgegangen, um mich selbst zu bestrafen. Bei Dad wäre es nervig geworden, aber hier am Strand und in der Kleinstadt habe ich vor allem eins um mich: das pure Leben. Glückliche, lachende, zufriedene Menschen, die mir allesamt vor Augen führen, was ich nicht bin.
Und aus irgendeinem kranken Grund brauche ich diesen Schmerz. Denn ohne ihn würde ich mich nicht einmal mehr lebendig fühlen. Ohne ihn hätte ich schon längst aufgegeben.
Aus der Tasche meiner Jeans ziehe ich eine kleine silberne Schatulle, in der ich immer zwei Zigaretten und eine schmale Streichholzschachtel aufbewahre. Eigentlich habe ich mit dem Rauchen aufgehört. Inzwischen hasse ich den Gestank und den Geschmack von Tabak. Doch es gibt Tage wie diesen, da holt mich die Sucht wieder ein.
Immerhin lasse ich seit zwei Jahren die Finger vom Gras. Das Zeug hat mich manchmal vergessen lassen, wer ich bin, und auch wenn dieser Gedanke verlockend erscheinen mag, gab es doch Momente, in denen es mir eine Scheißangst eingejagt hat.
Ich klemme mir die Kippe zwischen die Lippen und versuche, für einen Moment alles auszublenden. Die Stimmen um mich herum. Meine eigenen Gedanken. Meine Vergangenheit und meine Zukunft. Da ist nur noch das konstante Rauschen der Wellen.
Mit zittrigen Fingern ziehe ich eines der Streichhölzer heraus. Das Ratschen des Zündkopfes am Rand der Schachtel klingt fast beruhigend in meinen Ohren. Den Kopf leicht nach vorn geneigt, halte ich die Flamme an das Ende der Zigarette. Die raue Wärme des Rauchs füllt meine Lungen, eine seltsame Mischung aus Schmerz und Genuss.
Ich halte den Atem an und beobachte, wie die Flamme des Streichholzes im Wind züngelt und tanzt. Sekunden vergehen, in denen die Glut das dünne Holz verkohlen lässt und mir die Endlichkeit von allem vor Augen führt.
Ein forsches Räuspern durchbricht meine eigene Stille, und plötzlich nehme ich wieder alles um mich herum wahr. Als hätte jemand auf Play gedrückt, und die Welt dreht sich weiter.
Ich sehe auf zu einer jungen Frau in Neoprenanzug und mit einem Kitesurfboard unter dem Arm, die direkt auf mich zukommt. Sie bleibt neben mir stehen und mustert mich abschätzig. Ihre weißblonden, schulterlangen Haare flattern im Wind und wehen ihr immer wieder ins Gesicht. Und doch entgehen mir ihre Augen nicht. Sie strahlen mit dem Meer um die Wette: so ozeanblau, dass man in ihnen ertrinken könnte.
»Ich weiß nicht, ob du es nicht gesehen hast oder du bloß ein ignorantes Arschloch bist, aber die Schilder stehen hier nicht umsonst.« Sie reckt das Kinn und deutet mit einer Kopfbewegung zu der Aufschrift: Rauchen verboten!
Ihr Blick wandert über mich, und für einen kurzen Moment bleibt er an meinem nackten Oberkörper haften. Ich hasse das Gefühl, beobachtet zu werden, und ganz besonders von jemandem, der aussieht, als gehöre er genau hierher, in diese Welt voller Sonne und Meer, die mir so fremd ist. Ihr Neoprenanzug hängt ihr aufgezippt die Hüften herab, entblößt ihr gelbes Bikinioberteil und die vielen Muttermale auf ihrer gebräunten Haut.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll, also sage ich nichts. Stattdessen ziehe ich noch einmal provokant an meiner Zigarette, lasse den Rauch durch meine Nasenlöcher entweichen und versuche, ihr mit einem schiefen Grinsen zu vermitteln, dass mich die Regeln hier nicht interessieren.
Sie scheint für einen Moment zu zögern, dann tritt sie näher, geht vor mir in die Hocke und … reißt mir allen Ernstes meine Kippe aus der Hand, um sie im Sand auszudrücken.
»Ich hasse Touristen wie dich, die meinen, den Strand mit ihrem Dreck verschmutzen zu können, und sich an keine Regeln halten.« Sie wedelt mit der Hand vor mir herum, während ich die Sommersprossen auf ihrem Nasenrücken zähle. »Wahrscheinlich glaubst du, dass du mit deiner stinkenden Zigarette, der schwarzen Jeans und der Lederjacke irgendwie sexy und geheimnisvoll wirkst. Aber hier eine kleine Serviceinfo für dich: Tust du nicht!« Sie wirft mir die ausgedrückte Kippe in den Schoß und erhebt sich wieder.
»Wow. Das war …« Ich versuche, mir ein Lachen zu verkneifen. Dabei verstehe ich sie sogar. Sie kann nicht wissen, dass ich meine Zigarettenstummel niemals auf den Boden – geschweige denn in den Sand – werfen würde. »Hattest du einen schlechten Tag?«
»Eine schlechte Woche. Einen schlechten Monat. Ein schlechtes Jahr. Nenn es, wie du willst, solange du deinen Müll bei dir behältst und Regeln nicht nur bei Mommy und Daddy zu Hause respektierst, sondern auch im Urlaub. Schönes Leben noch.« Sie wartet erst gar nicht auf eine Erwiderung. Stattdessen dreht sie sich einfach um und geht auf das tosende Meer zu.
Erst als sie im Wasser auf ihr Board steigt, entspannen sich meine Muskeln wieder. Meine Augen haften an ihr, folgen jedem ihrer Manöver, wie sie gekonnt über die Wellen tanzt. Ihr Körper bewegt sich mit einer Leichtigkeit und Anmut, als wäre sie selbst ein Teil des Ozeans.
Hinter ihr beginnt die Sonne langsam im Meer zu versinken und wirft ihre letzten goldenen Strahlen über die Wasseroberfläche. Die Bewegungen der Unbekannten sind präzise. Jeder Sprung, jede Drehung scheint mühelos. Ich bemerke, wie sich mein Atem mit dem Rhythmus ihrer Sprünge synchronisiert. Einatmen, wenn sie Anlauf nimmt. Ausatmen, wenn sie landet. Und für einen Moment wünschte ich, ich könnte das auch. Nicht das Kitesurfen, nein, aber diese unbeschwerte Freiheit genießen, sich dem Leben, dem Hier und Jetzt so sehr hinzugeben. Das Einzige, was für mich diesem Gefühl gleichkommt, ist das Motorradfahren.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, in der ich meinen Kopf ausgeschaltet und die Frau auf dem Wasser beobachtet habe. Doch als sie schließlich aus dem Meer kommt, tritt die Dämmerung bereits ein, und es ist, als wäre dies mein Stichwort. Sie erinnert mich daran, dass ich hier nicht hingehöre. Bevor ich mir den nächsten Ärger mit ihr einhandele, stehe ich auf, klopfe mir den Sand von der Jeans und ziehe mein Shirt über.
Zielstrebig und ohne mich noch einmal umzudrehen, schlendere ich zurück zu meinem Motorrad, das ein Stück entfernt vom Ufer im Schatten einer Surf- und Kitesurfschule steht. An meiner schwarzen Suzuki GT 750 angelangt, hole ich mein Smartphone aus der Hosentasche und tippe eine kurze Nachricht an Dad.
Plötzlich ertönt ein lautes Krachen. Reflexartig fahre ich herum und sehe sie – die blonde Unbekannte. Ihre Ausrüstung liegt auf dem Boden vor der Kitesurfschule. Ein lautes »Fuck« entweicht ihren Lippen, während sie sich hockend daranmacht, etwas aufzuheben.
Ihre Augen finden die meinen, und das Blau ihrer Iriden lodert anklagend. »Hast du etwa geglaubt, du könntest mich beklauen?«
Sie steht auf und geht auf mich zu, ihr Gang entschlossen, beinahe schon kämpferisch. Der Jutebeutel in ihrer Hand schwingt hin und her.
»Was?«
»Du hast mich schon richtig verstanden.« Sie stemmt die Hände in die Hüften und reckt mir ihr Kinn entgegen, wobei sie den Kopf in den Nacken legen muss.
»Ich habe deinen beschissenen Beutel nicht angerührt«, erwidere ich gelassen, obwohl es in mir zu brodeln beginnt.
»Dann erklär mir, warum mein Zeug plötzlich überall verstreut auf der Veranda liegt, während du neben der Kitesurfschule stehst!«, faucht sie. Ihre Haare kleben nass an ihrer Stirn. Einzelne Tropfen rinnen ihr über die Wange, als wären es Tränen aus Salzwasser. Doch in ihren Augen liegt kein Schmerz, keine Traurigkeit, nur glühender Zorn.
»Vielleicht hast du ihn in einem Wutanfall selbst hingeworfen? Wieder jemanden beim Rauchen erwischt? Oder war es ein noch viel schlimmeres Vergehen?« Ich schiebe beiläufig mein Handy zurück in die Jeanstasche.
»Du glaubst, du kannst mich für dumm verkaufen?«, zischt sie, und mit jedem Wort schrumpft der Abstand zwischen uns. »Mir wurde hier noch nie etwas gestohlen. Und du stehst verdächtig nahe an der Veranda. Im Übrigen ist das ein Privatparkplatz!«
»Mimimi«, mache ich und beobachte fasziniert, wie ein Muskel unter ihrem rechten Auge zu zucken beginnt.
»Du stehst hier mit deinem Motorrad, spielst den coolen Macker und denkst, du weißt, wie die Welt funktioniert! Vielleicht kommst du zu Hause mit Diebstahl davon. Aber nicht in Ferley!« Sie fährt sich mit den Fingern durch das nasse, hellblonde Haar.
»Ich spiele niemanden«, entgegne ich, während ich mich bemühe, nicht die Fassung zu verlieren. Mein Puls ist auf hundertachtzig. »Aber schön zu wissen, wie aufgeschlossen und unvoreingenommen die Bewohner dieser Kleinstadt sind. Beurteilst du alle Menschen anhand ihres Aussehens? Soll ich dir mal sagen, was ich denke?«
»Nein. Ehrlich gesagt ist es mir scheißegal, was du denkst. Gib mir einfach meine Sachen wieder.«
Ich beuge mich zu ihr hinunter. »Ich denke, dass du eine verwöhnte Prinzessin bist, die nicht über den goldenen Tellerrand hinausschauen kann«, flüstere ich ihr ins Ohr und rechne damit, dass sie einen Schritt zurückweicht. Doch sie bleibt standhaft und atmet tief ein.
»Gib mir sofort meine Sachen wieder. Ich sage das kein zweites Mal, Arschloch. Oder ich rufe die Polizei.«
Ein lautes Lachen entkommt meiner Kehle und löst all die Anspannung, die ich bis eben noch verspürt habe. »Tu dir keinen Zwang an, Sweetheart.«
Für einen Moment erstarren ihre Gesichtszüge, und sie beißt sich auf die Unterlippe.
Und ohne auf ein weiteres Wort ihrerseits zu warten, schwinge ich mich auf die Suzuki. Der Motor erwacht mit einem Brummen zum Leben. Ich werfe einen letzten Blick über die Schulter, auf die rasende Wut in ihren Augen, und dann gebe ich Gas.
Kapitel 2
Mit einem schrillen Schrei sitze ich kerzengerade in meinem Bett und werfe die Decke von mir, als könnte ich mich an ihr verbrennen. Alles in mir krampft sich zusammen, ich schwitze und friere zugleich. Mein Herz rast so schnell, dass es alles andere als gesund sein kann, und mein Gesicht ist nass. Nass von all den Tränen, die mir dieser eine Albtraum immer wieder aufs Neue beschert. Die ersten Sekunden nach dem Aufwachen wünsche ich mir jedes Mal dasselbe: Wäre ich doch nur vor vierzehn Jahren mit meinen Eltern in den Flammen gestorben.
Ich greife nach der Wasserflasche neben meinem Bett und nehme einen großen Schluck. Die digitale Uhr an meiner Wand verrät mir, dass der Wecker in drei Stunden klingeln wird. Es ist also noch viel zu früh, um aufzustehen, und doch weiß ich, dass ich kein Auge mehr zubekommen werde. Nicht, weil ich nicht müde bin. Es ist die Angst davor, die Explosion in meinem Kopf in Dauerschleife zu hören, sobald ich mich wieder schlafen lege.
Mit wackligen Beinen stehe ich auf und setze mich auf mein breites Fensterbrett. Bis zu den Oberschenkeln in meine weiße Kuscheldecke gehüllt, schaue ich ins schwarze Nichts. Einzig und allein die Laternen beleuchten schwach die kleine Gasse, die zu unserem Wohnheim führt. In wenigen Stunden wird die Junisonne über den Hügeln Ferleys aufgehen und den Campus der Fox University in eine Mischung aus warmen Orangetönen und zartem Rot tauchen. Ein Anblick, an dem ich mich niemals sattsehen werde. Allein dafür lohnt es sich, morgens früh aufzustehen.
Ich seufze und möchte gerade zurück ins Bett gehen, da stoße ich mit dem Arm gegen den Bücherstapel hinter mir, der mit einem lauten Knall zu Boden fällt. Mist. Auf Zehenspitzen tapse ich auf meinem Teppich herum und staple ein Buch auf das nächste in meinen Armen, als plötzlich die Zimmertür aufgerissen wird.
»Summer! Alles okay?« Mila knipst das Licht an und reibt sich die verschlafenen Augen. »Geht’s dir gut?«
In einer knallblauen Pyjamahose steht meine Mitbewohnerin vor mir und sieht mich entgeistert an, bevor sie die Bücher auf dem Boden entdeckt. »Hast du auf die Uhr geschaut? Ich weiß nicht einmal, ob es zu spät oder zu früh ist, um die Nase in ein Buch zu stecken.«
»Sorry. Ich wollte dich nicht wecken.« Vorsichtig stelle ich den Stapel wieder zurück auf die Fensterbank.
Mila geht auf mich zu, mustert mich besorgt und fährt mir dann durch meine zerzausten, schulterlangen Haare. »Ich habe mich noch immer nicht an die neue Farbe gewöhnt.«
»Ich zucke selbst immer noch kurz zusammen, wenn ich mich im Spiegel sehe«, gestehe ich lachend. Als Dad – mein Adoptivvater, um genau zu sein, aber so nenne ich meine Eltern nie – meine neue Frisur zum ersten Mal gesehen hat, war auch er kurz erschrocken.
»Wieso bist du überhaupt wach?«, möchte Mila schließlich wissen.
»Albtraum.«
»Schon wieder?« Sie zieht mich in ihre Arme.
Mila greift nach der kleinen Fernbedienung und knipst die Lichterkette über uns an, bevor sie die Deckenleuchte ausmacht. Gemeinsam legen wir uns hin und starren an die Zimmerdecke, die nun mit kleinen, warmen Lichtpunkten übersät ist.
»Wenn das wieder passiert, kommst du einfach direkt in mein Zimmer und legst dich zu mir.« Sie streckt ihren Arm aus, und ich kuschle mich an ihre Seite. »Verstanden?«
»Aye, aye, Chef.«
»Oder war es eher ein Albtraum der Sorte Damian?« Sie wackelt mit den Augenbrauen.
»Nein.« Ich lache kurz auf. »Auch wenn ich seit ein paar Tagen ein blödes Gefühl im Bauch habe, sobald ich an den Semesterbeginn heute denke. Es ist noch nicht so schlimm, dass es mich in meinen Träumen heimsucht.« Mein bester Freund Damian ist die letzten Wochen über durch den Westen Amerikas gereist, weshalb wir uns heute das erste Mal seit unserem One-Night-Stand wiedersehen.
»Es ist mir noch immer ein Rätsel, wie ihr im Bett landen konntet. Versteh mich nicht falsch, natürlich kann sich aus einer Freundschaft auch eine Freundschaft plus oder vielleicht sogar mehr entwickeln. Gar keine Frage. Aber bei euch beiden hätte ich das nicht gedacht. Ihr wart immer eher wie …«
»Bitte sprich den Satz nicht zu Ende. Das macht es noch furchtbarer.«
»Du meinst, ich soll nicht sagen, dass ihr auf mich seit Kindheitstagen wie Geschwister gewirkt habt?«, zieht Mila mich auf.
»Nein! Aber ich hätte wissen müssen, dass du nicht auf mich hörst. Ich weiß auch nicht, wie es so weit kommen konnte. Es muss am Alkohol auf Calebs Party gelegen haben. Der war anders wild.« Nüchtern wäre uns das niemals passiert, da bin ich mir sicher.
»Oh, bitte!« Sie richtet sich im Bett auf und sieht mich anklagend an. »Ich hasse diese Ausrede. Alkohol allein reicht nicht aus, um einen Fehler zu begehen.«
Ich kann Mila nicht sagen, weshalb es Damian so mies ging, dass er nur noch aus der Realität flüchten wollte. Das steht mir nicht zu.
»Wir sollten schlafen. Morgen müssen wir früh raus«, sage ich und ziehe Mila zurück auf die Matratze.
»Ich verfluche die Fox University dafür, dass sie ihre eigenen Regeln macht. Es gibt unendlich viele Unis, und ausgerechnet unsere beschließt, dass wir Mitte Juni in ein neues Semester starten?«
»Du weißt doch, wie das in Ferley ist. Hier läuft eben alles ein bisschen anders.«
Mein Blick fällt auf eines der unzähligen Polaroidfotos an der Wand, das durch den schwachen Schein der Lichterketten angeleuchtet wird. Es zeigt mich und meine Freunde. Als wir noch vollzählig waren. Als Hazel noch kein Loch in unserer Gruppe und in meinem Herzen hinterlassen hat. Als sie noch nicht spurlos aus unserem Leben verschwunden war. Sie ist … oder besser war … meine beste Freundin. Ich weiß nicht, ob ich sie so noch nennen kann. Zum einen, weil sie seit zwei Jahren wie vom Erdboden verschluckt ist, und zum anderen, weil ich vor wenigen Wochen mit ihrem Ex-Freund Damian geschlafen habe. Nicht unbedingt etwas, was man in einer guten Freundschaft tun sollte. Aber einfach abzuhauen ist schließlich auch nicht die feine Art. Selbst von Damian hat sie sich nie verabschiedet. Alles, was wir von ihrem Großvater wissen, ist, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Wow. Danke für nichts.
»Vielleicht ist genau das der Grund, weshalb unser letzter Mitbewohner mitten im Semester das Studium geschmissen hat, um zurück nach San Francisco zu gehen«, ergänze ich, um den Gedanken an Hazel aus meinem Kopf zu verbannen.
Mila gähnt. »Ich vermute noch immer, dass seine Entscheidung weniger mit dem Studium als mit Ferley zu tun gehabt hat. Manche Menschen halten es nicht lange in einer Kleinstadt aus.«
Sie hat recht, doch für mich ist diese Kleinstadt das perfekte Zuhause. Die Lage direkt am Strand, der stetige Wind zum Kitesurfen, die kleinen Cafés und Restaurants, das familiäre Miteinander. Ich liebe alles an Ferley.
»Darüber hat er sich ja ständig aufgeregt.« Mila verzieht das Gesicht und äfft den blasierten Ton unseres damaligen Mitbewohners so treffend nach, dass ich mir ein Grinsen verkneifen muss. »Hier kann man ja nicht mal richtig shoppen. Die Läden am Strand haben überhaupt keine Markenklamotten. Mein Leben ist vorbeiiii.«
»Deshalb hat er sich auch gefühlt jeden zweiten Tag was im Internet bestellt.«
»Oh Gott, stimmt. Ich habe immer noch Albträume von dem Labyrinth aus Paketen im Flur.« Mila rollt mit den Augen und reibt sich über die Stirn.
Einige Minuten ist es still zwischen uns.
»Ich hab dich lieb, Summer.«
»Ich dich auch, Mila. Ich dich auch.«
Und so finde ich Hand in Hand neben meiner Freundin dann doch irgendwann wieder in den Schlaf. Ohne das Geräusch von knisterndem Feuer und Explosionen in meinem Kopf. Dafür mit den Gedanken und Erinnerungen an Hazel, die mir gewissermaßen das Herz gebrochen hat.
Kapitel 3
Ein unerträgliches Surren reißt mich aus dem Schlaf. Es dauert eine Weile, bis ich merke, dass es sich um die Klingel unseres Wohnheimapartments handelt.
»Ignorieren. Einfach ignorieren.« Mila zieht sich mit einem Stöhnen meine Decke über den Kopf. »Vielleicht ist es Stewart. Ich habe gestern Abend wieder meine Sneaker vor der Tür stehen lassen.«
Stewart ist Hausmeister der Wohnheime auf dem Campus und übereifrig darum bemüht, dass alles seine Ordnung hat. So auch die Flure. Ich habe Mila schon oft gesagt, dass sie ihre Schuhe einfach in unsere Wohnung stellen soll. Nicht umsonst haben wir einen Schrank dafür gekauft. Doch sie wird die Gewohnheit einfach nicht los. Ihre Mom hat eine strikte Keine-Straßenschuhe-in-meinem-Haus-Regel.
Die Klingel gibt keine Ruhe, und als ich gerade aufstehen möchte, springt Mila aus dem Bett. Mit einem bedrohlichen Murren stampft sie aus meinem Zimmer. »Dieser Mann raubt mir noch den letzten Nerv. Kein Mensch wird über meine Sneaker stolpern und sich die Beine brechen.«
Ich hole sie ein und halte sie an der Schulter zurück, bevor dieser kleine Giftzwerg Stewart noch den Kopf abreißt. Ein Verweis wäre nun wirklich das Letzte, was wir gebrauchen könnten.
»Lass mich lieber. Bevor du dem armen Kerl noch an die Gurgel gehst.« Ich reibe mir den Schlaf aus den Augen und fahre mit den Fingern durch mein Haar, um wenigstens nicht komplett zerzaust auszusehen. In unserem offenen Wohnzimmer bleiben wir gleichzeitig vor dem runden Spiegel über dem Sideboard stehen. Wir blicken hinein, sehen einander an und beginnen in derselben Sekunde zu lachen, als es erneut – und dieses Mal sogar noch stürmischer – an der Tür klingelt.
Ich reiße sie auf, und mir verrutscht das aufgesetzte Lächeln.
»Eine Sekunde länger, und ich hätte die Tür eingetreten«, verkündet mein Gegenüber. Es ist definitiv nicht der kleine Stewart mit seinem Bierbauch, dem Schnauzer und dem freundlichen Lächeln. Stattdessen steht er da. Der unverschämte, aber verdammt gut aussehende Typ, der mich vorgestern am Strand bestohlen hat.
Seine Haare sind dunkel wie die Nacht, seine Augen hell wie Gletscher in der Antarktis. Noch nie habe ich einen so atemberaubenden Kontrast gesehen. Wobei mir beim genaueren Hinsehen auffällt, dass sein lockiges, kurzes Haar eher dunkelbraun ist. Er trägt einen kleinen Ring im linken Ohrloch, und obwohl ich Piercings jeglicher Art für gewöhnlich nichts abgewinnen kann, muss ich zugeben … verdammt, es steht ihm. Sogar sehr. Himmel!
Ein Räuspern ertönt hinter mir und durchbricht die unangenehme Stille, während wir einander anstarren.
»Was machst du …« Während ich stolz darauf bin, meiner Sprache wieder mächtig zu sein, unterbricht er mich, bevor ich meine Frage überhaupt zu Ende führen kann. So sympathisch, wie ich ihn in Erinnerung habe.
»Das ist doch Haus zehn, Apartment sechs?« Seine raue Stimme hinterlässt eine Gänsehaut auf meinen Oberarmen, und ich hasse mich dafür. Mir wäre es lieber, er hätte eine Stimme wie Kermit der Frosch und nicht wie Tom Hiddleston höchstpersönlich.
Langsam nicke ich. Meine linke Augenbraue zieht sich unkontrolliert nach oben, und ich bin mir der tausend Fragezeichen in meinem Gesicht durchaus bewusst. Was will er hier?
»Dann bin ich hier goldrichtig.« Lässig schmeißt er sich seine Tasche über die Schulter und drängt sich so dicht an mir vorbei, dass ich einen Schritt beiseite machen muss, um ihn nicht zu berühren. Was zur Hölle? Er kann doch nicht wie selbstverständlich in unser Apartment stolzieren, als würde es ihm gehören.
»Entschuldigung?« Vielleicht wäre dies nun der Zeitpunkt, in dem Mila mich zurückhalten sollte, damit ich niemandem an die Gurgel gehe. »Ich kann mich nicht daran erinnern, dich hereingebeten zu haben.«
»Summer?« Mila schaut zwischen dem Kerl, der unbeirrt seine Tasche vor unserem Sofa fallen lässt, und mir hin und her. »Träume ich noch, oder steht da ein fremder Mann in unserer Wohnung?« Sie gähnt und lässt ihren Kopf kreisen. »Schlecht sieht er ja nicht aus. Wenn auch ein wenig mürrisch.« Dass er sie hören kann, scheint sie kein bisschen zu stören, was ich darauf schiebe, dass sie dank mir nur wenig Schlaf bekommen hat.
»Mein Morgen war so stressig, dass ich mich erst einmal ausruhen muss.« Als wären wir gar nicht da, wirft der Dieb sich auf unser cremeweißes Ecksofa und legt die Füße auf den Couchtisch.
»Hey!«, brüllen Mila und ich im Einklang.
Er trägt ein weißes und makellos gebügeltes Hemd, was nicht ganz zum restlichen Bild mit der schwarzen Jeans und den schweren Boots passt. Die oberen Knöpfe stehen offen und geben die Sicht auf seine gebräunte Haut frei. Ich finde es schrecklich, Menschen in Schubladen zu stecken, aber er macht seine Schublade förmlich selbst auf und legt sich mit seinem Benehmen von ganz allein hinein. Er wirkt wie einer dieser klischeehaften Bad Boys aus den Büchern, die Mila so gern liest.
Erhobenen Hauptes gehe ich auf ihn zu, schubse seine Füße von unserem Tisch und greife nach seiner Tasche. »Möchtest du mir mein Portemonnaie wiedergeben? Ansonsten habe ich nämlich keine Ahnung, was du hier willst.« Mit seinem Gepäck, das schwerer ist, als es aussieht, gehe ich auf die Tür zu. Ich warte auf ein Rascheln, auf irgendein Geräusch, das mir verrät, dass er aufsteht und endlich aus unserer Wohnung verschwindet. Doch es bleibt still.
»Ich wurde diesem Apartment zugewiesen, Sweetheart. Wenn das hier Haus zehn, Apartment sechs ist, bin ich genau da, wo ich hingehöre.«
Ruckartig drehe ich mich um. »Wie bitte?«
Doch anstatt etwas zu erwidern, widmet er seine volle Aufmerksamkeit unseren vier Wänden. Er fährt sich durch das Haar und sieht sich neugierig um.
Wir haben einen offenen Wohnbereich, der nur durch einen Tresen von der Küche getrennt ist. Zur optischen Abgrenzung wurde in der Küche eine Tapete in Backsteinoptik angebracht, während die Wände im Wohnbereich schlicht weiß gestrichen sind. Die ersten Sonnenstrahlen des Tages erhellen die Wohnung durch die langen Kachelfenster.
»Das muss eine Verwechslung sein«, meint Mila und nimmt auf der anderen Seite des Ecksofas Platz, darauf bedacht, eine Menge Abstand zwischen sich und dem Fremden zu lassen. »Uns wurde gesagt, dass in diesem Semester niemand zu uns zieht.«
Kurz vor den Ferien hat Mrs. McLeeds uns die freudige Botschaft übermittelt, dass Mila und ich für das kommende Semester allein im Apartment sein werden. Zu behaupten, wir hätten uns auf die Zeit ganz unter uns gefreut, wäre die Untertreibung des Jahrhunderts. Wir haben diese Nachricht regelrecht gefeiert.
Mila zupft an den Ärmeln ihres Pyjamas, und wir tauschen abwechselnd entsetzte und ungläubige Blicke aus. Wortlos sind wir uns einig darüber, dass das neue Semester nicht beschissener hätte starten können als mit einem unverschämten neuen Mitbewohner.
»Tja, das war dann wohl ein Fehler. Ich wohne jetzt hier.« Er steht auf und geht auf mich zu. »Keine Ahnung, ob es euch interessiert, aber ich bin Ares.«
Ares. Sein Name ist außergewöhnlich schön. Ich hasse es, dass ich ihn in meinen Gedanken schon viel zu oft mit dem Wort schön in Verbindung gebracht habe.
»Ich bin Mila, und das ist meine bessere Hälfte Summer.« Sie steht auf, strafft die Schultern und scheint die Hiobsbotschaft innerhalb weniger Sekunden verdaut zu haben. Sie hält ihm die Hand hin, und aus irgendeinem Grund fühlt es sich an wie Hochverrat.
Mit einem schiefen Lächeln schüttelt er Milas Hand. Während ich die Wohnungstür schließe und ihn mit verschränkten Armen beobachte, geht er an mir vorbei und greift nach seiner Tasche.
»Es kann doch nicht sein, dass sie uns einen Verbrecher zuteilen!« Ich platze beinahe vor Wut, und es fehlt nicht mehr viel und ich stampfe wie ein bockiges Kind mit dem Fuß auf den Boden.
»Verbrecher?«, fragt Mila wie aus der Pistole geschossen.
Ares winkt ab. »Sie hält mich für einen Dieb und beschuldigt mich, ihr irgendwas geklaut zu haben.«
»Nicht irgendwas. Mein Portemonnaie!«
»Moment mal. Das ist das arrogante Arschloch, das dich bestohlen hat und dann auf seinem Motorrad abgehauen ist?« Mila zieht scharf die Luft ein.
»Ja«, antworte ich.
»Nein«, entgegnet Ares. Seine Mundwinkel zucken verräterisch, und ich frage mich, was an der ganzen Situation so lustig sein soll. »Hör mal, Prinzessin. Ich kann nichts dafür, dass du auf deine Sachen nicht aufpassen kannst. Aber noch einmal zum Mitschreiben. Ich. Habe. Dich. Nicht. Beklaut.«
»Das würde jeder Dieb sagen!«
Mila zieht mich kurz beiseite und flüstert: »Vielleicht sagt er die Wahrheit? Hast du denn gesehen, wie er es getan hat?«
»Nein, aber …«
»Wir sollten ihm eine Chance geben. Vielleicht war er es wirklich nicht.«
»Ich werde mein Zimmer ab sofort jedes Mal abschließen, wenn ich es verlasse. Wenn du ihm eine Chance geben möchtest, gern. Aber sag am Ende nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte.«
»Ich möchte euren Kaffeeklatsch gar nicht groß unterbrechen«, behauptet Ares, doch der ironische Unterton in seiner Stimme spricht eine andere Sprache. »Aber wo ist mein Zimmer?«
Mila und ich schauen uns an. Sie presst die Lippen aufeinander und schaut schuldbewusst zu mir rüber, während mein Augenlid nervös zu zucken beginnt. Wir führen ein stummes Blickduell, weil keiner von uns mit der Sprache rausrücken möchte. Kurz nachdem das Zimmer frei wurde, haben wir daraus eine Art begehbaren Kleiderschrank gemacht.
Ares sieht von ihr zu mir und wieder zurück. »Ihr zwei seid echt seltsam und eine große Hilfe, vielen Dank auch.«
Mit großen Schritten gehe ich ihm hinterher. Noch bevor ich ihn aufhalten kann, reißt er die Tür zu meinem Zimmer auf. »Wow.« Seine Lippen teilen sich. »Das ist ja riesig.«
»Das ist mein Zimmer, Ares.« Ich betone seinen Namen, während ich ihn leicht am Ärmel seines Hemdes wieder rausziehe. Er leistet keinen Widerstand und schließt die Tür. »Und ich warne dich! Betritt es nie wieder.«
Mit einem Schmunzeln auf den Lippen sieht er mich an. Die Belustigung in seinen grauen Augen macht mich rasend.
»Ihr seid mir schon jetzt unheimlich sympathisch«, lässt er uns mit einem verächtlichen Schnauben wissen.
»Das beruht auf Gegenseitigkeit.« Ich versuche, sein blödes Schmunzeln zu imitieren.
»Okay, Leute. Wir fahren jetzt alle einen Gang runter.« Mila schiebt sich zwischen uns. »Wir sollten noch einmal von vorn anfangen. Das war bei Weitem nicht der beste Start.«
Ares lehnt sich an meinen Türrahmen und nickt. »Guter Plan. Du bist dann also der Good Cop.«
Mir entfährt ein Schnauben.
»Sie ist gar nicht so übel.« Mit einer Kopfbewegung deutet Mila zu mir. »Also … Ich bin Mila, zwanzig Jahre jung und im vierten Semester für Politikwissenschaften.«
Er lächelt sie an, bevor er mit ernster und erwartungsvoller Miene zu mir sieht. Ich kann nicht glauben, dass ich hier mit dem Kerl stehe, der mich bestohlen hat, und mich ihm vorstellen soll. Verdammt. Hätte ich doch nur Beweise für meine Vermutung.
»Summer.« Ich knirsche mit den Zähnen. »Einundzwanzig. Viertes Semester. Ebenfalls in Politikwissenschaften. Von Sternzeichen Skorpion, falls es jemanden interessiert.«
Ares hebt eine Braue und sieht mich mit zusammengekniffenen Augen an.
»Ares. Vierundzwanzig. Ich mache meinen Bachelor in Soziologie.« Er zwinkert mir zu. »Sternzeichen Krebs.«
»Bachelor?«, fragt Mila.
»Ich habe eine gewisse Zeit …« Ares reibt sich über den Nacken. »Nennen wir es pausiert.«
Ich höre den beiden schon kaum mehr zu. Der Fakt, dass sein Major mein Minor ist, lässt mich glauben, dass das Schicksal mir einen Streich spielen will. Dann werde ich ihm wohl nicht nur in unserer Wohnung, sondern auch noch im Soziologiekurs über den Weg laufen.
»Dein Zimmer wäre dann hier.« Mila zeigt auf die Tür neben meiner.
Langsam betritt Ares den Raum. Direkt vor dem kleinen Fenster liegt eine Matratze auf weiß gestrichenen Holzpaletten, durch die Lichterketten gefädelt wurden. Links davon steht ein kleiner Schreibtisch. Der Rest des Zimmers ist voll mit Kleiderstangen, die wir – wie sich nun herausstellt – ganz umsonst gekauft haben.
»Sorry. Die Sachen räumen wir natürlich noch raus«, nuschelt Mila verlegen und beginnt, energisch an einer der Stangen zu ziehen. Das schabende Geräusch auf dem Holzboden hinterlässt eine Gänsehaut auf meinen Armen.
»Lass ruhig. Ich mache das schon. Dein Zimmer ist das um die Ecke, oder?«
Sie blinzelt einige Male, als wäre es komplett abwegig, dass er ihr hilft. Als sie nickt, setzt sich Ares in Bewegung und trägt die Stange voller Klamotten rüber in ihr Zimmer.
Mila dreht sich zu mir um. Ihr Gesicht glüht vor Aufregung. »Fuck, Summer. Der ist süß.« Mit dem Ellenbogen stößt sie mir in die Seite. »Hast du seinen knackigen Hintern gesehen? Und da waren definitiv Vibes zwischen euch beiden …«
Ich presse die Lippen aufeinander und sage nichts. Doch leider muss ich mir selbst eingestehen, dass Mila recht hat. Also, dass Ares attraktiv ist. Das mit den Vibes hingegen hat sie komplett falsch gedeutet. Und süß wäre auch nicht das Wort, mit dem ich Ares beschreiben würde, aber ja … er sieht gut aus. Das kann jedoch nicht über seine arrogante Art hinwegtäuschen.
Kapitel 4
Meredith (4)
Vier verpasste Anrufe. Nein, nicht verpasst. Ignoriert. Eine Sache, in der ich so gut geworden bin, dass ich vermutlich eine Meisterschaft darin gewinnen würde. Im Verdrängen und Ignorieren. Es ist leicht, die Augen vor der Welt zu verschließen. Sich seiner Verantwortung zu entziehen. Sich treiben zu lassen. Aufzugeben.
Ich trete aus der Tür der Universitätsbibliothek und atme tief durch. Es riecht nach einem lauen Sommerabend und salziger Meeresluft. Früher habe ich das Meer geliebt. Bin mit meinen Freunden oder Dad am Wochenende an den Strand gefahren, anstatt in der Großstadt abzuhängen. Doch auch das Wellenrauschen ist von der Liste mit Dingen, die ich liebe, verschwunden. Manchmal frage ich mich, ob da überhaupt noch etwas draufsteht. Wenn man sich selbst ausradiert, gibt es wohl nicht mehr viel, das einem etwas bedeutet. Wie auch, wenn man sich selbst nichts mehr wert ist?
Mit einem Mal stolpere ich, und mein Rucksack gleitet mir von der Schulter. Jemand murmelt ein »Sorry«, bevor er an mir vorbeiläuft. Direkt an der Tür zum Innenhof der Fox University stehen zu bleiben ist vielleicht nicht die beste Idee. Seufzend setze ich mich in Bewegung und versuche, in der Menge unterzugehen.
Die Universität ist ziemlich eindrucksvoll. Eine sandfarbene Fassade, an der sich Efeu einen Weg beinahe bis nach ganz oben zu den roten Dächern und spitzen Türmen gebahnt hat. Ein riesiger Torbogen verbindet die zwei Gebäude mit einem Durchgang.
Als Dad mir verkündete, dass wir umziehen würden, war ich heilfroh. Ich hatte mir sowieso eine Auszeit von dem Studium in Seattle genommen und war wieder bei Dad eingezogen. Er wurde vom Sergeant zum Lieutenant befördert und nahm das Jobangebot bei der Polizei in Ferley an, obwohl er nie aus Portland wegwollte. Weg aus der Stadt, in die er gemeinsam mit Mom zog, in der sie sich ein Zuhause aufbauten, heirateten, in der Mom mit mir schwanger wurde und in der sie am Tag meiner Geburt starb.
Wenn ich mich jetzt am Campus so umschaue, meinen Blick über die Grüppchen schweifen lasse, die sich auf den perfekt gestutzten Rasenflächen tummeln, frage ich mich, was ich hier verloren habe. Wieso ich überhaupt noch studiere. Wäre alles nach Plan gelaufen, wäre ich mit dem Studium längst durch. Doch das Leben verläuft nur selten nach Plan. Bei mir läuft es vor allem bergab, ohne Handbremse.
Der erste Tag war anstrengend, und das Kennenlernen mit meinen neuen Mitbewohnerinnen verlief nicht unbedingt reibungslos. An der Tatsache bin ich wohl nicht ganz unschuldig, doch als die Tür aufging und ich aus großen blauen Augen angeschaut wurde, verschlug es mir für einen Moment die Sprache.
Nicht nur, dass ausgerechnet die junge Frau vor mir stand, die mich des Diebstahls bezichtigt hatte. Es war auch noch so, als würde mein Spiegelbild mir die Tür öffnen. Und ich hasste es. Hasste sie für einen Moment, weil ich in ihrem Gesicht etwas von mir wiedererkannte. Vielleicht die störrische Art oder die Wut auf alles und jeden. Etwas, das mir verriet, dass sie eine Geschichte mit sich trägt. Eine, die genauso dunkel ist wie meine.
Und doch kann ich sie nicht ausstehen. Denn in einer Sache unterscheiden wir uns: Ich laufe nicht umher und beschuldige wildfremde Menschen einer Straftat, für die ich keine Beweise habe. Vor allem nicht aufgrund ihres Aussehens.
»Ares?«
Ich versteife mitten in der Bewegung und bleibe neben einer Bank auf dem Campus stehen. Würde ich Jake heißen, wäre ich jetzt vermutlich weitergegangen und hätte mich nicht angesprochen gefühlt. Aber mein Name ist nicht Jake, und ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der ebenfalls Ares heißt. Ich glaube, nicht jeder hat so ein Faible für die griechische Mythologie wie meine Mom.
»Ha! Hab ich doch richtig gesehen. Hast du noch einen Kurs, oder bist du auch durch für heute? Wollen wir zusammen zum Wohnheim? Oder hast du etwas anderes vor? Seit wann bist du eigentlich schon in Ferley? Warst du vorher schon mal hier?« Milas braune Korkenzieherlocken wippen bei jeder ihrer Fragen von links nach rechts, und ich bin mir nicht sicher, worauf ich zuerst antworten soll. Kann sie sich überhaupt noch an die erste Frage erinnern?
Ich kratze mich verlegen am Hinterkopf, was nur selten vorkommt, aber ihre laute und aufdringliche Art, auch wenn sie es gewiss nur nett meint, überfordert mich. »Also … Ähm …«
»Du musst ihr nicht antworten.« Summer huscht unbemerkt aus der Tür und stellt sich mit verschränkten Armen neben Mila. »Sie möchte nur höflich sein, um dir im Anschluss mitzuteilen, dass wir am Wochenende eine Party bei uns in der Wohnung schmeißen.« Sie schiebt sich das weiße Haar aus dem Gesicht, bevor sie mich mit einem Blick bedenkt, der mir deutlich zu verstehen gibt, dass ich unerwünscht bin. Auf der Party, in ihrer Wohnung, in ihrem Leben.
»Danke. Ich habe komplett vergessen, wieso du meine Freundin bist.« Mila verdreht die Augen, bevor sie zu lachen beginnt und sich wieder mir zuwendet. »Auch wenn ein Funke Wahrheit in Summers Aussage steckt, möchte ich trotzdem Antworten auf meine Fragen. Sei es heute oder eben am Wochenende bei der Party. Zu der du natürlich herzlich eingeladen bist. Das wird bestimmt lustig. So lernst du direkt ein paar Leute von der Uni kennen.«
Juhu, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
»Sehr freundlich von dir, mich in meiner eigenen Wohnung zu einer Party einzuladen, bei der ich nicht einmal gefragt wurde, ob ich einverstanden bin.«
Betroffen blinzelt Mila mich an. Ihr ist anzusehen, dass sie nach einer schlagfertigen Erwiderung sucht, doch sie bleibt stumm. Summers ozeanblaue Augen hingegen werden schmal, und sie muss ihren Kiefer stark aufeinanderpressen, so sehr treten ihre Kieferknochen hervor.
»Du bist nicht gezwungen, am Freitagabend in der Wohnung zu hocken. Such dir gern irgendwo ein ruhiges Plätzchen. Die Party stand bereits fest, als wir noch dachten, wir würden zu zweit bleiben. Tja, leider standest du heute Morgen bei uns auf der Matte.« Summer zieht ihre Jeansjacke über das weiße Kleid. In diesem Outfit wirkt sie beinahe unschuldig, fast schon süß. Hätte ich sie nicht bereits kennengelernt, würde sie mir definitiv ins Auge fallen. »Glaub mir, wir freuen uns darüber genauso wenig wie du.«
»Du bist ein echter Sonnenschein.« Ich grinse Summer frech an, doch ihr Gesicht bleibt unverändert abweisend. »Wann geht es los, und wie viele Leute werden da sein?«
Wolken schieben sich langsam vor die Sonne, und obwohl wir mit Sicherheit noch mindestens dreiundzwanzig Grad haben, hat es sich im Gegensatz zu vorhin deutlich abgekühlt.
»Unsere Clique trudelt meistens schon so gegen acht ein«, entgegnet Mila. »Der Rest vermutlich um neun oder zehn. Wie viele kommen werden, ist eine gute Frage. Mal sind wir nur zehn Leute, und mal spricht es sich so weit herum, dass es doch ein paar mehr werden.« Sie zeigt mir ein perfektes Zahnpastalächeln, das direkt aus einer Werbung entspringen könnte. Mit ihren lockigen Haaren und dem dunklen Teint erinnert sie mich an jedes einzelne Foto von Mom. Mein Herz zieht sich für einen Augenblick schmerzhaft zusammen.
»Eure Clique?« Wo bin ich hier gelandet? In einem Teenie-Film?
Mila macht einen Schritt auf mich zu, und ich weiche instinktiv zurück. »Wir sind zu sechst und seit dem Kindergarten befreundet. Summer, Damian, Caleb, Elijah und Fynn«, erklärt sie mir voller Euphorie.
Mein Handy vibriert, und ich erwarte erneut Merediths Namen auf dem Display, doch es ist Dad. Ich drücke ihn weg, öffne unseren Chat und schreibe ihm, dass ich unterwegs und in ein paar Minuten da bin. Wenn es nach mir ginge, würde ich jetzt viel lieber in mein neues Zimmer gehen und mich einrichten, aber ich habe Dad versprochen, nach der Uni bei ihm vorbeizuschauen.
»War nett, mit euch zu plaudern.« Meine Stimme trieft vor Ironie. »Aber ich muss dann mal los.«
»Okay, vielleicht sehen wir uns später. Ich mache Enchiladas. Das willst du nicht verpassen, glaub mir. Wir lassen dir welche übrig«, ruft mir Mila hinterher.
Mit großen Schritten verlasse ich den Campus. Wenn ich schnell fahre – und das tue ich immer –, bin ich in zehn Minuten bei Dad. Wir sind vor drei Wochen nach Ferley gezogen, und er hat noch so gut wie keinen Karton ausgepackt. Zwei davon gehören mir. Voll mit Sachen, von denen ich nicht weiß, ob ich sie jemals wieder auspacken möchte.
Ich könnte bei ihm wohnen anstatt auf dem Campus. Doch aus vielerlei Gründen bin ich froh darüber, dass er mich hat gehen lassen. Wahrscheinlich spürt auch er, dass ich mich distanziere. Dabei trifft ihn keine Schuld. Er ist ein guter Dad. Der beste, den man sich wünschen kann. Es ist einzig und allein meine Schuld. Ich bin eher die Sorte Sohn, die man nicht einmal seinem schlimmsten Feind wünscht. So war es nicht immer. Es gab eine Zeit, in der wir ein unschlagbares Team waren. Bis zu Tag X.
Dad wartet bereits vor dem kleinen, hellblau gestrichenen Haus. Mit den blonden Haaren und dem hellen Teint sieht er mir kaum ähnlich. Nur die grauen Augen und das Muttermal an der linken Wange haben wir gemeinsam. Ansonsten bin ich das Ebenbild meiner portugiesischen Mutter. Ich spüre Dads abschätzigen Gesichtsausdruck auf mir und weiß ganz genau, was jetzt kommt.
»Muss ich es dir immer wieder sagen? In diesem Bundesstaat ist es verboten, ohne Helm zu fahren, Ares. Ich weiß nicht, ob es dir entgangen ist, aber ich bin ein Cop. Könntest du dich nicht wenigstens auf dem Weg zu mir an die Regeln halten?« Er verschränkt die uniformierten Arme, und das blau-goldene Lieutenant-Abzeichen prangt mir auf seiner Brust entgegen.
»Deine Beförderung ist dir wohl zu Kopf gestiegen«, ziehe ich ihn mit einem frechen Grinsen auf den Lippen auf. Auch wenn ich das nur schwer zeigen kann, bin ich unfassbar stolz auf ihn.
Ich weiß nicht, wie es ihm nach Moms Tod ging. Wie auch? Ich war noch ein Baby. Neu auf dieser brutalen Welt. Manchmal bin ich froh darüber, die Anfangszeit nicht mitbekommen zu haben, und manchmal wünsche ich mir, ich hätte für ihn da sein können. Er sagt mir ständig, dass ich ihm mehr Halt gab, als ich je ahnen könnte. Doch wenn ich daran denke, wie sehr es schmerzt, jemanden verloren zu haben, den ich nie kennenlernen durfte, kann ich mir kaum vorstellen, wie unerträglich es erst für Dad gewesen sein muss.
»Hast du Kaffee da?«, frage ich und steige von meinem Motorrad. »Alternativ würde ich sonst auch ’nen Whiskey nehmen.«
»Ares!«
Ich schmunzle. »War nur Spaß. Beruhig dich.«
»Du bist unmöglich. Siehst du die grauen Haare auf meinem Kopf?« Dad schlägt mir lachend auf die Schulter, während wir gemeinsam die drei Stufen zur Eingangstür hochgehen. »Die habe ich allesamt dir zu verdanken.«
Tatsächlich muss ich zugeben, dass Dad innerhalb der letzten Monate stark ergraut ist und es mich nicht wundern würde, wenn das ein oder andere Haar auf mein Konto geht. Schuldig im Sinne der Anklage.
»Hast du überhaupt schon eine Kiste ausgepackt?«, frage ich, als wir das Wohnzimmer betreten, in dem sich die Umzugskartons bis zur Zimmerdecke stapeln. Die Wände sind in jedem Zimmer weiß, und es wird wohl noch eine Weile dauern, bis hier ein wenig Leben einzieht.
»Du bist nicht einmal vierundzwanzig Stunden weg gewesen. Ich weiß nicht, ob es dir entgangen ist, aber ich hatte heute auch meinen ersten Arbeitstag.« Dad geht rüber zur Küche und füllt unsere Tassen mit der braunen Flüssigkeit. Morgens. Mittags. Abends. Für ihn kann es nie genug Kaffee geben. Und auch für mich geht nichts über einen guten alten Filterkaffee, den man heutzutage kaum mehr irgendwo bekommt, da jeder einen Vollautomaten rumstehen hat. Diese grässlichen, lauten Maschinen stammen direkt aus der Hölle. Daran habe ich keinen Zweifel.
Ich setze mich auf die braune Couch und strecke die Beine aus. »Und? Wie sind deine Kollegen so drauf? Wie ist das Revier?«
»Klein. Sehr, sehr klein. Wie alles in dieser Stadt. Bis auf deine neue Uni. Es ist mir ein Rätsel, wie so eine große Universität in solch einer Kleinstadt ihren Sitz haben kann.« Dad setzt sich neben mich. »Ich habe noch nicht alle auf dem Revier kennengelernt, aber sie scheinen nett zu sein, wenn auch etwas reserviert. Dem neuen Chef steht man zu Beginn wahrscheinlich immer etwas skeptisch gegenüber, aber das wird schon.«
»So ist das wohl in Kleinstädten. Vergiss nicht, dass ich dich gewarnt habe. In einer Stadt, in der gefühlt jeder jeden kennt, ist es ziemlich schwer, in der Menge unterzugehen.« Die Worte richte ich eher an mich selbst. Denn sosehr ich auch aus meiner Heimat wegwollte, umso erdrückender ist der Gedanke daran, nicht mehr anonym zu sein. Gesehen zu werden.
Kapitel 5
Es ist drei Tage her, seit das Semester begonnen hat und Ares bei uns eingezogen ist. Nicht nur bei Mila ist er das Gesprächsthema Nummer eins. Auch auf dem Campus scheint sich sein Name herumgesprochen zu haben. Als ich gestern nach meinen Vormittagskursen auf dem Weg zurück ins Wohnheim an zwei Mädels vorbeiging, tuschelten sie über ihn. Und obwohl jeder seinen Namen kennt, bin ich mir sicher, dass er noch keine Bekanntschaften geschlossen hat. Er ist ständig allein. Entweder läuft er mit gesenktem Kopf und Musik auf den Ohren über den Campus, oder er strafft die Schultern und stolziert erhobenen Hauptes an einem vorbei.
Ich ziehe gerade mein Kleid über, als Mila mein Zimmer betritt, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, anzuklopfen. Normalerweise ist mir das egal, doch seit Ares bei uns wohnt, kriege ich jedes Mal Schnappatmung, weil ich Angst habe, dass er urplötzlich in mein Zimmer stürmt.
»Oh, Summer.« Sie lässt sich rücklings auf mein Bett fallen und verschränkt die Arme über ihrem Kopf. »Ich habe jetzt Philosophie und gar keine Lust. Können wir nicht schwänzen und ein Eis essen gehen? Wir haben heute dreiunddreißig Grad.«
Zum Glück weht in Ferley immer eine leichte Brise. Nicht umsonst ist es ein beliebter Ort zum Kitesurfen.
»Glaub mir, ich würde auch lieber Eis essen und kiten gehen. Geht nur leider nicht. Professor Gregory stellt uns heute unser Projekt vor. Das ist wirklich wichtig und gibt vor allem viele Creditpoints.« Ich wende mich ab und schaue in den Spiegel, um das mintgrüne Sommerkleid, das mir bis kurz über die Knie reicht, an meiner Taille zuzubinden.
»Du bist so eine Streberin.«
Etwas Weiches streift meinen Hinterkopf, und als ich mich gerade umdrehe, greift Mila nach dem nächsten Kissen. Ich ducke mich und schmeiße es zurück. »Lass uns später mit den Jungs was essen gehen. Okay?«
Mila nickt. »Bist du Damian schon über den Weg gelaufen?« Sie drückt das Plüschkissen eng an ihre Brust.
»Bist du denn schon Caleb über den Weg gelaufen?«, frage ich sie im Gegenzug, und obwohl sie mich böse anfunkelt, sind die Herzchen in ihren Augen nicht allzu schwer zu erkennen. Seit sie und Caleb vor einem Jahr in einer wilden Nacht übereinander hergefallen sind, hat sich zwischen ihnen etwas verändert. Sie kann mir noch so oft sagen, dass sie keine Gefühle für ihn hat, ich kaufe es ihr nicht ab. Und auch von ihm weiß ich, dass Mila nicht bloß eine gute Freundin ist. Doch aus irgendeinem Grund schaffen sie es nicht, ehrlich zueinander und zu sich selbst zu sein. Stattdessen daten sowohl Mila als auch Caleb ständig irgendwelche Leute, obwohl jedes Mal etwas in ihr bricht, wenn sie ihn mit einer Neuen sieht. Und ich verstehe nicht, wieso niemand außer mir das Brechen ihres Herzens hört?
»Lenk nicht vom Thema ab. Also? Hast du Damian gesehen?«, bohrt sie weiter nach.
Ich setze mich auf den Stuhl vor meinem Schreibtisch. »Nein. Als ich ihn gestern von Weitem gesehen habe, bin ich sofort umgedreht. Ich weiß gar nicht, wieso. Eigentlich sollte alles cool zwischen uns sein. Nach unserem Ausrutscher haben wir bereits unzählige Male telefoniert und geschrieben.«
»Aber?«, hakt Mila nach.
»Aber es ist etwas anderes, wenn man sich dann wieder gegenübersteht. Ist das nicht absurd? Wir waren und sind beste Freunde. Wir wollen beide nichts voneinander. Und trotzdem habe ich Angst, dass es komisch wird.« In der besagten Nacht waren wir beide betrunken. Er, weil er den erneuten Streit mit seinen Eltern, die sich einen Scheiß für ihn interessieren und nur auf Leistung aus sind, vergessen wollte. Und ich, weil ich seit Tagen nicht mehr richtig geschlafen hatte, aus Angst, immer und immer wieder diesen Albtraum zu durchleben.
»Summer?«
»Hm?« Ich sehe auf.
»Das wird schon gut gehen«, sagt Mila, steht auf und beugt sich zu mir herunter, um mich in den Arm zu nehmen, bevor wir gemeinsam in den Wohnbereich gehen.
»Ich wollte mir vor dem Kurs noch einen Kaffee holen. Kommst du mit?«
»Muss meine Sachen noch packen. Ich schreibe dir später und sage den Jungs Bescheid, dass wir essen gehen«, antwortet Mila und tänzelt zurück in ihr Zimmer, während sie Señorita von Shawn Mendes und Camila Cabello vor sich hin summt. Ihre braunen Locken hüpfen hin und her.
Ich öffne einen Küchenschrank nach dem anderen. Schaue im Geschirrspüler nach, auf dem Couchtisch und auch in meinem Zimmer. Doch mein Becher ist nirgendwo aufzufinden. Na super. Habe ich den schon wieder verschlampt? Das wäre dann der vierte To-go-Becher in kürzester Zeit. Die Barista im Café muss glauben, ich habe eine Obsession mit Bechern.
»Hi«, höre ich Ares plötzlich rufen, als ich gerade meine Kopfhörer aufsetzen will. Meine Augen bleiben an etwas Blauem in seiner Hand hängen. Das kann doch nicht wahr sein.
»Das da«, sage ich und zeige unverfroren auf den Becher in seiner Hand, »ist meiner!«
»Ups.«
Mir fällt die Kinnlade runter. Sekunden vergehen, doch aus seinem Mund kommt nichts mehr. Keine Entschuldigung und auch kein Angebot, ihn mir zurückzugeben. Im Gegenteil. Ares’ Lippen verziehen sich zu einem frechen Grinsen, das in mir solch eine Wut weckt, dass ich ihm den Becher am liebsten um die Ohren hauen möchte. Ohne mich aus den Augen zu lassen, legt er meinen Becher an seine Lippen und trinkt aus ihm.
»Du bist …«
»Atemberaubend? Heiß? Anbetungswürdig?« Er wackelt mit seinen Brauen.
Ich mache einen Schritt auf ihn zu. Dann noch einen und noch einen. Bis wir so dicht voreinanderstehen, dass ich glaube, seinen Atem auf meiner Haut spüren zu können. » Du bist nichts als nervig! Und ein verdammter Dieb!«
Meine Finger streifen seine, als ich versuche, ihm den Becher aus der Hand zu reißen. Doch anstatt loszulassen, zieht er mich mit einem Ruck noch näher an sich heran. Seine gewittergrauen Iriden verdunkeln sich.
»Ich dachte, dies sei der Moment, in dem wir uns küssen.« Er schmunzelt, und obwohl ich ihm am liebsten eine knallen würde, spüre ich, wie meine Wangen glühen und ich eine Sekunde zu lange auf seine geschwungenen Lippen blicke. Dieser verdammte Mistkerl.
»Träum weiter. Bevor wir uns küssen, friert die Hölle zu.« Gerade als ich erneut an dem Becher ziehen möchte, lässt er ihn los, und ich taumle leicht zurück.
Ares legt seinen Zeige- und Mittelfinger an die Schläfe, als würde er salutieren. »Bis später, Sweetheart.«
»Nenn mich nicht so!«
»Ich finde, Sweetheart passt perfekt zu dir und deiner überaus freundlichen und süßen Art.«
»Fick dich, Ares!«
Ein schiefes Lächeln schmückt sein Gesicht, bevor er sich umdreht und die Wohnung verlässt. Vollkommen fassungslos stehe ich da und starre noch sekundenlang auf die Tür, die er ziemlich laut ins Schloss hat fallen lassen.
Sweetheart. Ein Wort, mit dem ich unzählige Erinnerungen verbinde und gleichzeitig viel zu wenige. Meine leibliche Mom hat mich immer so genannt. Summer, du bist so süß wie deine Lieblingspancakes. Deshalb bist du mein kleines Sweetheart. Ihre Stimme ist nur noch ein Echo in meinem Kopf. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich sie richtig in Erinnerung habe. Es gibt keine alten Videoaufzeichnungen von ihr, von Dad, von uns. Alles ist fort. Zu Asche verbrannt. Von unserem alten Leben blieb nichts übrig. Nichts, außer ich selbst.
Nur Mike ist es zu verdanken, dass ich zumindest ein paar Fotos von meinen Eltern habe. Auch wenn es nicht viele sind. Sie sind gemeinsam aufgewachsen, weshalb er sogar noch alte Jugendfotos von ihnen besaß, die er mir alle gegeben hat. Und genau diese wenigen Fotos sind mein größter Besitz.
Ares hat kein Recht, mich Sweetheart zu nennen, und sollte er es noch einmal tun, werde ich nicht mehr so freundlich bleiben. Ich verstehe nicht, was Mila an ihm sympathisch finden kann. Sympathisch. Weiß sie überhaupt, was dieses Wort bedeutet? Für mich ist er nur eins: Provokation auf zwei Beinen.
In den letzten Tagen haben wir kaum etwas über ihn in Erfahrung bringen können. Er ist jeder von Milas Fragen ausgewichen, war entweder unterwegs oder hat sich in sein Zimmer verkrochen und Gitarre gespielt. Meine Angst, dass er nicht spielen kann und uns mit seiner Musik belästigen würde, war unbegründet. Ares hat nicht nur das Talent, mich zum Brodeln zu bringen. Nein, er spielt auch noch sehr gut Gitarre. So gut, dass Mila sich gestern davon überzeugen wollte, ob er tatsächlich selbst spielt oder nur Musik hört. Also hat sie kurzerhand seine Tür aufgerissen. Wir können von Glück reden, dass er nicht nackt war. Wobei der Anblick von einem nackten Ares mit Gitarre vor seinem Körper durchaus amüsant wäre.
Summer! Hör auf, über diese Arschkröte nachzudenken, und geh los, bevor du zu spät bei der Vorlesung bist!
Ich kippe Ares’ schwarzen Kaffee aus meinem Becher in die Spüle und schrubbe mindestens zehnmal über jede Stelle, die er mit seinen Lippen berührt hat. Mit einem vermutlich mehr als klinisch reinen Becher verlasse ich unsere Wohnung. Auch wenn mir nicht mehr viel Zeit bleibt, lasse ich es mir nicht nehmen, schnell ins waves & coffee zu gehen. Auf dem Campus befinden sich neben den Lehrräumen und Wohnheimen auch die Mensa, zwei Bistros und ein Café.
Sobald ich das waves & coffee betrete, umgibt mich ein angenehmer Geruch von frischen Kaffeebohnen. Mein zufriedenes Lächeln gefriert.