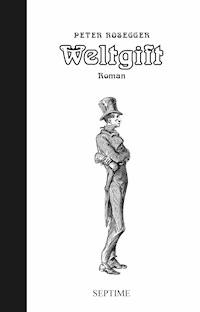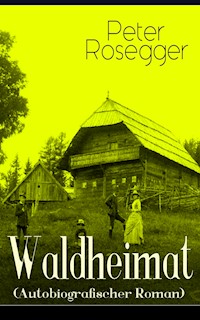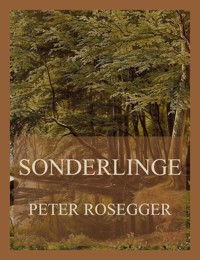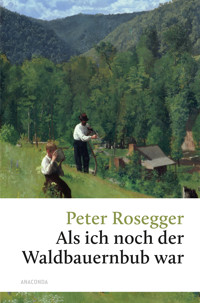
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Große Klassiker zum kleinen Preis
- Sprache: Deutsch
Im Dörfchen Alpl in der Steiermark wuchs Mitte des 19. Jahrhunderts ein Junge auf, der dem Leben der Menschen in seiner »Waldheimat« später dieses literarische Denkmal setzen sollte. In einem Reigen vergnüglicher Erzählungen und Schilderungen schreibt Peter Rosegger über das urwüchsige Leben als Bub inmitten der Natur. Umgeben von Wäldern, Tieren, Typen und den sagenhaften Geschichten der Altvorderen, erlebt der Junge den Lauf der Welt auf seinem entrückten und doch ganz einzigartigen Fleckchen Erde.
- Peter Rosegger, der nur notdürftig Lesen und Schreiben gelernt hatte, war einer der beliebtesten Schriftsteller seiner Zeit
- »Es bringt seelische Unruhe, zu hoffen und zu fürchten zugleich ... Aber dieses Hängen an verschiedenen Angeln, dieses peinliche Unerlöstsein wird mir gemildert durch meine höchst einfache Weltanschauung, die ich aus der dämmernden Waldheimat mitgebracht habe.« (Peter Rosegger in seinem letzten Brief)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Peter Rosegger
Als ich noch derWaldbauernbub war
Jugendgeschichten aus der Waldheimat
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt undenthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugteNutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzungdurch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitungoder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere inelektronischer Form, ist untersagt und kann straf- undzivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten,so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir unsdiese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Standzum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Kindheits- und Jugenderinnerungen des österreichischenSchriftstellers Peter Rosegger (1843–1918) erschienen ab 1877 invier Bänden unter dem Titel Waldheimat. Ab 1900 bis 1902erschien, herausgegeben vom Hamburger Jugendschriftenausschuss,erstmals eine gekürzte, auf die Kindheitsjahre beschränkte Fassungin drei Bänden unter dem Titel Als ich noch der Waldbauernbub war.Der vorliegende Band folgt einer Auswahl, die 1974 in einerGemeinschaftsausgabe vom Staackmann Verlag und demÖsterreichischen Agrarverlag in München und Wien erschienund sich nur in wenigen Stücken von der Hamburger Fassungunterscheidet. Orthografie und Interpunktion wurdenunter Wahrung von grammatischen Eigenheiten aufneue Rechtschreibung umgestellt.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2023 by Anaconda Verlag, einem Unternehmender Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: Thomas Pollock Anschutz, »The Farmer and HisSon at Harvesting« (1879), Private Collection, Photo © Christie’sImages / Bridgeman Images
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
Satz und Layout: InterMedia – Lemke e. K., Heiligenhaus
ISBN 978-3-641-31147-6V001
www.anacondaverlag.de
Ich bin daheim auf waldiger Flur,Mein Hüttchen ist ein grüner Baum,Mein Ruhebett der WiesensaumAm Herzen der Natur.
Ein Rehlein kommt durch Zweige dicht,Mir dringt ans Ohr sein weicher Laut,Es sieht mich an, es spricht so traut,Und ich versteh es nicht.
Nun kommt ein blühend Mädchen noch,Und sinnend steht es auf der Flur;Es sieht mir stumm ins Auge nur,Und ich versteh es doch.
Inhalt
Von meinen Vorfahren
Vom Urgroßvater, der auf der Tanne saß
Ums Vaterwort
Die ledernen Brautwerber meines Vaters
Allerlei Spielzeug
Wie der Meisensepp gestorben ist
Wie ich dem lieben Herrgott mein Sonntagsjöppel schenkte
Wie das Zicklein starb
Dreihundertvierundsechzig und eine Nacht
Geschichten unter dem wechselnden Mond
Als ich Bettelbub gewesen
Als ich zur Drachenbinderin ritt
Als dem kleinen Maxel das Haus niederbrannte
Als ich das erste Mal auf dem Dampfwagen saß
Als ich …
In der Christnacht
Was bei den Sternen war
Wie ich mit der Thresel ausging und mit dem Maischel heimkam
Als ich auf den Taschenfeitel wartete
Als ich das Ofenhückerl war
Als ich um Hasenöl geschickt wurde
Als ich mir die Welt am Himmel baute
Als ich die Christtagsfreude holen ging
Das Schläfchen auf dem Semmering
Als ich nach Emmaus zog
Am Tag, da die Ahne fort war
Der Fronleichnamsaltar
Weg nach Mariazell
Als ich der Müller war
Als ich den Himmlischen Altäre gebaut
Als ich im Walde beim Käthele war
Als die hellen Nächte waren
Aus der Eisenhämmerzeit
Als wir zur Schulprüfung geführt wurden
Als ich Eierbub gewesen
Von meinen Vorfahren
Bauerngeschlechter werden nur in Kirchenbüchern verbucht.
Das Kirchenbuch zu Krieglach, wie es heute vorliegt, beginnt im siebzehnten Jahrhundert mit dem Jahre 1672. Die früheren Urkunden sind wahrscheinlich bei den Einfällen der Ungarn und Türken zugrunde gegangen. Zu Beginn des Pfarrbuches gab es in der Pfarre schon Leute, die sich Roßegger schreiben ließen. Nach anderen Urkunden waren in jener Gegend schon um 1290 Rossecker vorhanden. Sie waren Bauern. Teils auch Amtmänner und Geistliche. In Kärnten steht noch heute eine Schlossruine, Roßegg oder Rosegg genannt; man könnte also, wenn man hoffärtig sein wollte, sagen, die Roßegger wären ein altes Rittergeschlecht und obiges Schloss sei ihr Stammsitz. Aber diese Hoffart brächte zutage, dass wir herabgekommene Leute wären. – Bei Bruck an der Mur in der Steiermark steht ein schöner Berg, der auf seiner Höhe grüne Almen hat und einst viele Sennhütten gehabt haben soll. Dieser Berg heißt das Roßegg. Man könnte also, wenn man bescheiden sein wollte, auch sagen, die Roßegger stammten von diesen Almen, wo sie einst Hirten gewesen, Kühe gemolken und Jodler gesungen hätten. – In der nächsten Nachbarschaft der Krieglacher Berggemeinde Alpl, in der Pfarre Sankt Kathrein am Hauenstein, der Gegend, die einst von Einwanderern aus dem Schwabenlande bevölkert worden sein soll, steht seit unvordenklichen Zeiten ein großer Bauernhof, von jeher insgeheim »beim Roßegger« genannt, trotzdem die Besitzer des Hofes nun schon lange anders heißen. Möglich, dass genannter alter Bauernhof das Stammhaus der Roßegger ist. Diese sind ein sehr weitverzweigtes Geschlecht geworden; in Sankt Kathrein, in Alpl, in Krieglach, in Fischbach, in Stanz, in Kindberg, in Langenwang usw. gibt es heute viele Familien Roßegger, deren Verwandtschaft miteinander gar nicht mehr nachweisbar ist. Zumeist sind es einfache Bauersleute. Ein Priester Rupert Roßegger hat große Reisen gemacht, darüber geschrieben und auch Gedichte verfasst. – Das, was ich von meinen Ahnen weiß, hat mir größtenteils mein Vater erzählt, er hat besonders in seinen alten Tagen gerne davon gesprochen. Was daran Tatsache, was Sage ist, lässt sich schwer bestimmen.
Der Bauernhof in Alpl, zum untern Kluppenegger, in diesem Buche auch der »Waldbauernhof« genannt, gehörte zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts einem Manne, genannt der Anderl (Andreas) in Kluppenegg. Das soll ein wohlhabender Mann gewesen sein und in der Erinnerung der Familie wird er noch heute der »reiche Kluppenegger« geheißen. Er hat ein Pferd besessen, mit welchem er für die Gemeinde Alpl den Saumverkehr mit dem Mürztale (Fahrweg hat es damals noch keinen gegeben) versorgt haben dürfte.
Der Anderl in Kluppenegg war einmal beim »Graßschnatten« vom Baum herabgefallen und hatte einen hinkenden Fuß davongetragen. So soll er des Sonntags auf seinem Rösslein in die Kirche geritten sein, auch beim Wirtshause sich den Krug Wein aufs Rösslein habe reichen lassen und ein großes Ansehen gehabt haben.
Dieser Anderl hat wahrscheinlich auch das stattliche Haus gebaut, welches auf seinem Trambaume die Jahreszahl 1744 führt und dessen Zimmerholz an vielen Stellen heute noch hart wie Stein ist, weil man zu jener Zeit das Bauholz aus reifen Waldungen genommen hat. Der Anderl hatte einen Bruder bei sich in der Einwohne, der Zimmermann war. Zur Zeit gehörten zum Hofe zwei »Gasthäuseln«; in dem einen, das gleich oberhalb des Gehöftes stand, wohnte ein Schneider, in dem andern, das tief unten an der steilen Berglehne war, wohnte ein Schuster; der Anderl selbst verstand die Weberei, die Lodenwalcherei und die Hautgerberei, also hatte er die wichtigsten Gewerbe beisammen und konnte den Nachbarn damit aushelfen. Auch hatte er unten im Graben eine zweiläufige Getreidemühle gebaut und gleich in demselben Gebäude eine Leinölpresse. Der Anderl soll fast Tag und Nacht gearbeitet haben, sich ausgeruht nur auf dem Pferde. Von einem Kluppenegger geht die Sage, dass er eines Tages auf dem Pferde sitzend tot nach Hause gekommen sei; ob das von dem Anderl gilt oder von einem noch Älteren, das kann ich nicht berichten.
Der Anderl hat nur ein einziges Kind gehabt, eine Tochter. Die soll viele Freier abgewiesen haben. Da kam der junge Nachbar vom Riegelbauernhof.
Das Riegelbauernhaus ist das zuhöchst gelegene in Alpl und von ihm aus sieht man rings über die Engtäler des Alpls hinweg in der Ferne hohe Berge. Man pflegte in alten Zeiten die Höfe hoch hinauf zu bauen, so hoch, dass man oft nicht einmal einen Brunnen hatte, eben wie auch bei diesem Riegelbauernhofe, wo man jeden Tropfen Wasser unten an der steilen Berglehne holen musste. Das Gebäude der Riegelbauern ist erst vor Kurzem niedergerissen worden. In diesem Hause tauchten jetzt die Roßegger auf. Ihrer sollen zur Zeit viele Buben gewesen sein und einer davon, der Josef, ging zur Kluppeneggertochter herüber. Also hat die Kluppeneggertochter vom Riegelbauernhofe her den Josef Roßegger geheiratet, welcher geboren worden war am 16. März 1760.
Der Josef soll ein kleines, rühriges Männlein gewesen sein, an seinen kurzen, rundlichen Beinen niedrige Bundschuhe, grüne Strümpfe und eine Knielederhose getragen haben, auf dem Haupte einen breitkrempigen Filzhut, unter welchem lange graue Locken bis zu den Achseln herabreichten. Ein kleines hageres Gesicht, stets wohlrasiert, graue lebhafte Äuglein und im Munde allzeit ein harmloses Späßlein, sodass es immer zu lachen gab, wo der »Seppel« dabei war.
Der Seppel hat auch die Kunst zu schreiben verstanden. In einem alten Hausarzneibuche steht mit nun freilich verblasster Tinte schlicht und schlecht geschrieben: »Groß Frauentag, 1790. Ich, Joseph Roßegger, habe am Heutigen den Erstgeporenen Suhn Ignatzius bekemen. Empfelche das klein Kind unserer Lieben Frau.«
Vom Seppel erzählt man auch, dass er schon in seiner Jugend graue Haare bekommen hätte. Er sei nämlich während eines schweren Nachtgewitters auf einer hohen Tanne von wütenden Wölfen belagert worden und habe Todesangst ausgestanden.
Der Seppel soll eine Alm gepachtet und sich nebst Ackerbau und Holzwirtschaft viel mit Viehzucht befasst haben. Er hatte zeitweilig acht Knechte und ebenso viele Mägde gehabt, zu denen nachher noch die eigenen Kinder kamen.
Die Söhne hießen Ignatz, Michel, Martin, Simon, Baldhauser, Jakob. Von diesen Brüdern ist die große Verträglichkeit und Einigkeit in der ganzen Gegend sprichwörtlich geworden. In jeder Arbeit halfen sie einander, und wo an Sonntagen einer der »Kluppeneggerbuben« war, da sah man die anderen auch. Keiner ließ über die anderen ein böses Wort aufkommen, jeder stand für alle ein. Wenn es um einen Bruder ging, so hob selbst der Friedfertigste, der Ignatz, seinen Arm. Wer einen dieser Burschen überwinden wollte, der musste alle sechs überwinden, und der, für den einer derselben eintrat, hatte sechs gute Kameraden.
Mehrere dieser Brüder kauften sich später Bauerngüter im unteren Mürztale oder erheirateten sich solche. Dadurch entkamen sie der Militärpflicht. Soldat ist nur einer gewesen, derselbe starb zu Preßburg an Heimweh. Der Baldhauser, welcher die Soldatenlänge nicht hatte, brauchte sich um einen Besitz nicht zu bemühen, er blieb im heimatlichen Hofe als Knecht.
Der Josef erreichte ein hohes Alter. Auf einem Besuche bei einem seiner verheirateten Söhne im Mürztale ist er fast plötzlich, über Nacht, gestorben (1815). Bevor er zu jenem Besuche fortging, soll er gebeugt und auf seinen Stock gestützt, hastig dreimal um den Kluppeneggerhof herumgegangen sein und dabei mehrmals gesagt haben: »Nicht geboren, nicht gestorben, und doch gelebt!« Als er hierauf nicht mehr heimgekommen war, hat man das so gedeutet, als hätte er sagen wollen: In diesem Hause bin ich nicht geboren und werde darin nicht sterben, und habe doch darin gelebt.
Zur selben Zeit war schon sein Sohn Ignatz (geboren 1790) Besitzer des Kluppeneggerhofes.
Er heiratete eine Tochter aus dem Peterbauernhofe, namens Magdalena Bruggraber. Diese Magdalena hatte auch mehrere Brüder, wovon einer sich das nachbarliche Grabenbauernhaus erwarb; sein Bruder Martin war bei ihm Knecht. Seit jeher waren diese beiden ein paar gute Genossen gewesen zu den Kluppeneggersöhnen; jetzt in Verwandtschaft getreten, standen sie noch fester zu ihnen. Und doch ist es einmal anders geworden, wir werden das später erfahren.
Der Ignatz Roßegger soll ein schöner, stattlicher Mann gewesen sein, sonntags in schmucker Steirertracht, wie sie damals der Erzherzog Johann wieder zu Ehren gebracht hatte, ins Pfarrdorf gekommen sein und gerne gesungen haben. Dem »Natzl in Kluppenegg« seine helle Stimme war in der ganzen Gegend bekannt, und keinen Tag gab Gott vom Himmel, ohne dass man den »Natzl« jauchzen hörte auf der Weiden oder in den Wäldern von Alpl. Im Gegensatz zu seinem Vater trug er kurzgeschnittenes Haupthaar, ließ aber seinen blonden Schnurrbart stehen. Die Herrschaft (das Grafenamt Stubenberg) sah es damals nicht gerne, wenn die Leute ihren Bart stehen ließen, das war »neuerisch«, aber den harmlosen lustigen Natzl hat sie deshalb nie zur Verantwortung gezogen.
Den Ignatz soll nie jemand trotzig oder zornig gesehen haben, mit jedermann war er gemütlich und verträglich, die Alplbauern sagten viel später noch, einen besseren Nachbar kann sich kein Mensch wünschen, als es der Natzl gewesen ist. Weitberufen war er als Kinderfreund und wo ihm auf Wegen und Stegen ein Kind begegnete, da tat er sein rotes Lederbeutelchen auf und schenkte ihm einen Kreuzer. Auch selbst war er mit Kindern reich gesegnet, sieben Söhne, Lorenz, Franziskus, Sebastian, Thomas, Anton, Jakob, noch einmal Franziskus, zwei Töchter, Margareta und Katharina, wurden ihm rasch nacheinander geboren; mehrere starben in früher Kindheit, die übrigen wuchsen auf unter den strengen Züchten der Mutter Magdalena. Der Ignatz hatte sich aber, wahrscheinlich aus Ursache seiner Leutseligkeit, einen großen Fehler angelebt. Er saß gerne in den Wirtshäusern. Wenn er auch nicht viel trank, so trank er doch wenig, wenn er auch nicht um Hohes Karten spielte, so spielte er doch um Geringes, wenn er auch nicht schweren Tabak rauchte, so rauchte er doch leichten, und wenn er auch nicht Schulden machte, so ward sein kirschroter Geldbeutel zum Mindesten immer um einiges dünner. Die Woche über arbeitete er fleißig, des Sonntags aber, wenn er in die Kirche ging, da kam er nie zum Mittagessen nach Hause, wie es sonst der Brauch, da setzte er sich in ein Wirtshaus, ließ sich’s wohl geschehen, jodelte ein wenig, spielte ein wenig, war stets heiter, und erst wenn es finster wurde, ging er den weiten Weg ruhig nach Hause.
Seine Magdalena muss ein scharfes Weib gewesen sein. So spät er auch kommen mochte, immer hat sie ihn wachend und gerüstet erwartet. Das soll dann stets ein Wetter gewesen sein, dass das ganze Haus erbebt hat, erbebt mitsamt den Kindern, die es nicht begreifen konnten, wie die Mutter wegen seines Nachtheimkommens so herb sein konnte, da er ja doch heimgekommen war. Er soll die heftigsten Vorwürfe ruhig und schweigend über sich ergehen lassen und nur immer die Kinder beschwichtigt haben, die sie durch ihr Lärmen aus dem Schlaf geschreckt.
Manchmal nahm er auch einen oder den andern seiner Knaben mit in die Kirche, was den Kleinen allemal ein Festtag war. Nur der Knabe Lorenz, so lieb er sonst seinen Vater hatte, wollte bald nicht mitgehen, denn der bekam Heimweh, wenn er den ganzen Sonntagnachmittag neben ihm im Wirtshaus sitzen musste.
Der Knabe blieb also im Schachen hinter dem Hause stehen, bis der Vater nachkommen würde. Die Schatten der Schachenbäume wurden länger und vergingen endlich, ein Gewitter stieg auf und ging nieder, vom Riegelbauernwalde war es manchmal wie das Geheul eines wilden Hundes, der Knabe stand im Schachen und wartete auf den Vater. Der Vater begleitete aber an diesem Tage seinen Nachbar und Gevatter Grabler bis zu seinem Hause, kam daher auf einem anderen Wege heim und konnte der Magdalena Frage nach dem Knaben Lorenz nicht beantworten. Der Lorenz war im Wirtshaus ja längst vor ihm heimgegangen und war jetzt nicht da. Der Schreck des Ignatz war so groß, dass er zur Stunde ein heiliges Fürnehmen tat, wenn der Knabe glücklich wiedergefunden werde, so betrete er sein Lebtag kein Wirtshaus mehr, außer es sei auf einer Wallfahrt oder sonst auf einer Reise, oder es sei bei seiner goldenen Hochzeit mit der Eheliebsten Magdalena.
Bei der Eheliebsten Magdalena würde zu solcher Stunde diese Wendung nicht viel gefruchtet haben, wenn der Knabe nicht jetzt zur Tür hereingegangen wäre.
Das Gelöbnis soll der Ignatz leidlich gehalten haben, obwohl durch einen seltsamen Zufall eine neue Versuchung herantrat, mit einem guten Kruge sich manchmal gütlich zu tun.
Eines Tages, als sein Kind Jakob gestorben war, und als er, um beim fernen Pfarramte die Leiche anzeigen zu gehen, aus seinem Gewandkasten ein frisches Linnenhemde herausnehmen wollte, wie solche von seiner Mutter noch eigenhändig gesponnen und genäht im Vorrate waren, fiel es ihm auf, dass der Kasten einen so dicken Sohlboden hatte. Durch Klopfen kam er darauf, dass dieser Boden hohl war, durch Umhertasten bemerkte er an der inneren Ecke ein Schnürchen. Er zog an und da hob sich ganz leicht ein Deckel und ließ ihn hineingehen auf sieben vollgepfropfte Säcklein, die zwischen dem Doppelboden verborgen gewesen waren. Aus alten Hosen getrennte Säcke waren es, mit Schuhriemen zugebunden, und ihr Inhalt Silbergeld, lauteres Silbergeld.
Der Ignatz erzählte von diesem Funde seinem Weibe und seinen Brüdern. Während in der Stube noch das Leichlein lag, setzten sie sich auf dem Küchenherde zusammen und untersuchten das Geld; es war keine landläufige Münze darunter, lauter alte »Taler«, manche gar unregelmäßig, fast eckig in der Form, mit fremdartiger Prägung, teils abgegriffen und schwarz, aber von so hellem Klange, dass die Ohren gellten.
Nun rieten sie hin und her, von wem wohl der Schatz stammen konnte, und da fiel es dem Ignatz ein, dass er von ihrem Großvater, dem Anderl in Kluppenegg, herrühren dürfte, der als reich bekannt gewesen, von dem aber nach seinem Tode kein Bargeld gefunden worden war. Die Brüder beschlossen also, das Silbergeld unter sich zu teilen. Jeder soll an die siebzig Gulden bekommen haben, der Ignatz um einen Teil mehr, und das war zum Finderlohn. Weiter hatten sie keinem Menschen von dem Funde gesagt, sollen aber ihre liebe Not gehabt haben mit einzelnen der alten, unbekannten Münzen, um sie an den Mann zu bringen. Der Betrag war für die damalige Zeit ein bedeutender, doch keinem der »Kluppeneggerbuben« hatte man es angemerkt, dass sie einen Reichtum besaßen. Der Ignatz mag zu Ehren der alten Schimmeln wohl einmal einen Krug getrunken haben, ohne dass die Magdalena erheblichen Einspruch tat, im Ganzen mied er die Wirtshäuser. Vorübergehen konnte er zwar an keinem, und so blieb er ihnen fern, indem er an Sonn- und Feiertagen nur gar selten in die Kirche ging, sondern seinen Rosenkranz zu Hause betete und dann vor dem Hause seine Jodler sang über die grünen Höhen, sodass die Magdalena erst eine Freude hatte an ihrem braven und lustigen Mann.
Da kam jene Kirchweih zu Fischbach. Dieser Ort ist von Alpl durch den Gebirgszug der Fischbacher Alpen getrennt. Aber man ging an Festtagen gern über dieses waldige Gebirge, weil es in Fischbach sehr lustige und kecke Leute gab, weil in den dortigen Wirtshäusern damals noch keine ständige Polizei war, wie etwa im Mürztale, und weil es daher dort sehr ungezwungen herging. Besonders die Fischbacher Herbstkirchweih war weitum berüchtigt, und wenn irgendwo Bauernburschen miteinander einen unausgetragenen Händel hatten, so stellten sie sich bei der Kirchweih ein, wo es dann allemal zu einem blutigen Raufen kam. Ignatz’ Bruder Baldhauser war dem Raufen nicht abgeneigt. Manchmal, wenn er des Morgens die damals übliche, schön geformte und mit weißen Nähten gezierte Lederscheide mit Pfeifenstierer, Gabel und dem großen Messer in den Hosensack schob, soll er gesagt haben: »Man weiß nicht, wozu man’s brauchen kann.« Bei den Weibsbildern scheint der Baldhauser auch nicht blöde gewesen zu sein, denn er wählte sich allemal eine solche aus, die auch anderen Burschen gefiel, und so kam es vor, dass das Recht des Stärkeren entschied. Der Baldhauser war ein mehr kleiner, untersetzter Mann, sonst sehr bedächtig und langsam in seinen Bewegungen, beim Ringen aber der Flinkeste und Abgefeimteste, der seinen Gegner fast allemal so bettete, wie er nicht gebettet sein wollte. Wer es also mit dem »Hausel« zu tun hatte, der trachtete erstens ihm in Abwesenheit seiner Brüder beizukommen, was schon leicht war, da die meisten derselben in eine fremde Gegend fortgeheiratet hatten. Trotzdem pflegte ein Gegner des Baldhauser sich um Genossen umzuschauen, und wenn ihrer drei oder vier gegen ihn waren, da geschah es wohl manchmal, aber durchaus nicht immer, dass er wesentliche Merkmale heimbrachte, worauf seine Schwägerin Magdalena freilich allemal die Bemerkung tat: »All zwei Füß’ hätten sie dir abschlagen sollen, das wär dir gesund, du Raufbär!« Solcher Meinung war der Baldhauser zwar nicht.
Da kam nun wieder einmal die Fischbacher Herbstkirchweih, und er hatte wieder einmal eine Liebste, die Heidenbauerdirn, auf welche das Eigentumsrecht aber der Grabenbauer gelegt haben wollte. Dem Grabenbauer hatte er schon früher einmal Post geschickt: »Du! Wenn du noch länger gesunde Knochen haben willst, so lass die Dirn!«, und trotzdem hörte er nun, der Grabenbauer führe dieselbe zur Kirchweih, habe aber gleichzeitig auch etliche Kameraden bestellt. Da wusste er freilich, dass zwischen ihm und den Grabenbauernleuten der Friede gebrochen war und was er zu tun hatte bei dieser Kirchweih zu Fischbach. Sein Bruder, der Ignatz, wusste nichts davon, der Baldhauser sagte ihm auch nichts, lud ihn nur ein, mit ihm über das Gebirge zu gehen nach Fischbach zu dem lustigen Feste, wo getanzt und gesungen würde über die Maßen. Der Ignatz fand sich gern bereit und wollte auch seinen Knaben Lorenz mitnehmen. Dieser war von Natur aus zart und beschaulich angelegt; wo es lärmende Leute gab, da war er nicht gern; die Wirtshäuser waren ihm ja ein Graus, und da hatte er gehört, auf Kirchweihen gäbe es noch mehr Wirtshäuser als sonstwo; also bliebe er lieber daheim. Seine Mutter rief: »Der Junge ist gescheiter wie der Alte und weiß, dass Kinder nicht auf Kirchweihen taugen. Bliebest auch du daheim, Natzl, morgen tät’s dir gewiss nicht leid sein.«
Der Ignatz zog aber sein schönes Gewand an und ging mit seinem Bruder Baldhauser nach Fischbach. Als sie hinkamen, war der Marktplatz schon voller Buden, Leute und Gesurre; Leutedunst, Tabakrauch, Metgeruch, alles durcheinander, aus den Wirtshäusern fröhlicher Lärm, und der Baldhauser wollte gleich zum Bauernhoferwirt hinein. Der Ignatz sagte, sie täten zuerst doch lieber ein bissel in die Kirche schauen, weil man gerade zum Hochamt läute; und nachher standen sie eine Stunde lang eingekeilt in der Menge, und der Baldhauser war sehr ungeduldig und dachte nach, wie er mit dem Grabenbauer zusammenkommen würde.
Nach dem Gottesdienste kauften sie auf dem Markte Schuhnägel, Pfeifenzugehör mit Tabak, und der Ignatz weißbestriemte Lebzeltherzen für die Kinder daheim und ein großes Lebkuchenstück mit Mandeln gefüllt für seine Magdalena. Das band er in ein blaues Sacktuch zusammen und dann gingen sie gleich zum Neuwirt. Dort waren lauter lustige Leute und der Ignatz hub bald an zu singen. Dem Baldhauser ließ es aber keine Ruhe, er meinte, auch den übrigen Wirten müsse man ein Seidel abkaufen, sonst könnte es sie verdrießen, und sie gingen nachher zum Tafernwirt und zum Krammerwirt und zu anderen. Aber nirgends traf er den Grabenbauer und die Heidenbauerndirn. Beim Krammerwirt war es ihm vorgekommen, als huschten sie zur hinteren Tür hinaus, während er mit seinem Bruder zur vorderen hereinging.
Am Nachmittage wurde es in einzelnen Wirtshäusern schon unheimlich laut, und aus dem wirren Geschrei gellte manchmal ein rohes Fluchwort auf. Vor dem Bauernhofer Wirtshaus balgten sich ihrer ein halb Dutzend betrunkener Burschen auf der Gasse, mit Fensterrahmen hieben sie aufeinander los, die sie drinnen ausgebrochen hatten. Beim Krammerwirt soll zwischen Holzknechten und Schustergesellen ein solches Schlagen losgegangen sein, dass das Blut zu den Türstufen herabtröpfelte. Solange noch gesungen worden, hatte der Ignatz frisch und klingend mitgetan, hatte zu zweien oder dreien den Arm um den Nacken des andern gelegt und den Kameraden froh in die Augen schauend sinnige oder kecke Lieder angestimmt. Als es nun überall ins Stänkern und Schimpfen und Schreien und Raufen ausartete, wollte er heimgehen. Da es gegen Abend war und der Baldhauser seinen Grabenbauer immer noch nicht gefunden hatte, sagte er zum Bruder: »Das ist eine lausige Kirchweih!«, und machte sich missmutig auf den Heimweg. Der Ignatz ging fröhlich mit ihm.
Nach einer Stunde kamen sie hinauf zu den Almhöhen, wo die Halterhütte stand. Der Weg ging hier oben glatt und eben durch jungen, dichten Lärchenwald, es ward schon dunkel.
»Da gibt’s auch noch Leute«, sagte der Ignatz plötzlich, denn auf einem Rasenplatze saßen ihrer etliche Männer und ein Weibsbild. Es waren ja seine zwei Schwäger, der Grabenbauer und dessen Bruder, der Mirtel, und es war ein Riegelbauernknecht und der Holzknecht Kaspar; das Weibsbild war die Heidenbauerndirn.
Der Baldhauser stand einen Augenblick still und stutzte. Dann trat er vor die Dirn und sagte: »Was machst denn du da? Du gehörst da nicht her!«
»Hausel, wenn’s dir nicht recht ist!«, versetzte der Grabenbauer fast leise, ballte die Fäuste und erhob sich.
»Mit so Wegelagererlumpen nehm ich’s auf«, sagte der Baldhauser trotzig.
»Lass sie gehen, Hausel«, mahnte der Ignatz und suchte den Bruder mit fortzuzerren. Das war schon zu spät, sie gerieten zusammen; zuerst ihrer zwei, der Grabenbauer und der Mirtel waren über den Baldhauser hergefallen; als dieser aber den einen arg nach rückwärts bog, dem andern ein Bein schlug, sprangen auch die beiden anderen bei. Als der Ignatz sah, dass vier starke Männer über seinen Bruder her waren, da griff er auch zu. Die Dirn kreischte und rief alle Heiligen an. Wortlos rangen die Männer in einem Knäuel, sie schnoben, unter ihren Füßen dröhnte der Boden. Der Grabenbauer hatte die Finger der einen Hand an Baldhausers Kehle gesetzt, mit der anderen wollte er sein Messer ziehen; in dem Augenblick flog er von Ignatz geschleudert auf den Rasen hin. Fast gleichzeitig auch der Ignatz, und jetzt sprang ihm der Mirtel mit beiden Füßen auf die Brust. Da der Ignatz unbeweglich liegen blieb, so stieß der Mirtel einen grausigen Fluch aus und versetzte ihm mit schwerem Stiefel noch einen heftigen Fußtritt auf das krachende Brustblatt. – Der Baldhauser riss sich los, fasste die Dirn und raste mit ihr davon.
Weit unten in der Köhlerhütte verbarg er sie und verbot ihr, einen Laut zu tun; er lugte zum Fensterlein hinaus, wie der Holzknecht Kaspar und der Riegelbauernknecht und endlich auch der Mirtel mit dem Grabenbauer vorbeigingen. Sein Bruder Ignatz aber kam nicht. Als er auf diesen vergebens gewartet hatte, ließ er das Weibsbild im Stich und ging den Weg zurück hinauf bis zur Höhe. Es war schon Nacht. Der Ignatz saß auf einem Baumstück. »Was hast denn, dass du nicht nachkommst?«, fragte ihn der Baldhauser.
»Der Mirtel hat mich getreten!«, antwortete der Ignatz, sonst sagte er nichts.
»Kannst nicht gehen, Bruder? Komm, ich werde dich führen.« Der Ignatz deutete mit der Hand, der Baldhauser solle nur seines Weges gehen, er werde schon nachkommen.
Das tat der Baldhauser freilich nicht, er blieb bei dem Bruder, er suchte eine Quelle und brachte im Hute Wasser, den Verletzten zu laben. Dann stand der Ignatz auf, stützte sich an den Baldhauser, und sie huben an zu gehen.
Oft musste er rasten, und da sprach er einmal zum Baldhauser: »Bruder, daheim wollen wir nichts sagen davon, dass wir’s mit den Schwägern gehabt haben. Es ist eine Schande.«
Um Mitternacht erst sollen sie nach Hause gekommen sein, und der Baldhauser erschrak fast zu Tode, als er nun beim Kienspanlicht sah, wie blass der Ignatz war, wie matt und stier sein Auge, und wie an den Mundwinkeln Blutkrusten klebten. Er gab ihm wieder Wasser zu trinken und suchte in dem Küchenkastel nach einem Balsam. – Der Magdalena fiel es schon auf, was sie denn in der Küche herumzutun hatten, sie eilte hinaus und erfuhr es nun, gerauft wäre worden und den Natzl hätt’s ein bissel getroffen, aber die anderen hätten auch ihr Teil bekommen!
Als die Magdalena ihren Mann ansah, wie er halb auf die Bank hingesunken dalehnte, sagte sie scheinbar sehr ruhig: »Nau, der hat genug.«
Mit keinem Worte hatte sie gefragt, wie das gekommen war, sie ahnte es gleich, die Ursache wäre der Schwager, und bevor sie den Verletzten zu Bette brachte, hielt sie Gericht über den Baldhauser. Eine solche Wucht der wildesten Vorwürfe soll in dem Hause nicht erhört worden sein, als die Magdalena jetzt dem Schwager Baldhauser machte, der ihren Mann mit auf die Kirchweih gelockt, um ihn dort von Raufgesellen erschlagen zu lassen. Zuerst hatte der Baldhauser sich verteidigen wollen, sich rechtfertigen und wehren, aber ihre Zornes- und Gefühlsausbrüche wurden so gewaltig, dass er schwieg und anhub zu grölen. Die Kinder waren aufgewacht und jammerten, der Kettenhund winselte, die Hühner flatterten von ihren Stangen und gackerten, das Gesinde war herbeigekommen und umstand erschrocken die Gruppe, wie die Bäurin Magdalena rasend vor Wut und Schmerz ihr Gewand zerriss und die Fetzen hinschleuderte auf den Baldhauser, der wimmernd vor ihr auf den Knien lag.
Als endlich in ihrem Gemüte die Erschöpfung und Dumpfheit eingetreten war, wendete sie sich an den Ignatz, der in völliger Ohnmacht dahinlag, brachte ihn auf seine Liegerstatt, flößte ihm warme Milch ein und saß bei ihm die ganze Nacht, die Hände auf dem Schoß gefaltet. Als die Morgenröte zu dem Fenster hereinkam und die Ofenmauer matt anglühte, schlug der Ignatz einmal die Augen auf und blickte um sich. Die Magdalena legte ihre Hand auf seine feuchte Stirn und sagte mit einem Ton unendlicher Milde: »Ist dir besser, mein Natz?«
Er tastete nach ihrer Hand: »Es wird schon wieder gut, Magdalena, es wird schon wieder gut.«
Der Baldhauser hat noch in derselben Nacht seine Sachen zusammengepackt und ist fortgegangen, höher hinauf ins Gebirge zu den Holzknechten.
Und nun sind die stillen betrübten Tage gekommen. Allerlei Hausmittel hatten sie angewendet, der Kranke musste Gemswurzeln kauen, Hundsfett essen, sich »ziehende Pflaster« auf die Brust legen lassen und sonst allerlei. Er saß wohl in der Stube auf der Ofenbank oder er ging draußen im Hofe langsam umher, um sich immer wieder irgendwo niederzusetzen. Bei den Kindern war er gerne, sah ihnen zu bei ihren Spielen mit Steinchen und Fichtenzapfen, redete aber wenig mit ihnen, kam allemal bald nur so ins dumpfe Hinschauen und Hinträumen. Einen schweren Atem hatte er und musste viel husten. Manchmal kam Blut aus der Brust, aber nur in wenigen Tropfen.
So währte es mehrere Monate. Eines Sonntags am Nachmittage, als der Ignatz neben dem warmen Ofen saß und doch fröstelte, kam die Magdalena herein und berichtete, dass ihr Bruder, der Grabenbauer-Mirtel, in der Küche draußen sei und die einfältige Frage getan habe, ob er hereingehen dürfe. Sie habe ihm geantwortet, das stehe doch jedem Bekannten frei, geschweige erst einem Schwager. Der Mirtel habe aber gebeten, sie möchte doch anfragen beim Natz, ob er auf ein Wort zu ihm hereinkommen dürfe.
»Ich weiß es wohl, warum er fragt«, entgegnete der Ignatz; die Magdalena konnte es aber nicht wissen, weil es ihr nicht gesagt worden war, dass gerade der Mirtel ihn so schwer verletzt hatte.
»Er kann schon hereinkommen«, antwortete der Ignatz nun leiser und kurzatmig, »und du musst so gut sein und noch ein paar Scheiter in den Ofen stecken.« Denn er wollte sie draußen beschäftigen, während der Mirtel bei ihm in der Stube war.
Dieser trat dann ein, schaute beklommen in der dumpfigen Stube umher und sah ihn nicht gleich. Erst als er aus dem Ofenwinkel ein Husten hörte, trat er dorthin, blieb stehen vor dem Kranken und konnte kein Wort sagen. Der Ignatz sagte auch nichts, sondern hob langsam seine rechte Hand und hielt sie ihm hin. Unsicher reichte der Mirtel die seine und sprach: »Natz! Keine ruhige Stund hab ich mehr gehabt seit der Kirchweih. Dass mir solches hat müssen aufgesetzt sein. Wo du mir alleweil frei der liebste Kamerad bist gewesen …« Er wendete sich ab und ging einige Schritte gegen ein Fenster, als wolle er hinausschauen. Und mit dem Ärmling fuhr er sich übers Gesicht.
»Mirtel!«, sagte der Ignatz leise. »Geh her. Geh her zu mir. – Dir ist’s aufgesetzt gewesen, und mir ist’s aufgesetzt gewesen. Wer kann dafür. Braucht’s auch weiter niemand zu wissen, wie es ist hergegangen. Es wird ja schon besser. Und will auch einmal zum Arzte schicken, dass er ein wenig nachhilft.«
»Und du hast mir nichts für ungut, Natzl?«
Der Ignatz machte mit der flachen Hand eine Bewegung in die Luft hinein, gleichsam als wollte er sagen: Lass es gut sein, Mirtel. Ein sehr heftiger Hustenanfall verhinderte ein weiteres Gespräch. Als der Mirtel wieder in die Küche hinaustrat, sagte er zu der Magdalena: »’s ist wohl ein herzensguter Mensch!«
»Wie findest ihn denn, Bruder?«
Ein Trostwort wollte er sagen, es verschlug ihm die Rede.
»Mir gefällt er halt wohl gar nicht«, meinte sie, »und morgen will ich doch endlich zum Bader schicken nach Strallegg. Sie sagen, für die auszehrende Krankheit wäre der soviel gut.«
Der Mirtel ist davongegangen – halb verloren. Dass es so sollte stehen mit dem Ignatz, hätte er nicht gedacht. Die Magdalena hat ihm von der Tür aus eine Weile nachgeschaut. Das war ihr nicht recht vorgekommen jetzt, mit dem Mirtel!
Am nächsten Frühmorgen ging vom Kluppeneggerhofe ein alter Knecht nach Strallegg. Er hatte Geld mitbekommen für den Arzt, gedachte es aber dem Bauer zu ersparen. Wenn er sagt, dass der reiche Bauer krank ist, da wird sich der Arzt hoch lohnen lassen. Als der alte Knecht daher vor dem Arzte stand, tat er sehr erschöpft und kurzatmig und hüstelte und sagte, ihn hätt’s arg auf der Brust. Ein böser Stier habe ihn gestoßen vor drei Monaten, und seither nehme er an Fleisch und Kräften ab, er glaube, die Auszehrung werde es sein, er sei ein armer Dienstbot’ und täte halt gar schön bitten um einen guten Rat.
Der Arzt sagte: »Musst halt recht viel Milch trinken und immer einmal ein Stückel Fleisch essen, und wenn dich der Husten anpackt, so trink eine Schale Kramperlmoostee, aber so heiß, als du’s derleiden kannst.«
Was der Rat täte kosten?
Der koste nichts. Also eilte der Knecht heim, und sein erstes Wort war, er habe dem Ignatz das Geld erspart und doch einen guten Rat mitgebracht. Fleisch und Milch. Und gegen den Husten Kramperlmoostee trinken, so heiß, als er’s derleiden kunnt.
Eine Nachbarin hatte den Tee vorrätig, er war zwar sehr bitter zu trinken, aber er wärme Brust und Magen, und der Ignatz schöpfte aus diesem Mittel neue Hoffnung.
Zu Anfang des Advents war’s, wenige Wochen vor Weihnachten, als der Husten mit erneuter Heftigkeit auftrat. Ließ der Ignatz sich wieder einmal den heißen Tee richten, trank ihn rasch aus und wankte dann ins Freie. Nach einer kleinen Weile kam er wieder in die Stube zurück, ganz verändert und taumelnd. »Ich weiß nicht«, sagte er noch, »ich muss zu heiß getrunken haben …« Und sank auch schon zu Boden.
Die Weibsleute, die beim Spinnen waren, sprangen herbei und riefen, was denn das wäre! Er antwortete nicht mehr. Sie legten ihn ins Bett und huben an zu beten, und die Magdalena wurde nicht müde, ihn mit allen Mitteln, die ihr einfielen, wieder zum Bewusstsein zu erwecken. Er holte wohl Atem, manchmal stöhnte er, machte die Augen auf, aber man wusste nicht, ob er jemanden erkannte. Der Lorenz, damals vierzehn Jahre alt, ging noch am stöbernden Abend fort nach Sankt Kathrein, um den Geistlichen zu holen. Er soll, wie später erzählt wurde, den fast drei Stunden langen Weg hin und her in nicht ganz zwei Stunden zurückgelegt haben. Er kam ganz unmenschlich schnaufend zurück, aber ohne Priester. Der Pfarrer von Kathrein war selber krank. So müsse eilends jemand nach Krieglach. Wieder erbot sich der Lorenz, und so schnell wie er bringe den Geistlichen keiner.
Krieglach ist weit, erst gegen Morgen kam der Junge zurück, wieder allein und ganz trostlos; der Pfarrer sei nach Graz gereist und der Kaplan auf einem anderen Versehgang in die hintere Massing, von welchem er erst mittags zurückkehren könne. Dann komme er nach.
»So kann er auch das nicht haben!«, jammerten alle. Es hätte sich ja doch nur mehr um die Letzte Ölung gehandelt. Der Lorenz fand seinen Vater bewegungslos daliegen und schlummern. Das sei das Allerbeste, meinte die Mutter, und er, der Knabe, solle sich auch niederlegen, sonst werde er ebenfalls krank. Denn die Aufregung, die in dem Jungen war um den Vater, konnte ihr nicht verborgen bleiben. Er legte sich in die Küche hin auf die Bank und schlief ein paar Stunden fest. Eine eigentümliche Unruhe, die sich im Hause erhoben hatte, weckte ihn auf. Hastig, aber leise auftretend, einen Augenblick unter Flüstern beieinander stehen bleibend und dann weiterhuschend, waberten die Leute türaus und -ein, und in der Stube war ein Murmeln, als ob jemand bete. Der Lorenz sprang auf und fragte nach dem Vater.
»Er ist ein wenig schlechter geworden«, berichtete die Magd, setzte aber, da der Junge vor Schreck aufstöhnte, bei: »Wird doch wohl wieder besser werden. Er ist gleichwohl noch so jung.«
Als der Lorenz in die Stube kam, knieten sie betend und schluchzend um das Bett herum; der Vater lag ruhig da, zwischen den aneinandergelegten Händen stand eine rote, brennende Kerze.
Es war schon vorbei.
Ignatz Roßegger ist nur neununddreißig Jahre und zehn Monate alt geworden. Er starb am 4. Dezember 1829. Die Trauer um ihn war eine sehr große und allgemeine. Während er aufgebahrt lag, konnte das Haus die Leute kaum fassen, die zu der nächtlichen Leichwache erschienen waren. Auch alle Freunde und Verwandten waren da, vor allem der Baldhauser, der Grabenbauer und der Mirtel. Sie standen zusammen und gelobten, die Witwe Magdalena, auf der nun so große Sorgen lagen, nicht zu verlassen. Die Kinder lagen verweint, im Schlafe noch schluchzend, in ihren Bettlein oder standen und lehnten unter den Leuten so herum, wie arme Waiselein. Der Knabe Lorenz stand fast immer auf einem Flecke neben der Stubentür und sah auf alles, was jetzt war und im Hause vorging, mit großen Augen hin. Er konnte es nicht fassen, was geschehen war, und später in seinem Leben tat er noch oft den Ausspruch: »Dazumal, wie mein Vater gestorben, das ist mein härtester Tag gewesen.«
Die Magdalena trug zur Zeit ein Kind unter dem Herzen. In allem Gewirre stand allein sie aufrecht und ruhig, fast finster da. Sie redete nur mit wenigen wenige Worte; wenn man weinend sie tröstete, so schwieg sie, hatte ein ganz trockenes Auge und ihr Antlitz zeigte einen herben Ausdruck. Sie versorgte das Haus und tat ihre Verrichtungen wie jeden Tag; manchmal hielt sie inne, als wäre ihr Leib erstarrt, und schaute vor sich hin. Dann arbeitete sie wieder. Als in der letzten Nacht der Leichenwache das Totenmahl aufgetragen wurde und die Leute in der Stube halblaut murmelnd bei den Tischen zusammensaßen unter dem matten Scheine eines Talglichtes; als zur offenen Stubentür vom Vorhause, wo die Bahre stand, das Öllichtlein hereinflimmerte; als drei Männer die Leiche hoben und in den Sarg aus weißem Fichtenholze legten; als Magdalena hin und her ging, um noch das Letzte für den Kirchgang zum Begräbnisse zu ordnen, blieb sie auf einmal vor dem Sarge stehen, schaute auf den Toten und rief mit heller Stimme: »Einzig das möcht ich wissen, wer ihn erschlagen hat auf der Fischbacheralm!«
Den Leuten ging der Ruf durch Mark und Bein. Der Mirtel legte seinen Löffel weg. – Gar bange still war’s in der Stube, allmählich begannen aber einige zu flüstern: »Es werden ihrer heute wohl da sein, die davon wissen.« Weiter sagten sie nichts.
Als der Ignatz begraben war, ging die Magdalena heim auf den einsamen Hof und hub mit ihren Kindern und mit ihrem Gesinde an zu wirtschaften. Ihre Verwandten boten ihr manche Zuhilfe und manchen Rat; wenn aber ihre Brüder kamen, der Grabenbauer, der Mirtel, oder der Schwager Baldhauser, da sagte sie kurz und herb, ich brauche nichts.
Vierzehn Jahre lang hatte sie fest und zielbewusst die Herrschaft geführt auf dem Kluppeneggerhofe, sie war strenge, arbeitsam, sparsam und hob das Waldbauernhaus zu neuer Wohlhabenheit. Endlich war der Lorenz, der Älteste, so weit, dass er sich wagen wollte, der alternden Mutter die Last abzunehmen. Eine junge Dienstmagd war da, deren Eltern mit Kohlenbrennen den dürftigen Unterhalt erwarben. Das Dirndl hieß Maria.
Diese Dienstmagd fing der Lorenz sachte an, gern zu haben, und es soll in diesem Buch erzählt werden, wie er um sie geworben hat. Die Leute redeten hin und her, dass sie so arm sei, von so geringem Stamme, dass er vermöge seiner Person, seines Hofes und seines Ansehens wohl eine andere Wahl hätte treffen können. Die Mutter Magdalena sagte nichts als das: Wenn sie voneinander nicht lassen können, so müsse geheiratet werden! – Und also hat der Lorenz Roßegger die Maria geheiratet. Das war im Jahre 1842, dreizehn Monate vor meiner Geburt.
Der Lorenz war ein Mensch ohne Anmaßung und Hochmut, doch in wirtschaftlichen Dingen hatte er seinen eigenen Kopf. Von der sanftmütigen Maria steht zu vermuten, dass sie der Schwiegermutter die Herrschaft im Hause nicht streitig gemacht hat. Gegen ihre Enkel, deren zwei sie erlebt hat, war die Magdalena voll von einer Zärtlichkeit, der man sie kaum für fähig gehalten hätte.
Nur einmal habe ich das kleine, schon tiefgebückte Weiblein herb und unheimlich gesehen. Das war wenige Monate vor ihrem im Jahre 1847 erfolgten Tode. Ich stand mit ihr vor dem Hause an der alten Torsäule, die an ihrem Scheitel schon rissig und zackig war, und an welcher die weißgrauen Flechten wucherten. Da ging am nahen Wege ein Mann mit grauen Bartstoppeln, in Kniehose und mit einer schwarzen Zipfelmütze vorbei. Ich erkannte ihn und rief: »Ahnl, Ahnl, der Vetter Mirtel!« Da gab die Großmutter mir mit der Faust einen Stoß, dass ich hintaumelte, und sprach klingend hart: »Still sei! Der Mensch geht dich nichts an!«
Diese Worte habe ich erst verstanden viele Jahre später, als ich selber schon reich an Jahren und Erfahrungen war und als mein Vater Lorenz mir eines Tages, unter einem Eschbaume sitzend, die Geschichte von meinem Großvater Ignatz erzählt hatte.
Vom Urgroßvater, der auf der Tanne saß
An die Felder meines Vaters grenzte der Ebenwald, der sich über Höhen weithin gegen Mitternacht erstreckte und dort mit den Hochwaldungen des Heugrabens und des Teufelssteins zusammenhing. Zu meiner Kindeszeit ragte über die Fichten- und Föhrenwipfel dieses Waldes das Gerippe einer Tanne empor, auf welcher der Sage nach vor mehreren hundert Jahren, als der Türke im Land war, der Halbmond geprangt haben und unter welcher viel Christenblut geflossen sein soll.
Mich überkam immer ein Schauern, wenn ich von den Feldern und Weiden aus dieses Tannengerippe sah; es ragte so hoch über den Wald und streckte seine langen, kahlen, wild verworrenen Äste so wüst gespensterhaft aus, dass es ein unheimlicher Anblick war. Nur an einem einzigen Aste wucherten noch einige dunkelgrüne Nadelballen, und über diese ragte ein scharfkantiger Strunk, auf dem einst der Wipfel gesessen. Den Wipfel musste der Sturm oder ein Blitzstrahl geknickt haben – die ältesten Leute der Gegend erinnerten sich nicht, ihn auf dem Baum gesehen zu haben.
Von der Ferne, wenn ich auf dem Stoppelfeld die Rinder oder die Schafe weidete, sah ich die Tanne gern an; sie stand in der Sonne rötlich beleuchtet über dem frischgrünen Waldessaum und war so klar und rein in die Bläue des Himmels hineingezeichnet. Dagegen stand sie an bewölkten Tagen, oder wenn ein Gewitter heranzog, starr und dunkel da; und wenn im Walde weit und breit alle Äste fächelten und sich die Wipfel tief neigten im Sturm, so stand sie still, fast ohne alle Regung und Bewegung.
Wenn sich aber ein Rind in den Wald verlief und ich, es zu suchen, an der Tanne vorüber musste, so schlich ich gar angstvoll dahin und gedachte an den Halbmond, an das Christenblut und an andere entsetzliche Geschichten, die man von diesem Baum erzählte. Ich wunderte mich aber auch über die Riesigkeit des Stammes, der auf der einen Seite kahl und von vielen Spalten durchfurcht, auf der anderen aber mit rauen, zersprungenen Rinden bedeckt war. Der unterste Teil des Stammes war so dick, dass ihn zwei Männer nicht hätten zu umspannen vermocht. Die ungeheuren Wurzeln, die zum Teil kahl dalagen, waren ebenso ineinander verschlungen und verknöchert wie das Geäst.
Man nannte den Baum die Türkentanne oder auch die graue Tanne. Von einem starrsinnigen oder übermütigen Menschen sagte man in der Gegend: »Der tut, wie wenn er die Türkentanne als Hutsträußl hätt!« Und heute, da der Baum schon längst zusammengebrochen und vermodert ist, sagt man immer noch das Sprüchlein.
In der Kornernte, wenn die Leute meines Vaters, und er voran, der Reihe nach am wogenden Getreide standen und die »Wellen«, die Garben, herausschnitten, musste ich auf bestimmte Plätze die Garben zusammentragen, wo sie dann zu je zehn in »Deckeln« zum Trocknen aufgeschöbert wurden. Mir war das nach dem steten Viehhüten ein angenehmes Geschäft, umso mehr, als mir der Altknecht oft zurief: »Trag nur, Bub, und sei fleißig, die Garbenträger werden reich!« Ich war sehr behänd und lief mit den Garben aus allen Kräften; aber da sagte wieder mein Vater: »Bub, du laufst ja wie närrisch! Du trittst Halme in den Boden und du beutelst die Körner aus. Lass dir Zeit!«
Als es aber gegen Abend und in die Dämmerung hineinging und als sich die Leute immer weiter und weiter in das Feld hineingeschnitten hatten, sodass ich mit meinen Garben weit zurückblieb, begann ich unruhig zu werden. Besonders kam es mir vor, als fingen sich die Äste der Türkentanne dort, die in unsicheren Umrissen in den Abendhimmel hineinstand, zu regen an. Ich redete mir zwar ein, es sei nicht so, und wollte nicht hinsehen – konnte es aber doch nicht ganz lassen.
Endlich, als die Finsternis für das Kornschneiden zu groß wurde, wischten die Leute mit taunassem Gras ihre Sicheln ab und kamen zu mir herüber und halfen mir unter lustigem Sang und Scherz die Garben zusammentragen. Als wir damit fertig waren, gingen die Knechte und Mägde davon, um in Haus und Hof noch die abendlichen Verrichtungen zu tun; ich und mein Vater aber blieben zurück auf dem Kornfeld. Wir schöberten die Garben auf, wobei der Vater diese halmaufwärts aneinanderlehnte und ich sie zusammenhalten musste, bis er aus einer letzten Garbe den Deckel bog und ihn auf den Schober stülpte.
Dieses Schöbern war mir in meiner Kindheit die liebste Arbeit; ich betrachtete dabei die »Romstraße« am Himmel, die hinschießenden Sternschnuppen und die Johanniswürmchen, die wie Funken um uns herumtanzten, dass ich meinte, die Garben müssten zu brennen anfangen. Dann horchte ich wieder auf das Zirpen der Grillen, und ich fühlte den milden Tau, der gleich nach Sonnenuntergang die Halme und Gräser und gar auch ein wenig mein Jöpplein befeuchtete. Ich sprach über all das mit meinem Vater, der mir in seiner ruhigen, gemütlichen Weise Auskunft gab und über alles seine Meinung sagte, wozu er jedoch oft bemerkte, dass ich mich darauf nicht verlassen solle, weil er es nicht gewiss wisse.
So kurz und ernst mein Vater des Tages in der Arbeit gegen mich war, so heiter, liebevoll und gemütlich war er in solchen Abendstunden. Vor allem half er mir immer meine kleine Jacke anziehen und wand mir seine Schürze, die er in der Feldarbeit gerne trug, um den Hals, dass mir nicht kalt werde. Wenn ich ihn mahnte, dass auch er sich den Rock zuknöpfen möge, sagte er stets: »Kind, mir ist warm genug.« Ich hatte es oft bemerkt, wie er nach dem langen, schwierigen Tagewerk erschöpft war, wie er sich dann für Augenblicke auf eine Garbe niederließ und die Stirne trocknete. Er war durch eine langwierige Krankheit ein arg mitgenommener Mann; er wollte aber nie etwas davon merken lassen. Er dachte nicht an sich, er dachte an unsere Mutter, an uns Kinder und an den durch mannigfaltige Unglücksfälle herabgekommenen Bauernhof, den er uns retten wollte. Wir sprachen beim Schöbern oft von unserem Hof, wie er zu meines Großvaters Zeiten gar reich und angesehen gewesen, und wie er wieder reich und angesehen werden könne, wenn wir Kinder, einst erwachsen, eifrig und fleißig in der Arbeit sein würden, und wenn wir Glück hätten.
In solchen Stunden beim Kornschöbern, das oft spät in die Nacht hinein währte, sprach mein Vater mit mir auch gern von dem lieben Gott. Er war vollständig ungeschult und kannte keine Buchstaben; so musste denn ich ihm stets erzählen, was ich da und dort von dem lieben Gott schon gehört und gelesen hatte. Besonders wusste ich aus Predigten dem Vater manches zu erzählen von der Geburt des Herrn Jesus, wie er in der Krippe eines Stalles lag, wie ihn die Hirten besuchten und mit Lämmern, Böcken und anderen Dingen beschenkten, wie er dann groß wurde und Wunder wirkte und wie ihn endlich die Juden peinigten und ans Kreuz schlugen, von den Patriarchen und Propheten und von den Zeiten des Heidentums. Dann sprach ich auch aus, was ich vernommen von dem jüngsten Tage, vom Weltgericht und von den ewigen Freuden, die der liebe Gott für alle armen, kummervollen Menschen in seinem Himmel bereit hat.
Ich erzählte das alles in unserer Redeweise, dass es der Vater verstand, und er war dadurch oft sehr ergriffen.
Ein anderes Mal erzählte wieder mein Vater. Er wusste wunderbare Dinge aus den Zeiten der Ureltern, wie diese gelebt, was sie erfahren und was sich in diesen Gegenden einst für Sachen zugetragen, die sich in den heutigen Tagen nicht mehr ereignen.
»Hast du noch nie darüber nachgedacht«, sagte mein Vater einmal, »warum die Sterne am Himmel stehen?«
»Ich hab noch gar nie darüber nachgedacht«, antwortete ich. »Wir denken nicht daran«, sprach mein Vater weiter, »weil wir das schon so gewöhnt sind.«
»Es wird wohl endlich eine Zeit kommen, Vater«, sagte ich einmal, »in welcher kein Stern mehr am Himmel steht; in jeder Nacht fallen so viele herab.«
»Die da herabfallen, mein Kind«, versetzte der Vater, »das sind keine rechten Sterne, wie sie unser Herrgott zum Leuchten erschaffen hat; – das sind Menschensterne. Stirbt auf der Erde ein Mensch, so lischt am Himmel ein Stern aus. Wir nennen das Sternschnuppen; – siehst du, dort hinter der grauen Tanne ist just wieder eine niedergegangen.«
Ich schwieg nach diesen Worten eine Weile, endlich aber fragte ich: »Warum heißen sie jenen wilden Baum dort die graue Tanne, Vater?«
Mein Vater bog eben einen Deckel ab, und als er diesen aufgestülpt hatte, sagte er: »Du weißt, dass man ihn auch die Türkentanne nennt. Die graue Tanne heißen sie ihn, weil sein Geäst und sein Moos grau ist und weil auf diesem Baum dein Urgroßvater die ersten grauen Haare bekommen hat. – Wir haben hier noch sechs Schöber aufzusetzen, und ich will dir eine Geschichte erzählen, die sehr merkwürdig ist.«
»Es ist schon länger als achtzig Jahre«, begann mein Vater, »seitdem dein Urgroßvater meine Großmutter geheiratet hat. Er war sehr reich und schön, und er hätte die Tochter des angesehensten Bauern zum Weib bekommen. Er nahm aber ein armes Mädchen aus der Waldhütten herab, das gar gut und sittsam gewesen ist. Von heute in zwei Tagen ist der Vorabend des Festes Mariä Himmelfahrt; das ist der Jahrestag, an welchem dein Urgroßvater zur Werbung in die Waldhütten ging. Es mag wohl auch im Kornschneiden gewesen sein; er machte frühzeitig Feierabend, weil durch den Ebenwald und bis zur Waldhütten hinauf ein weiter Weg ist. Er brachte viel Bewegung mit in die kleine Wohnung. Der alte Waldhütter, der für die Köhler und Holzleute die Schuhe flickte, ihnen zuzeiten die Sägen und die Beile schärfte und nebenbei Fangschlingen für Raubtiere machte – weil es zur selben Zeit in der Gegend noch viele Wölfe gab –, der Waldhütter nun ließ seine Arbeit aus der Hand fallen und sagte zu deinem Urgroßvater: ›Aber, Josef, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du mein Lenerl zum Weib haben willst, das wär ja gar aus der Weis’!‹ Dein Urgroßvater sagte: ›Ja, deswegen bin ich heraufgegangen den weiten Weg, und wenn mich das Lenerl mag und es ist ihr und Euer redlicher Wille, dass wir zusammen in den heiligen Ehestand treten, so machen wir’s heut richtig, und wir gehen morgen zum Richter und zum Pfarrer, und ich lass dem Lenerl mein Haus und Hof verschreiben, wie’s Recht und Brauch ist.‹ – Und das Mädchen hatte deinen Urgroßvater lieb, und es sagte, es wolle seine Hausfrau werden. Dann verzehrten sie zusammen ein kleines Mahl, und endlich, als es schon zu dunkeln begann, brach der Bräutigam auf zum Heimweg.
Er ging über die kleine Wiese, die vor der Waldhütten lag, auf der aber jetzt schon die großen Bäume stehen, und er ging über das Geschläge und abwärts durch den Wald, und er war gar freudigen Gemütes. Er achtete nicht darauf, dass es bereits finster geworden war, und er achtete nicht auf das Wetterleuchten, das zur Abendzeit nach einem schwülen Sommertag nichts Ungewöhnliches ist. Auf eines aber wurde er aufmerksam, er hörte von den gegenüberliegenden Waldungen ein heulendes Gebell. Er dachte an Wölfe, die nicht selten in größeren Rudeln die Wälder durchzogen; er fasste seinen Knotenstock fester und nahm einen schnelleren Schritt. Dann hörte er wieder nichts als zeitweilig das Kreischen eines Nachtvogels und sah nichts als die dunklen Stämme, zwischen welche der Fußsteig führte und durch welche von Zeit zu Zeit das Leuchten kam. Plötzlich vernahm er wieder das Heulen, aber nun viel näher als das erste Mal. Er fing zu laufen an. Er lief, was er konnte; er hörte keinen Vogel mehr, er hörte nur immer das entsetzliche Heulen, das ihm auf dem Fuß folgte. Als er sich hierauf einmal umsah, bemerkte er hinter sich durch das Geäst funklende Lichter. Schon hört er das Schnaufen und Lechzen der Raubtiere, die ihn verfolgen, schon denkt er bei sich: ’s mag sein, dass morgen kein Versprechen ist beim Pfarrer! – da kommt er heraus zur Türkentanne. Kein anderes Entkommen mehr möglich; rasch fasst er den Gedanken, und durch einen kühnen Sprung schwingt er sich auf den untersten Ast des Baumes. Die Bestien sind schon da; einen Augenblick stehen sie bewegungslos und lauern; sie gewahren ihn auf dem Baum, sie schnaufen, und mehrere setzen die Pfoten an die raue Rinde des Stammes. Dein Urgroßvater klettert weiter hinauf und setzt sich auf einen dicken Ast. Nun ist er wohl sicher. Unten heulen sie und scharren an der Rinde; – es sind ihrer viele, ein ganzes Rudel. Zur Sommerszeit war es doch selten geschehen, dass Wölfe einen Menschen anfielen; sie mussten gereizt oder von irgendeiner andern Beute verjagt worden sein. Dein Urgroßvater saß lange auf dem Ast; er hoffte, die Tiere würden davonziehen und sich zerstreuen. Aber sie umringten die Tanne und schnüffelten und heulten. Es war längst schon finstere Nacht; gegen Mittag und Morgen hin leuchteten alle Sterne, gegen Abend hin aber war es grau, und durch dieses Grau schossen dann und wann Blitzscheine. Sonst war es still, und es regte sich im Wald kein Ästchen.
Dein Urgroßvater wusste nun wohl, dass er die ganze Nacht in dieser Lage würde zubringen müssen; er besann sich aber doch, ob er nicht Lärm machen und um Hilfe rufen sollte. Er tat es, aber die Bestien ließen sich nicht verscheuchen; kein Mensch war in der Nähe, das Haus zu weit entfernt.
Damals hatte die Türkentanne unter dem abgerissenen Wipfelstrunk, wo heute die wenigen Reiserbüschel wachsen, noch eine dichte, vollständige Krone aus grünenden Nadeln. Da denkt sich dein Urgroßvater: Wenn ich denn schon einmal hier Nachtherberge nehmen soll, so klimme ich noch weiter hinauf unter die Krone. Und er tat’s und ließ sich oben in einer Zweigung nieder, da konnte er sich gut an die Äste lehnen.
Unten ist’s nach und nach ruhiger, aber das Wetterleuchten wird stärker, und an der Abendseite ist dann und wann ein fernes Donnern zu vernehmen. – Wenn ich einen tüchtigen Ast bräche und hinabstiege und einen wilden Lärm machte und gewaltig um mich schlüge, man meint, ich müsst den Rabenäsern entkommen! So denkt dein Urgroßvater – tut’s aber nicht; er weiß zu viele Geschichten, wie Wölfe trotz alledem Menschen zerrissen haben.
Das Donnern kommt näher, alle Sterne sind verloschen, ’s ist finster wie in einem Ofen; nur unten am Fuß des Baumes funkeln die Augensterne der Raubtiere. Wenn es blitzt, steht wieder der ganze Wald da. Nun beginnt es gar zu sieden und zu kochen im Gewölk wie in tausend brauenden Kesseln. Kommt ein fürchterliches Gewitter, denkt sich dein Urgroßvater und verbirgt sich unter die Krone, so gut er kann. Der Hut ist ihm hinabgefallen, und er hört es, wie die Bestien den Filz zerfetzen. Jetzt zuckt ein Strahl über den Himmel, es ist einen Augenblick hell wie zur Mittagsstunde – dann bricht in den Wolken ein Schnalzen und Krachen und Knallen los, und weithin hallt es im Gewölk.
Jetzt ist es still, still in den Wolken, still auf der Erde – nur um einen gegenüberliegenden Wipfel flattert ein Nachtvogel. Aber bald erhebt sich der Sturm, es rauscht in den Bäumen, es tost durch die Äste, eiskalt ist der Wind. Dein Urgroßvater klammert sich fest an das Geäst. Jetzt flammt wieder ein Blitz, schwefelgrün erleuchtet ist der Wald; alle Wipfel neigen sich, biegen sich tief; die nächststehenden Bäume schlagen, es ist, als fielen sie heran. Aber die Tanne steht starr und ragt hoch über den ganzen Wald. Unten rennen die Raubtiere wild durcheinander und heulen. Plötzlich saust ein Körper durch die Äste wie ein Steinwurf. Da leuchtet es wieder – ein schneeweißer Knollen hüpft auf dem Boden und kollert dahin. Dann finstere Nacht. Es braust, siedet, tost, krachend stürzen Wipfel. Ein Ungeheuer mit weichschlagenden Flügeln, im Augenblick des Blitzes gespenstige Schatten werfend, naht in der Luft, stürzt der Tanne zu und birgt sich gerade über deinem Urgroßvater in die Krone. Ein Habicht war’s, Bübel, ein Habicht, der auf der Tanne sein Nest gehabt.«
Mein Vater hatte bei dieser Erzählung keine Garbe angerührt; ich hatte den ruhigen, schlichten Mann bisher auch nie mit solcher Lebhaftigkeit sprechen gehört.
»Wie’s weiter gewesen?«, fuhr er fort. »Ja, nun brach es erst los; das war Donnerschlag auf Donnerschlag, und beim Leuchten war zu sehen, wie, weißen Wurfspießen gleich, Eiskörner auf den Wald niedersausten, an die Stämme prallten, auf den Boden flogen und wieder hoch emporsprangen. Sooft ein Hagelknollen an den Stamm der Tanne schlug, gab es im ganzen Baum einen hohen Schall. Und über dem Heugraben gingen Blitze nieder, und auf den jenseitigen Wald gingen Blitze nieder; plötzlich war eine blendende Glut, ein heißer Luftdruck, ein Schmettern, und es loderte eine Fichte.
Und die Türkentanne stand da, und dein Urgroßvater saß unter der Krone im Geäst.
Die brennende Fichte warf weithin ihren Schein, und nun war zu sehen, wie ein rötlicher Schleier lag über dem Wald, wie nach und nach das Gewebe der sich kreuzenden Eisstücke dünner und dünner wurde, wie viele Wipfel keine Äste, dafür aber weiße Streifen hatten, wie endlich der Sturm in einen mäßigen Wind überging und ein dichter Regen rieselte.
Die Donner wurden seltener und dumpfer und zogen sich gegen Mittag und Morgen hin; aber die Blitze leuchteten noch immer.
Am Fuße des Baumes war kein Heulen und kein Augenfunkeln mehr. Die Raubtiere waren durch das wilde Wetter verscheucht worden. Stieg also dein Urgroßvater nieder von Ast zu Ast bis zum Boden. Und er ging heraus durch den Wald über die Felder gegen das Haus. Es war schon nach Mitternacht.
Als der Bräutigam zum Haus kommt und kein Licht in der Stube sieht, wundert er sich, dass in einer solchen Nacht die Leute so ruhig schlafen können. Haben aber nicht geschlafen, waren zusammengewesen in der Stube um ein Kerzenlicht.
Sie hatten nur die Fenster mit Brettern verlehnt, weil der Hagel alle Scheiben eingeschlagen hatte.
›Bist in der Waldhütten ’blieben, Sepp?‹, sagte deine Ururgroßmutter. Dein Urgroßvater aber antwortete: ›Nein, Mutter, in der Waldhütten nicht.‹
Es war an dem darauffolgenden Morgen ein frischer Harzduft gewesen im Wald – die Bäume haben geblutet aus unzähligen Wunden. Und es war ein beschwerliches Gehen gewesen über die Eiskörner, und es war eine sehr kalte Luft.