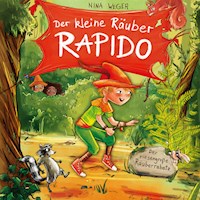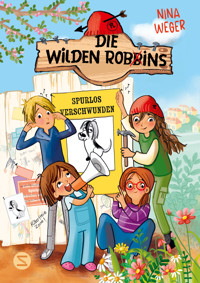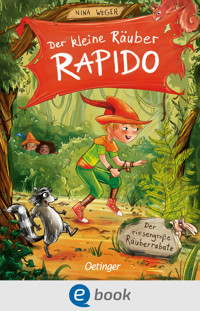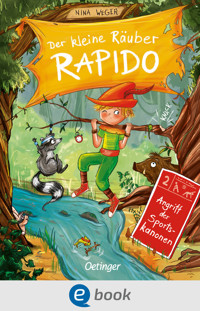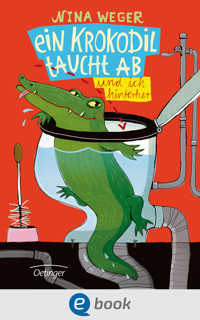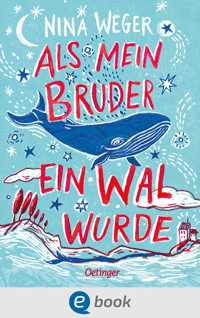
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Oetinger
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
"Manchmal, wenn ich abends im Bett lag, stellte ich mir vor, dass Julius wie ein riesiger Wal durch die Tiefen des Ozeans glitt." Darf man über das Leben eines anderen bestimmen? Und woher soll man wissen, was richtig oder falsch ist, wenn man ihn nicht fragen kann? Belas großer Bruder Julius liegt im Wachkoma, die Familie soll eine Entscheidung treffen und steht kurz davor, auseinanderzubrechen. Und jetzt? Belas Freundin Martha würde zum Papst fahren. Der muss schließlich wissen, was in so einem Fall zu tun ist … Heimlich schlachten sie ihre Sparschweine, klauen eine Kreditkarte und begeben sich auf eine abenteuerliche Reise nach Rom, um eine Antwort zu finden und Belas Familie zu retten. Einfühlsam und einzigartig – ein wunderbares Buch über das Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch
Darf man über das Leben eines anderen bestimmen? Und woher soll man wissen, was richtig oder falsch ist, wenn man ihn nicht fragen kann? Belas großer Bruder Julius liegt im Wachkoma, die Familie soll eine Entscheidung treffen und steht kurz davor, auseinanderzubrechen. Und jetzt? Belas Freundin Martha würde zum Papst fahren. Der muss schließlich wissen, was in so einem Fall zu tun ist. Heimlich schlachten die beiden ihre Sparschweine, klauen eine Kreditkarte und begeben sich auf eine abenteuerliche Reise nach Rom, um eine Antwort zu finden und Belas Familie zu retten.
Einfühlsam und einzigartig – ein wunderbares Buch über das Leben.
Für die Kinder und Jugendlichen des Geschwisterrats der Janusz-Korczak-Geschwisterbücherei
Wir waren in den Ferien mal am Meer. Es war ein wunderbarer, heißer Sommer. Unsere Eltern dösten in der Sonne, und Julius und ich spielten von morgens bis abends am Strand. Jeden Tag dehnten wir unsere Erkundungstouren ein bisschen weiter aus, und bald entdeckten wir, ein ganzes Stück von unseren Handtüchern und Sonnenschirmen entfernt, eine kleine Bucht.
Das Wasser war schwarz, der Grund schien unendlich tief und unvorstellbar weit.
»Komm!«, rief Julius und kletterte über die Felsen. Ich zögerte. Die Dunkelheit unter den Wellen machte mir Angst. Julius konnte es gar nicht erwarten. Mit einem »Yippie!« sprang er ins Wasser und verschwand unter der Oberfläche. Nur verschwommen erkannte ich seinen Körper bis zur Hüfte, der Rest verlor sich im düsteren Nichts der See. Als Julius wieder auftauchte, lachte er und streckte mir die Hand entgegen. »Na los!«
Mit klopfendem Herzen setzte ich mich auf einen Stein und rutschte ein Stück vor, dann verließ mich der Mut. Mit beiden Händen klammerte ich mich an den Fels.
»Bela! Komm! Ich pass auf dich auf!« Julius sah mich mit seinem ganz speziellen Mut-Mach-Lächeln an. »Vertrau mir, ich bin dein großer Bruder.«
Da ließ ich los.
Ich wünschte, ich könnte mich noch einmal in das dunkle Meer zu Julius hinablassen. Zu meinem wunderbaren großen Bruder.
1
»Hey, Bela! Wirf mir mal ein Croissant rüber!« Julius sprintete wie immer auf den letzten Drücker in die Küche und ließ sich auf den Stuhl am Ende des Frühstückstischs fallen. Rhythmisch bewegte er den Oberkörper hin und her wie ein Torwart vor dem Elfmeter. »Los, Champion! Gib alles!«
Ich griff in den Korb und schmetterte Julius das Hörnchen entgegen. Lässig schnappte er es aus der Luft, ohne dass sich ein einziges Krümelchen löste. Julius fing immer alles. Er spielte Basketball in der Auswahlmannschaft und wollte mal Profi in Amerika werden.
»Wow, guter Wurf!« Julius lachte mir anerkennend zu. »Aber jetzt wollen wir doch mal sehen, ob deine Reaktionsfähigkeit am frühen Morgen genauso krass ist wie deine Wurfkraft!« Er holte aus, und ich hob abwehrend die Hände. »Nein, nicht!«
Julius hielt mitten in der Bewegung inne. »Wieso nicht?«
»Weil es runterfällt.« Wenn es drauf ankam, versemmelte ich beim Fangen nämlich immer den entscheidenden Moment. Ich zögerte oder streckte mich zu halbherzig. Ich war halt nicht die Supersportskanone mit dem Sieger-Gen, so wie Julius. Ich interessierte mich mehr für Fische. Und konnte ganz gut Crossrad fahren.
Mein Bruder strich sich die blonden, vom Duschen noch nassen Haare aus der Stirn. »Hey, du fängst das. Aber du musst schon daran glauben, dass du es schaffst. Also – Achtung …«
In einem sanften Bogen warf er das Croissant auf mich zu. Ich hob die Hände, der knusprige Teig streifte meine Fingerkuppen – dann landete das Hörnchen auf den Küchenfliesen.
»Sagt mal, spinnt ihr?!« Mama fuhr von der Spüle herum. »Das sind Lebensmittel!«
»Ist doch nichts passiert.« Julius stand auf und sammelte das zerbröselte Croissant auf. »Ich esse das.« Er zwinkerte mir zu und tauchte das platt gedrückte Ende in seinen Milchkaffee.
Mama reichte mir einen Kakao und setzte sich zu uns. »Ah, bevor ich es vergesse, Julius: Du müsstest heute Nachmittag zwischen drei und vier Telefondienst machen.«
»Tut mir leid, geht nicht.« Julius zuckte bedauernd mit den Schultern. »Da lerne ich mit Arne.«
»Dann müsstest du das bitte verschieben.« Mama begann, sich einen Apfel zu schneiden. »Ich habe einen Termin mit dem Steinmetz, und Jan muss zum Krematorium.«
»Guten Morgen!« Papa stapfte in die Küche. Er trug schon seinen schwarzen Arbeitsanzug mit der dunklen Krawatte.
Julius schaute auf. »Morgen. Wenn du jetzt deine Einäscherung hast, dann bist du doch bis mittags zurück und kannst ans Telefon gehen, oder?«
Papa schüttelte den Kopf. »Nee, da habe ich noch eine Urnen-Beisetzung.«
Das war normal für uns: Grabsteine. Leichen. Friedhof. Meine Eltern betrieben ein Beerdigungsinstitut, und alles rund um den Tod gehörte praktisch zu unserem Alltag. An unser Wohnzimmer grenzte die Halle mit der Sargausstellung, und dahinter befand sich der Raum, in dem die Toten gewaschen und herausgeputzt wurden. Die meiste Zeit wohnten wir zusammen mit Leichen unter einem Dach.
»Tja …« Julius sah Mama ratlos an. »Tut mir echt leid, aber ich kann wirklich keinen Telefondienst machen. Wenn Arne die Arbeit vermasselt, bleibt er hängen.«
Mama griff etwas gereizt nach der Müslipackung. »Dann müsst ihr halt später lernen, oder Arne muss hierherkommen.«
»Wir lernen in der Schule. Von da aus gehe ich direkt zum Training. Anders geht es heute nicht. Außerdem ist jetzt alles so verabredet!« Julius stopfte sich den Rest des Croissants in den Mund und mümmelte: »Ich muss los, sonst verpasse ich den Bus.«
»Du kommst bitte nach der Schule nach Hause.« Mama klang ärgerlich. »Alle müssen sich irgendwie einbringen. Und das ist nun mal dein Part.«
»Ich mach ja auch gern Telefondienst – morgen oder übermorgen. Aber nicht heute. Bis später!« Julius schnappte seinen Rucksack und schob die Tür auf.
Mama ließ laut scheppernd den Löffel auf den Tisch fallen. »Das war keine Bitte!«
Julius drehte sich um und sah sie mit seinem berühmten Julius-Lächeln an. »Du kannst nicht einfach über mich bestimmen.«
»Julius!«, warf Papa ein. »Du bist vierzehn, nicht achtzehn! Und du lebst hier in einer Familie – nicht in einem Hotel!«
Ich werde niemals Julius’ Blick vergessen. Er schaute Mama und Papa liebevoll, aber auch ein bisschen ratlos an, als hätten sie etwas absolut Klares immer noch nicht richtig verstanden. »Aber trotzdem könnt ihr nicht einfach über mich bestimmen!«
»Ich mach Telefondienst«, schlug ich schnell vor, bevor es gleich richtig krachte.
Julius nickte mir zu: »Aber nur, wenn sie dich nett fragen.«
»Nein!«, schimpfte Mama. »Dafür ist Bela noch zu jung. Keine Diskussion mehr.«
Julius schüttelte den Kopf. »Ich muss jetzt echt los – bis heute Abend!« Damit trabte er aus der Küche.
Mama warf Papa einen auffordernden Blick zu. Der seufzte und rief Julius nach: »Du hast gehört, was deine Mutter gesagt hat?!«
Ich weiß nicht, ob Julius es noch gehört hat. Ich weiß nicht, ob er vorhatte, nach der Schule nach Hause zu kommen oder nicht. Aber es war auch völlig egal. Denn als Julius fünf Minuten später im Laufschritt bei grünem Fußgängermännchen die Hauptstraße überquerte, kam von links ein Lkw. Der Fahrer hatte ihn übersehen. Ungebremst knallte er in seinen durchtrainierten Basketballkörper und schleuderte ihn zehn Meter weiter mit dem Kopf gegen die Bordsteinkante.
2
Wir hörten als Erstes den Rettungshubschrauber. Aber wer achtet schon beim Frühstück auf das Rotorenknattern eines Hubschraubers? Als Mama und ich aus der Haustür kamen, fuhr ein Polizeiwagen langsam die Straße herunter. Auch da fühlten wir uns noch nicht angesprochen. Erst als der silber-blaue Wagen direkt vor unserer Einfahrt hielt und ein Polizist ausstieg, spürte ich, wie Mama zusammenzuckte.
Von da an lief einfach alles an uns vorbei. Wie in einem Film. Und genauso wenig, wie wir durch den Plasmabildschirm unseres Fernsehers greifen und irgendetwas an der Handlung ändern konnten, genauso wenig konnten wir das hier, in der Wirklichkeit. Die Rettungssanitäter hatten komplett das Kommando übernommen. Als wir an der Unfallstelle ankamen, lag Julius schon in dem Krankenwagen, der ihn zum Hubschrauber bringen sollte. Mama klopfte an die Tür und wollte rein. Von drinnen brüllte jemand: »Nimm doch mal einer diese Leute weg!« Eine Polizistin nahm uns am Arm und schob uns beiseite – als wenn wir nicht dazugehörten!
Dann sahen wir den großen Blutfleck. Mama flippte aus, sie wollte wissen, was hier los war! Papa schrie die Polizistin an, woher sie wüsste, dass das Julius, sein Sohn, da drin in dem Wagen wäre?! Die Polizistin reichte Papa Julius’ Schülerkarte. Wir sagten nichts mehr. Uns fragte auch niemand oder informierte uns, was weiter passieren sollte. Irgendwann ging das Blaulicht an, und der Rettungswagen fuhr weg. Wir standen stumm auf der Hauptstraße, neben dem riesigen Blutfleck am Rinnstein, und sahen hinterher.
»Ich fahr euch ins Krankenhaus«, sagte ein Nachbar und führte uns zu seinem Auto.
Als wir in der Notaufnahme ankamen, winkte uns ein Arzt in einen kleinen Untersuchungsraum. Das Zimmer sah aus wie die Krankenstation in der Schule und war mit dem Schrank und der Plastikliege eigentlich voll. Wir standen dicht gedrängt, wie Menschen in einer Bushaltestelle bei Regen.
»Ihr Sohn hat ein schweres Schädel-Hirn-Trauma«, erklärte der Arzt. »Wir werden ihn jetzt operieren. Aber es sieht nicht gut aus. Stellen Sie sich auf das Schlimmste ein.«
Obwohl wir so nah beieinanderstanden, dauerte es ziemlich lange, bis seine Worte in unseren Köpfen landeten. Jedenfalls vergingen einige Sekunden, bis Papa nickte und Mama fragte, ob sie Julius sehen dürfe.
Aber das ging schon wieder nicht. Wir sollten uns in den Wartebereich setzen, und sobald man Genaueres sagen könne, würden wir informiert werden. Dann eilte der Arzt davon, und wir ließen uns auf die harten Schalenstühle im Gang fallen und warteten.
Papa rief einen unserer Sargträger an und bat ihn, sich um alles zu kümmern. »Julius hatte einen Unfall, wir sind im Krankenhaus und wissen noch nicht, wie lange es dauert«, sagte er. Es klang, als müsste Julius nur noch einen kleinen Gips bekommen. Mama begann zu weinen, und Papa legte den Arm um sie. »Alles wird gut«, tröstete er. »Julius ist jung und stark. Er hat einen durchtrainierten Körper. Er schafft das.«
Stunde um Stunde verging. Wir tranken Automatentee aus braunen Plastikbechern. Menschen in OP-Kleidung eilten vorüber. Türen öffneten und schlossen sich, aber niemand sagte uns etwas. Irgendwann zog ich mein Handy aus der Tasche und gab »Schädel-Hirn-Trauma« ein. Als Erstes stand da: Das Schädel-Hirn-Trauma (SHT) ist die häufigste Todesursache vor dem 40. Lebensjahr in Deutschland. Ich steckte das Handy wieder weg.
Um drei Uhr nachmittags wurden wir noch einmal in das Zimmer mit der Liege geholt. Vor uns stand nun ein anderer, ziemlich erschöpft aussehender Arzt. Er hielt ein Klemmbrett mit einem vollgekritzelten Blatt in der Hand. »Wir mussten bei Ihrem Sohn Teile der Schädeldecke entfernen, damit der Hirndruck nicht noch mehr steigt und weiteres Gewebe beschädigt. Wir wissen nicht, ob er die nächsten Stunden überlebt. Er kommt jetzt auf die Intensivstation. Sie dürfen in einer halben Stunde zu ihm.« Er sagte das in einem Tonfall, als würde er uns den Weg zur Kantine beschreiben. Dann flatterten noch irgendwelche Fachwörter, die ich noch nie gehört hatte, um unsere Köpfe. Aber sie drangen nicht zu uns durch, so wie alle anderen Geräusche, die uns kurz danach auf den Fluren des Krankenhauses entgegenschlugen.
Die Intensivstation wurde durch eine dicke Tür gesichert. Papa klingelte, und ein Pfleger in blauer Kleidung öffnete. Er führte uns einen langen, neonbeleuchteten Gang hinunter. Die Zimmertüren links und rechts standen weit offen. Überall fiepte und piepte es, und es war sehr warm.
Vor einem Raum mit drei wuchtigen Betten, in denen halb aufgerichtete, leblose Körper lagen, blieb der Pfleger stehen. Im ersten Moment erkannte ich Julius nicht. Er trug einen riesigen Verband um den Kopf. Ein Schlauch führte in seinen Mund, ein anderer in die Nase. Eine Maschine hatte für ihn das Atmen übernommen und pustete gleichmäßig Luft in seinen Brustkorb. Überall waren Monitore mit bunten Linien und Kurven, wie in der Schaltzentrale eines Raumschiffs.
Einen Moment standen wir wie angewurzelt. Dann machte Mama ein paar wackelige Schritte vor, beugte sich über Julius und küsste ihn auf die Wange. Dabei flüsterte sie ununterbrochen: »Es tut mir so leid, so wahnsinnig leid.«
Papa blieb stocksteif stehen und rührte sich nicht.
»Jede Berührung bedeutet Stress für Ihren Sohn«, sagte der Pfleger und zog Mamas Hand sanft zurück. Mama nickte. Sie zitterte am ganzen Körper, und der Pfleger schob ihr schnell einen Stuhl unter den Hintern. Dann begannen Tränen ihr Gesicht herunterzulaufen. Es hörte gar nicht mehr auf. Ich hatte noch nie so viele Tränen gesehen. Hilflos drehte ich mich zu Papa. Der stand immer noch genauso da wie vorher. Seit Minuten schien er sich nicht bewegt zu haben. Ich dachte: Irgendetwas läuft hier falsch, irgendjemand hat hier was ganz falsch programmiert. So als hätten wir den Flieger nach Mallorca gebucht, aber wären plötzlich am Polarkreis gelandet! Das Ganze musste eine Verwechslung sein. Oder so etwas wie »Versteckte Kamera«! Gleich kam jemand um die Ecke und sagte: ›Danke schön, Szene beendet!‹ Und dann würde Julius aufstehen und rufen: ›Los, Bela, mach hin, wir müssen doch in die Schule!‹ Papa würde sich schleunigst auf den Weg ins Krematorium machen, und Mama kümmerte sich um den Grabstein. Doch es kam keiner, der ›Schluss, aus, Ende‹ rief.
Der Einzige, der kurz darauf wirklich um die Ecke kam, war der Stationsarzt. Er stellte sich kurz vor und sagte: »Ich würde gern mit Ihnen über eine eventuelle Organspende sprechen.« Nun sah Papa das erste Mal auf. Er drehte den Kopf, starrte den Arzt einen Moment lang an und brüllte dann los. »Raus!«, schrie er. »Raus hier!« Ich hatte Angst, dass er dem Mann gleich eine runterhaute. Mama sprang auf und versuchte, Papas Arme festzuhalten. Aus dem Gang stürmten mehrere Pfleger heran und wollten Papa zurückhalten. Doch das war gar nicht mehr nötig. Papa rutschte Mama einfach aus den Armen und plumpste auf den Boden. Da hockte er dann in seinem schwarzen Beerdigungsanzug und schluchzte. So hatte ich Papa noch nie gesehen.
Der Arzt hob beschwichtigend die Hände und schob die Pfleger aus dem Raum. »Alles in Ordnung«, sagte er. »Alles gut.« Und zu Mama: »Wenn nur einer in der Familie gegen eine Organentnahme ist, passiert nichts. Keine Sorge, Sie entscheiden das. Ganz allein und in Ruhe.«
Dann ging er auf den Gang. Ich sah, wie er mit einem Pfleger sprach und dabei zu Julius sah. Plötzlich fiel mir ein, dass wir schon häufiger Leute beerdigt hatten, die nach ihrem Tod Organe gespendet hatten. Ich erinnerte mich, dass Julius das gut fand. In seinem Jahrgang war ein Mädchen, das dringend auf eine Niere wartete. »Wenn jemand sowieso tot ist, warum soll sie dann nicht seine Niere haben? Tausende warten auf ein Herz oder eine Leber, und bevor die Organe in der Erde verrotten oder verbrannt werden, sollen sie doch besser jemandem nutzen«, hatte Julius gesagt und hinzugefügt, dass er alles, nur seine Augen nicht spenden würde.
Ich sah zu Mama. Sie nickte stumm. Ich glaube, sie dachte dasselbe wie ich. Aber wir trauten uns nicht, etwas zu sagen.
Irgendwann saßen wir alle drei auf Stühlen. Keine Ahnung, wie wir da hingekommen waren. Keine Ahnung, wo die Stühle hergekommen waren. Wir saßen da und schauten auf Julius, meinen großen, supersportlichen Bruder mit der Megakondition, der normal locker und ohne einen roten Kopf zu bekommen, sechs Kilometer lief, aber jetzt nicht mal einen einzigen Atemzug allein schaffte.
Ich versuchte, mir Julius’ Kopf unter dem Verband vorzustellen. Wenn da Knochenstücke fehlten, dann war da bestimmt eine riesige Delle. Ich dachte an meinen Sturz mit dem Crossrad vor zwei Wochen. Die Prellungen hatten fies wehgetan, ohne dass meine Schienbeine auch nur einen Millimeter eingedetscht waren. Was für unerträgliche Schmerzen musste dann Julius haben?
Die Pfleger, die regelmäßig die Werte auf den Bildschirmen kontrollierten, behaupteten, er habe überhaupt keine Schmerzen, weil durch die Schläuche ein Cocktail von Medikamenten lief, der Julius in ein künstliches Koma versetzte. In eine totale, tiefe Bewusstlosigkeit.
Als der Abend zu dämmern begann, schöpften wir Hoffnung. Mehrere Stunden waren vergangen, und Julius lebte. »Dann hat er es doch geschafft, oder?«, fragte Mama flehend den Arzt. Der wiegte den Kopf und antwortete: »Die kommende Nacht wird entscheiden.«
Mama sah ihn fassungslos an. »Ich dachte, die letzten Stunden?! Wann hört das denn auf?«
Der Arzt zuckte mit den Schultern. Wir rutschten alle ganz eng zusammen. Wir klammerten uns aneinander. Ich glaube, wir alle hatten noch nie eine solche Angst. Sie war so schlimm, dass man es sich nicht vorstellen konnte. Schlimmer als in dem schlimmsten Albtraum. Und sie hörte nicht auf.
Irgendwann standen Oma und Opa im Raum. Sie drückten Mama und Papa lange und fest, dann legte Opa einen Arm um mich und sagte: »Wir fahren jetzt nach Hause, damit du schlafen kannst.«
Doch wie ich schlafen sollte, das sagte mir keiner. Drei Stunden später lag ich immer noch wach im Bett und presste die Fäuste aneinander. Ich fürchtete, wenn ich aufhörte, an Julius zu denken, dann würde er sterben. Also erinnerte ich mich ganz fest daran, wie wir zwei Tage zuvor versucht hatten, mein Crossrad zu reparieren. Wir waren noch nicht ganz fertig. Es knackte immer noch in der rechten Pedale. Mist, dachte ich, wann wollen wir das denn jetzt machen, wenn Julius im Krankenhaus liegt? Und dann dachte ich: Blödsinn! Ohne Julius durfte ich ja sowieso nicht auf die Rampenbahn! Weil das mit den Hügeln und Steilwänden angeblich zu gefährlich war. Dabei konnte man auch an einer Fußgängerampel ganz einfach von einem Laster übersehen werden. Und so ging es weiter und weiter, bis ich irgendwann doch eingeschlafen war.
In der Nacht nahm der Druck auf Julius’ Gehirn wieder zu. Er musste noch einmal operiert werden. Ein weiteres kleines Stück Schädelknochen wurde entfernt. Jetzt sollte der kommende Tag entscheiden. Und dann die nächste Nacht. Aber das spielte sowieso alles keine Rolle mehr. Wir hatten unser Gefühl für Zeit längst irgendwo auf den Krankenhausfluren verloren. Wir befanden uns in der Wattezeit, gefangen in einem dichten Nebel, während um uns herum die Sonne schien und die Welt sich weiterdrehte, als wenn nichts passiert sei. Menschen frühstückten, fuhren zur Arbeit, Rasenflächen wurden gemäht, Kinder kamen von der Schule, Familien aßen Mittag, es wurde telefoniert, Sport gemacht, Verabredungen getroffen, ins Bett gegangen. Für uns verschwamm das alles. Nur die regelmäßige Kontrolle von Julius’ Augen sagte uns, dass wieder eine Stunde vergangen war. Denn pünktlich alle sechzig Minuten kam eine Pflegekraft und leuchtete ihm ins Gesicht.
»Muss das sein?«, fragte Papa, als wieder ein Blaukittel mit Taschenlampe hereinkam.
»Wir müssen überprüfen, ob es eine Veränderung gibt«, erklärte eine große, dünne Schwester und richtete den Strahl volle Kanne in Julius’ Augen. Julius starrte trotz des grellen Lichts ins Leere. Aber angeblich reagierte seine rechte Pupille – und das war gut so. Denn solange das so war, konnte er nicht hirntot sein. Und solange er nicht hirntot war, gab es Hoffnung. Wir klammerten uns an diese winzige Bewegung. So winzig, dass wir sie nicht einmal erkennen konnten. Aber sie war alles, was wir hatten.
Wenn ich nicht im Krankenhaus war, dann lag ich zu Hause in meinem Zimmer, mit runtergezogenen Jalousien. Ich wollte nicht zur Schule oder Freunde treffen. Ich wollte nicht reden oder mitleidige Fragen beantworten. Meine Lehrer und Mitschüler hatten mir SMS geschrieben, manche hatten Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen. Hilflose, stockende Worte. Aber was sollten sie auch sagen? Ich war nicht zu trösten oder aufzumuntern. Nicht mal von meinen besten Kumpels Simon und Ben. Sogar in ihren Stimmen spürte ich eine Erleichterung, dass ich nicht selbst ans Telefon gegangen war. Als hätten sie plötzlich Angst vor mir, als wäre ich seit dem Unfall ein anderer. Niemand konnte mehr normal zu mir sein. Sogar unsere Nachbarn, die mich schon als Baby gekannt hatten, erschraken, wenn ich mit Oma und Opa in unsere Auffahrt fuhr und aus dem Auto stieg. Ihr Winken war verkrampft. Sie drucksten komisch rum, über blödsinnige Sachen, die mich sowieso nicht interessierten. Weil mich nichts interessierte: Die unzähligen Briefe, die jeden Tag eintrudelten. Das Essen, das Mamas und Papas Freunde brachten. Der Teddy vom Basketballteam, den Arne vor der Tür abstellte. Die Pappengel, die Julius’ Klassenkameraden bastelten, und auch nicht die Kerze, die irgendwer in der Kirche angezündet hatte. Ich wollte das alles nicht hören oder sehen, denn jeder Anruf, jeder blöde Engel waren nur Beweise, dass dies hier alles wirklich war. Dass die Bilder in meinem Kopf stimmten und dass es kein blöder Traum war.
Nach zwei Wochen fuhren die Ärzte den Medikamentencocktail herunter, der durch die Schläuche in Julius’ Körper floss. Sie wollten gucken, ob Julius aus dem künstlichen Koma erwachte und selbstständig atmete. Seine Lungen holten tatsächlich aus eigener Kraft Luft! Papa heulte vor Freude, und Mama brach auf ihrem Plastikstuhl zusammen. »Wer atmet, der lebt!«, jubelte Papa und schleuderte mich zwischen den Apparaten herum.
Doch obwohl Julius die Beatmungsmaschine jetzt nicht mehr brauchte und seine Lider munter offen standen, schien er uns nicht zu sehen. Er guckte durch uns durch. Sein Blick waberte ziellos im Raum herum, egal ob wir winkend am Fußende standen oder uns ganz dicht, Nase an Nase, zu ihm hinunterbeugten.
»Er muss erst einmal durchkommen«, tröstete Papa uns. »Sein Körper muss die ganzen Medikamente ja erst einmal abbauen. Vorher kann die Wirkung ja gar nicht nachlassen.«
Aber vier Tage später reagierte Julius immer noch nicht. Dann gab er endlich ein Lebenszeichen von sich und pupste. Papa machte einen Luftsprung, als ob Julius den entscheidenden Korb beim Landesfinale versenkt hätte. Doch der Pfleger lächelte nur milde. »Das sagt leider gar nichts. Das macht sein Körper ganz automatisch.« Es war halt nur ein Pups, mehr nicht.
Einen Tag später sagten uns die Ärzte, dass man Julius jetzt nicht mehr durch seinen Hals ernähren könnte, weil seine Rachenwand und Speiseröhre davon kaputtgingen. »Wenn Ihr Sohn nicht verhungern soll, dann braucht er ab jetzt eine Magensonde«, erklärten sie. Mama und Papa nickten, und von da ab floss eine schokobraune Masse aus einem Plastikbeutel durch einen Schlauch direkt in Julius’ Magen.
»Man kann auch wach werden, ohne schlucken zu können«, sagte Mama trotzig. »Außerdem kann man das Ding jederzeit wieder rausnehmen. Und wenn das nicht geht, kann man damit sogar steinalt werden.«
Dann wurden wir wieder zu einer Besprechung geholt. Die Ärzte zeigten uns CT-Fotos von Julius’ Gehirn, grau-schwarze Bilder, so ähnlich wie die aus dem Röntgenapparat. Bis dahin kannte ich eigentlich nur bunte Zeichnungen von Gehirnen, aus dem Biologiebuch oder von irgendwelchen Medikamentenpackungen. Meist ähnelte das Ganze einem verschlungenen Würmerhaufen, dessen Form an eine Walnuss erinnerte. Aber das, was uns die Ärzte da von Julius’ Gehirn zeigten, war nur ein grauer Klumpen. Wir schauten etwas ratlos. Dann gab es eine Diagnose: apallisches Syndrom.
Mein Handy sagte dazu: Das apallische Syndrom (Wachkoma) wird durch schwerste Schädigung des Gehirns hervorgerufen. Dabei kommt es zu einem funktionellen Ausfall der gesamten Großhirnfunktion oder größerer Teile, während Funktionen von Zwischenhirn, Hirnstamm und Rückenmark erhalten bleiben. Dadurch wirkt der Betroffene wach, hat aber aller Wahrscheinlichkeit nach kein Bewusstsein.
Kein Bewusstsein – was hieß das? Ohnmächtig? Tiefschlaf? Wusste Julius nicht, wo er war? Oder wie er hieß? Bekam er überhaupt nichts mit? So wie ich bei meiner letzten Klassenfahrt, als mir irgendein Vollpfosten nachts Senf ins Gesicht geschmiert hatte und ich mich am nächsten Morgen über die Kruste auf meinen Wangen wunderte? Ich hatte absolut keine Ahnung gehabt, wann und wie das passiert war.
Oder war es eher so wie bei den russischen Matrosen, die mit ihrem U-Boot auf den Grund der Barentssee gesunken waren? Die fühlten und atmeten da unten in der schwarzen Tiefe, aber waren von außen unerreichbar und nicht in der Lage, ein Lebenszeichen zu geben! Ich strengte mich total an, aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, was Julius jetzt dachte oder fühlte. Oder wie das war, wenn man gar nichts dachte und fühlte. Ging das überhaupt? Und dann dachte ich: Wann hört das auf? Konnten wir Julius wieder aufwecken? Davon hatte der Arzt nämlich nichts gesagt.
Mama war absolut überzeugt, dass Julius das schaffte. »Wir kriegen das hin«, verkündete sie entschlossen. »Dein Bruder wird wach. Mit Geduld und Disziplin, alle gemeinsam schaffen wir das ganz sicher.«
Trotzdem hörte ich sie in der Nacht weinen. Es war ein schreckliches, hilfloses Schluchzen. Es klang wie das Weinen der Trauernden, wenn sie unten in der Halle für immer Abschied nahmen. Jetzt ist Julius tot, dachte ich, und mit einem Mal fühlte sich die Dunkelheit in meinem Zimmer wie eine schwarze, samtene Kuhle an, aus der man nicht herausklettern konnte. Aber dann hörte ich die Stimme von Papa, der Mama und sich Mut zusprach. Und diesen Klang hatte ich bei den Leuten unten in der Aufbahrungshalle noch nie gehört. Und das bedeutete, Julius lebte.
Als ich am nächsten Morgen aufstand, klebte Mama schon wieder mit einem entschlossenen Gesichtsausdruck vor dem Bildschirm ihres Computers. Sie suchte nach der besten Reha-Klinik für Kinder und Jugendliche mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma. »Rehabilitation heißt Wiederherstellen«, erklärte sie mir mit einem Lächeln, und das hörte sich irgendwie beruhigend an.