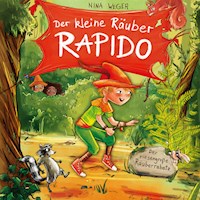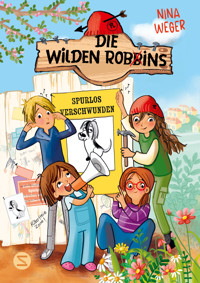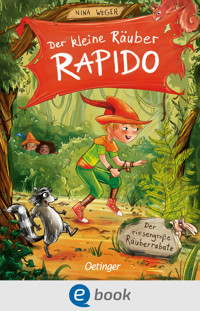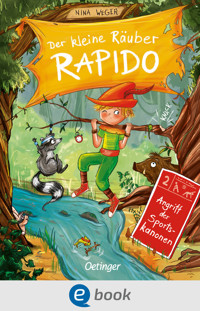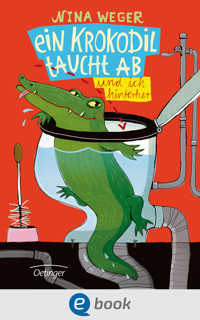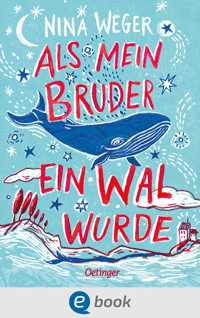6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Oetinger
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Hilfe, mein Opa spielt verrückt! Nick ist neun Jahre alt und wünscht sich nichts sehnlicher als einen echten Hund. Zum Glück gibt es in seiner verrückten Familie außer ihm wenigstens noch einen weiteren vernünftigen Menschen, nämlich seinen Opa, Direktor einer großen Pralinenfabrik. Ihn will Nick bitten, ihm bei der Erfüllung seines Wunsches zu helfen. Doch dann kommt alles anders, denn von einem Tag auf den anderen ist auch Opa durchgedreht und denkt, er sei der liebe Gott! Alle Versuche, Opa wieder normal zu machen, scheitern, bis Nick den entscheidenden Einfall hat. Das Buch von Nina Weger ist ein echter Leseschatz, die Familie, von der sie erzählt, total chaotisch, aber zum Knutschen. Ein Buch mit Herz, Witz und Verstand, turbulent und temporeich von der ersten bis zur letzten Seite.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Für Greta und Vincent
Wie ich entdeckte, dass Pralinen nicht an Bäumen wachsen und meine Familie nicht normal ist
Der Tag, an dem ich feststellte, dass meine Familie nicht normal ist, war ein Mittwoch. Es war einer der ersten warmen Frühlingstage, und ich erinnere mich noch genau, wie ich vor unserem Gartentor am Ende der kleinen Straße stand und nervös von einem Bein auf das andere trat. In meinem Hals steckte ein dicker trockener Kloß. Genau wie am Morgen, als ich von meinen Klassenkameraden umringt auf dem Schulhof gestanden und verzweifelt gerufen hatte: »Aber ich sage die Wahrheit!«
Niemand hatte mir geglaubt.
Ole Kratschbowski, unser Klassensprecher, hatte sich dicht vor mich gestellt und seinen Zeigefinger so fest in meine Brust gebohrt, dass er an den Knöcheln ganz weiß wurde. »Dann beweis es, du Spinner!«, hatte er gefordert.
»Genau, und zwar am besten gleich heute Nachmittag, Spinner!«, hatte sein Beschützer, der dicke Kevin, nachgequakt, und seine Augen waren dabei zu fiesen kleinen Schlitzen geworden.
Ich brauchte nur daran zu denken, und schon begann mein Herz wieder so heftig gegen meine Rippen zu schlagen, dass ich fürchtete, die ganze Straße könnte es hören. Ich versuchte, langsam ein- und auszuatmen und die schrecklichen Erinnerungen an den Morgen abzuschütteln.
Gleich würde ich ihnen beweisen, dass ich kein Spinner war.
Dass ich die Wahrheit sagte.
Dass Pralinen an Bäumen wachsen.
Fünf Minuten später schossen Ole und Kevin auf ihren Fahrrädern um die Ecke, rasten auf mich zu und blieben mit quietschenden Reifen vor mir stehen. »Na los, dann zeig uns mal deine Pralinenbäume«, sagte Ole, schob seine blaue Schirmmütze in den Nacken und grinste zu Kevin hinüber. Zwischen seinen schmalen Lippen blitzte der neue, riesige Schneidezahn hervor, der inmitten der kleinen weißen Milchzähne aussah wie ein Elefant in einer Mäuseparade.
»Wird’s bald? Wir haben nicht ewig Zeit!«, schnauzte der dicke Kevin, der genau wusste, dass Ole es überhaupt nicht leiden konnte, wenn jemand seinen mächtigen gelben Hasenzahn anstarrte. Mit seiner fleischigen Hand gab er mir einen kräftigen Stoß, sodass ich zwei Schritte zurückstolperte.
»Wir müssen da lang«, sagte ich schnell und führte sie über die Straße. Auf dem kleinen Trampelpfad, der sich durch die Bäume windet, stiefelten wir in den Wald hinein, der genau gegenüber von unserem Haus beginnt.
Nach ein paar Metern blieb ich stehen und zeigte nach oben. Ole setzte seine Schirmmütze ab, legte den Kopf nach hinten und blinzelte in die Baumwipfel. Dann klappte sein Kiefer herunter. »Da – da ist ja alles voll!«, krächzte er fassungslos.
Kevin quollen die dicken Glupschaugen aus dem runden Schweinegesicht und er stieß ein heiseres »Booaah!« aus.
Die beiden konnten nicht glauben, was sie sahen. Dabei hatte ich es ihnen doch gesagt: Der Wald gegenüber von unserem Haus ist von oben bis unten mit Nougatpralinen und Schokotrüffeln übersät. Sie kleben an Stämmen, Ästen und Zweigen. Sie mussten dort wachsen. Wie sollten sie sonst bis ganz da oben, in die Wipfel der riesigen Bäume, gekommen sein?!
»Kann man die auch essen?«, fragte Kevin, als er endlich seine Sprache wiedergefunden hatte.
»Klar«, sagte ich, hob eine Nougatpraline auf und reichte sie ihm. »Am besten schmecken sie, wenn sie ganz frisch heruntergefallen sind.«
Kevin steckte sich die Praline in den Mund und kaute genüsslich. »Mmh, lecker! Darf ich mir welche einstecken?«
Bevor ich antworten konnte, stopfte er sich schon die Taschen voll.
Ole streckte mir missmutig die Hand entgegen und murmelte: »Okay, du hast die Wahrheit gesagt.«
»Das musst du morgen vor der ganzen Klasse sagen. Gleich in der ersten Pause!«, forderte ich.
»Okay, gebongt«, grunzte Kevin mit vollen Backen.
Ole kniff die Lippen zusammen und nickte. Ich wusste, dass er nichts mehr verabscheute, als einen Fehler zuzugeben.
»Dann können wir jetzt ja wieder gehen, oder?«, fragte ich lässig und sah mutig auf Oles Schneidezahn.
»Mhm«, schmatzte Kevin, was wohl so viel wie »Ja« heißen sollte.
Ich drehte mich um und marschierte vorweg den Weg zurück zur Straße. Der Kloß in meinem Hals rutschte langsam nach unten und verschwand. Stolz wie ein Boxer nach einem K.-o.-Sieg, trat ich aus dem Wald, und für einen kurzen Moment fühlte ich mich unbesiegbar, bis – ja, bis ein lautes, hohles Plopp! die Stille des ruhigen Nachmittags durchbrach und in ein merkwürdig pfeifendes Sirren überging.
Ich hob den Kopf und sah in den blauen, wolkenlosen Himmel. Etwas Kleines, Braunes schoss mit ungeheurem Tempo auf uns zu. Es wurde größer, und ich konnte gerade noch erkennen, dass es rund war, da klatschte es mit voller Wucht gegen Kevins schwitzige Stirn. Er verdrehte die Augen, taumelte und plumpste rückwärts in den weichen Waldboden.
Ole und ich starrten auf ihn hinunter. Zwischen Kevins blonden Augenbrauen und dem tiefen, borstigen Haaransatz klebte eine Nougatpraline. Die knackige Hülle war aufgebrochen und die cremige Füllung verteilte sich langsam auf seiner rosa Stirn. Es sah ein bisschen so aus wie die Vogelkacke, die morgens manchmal auf der Windschutzscheibe unseres Autos klebt.
Ich sah zu Ole, der heftig nach Luft schnappte und dann mit schriller Stimme schrie: »Die kam von da!« Mit ausgestrecktem Arm zeigte er über die Straße zu unserem Haus, auf ein weit offen stehendes Fenster im ersten Stock. »Da hat jemand die Praline rausgeschossen!«
Ungläubig sah ich zu den aufgesperrten Fensterflügeln, zwischen denen sich ein cremefarbener Vorhang im Wind blähte. Das war eindeutig das Fenster zum Schlafzimmer meiner Eltern. Ich drehte mich zu Ole und schüttelte den Kopf. »Das kann nicht sein«, sagte ich.
»Doch!«, schrie Ole. »Ich hab es genau gesehen! Die Praline kam aus dem Fenster geflogen. Ich hab es doch gewusst! Pralinen wachsen nicht an Bäumen! Du bist nicht nur ein Lügner, du bist auch noch ein Betrüger!«
»Pralinen wachsen wohl an Bäumen!«, brüllte ich wütend zurück.
Doch genau in dem Moment schoss eine zweite Praline aus dem Fenster, segelte über unsere Köpfe hinweg und verschwand irgendwo zwischen den grünen Baumkronen im Wald.
Ole zerrte den immer noch benommenen Kevin auf die Füße und schubste ihn zu den Rädern. »Los, komm! Das müssen wir sofort den anderen erzählen.«
Er schnappte sein Fahrrad und sprang auf. »Mach schon!«, trieb er den dicken Kevin an, der immer noch ziemlich wackelig in den Knien war und unbeholfen auf den Sattel kletterte.
Dann drehte sich Ole noch einmal zu mir um, zischte: »Lügner!«, und preschte mit quietschenden Reifen davon.
Kevin eierte in großen Schlangenlinien hinter ihm her.
Ich rang nach Luft, starrte auf die geöffneten Fensterflügel und rannte los, durch das Gartentor, über die Terrasse ins Haus und die Treppe nach oben. Völlig außer Atem riss ich die Schlafzimmertür meiner Eltern auf – und blieb wie angewurzelt stehen. Auf dem Nachttisch neben dem großen Bett stand mein Vater. Er umklammerte mit beiden Händen einen Golfschläger, holte aus und schlug mit voller Wucht eine Praline aus dem Fenster.
Ich hatte das Gefühl, als ob sich plötzlich unter mir ein riesiger Krater auftäte und ich in eine unendliche Tiefe stürzte. In meinen Ohren begann es zu rauschen. Bis zu diesem Moment, das schwöre ich, war ich absolut sicher, dass Pralinen an Bäumen wachsen. Es war die einzige logische Erklärung dafür, wie sie da oben hingekommen sein konnten. Und nie hatte mir irgendjemand in der Familie widersprochen, wenn ich von Pralinenbäumen geredet hatte! Was hätte ein sechsjähriger Junge da anderes denken sollen?
Das Ganze ist heute drei Jahre her, aber ich weiß noch genau, dass mir an diesem Tag auf einen Schlag drei Dinge klar wurden.
Erstens: Pralinen wachsen nicht an Bäumen.
Zweitens: Ich will nie wieder in die Schule gehen.
Und drittens: Mein Vater ist nicht normal, genau wie alle anderen in meiner Familie.
Ehrlich, von meiner kleinen Schwester bis zu meiner Oma benehmen sich durchweg alle merkwürdig, tun seltsame Dinge und sagen eigenartige Sachen. Meine Verwandten gehören zu dieser Sorte Menschen, die man in Filmen sehr lustig findet, aber mit denen man auf der Straße nicht unbedingt gesehen werden will. Es gibt in dem ganzen verrückten Haufen nur zwei Personen, die man als unauffällig und normal bezeichnen kann.
Der eine bin ich, Nick Lasar, neun Jahre alt und so ziemlich der normalste Junge, den man sich vorstellen kann: Ich esse am liebsten Nudeln, ärgere mich über Hausaufgaben und trage meist Jeans und T-Shirts. Meine Haare sind aschblond und meine Augen unauffällig blau. Ich bin normal groß, mittelmäßig sportlich und habe es sogar geschafft, von neunundzwanzig Schülern auf der Liste der Besten und Schlechtesten jeweils den Platz fünfzehn einzunehmen, genau in der Mitte.
Der andere normale Mensch in unserer Familie ist mein Opa Johannes Lasar, der Direktor der berühmten Lasar-Pralinenwerke. Mein Opa sieht in seinen grauen Anzügen und mit seinen weißen, zurückgekämmten Haaren nicht nur genau so aus, wie man sich einen Opa vorstellt, er ist auch so. Er hört zu, wenn man ihm etwas erzählt. Er überlegt gründlich, bevor er redet, und sagt nur kluge Dinge. Er liebt Pünktlichkeit, Schokolade und seine Arbeit.
Für meinen Opa gibt es nichts Schöneres auf der Welt, als besondere Pralinen zu erfinden und zu verkaufen. Er hat die Lasar-Pralinen in ganz Europa berühmt gemacht, und in diesem Jahr feierte er das fünfzigjährige Jubiläum seiner Pralinenfabrik. Es sollte ein riesiges Fest werden.
Schon Wochen vorher hatte ich diesen Termin in meinem Kalender dreimal rot umkringelt und zählte die Tage rückwärts. Denn an diesem besonderen Jubiläumstag wollte ich meinen Opa um Hilfe bitten. Darum, meinen größten und sehnlichsten Wunsch zu erfüllen: einen echten, lebendigen Hund. Einen Hund, der mich beschützte und mir beistand in dieser merkwürdigen, verdrehten Familie.
Nichts wünschte ich mir mehr. Und ich wusste, wenn mein Opa an seinem großen Festtag verkünden würde: »Der Junge braucht einen Hund«, dann würde sich ganz sicher niemand trauen, etwas dagegen zu sagen. Nicht einmal meine Mutter, die findet, dass Hunde nur Dreck machen und stinken.
Ich hatte alles ganz genau durchdacht. Es war ein todsicherer, wunderbarer Plan. Aber dann kam alles ganz anders. So anders, wie man es sich gar nicht vorstellen kann. Nicht einmal bei so einer verrückten Familie wie meiner.
Aber vielleicht beginne ich lieber von vorne. Da, wo das große Durcheinander begann.
Wie ich auf der Flucht vor einer wilden Indianerin auf einer Nougatpraline ausrutschte
Der Umschlag mit dem Absender Lasar-Pralinenwerke flatterte an einem Montagmorgen durch den Briefschlitz unserer Haustür, rutschte über die grauen Granitfliesen des Flures und verschwand unter dem bunt bemalten Rand des Indianerzelts.
In normalen Hausfluren, das weiß ich von den wenigen Besuchen bei Klassenkameraden, stehen Garderobenständer mit Haken für Jacken und Mäntel. Manchmal steht auch noch ein Schuhschrank dort. Oder eine Reihe dreckiger Gummistiefel.
Nicht bei uns.
In unserem Hausflur steht ein riesiges Tipi aus Büffelleder. Es reicht von dem alten Eichenschrank neben der Haustür bis zur Treppe, die nach oben zu den Kinderzimmern und zum Schlafzimmer meiner Eltern führt. In diesem Zelt lebt und schläft meine kleine Schwester Josefine. Sie ist der festen Überzeugung, dass sie eine Indianerin vom Stamme der Dakota-Sioux ist.
Tag und Nacht trägt Josefine einen Anzug aus Hirschleder, ein Perlenstirnband und weiche Mokassins, die mit Lederriemen verschnürt sind. Niemals verlässt sie das Haus ohne ihren Bogen und einen Köcher mit zwölf Pfeilen. Wenn andere Kinder nach der Schule fernsehen oder mit Freunden spielen, zieht sie in dem Wald gegenüber auf die Jagd. Sie weigert sich, etwas anderes zu essen als das, was sie selbst gefunden oder erlegt hat. Meistens sind das nur Beeren, Pilze oder Mais. Aber es steckten auch schon zwei Hasen und die Siamkatze der Nachbarn in ihrer Tierfalle.
Den Sommer über hatte Josefines Tipi im Garten gestanden, neben den Bambussträuchern an der Terrasse. Aber dann hatte in den ersten Herbsttagen ein Unwetter mit Orkanböen der Stärke zehn über unserer Stadt getobt, das ganze Bäume entwurzelt hatte. Und als meine Eltern Josefine anflehten, sie möge bitte, bitte ins Haus kommen, und ihr dafür sogar einen Marterpfahl versprachen, schlug meine kleine Schwester ihr Tipi im Flur auf.
Seitdem können wir unser Haus nur noch durch die Terrassentür betreten. Und darum entdeckte meine Mutter den Umschlag mit dem Absender Lasar-Pralinenwerke erst neun Tage nach seiner Ankunft, als sie mit der Düse ihres Turbostaubsaugers unter dem Rand des Zeltes entlangsaugte.
Ich hatte gerade meine Hausaufgaben erledigt und war in großen Sätzen fröhlich die Treppe hinuntergesprungen, als der Staubsauger ein lang gezogenes Schlurfgeräusch von sich gab, der Motor aufheulte und eine Warnlampe Verstopfung meldete. Meine Mutter bückte sich und zog die Düse samt dem festgesaugten Brief unter dem Zelt hervor.
Verwundert las sie den Absender, zog eine Augenbraue hoch und strich sich das blonde Haar aus dem Gesicht. Sie riss den schokobraunen Umschlag auf und starrte auf die edle Karte. Dann ließ sie ganz langsam ihre Hände sinken, und ihre runden blauen Augen füllten sich mit Tränen.
So hatte ich meine Mutter noch nie gesehen. Ich wagte nicht, mich zu bewegen. Entweder haben wir im Lotto gewonnen oder jemand ist gestorben, dachte ich.
Nun schwebte meine Mutter, ohne mich auch nur anzuschauen, an mir vorbei in die Küche. Die Karte trug sie wie eine Trophäe mit ausgestreckten Armen vor sich her. Ich rannte ihr eilig nach.
Unsere Küche ist groß und hell und geht ohne Tür und Wand direkt vom Wohnzimmer ab. Die weißen Schränke reichen bis zur Decke und glänzen so sehr, dass man sich am Mittag, wenn die Sonne hereinscheint, darin spiegeln und Grimassen schneiden kann. In der Mitte der Küche steht ein großer, breiter Tresen aus hellem Holz.
An diesem Tresen stand mein Vater und machte sich ein Schinkenbrot. Gerade prüfte er das Verfallsdatum des Senfs. Und obwohl der Senf noch drei Monate haltbar war, zog er seine Stirn in Sorgenfalten. Seine ohnehin hängenden Schultern sanken noch ein Stückchen tiefer. Mein Vater sieht fast immer so aus, als müsste er sich für irgendetwas entschuldigen. Selbst dann, wenn er nur das Verfallsdatum von Senf prüft.
»Othello«, hauchte meine Mutter.
Mein Vater blickte auf und ließ vor Schreck das Senfglas fallen. Mit einem dumpfen Knall schlug es auf die Holzplatte und zerbrach in zwei Stücke.
»Mein Gott, Susanne!«, rief mein Vater bestürzt. »Ist etwas passiert?«
Meine Mutter nickte, hielt die Karte hoch und flüsterte: »Die Einladung zum fünfzigjährigen Jubiläum der Lasar-Pralinenwerke ist angekommen.«
Mein Vater sah sie verdutzt an. Alle wussten seit Monaten, dass wir das Jubiläumswochenende mit der ganzen Familie verbringen würden und dass es am Montag einen Empfang im Rathaus geben würde, bei dem Opa einen Orden bekommen sollte. Darum verstand mein Vater genauso wenig wie ich, was an dieser Einladung so überraschend sein sollte.
»Opa Johannes hat noch etwas handschriftlich hinzugefügt«, sagte meine Mutter mit zittriger Stimme und las vor: »Ich erwarte Euch schon am Freitagabend um neunzehn Uhr zu einem Abendessen. Es gibt noch etwas anderes zu feiern.«
Einen Moment war es ganz still. Nur der Sekundenzeiger der runden Küchenuhr wanderte mit einem steten Klack-klack voran.
Dann schrie meine Mutter so laut los, dass die Tassen im Schrank klirrten: »Jaaaaaaaaa!« Sie riss die geballten Fäuste in die Höhe und hopste um den Küchentisch. »Das kann nur eines bedeuten: den Generationswechsel!«
Ich sah zu meinem Vater, der etwas blass um die Nase geworden war und tonlos wiederholte: »Den Generationswechsel.« Ein Wort, das nach Autoreparatur klingt oder nach einer besonderen Taktik beim Fußballspielen, aber nichts anderes bedeutet als: Der Ältere macht dem Jüngeren den Platz frei.
Meine Mutter glaubte also, dass Opa in Rente gehen und den Chefposten für meinen Vater räumen wollte. Endlich würde er vom Leiter der Außenstelle zum Direktor des gesamten Pralinenwerks aufsteigen. Darauf wartete sie schon seit Jahren, und sie konnte sich nicht vorstellen, dass es irgendetwas Schöneres für meinen Vater geben könnte.
Glücklich nahm sie sein Gesicht in beide Hände und gab ihm einen liebevollen Kuss. »Ich freue mich so für dich.«
»Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll«, murmelte mein Vater.
»Keine Sorge«, beruhigte ihn meine Mutter. »Ich werde dir wie immer eine phantastische Rede schreiben.«
Mein Vater nickte, seufzte tief und verließ die Küche.
»Hach!«, stieß meine Mutter aus und sah ihm gerührt nach. »Dein Vater ist vollkommen sprachlos vor Glück!«
Dann begann sie, auf der Stelle hin und her zu trippeln, machte ein paar Boxbewegungen in die Luft und juchzte: »Darauf muss ich erst mal eine Runde staubsaugen.«
Wenn meine Mutter nicht an der Direktorenzukunft meines Vaters arbeitete oder in unserem Gartenhaus an neuen Pralinenmischungen für die Zeit nach dem Generationswechsel experimentierte, dann saugte sie. Sie besitzt drei silberfarbene Turbostaubsauger mit Flammenaufdruck und ausfahrbaren Düsen. Immer wenn der Motor eines ihrer Staubsauger aufjault und lose Gegenstände mit einem kurzen, kräftigen Schlurfen das Rohr hinaufsausen, bekommt sie diesen merkwürdigen abwesenden Tunnelblick und zieht mit größter Begeisterung alles ein, was ihr vor die Düse kommt.
Ich bin ziemlich sicher, dass das Verschwinden des einzigen Haustieres, das wir jemals besaßen – ein Wellensittich namens Hansi –, einzig und allein mit ihrem Saugtick zu tun hat. Sie hat nämlich auch den Vogelkäfig mit dem Turbo gereinigt. Darum sollte mein Hund auch sicherheitshalber kniehoch sein.
Mein Blick fiel auf die Einladungskarte, die auf dem Küchentisch lag, und mich durchfuhr ein warmer, wohliger Schauer. Wenn mein Opa meinen Vater zum Pralinendirektor machen würde, dann wäre meine Mutter vor Freude so aus dem Häuschen, dass sie ganz vergessen würde, »Nein« zu meinem Hund zu sagen. Außerdem würde sie sich gar nicht trauen, Opa an diesem Tag zu widersprechen. Damit war mein größter Hundegegner schachmatt gesetzt.
Mein Herz klopfte vor Freude so sehr, dass es wehtat. Endlich würde ich einen Hund bekommen! Einen Hund, mit dem ich im Wald spielen konnte und der nachts vor meinem Bett schlief. Der mich beschützte und nie von meiner Seite wich!
Ich musste mein großes Glück unbedingt mit jemandem teilen. Aber mit wem? Einen wirklich guten Freund hatte ich nicht und meine große Schwester Lola sprach nicht mit mir. Blieb also nur meine kleine Schwester Josefine.
Ich rannte an meiner saugenden Mutter vorbei in den Flur zum Tipi. Aus dem Zelt drangen dumpfe Trommelschläge. »Hey! Josefine? Kann ich reinkommen? Ich muss dir was erzählen!«, rief ich gegen den Lärm an. Das Trommeln verstummte und ich drängte mich zwischen der Büffelhaut und der Wand zum Eingang des Tipis durch. »Hast du gehört, Josefine?«
Der Felllappen vor dem Zelteingang schob sich ein kleines Stückchen beiseite, doch statt einer Antwort schoss ein spitzer Pfeil heraus. Er zischte knapp an meinem rechten Ohr vorbei und blieb zitternd in dem dunklen Holz des Eichenschranks stecken.
»Bist du verrückt geworden?«, krächzte ich.
»Ich hab dir schon hundertmal gesagt, dass ich Listige Schlange heiße!«, fauchte meine Schwester und sprang mit zornesrotem Gesicht aus dem Zelt.
»Okay – hab ich vergessen. Tut mir leid. Ich wollte dir nur etwas Wichtiges erzäh...«
»Dafür ist es jetzt zu spät«, unterbrach mich Josefine und warf stolz ihre braunen geflochtenen Zöpfe zurück. »Diesmal musst du für deine Dummheit bezahlen, Bleichgesicht.«
Sie zeigte auf meinen Kopf. »Ich will deinen Skalp. Mit Haut und Haaren. Dann habe ich auch gleich ein Geschenk für Opa zum Jubiläum.«
»Du tickst wohl nicht richtig!«, fuhr ich sie an. Sie glaubte doch nicht allen Ernstes, dass ich eine Glatze tragen würde, nur damit sie ein Geschenk für Opa hatte! Sollte sie ihm doch ein Bild malen!
Aber meine kleine Schwester zog ungerührt ihre Axt, einen original indianischen Tomahawk, aus dem Gürtel. Ich schluckte. Oft genug hatte ich Josefine bei ihren Wurfübungen beobachtet. Sie traf immer. Und ihr Tomahawk war so scharf, dass er ohne Probleme die harte Schale einer Kokosnuss zerteilte.
Jetzt kniff Josefine ihr linkes Auge zusammen, zielte auf meinen Scheitel – und in letzter Sekunde löste ich mich aus meiner Schockstarre. Ich rannte an dem Tipi vorbei ins Wohnzimmer, schlitterte um die graue Couchgarnitur herum über das Parkett und hechtete am Kamin vorbei hinaus in den Garten. Ohne anzuhalten, raste ich über die Straße auf das kleine Wäldchen zu, dicht gefolgt von Josefine.
Was hätte ich sonst tun sollen? Um Hilfe schreien hätte nichts genützt: Meine große Schwester Lola trug bestimmt wie immer Kopfhörer auf den Ohren und lauschte ihrem geliebten Rockstar Joe Mestinker, mein Vater verdaute die Nachricht vom bevorstehenden Generationswechsel, und meine Mutter war im Saugrausch.
Ich war allein im Kampf gegen eine wütende, mit einem Tomahawk bewaffnete Indianerin. Weglaufen war da vielleicht nicht besonders mutig, aber immer noch besser, als skalpiert zu werden. Denn wie man mit so einer unfreiwilligen Glatze aussieht, hatte ich bei Jule aus der 4a gesehen: Die war beim Krippenspiel als Heiliger König mit ihrem Turban an eine Kerze gekommen. Als der Pastor den Brand endlich gelöscht hatte, war von ihren braunen Locken außer drei Kringeln im Nacken nichts mehr übrig gewesen. Ein halbes Jahr lang musste sie ein albernes Piratentuch auf dem Kopf tragen, und als sie es endlich abnahm, war gerade mal ein dünner Flaum nachgewachsen.
Nein, das kam für mich überhaupt nicht infrage: weder das alberne Kopftuch noch eine Halbglatze. Darum erschien es mir am klügsten, Reißaus zu nehmen und meine lästige kleine Schwester mit ihrem Tomahawk einfach abzuschütteln.
So schnell ich konnte, rannte ich auf dem kleinen Trampelpfad in den Wald hinein. Bestimmt würde Josefine bald die Lust verlieren und umkehren, hoffte ich.
Doch ich hatte mich getäuscht.
Nach zwei Kilometern, meine Beine wurden langsam schwer und mein Atem ging nur noch stoßweise, war Josefine mir noch immer dicht auf den Fersen. Ihr schien das Gerenne überhaupt nichts auszumachen. Leicht wie eine Feder flog sie über den Weg, während ich schon wie ein alter Gaul röchelte und kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen konnte.
Mir wurde klar, dass ich hier, auf dem Weg, keine Chance gegen sie hatte. Durch ihre unzähligen Jagdstreifzüge war Josefine einfach zäher als ich. Aber abseits des Weges, im tiefen Laub, war ich mit meinen längeren Beinen eindeutig im Vorteil.
Abrupt bog ich nach links ab, in das Gehölz hinein, und jagte wie ein Hase im Zickzack um die Bäume. Doch als ich nach zehn Minuten das erste Mal einen Blick zurück wagte, musste ich mit Schrecken feststellen, dass ich nicht einen Meter an Abstand gewonnen hatte. Im Gegenteil: Josefine hatte aufgeholt. Ihr Blick war fest auf meinen Scheitel gerichtet, und jetzt schwang sie auch noch im Laufen den Tomahawk.
Ich rannte noch schneller. Jeder Schritt dröhnte in meinem Kopf, und in meinen Schläfen pochte das Blut. Meine Lungen brannten furchtbar. Ich konnte nicht mehr.
Gerade wollte ich aufgeben und die Arme heben, da entdeckte ich nicht weit von mir einen riesigen Stapel gefällter Baumstämme und gleich dahinter ein großes, düsteres Tannendickicht.
Das war meine Rettung!
Ich raffte noch einmal meine letzten Kräfte zusammen und stürmte, so schnell ich konnte, los, um den Stapel herum, sodass ich für Bruchteile von Sekunden aus Josefines Blickfeld verschwand. Diesen winzigen Moment nutzte ich, um mich kopfüber in das dunkle Tannendickicht zu stürzen.
Schwer atmend hing ich ausgestreckt auf den fächerartigen, piksenden Ästen der Tannen, einen Meter über dem Boden. Eine Tannennadel stach gemein in mein linkes Ohr und mein rechter Arm war schmerzhaft verdreht, doch ich wagte nicht, mich zu rühren. Bei der kleinsten Bewegung würde ich zwischen den Zweigen hindurchfallen und auf den Boden plumpsen.
Gebannt lauschte ich in den Wald und hörte, wie das Geräusch von Josefines federnden Schritten plötzlich abbrach. Ich hielt die Luft an. Ganz in der Nähe raschelten Blätter. Es klang, als würde sich Josefine suchend im Laub hin und her drehen. Ich spürte, wie sich ihr Blick auf das Tannendickicht heftete. Die ersten dünnen Äste gaben langsam unter meinem Gewicht nach und knackten.
Ich biss die Zähne zusammen und krallte mich an zwei dicken Zweigen fest. Schritt für Schritt hörte ich Josefine näher kommen, sie konnte nur noch eine Armlänge entfernt sein. Ich hatte mich fast in mein Schicksal ergeben – da setzten die federnden Schritte wieder ein. Josefine lief weiter.
Ich schaffte es noch genau zwei Atemzüge lang, mich zu halten, dann brachen die restlichen Äste unter mir weg. Ich rutschte zwischen den Zweigen hindurch und schlug auf die weiche, von Nadeln gepolsterte Erde auf. Erschöpft blieb ich liegen und betete, dass Josefine nach Hause laufen, ihren Tomahawk ins Zelt legen und ein anderes Geschenk für Opa suchen würde.
Es dauerte eine ganze Zeit, bis mein Herz nicht mehr wie verrückt raste, sondern wieder gleichmäßig schlug und ich mich aufrappeln konnte. Auch wenn Josefine nicht mehr in der Nähe war, schien es mir trotzdem sicherer, den längeren Weg im Schutz des Dickichts zu nehmen, einen großen Bogen zu schlagen und von der anderen Seite nach Hause zu laufen. Wer wusste schon, was für Gruben und Indianerfallen mir auf dem Weg drohten!
Der Umweg durch die dicht beieinanderstehenden Tannen war mühselig. Immer wieder piksten mir die spitzen Nadeln in die Arme und ins Gesicht, und bald schon standen die Bäume so eng beieinander, dass ich nur noch auf allen vieren unter den niedrigsten Ästen hindurchkriechen konnte.