
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbj
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Evie hat der Liebe abgeschworen. Doch die Liebe hat andere Pläne ...
Evie glaubt nicht mehr an die Liebe. Erst recht nicht, als etwas Unfassbares geschieht – sie kann plötzlich die Zukunft von Liebespaaren voraussehen: Alle Liebesgeschichten enden tragisch. Evie versucht noch, mit ihrer seltsamen Gabe zurechtzukommen, als sie bei einem Tanzkurs auf X trifft, der alles verkörpert, was Evie ablehnt: Abenteuerlust, Risikobereitschaft, Leidenschaft. X lebt nach dem Motto, zu allem Ja zu sagen – auch zu dem Tanzwettbewerb, den er und Evie gemeinsam antreten. Evie will sich auf keinen Fall in X verlieben. Doch je länger sie mit X tanzt, desto öfter stellt sie infrage, was sie über das Leben und die Liebe zu wissen glaubt. Ist die Liebe das Risiko vielleicht doch wert?
Romantisch, berührend, hochemotional – der neue umwerfende Liebesroman von der »Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt«-Nr.-1-New-York-Times-Bestsellerautorin!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Nicola Yoon
Aus dem amerikanischen Englischvon Dagmar Schmitz
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
alloyentertainment.comProduced by Alloy Entertainment
Text copyright © 2021 by Nicola Yoon
This translation is published by arrangement with Random House Children’s Books, a division of Penguin Random House LLC.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »Instructions for Dancing« bei Delacorte Press, an imprint of Random House Children’s Books, New York.
© 2022 für die deutschsprachige Ausgabe cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten
Aus dem amerikanischen Englisch von Dagmar Schmitz
Lektorat: Gabriele Rahnfeld
Covergestaltung: Isabelle Hirtz, Inkcraft
Cover art copyright © 2022 by Renike
he · Herstellung: UK
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-28266-0V004
www.cbj-verlag.de
Für meine Mom, die trotz allem immer noch lächelt
Und für meinen Schwiegervater, der durch alles hindurch gelächelt hat
INHALTSVERZEICHNIS
KAPITEL 1 Eine bessere Version von mir
KAPITEL 2 (Ehemalige) Lieblings-Genres von Liebesromanen
KAPITEL 3 Gib ein Buch, nimm ein Buch
KAPITEL 4 Danica und Ben
KAPITEL 5 Das Lagerfeuer
KAPITEL 6 Keine Hexe
KAPITEL 7 Shelley und Sheldon
KAPITEL 8 Zoltar
KAPITEL 9 Ein derart schändlicher Einfluss
KAPITEL 10 Typische Merkmale männlicher Charaktere im klassischen Liebesroman – Eine Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit
KAPITEL 11 Die Formel für Herzschmerz
KAPITEL 12 Lektion lernen
KAPITEL 13 Vom Tanzflow getragen
KAPITEL 14 Tanz Nr. 1
KAPITEL 15 Tanz Nr. 2, in Auszügen
KAPITEL 16 Tanz Nr. 3
KAPITEL 17 Tanz Nr. 4
KAPITEL 18 Eine strenge Definition
KAPITEL 19 Kein Date, Teil 1 von 3
KAPITEL 20 Spätestens am Ende des 2. Akts
KAPITEL 21 Kein Date, Teil 2 von 3
KAPITEL 22 »Black Box«, Lyrics Evie Thomas und Xavier Woods
KAPITEL 23 Fabelhaft, Hervorragend, Ausgezeichnet
KAPITEL 24 Kein Date, Teil 3 von 3
KAPITEL 25 Was man nicht kommen sieht, Teil 1
KAPITEL 26 Sophie und Cassidy
KAPITEL 27 Was man nicht kommen sieht, Teil 2
KAPITEL 28 Der Sturz
KAPITEL 29 Was man nicht kommen sieht, Teil 3
KAPITEL 30 Von der Klippe
KAPITEL 31 Definitiv ein Date
KAPITEL 32 Nacho Problemo
KAPITEL 33 Die Zeit, die wir haben
KAPITEL 34 I Got You, Babe
KAPITEL 35 Bachata-Montag
KAPITEL 36 Salsa-Dienstag
KAPITEL 37 West-Coast-Swing-Mittwoch
KAPITEL 38 Hustle-Donnerstag
KAPITEL 39 Tango-Argentino-Freitag
KAPITEL 40 Erklärungen
KAPITEL 41 Freude-Emoji
KAPITEL 42 Unbehagliches Schweigen
KAPITEL 43 Unterhaltet uns
KAPITEL 44 Archibald und Maggie
KAPITEL 45 Die Erfindung der Sprache
KAPITEL 46 Das Turnier
KAPITEL 47 Wird zum Meer
KAPITEL 48 X und ich
KAPITEL 49 Nicht mehr da, Teil 1
KAPITEL 50 Liebe und ihr Gegenteil
KAPITEL 51 Nicht mehr da, Teil 2
KAPITEL 52 Vergebung
KAPITEL 53 Licht und Dunkel
KAPITEL 54 Eine Million achthundertvierzehntausendundvierhundert Sekunden
KAPITEL 55 Der Fisch und das Wasser
KAPITEL 56 Einmal und vielleicht wieder
KAPITEL 57 Zwei Kleider
KAPITEL 58 Antworten
KAPITEL 59 Uns scheidet
KAPITEL 60 Die Zukunft
Autorin
Übersetzerin
The book of love is long and boringNo one can lift the damn thingIt’s full of charts and facts and figuresAnd instructions for dancingBut II love it when you read to meAnd youYou can read me anything
– The Magnetic Fields, »The Book of Love«
Fast niemand übersteht die Liebe unversehrt.
– Helen Fisher
KAPITEL 1 Eine bessere Version von mir
BÜCHER ÜBEN KEINEN ZAUBER mehr auf mich aus. Früher war das anders. Wenn ich bedrückt war oder mich im kargen Hinterland zwischen tiefer Traurigkeit und Wahnsinn befand, konnte ich einfach blind irgendeins aus dem Regal mit meinen Lieblingsromanen ziehen und mich zum Schmökern in meinen pinkfarbenen Plüschsessel kuscheln. Spätestens bei Kapitel drei – allerspätestens bei Kapitel vier – ging es mir besser.
Jetzt sind Bücher für mich nur noch Buchstaben, aneinandergereiht zu fehlerlos geschriebenen Wörtern, die zu grammatikalisch korrekten Sätzen und zu übersichtlich gegliederten Absätzen und thematisch zusammenhängenden Kapiteln angeordnet sind. Sie sind nicht länger magisch und transportieren auch keine Botschaft mehr.
In einem früheren Leben war ich Bibliothekarin, deshalb sind meine Bücher nach Genre geordnet. Bevor ich angefangen habe, sie zu verschenken, war der Bereich »Zeitgenössische Liebesromane« der größte. Mein absoluter Dauerfavorit ist Cupcakes and Kisses. Ich hole es aus dem Regal und blättere es durch, in einem letzten Versuch, seinen Zauber auf mich wirken zu lassen. Die beste Szene ist die, in der sich der griesgrämige Chefkoch und die grüblerische Schöne mit geheimnisvoller Vergangenheit, deren Aufgabe die Zubereitung der Kaltspeisen ist, eine Küchenschlacht liefern. Am Ende sind beide voller Mehl und Zuckerguss. Sie küssen sich und es folgen eine Menge auf Süßspeisen bezogene Zweideutigkeiten:
Zuckerschnute
Zimtschnecke
Bananensplit.
Vor sechs Monaten wäre ich bei dieser Szene innerlich zu Honig zerflossen. (Was zeigt, welche Wirkung es auf mich hatte.)
Aber jetzt? Nichts.
Und da sich die Wörter nicht verändert haben, seit ich sie das letzte Mal gelesen habe, muss ich mir wohl eingestehen, dass der Roman nicht das Problem ist.
Das Problem bin ich.
Ich klappe das Buch wieder zu und lege es auf den Stapel zu den anderen, die ich morgen weggeben will. Noch ein letzter Ausflug in die Bibliothek und ich bin alle meine Liebesromane los.
Ich will sie gerade in meinen Rucksack packen, als Mom den Kopf in mein Zimmer steckt. Ihr Blick zieht einen Kreis von meinem Gesicht hinunter zum Bücherstapel, hoch zu den vier leeren Regalreihen und wieder zurück zu meinem Gesicht.
Sie runzelt die Stirn und sieht aus, als wollte sie etwas sagen, tut es dann aber doch nicht. Stattdessen streckt sie mir ihr Handy entgegen. »Dein Vater.«
Ich schüttle so heftig den Kopf, dass mir meine Rastazöpfe ums Gesicht peitschen.
Sie stößt das Telefon noch einmal nachdrücklich in meine Richtung. »Jetzt nimm schon«, formt sie lautlos mit den Lippen.
»Nein, nein, nein«, erwidere ich ebenfalls lautlos.
Ich habe noch nie zwei Pantomimen beim Streiten beobachtet, stelle mir aber vor, dass es in etwa so aussehen könnte.
Sie löst sich vom Türrahmen und kommt jetzt ganz in mein Zimmer. Mir bleibt gerade noch genug Platz, um sie herumzuhuschen, was ich auch tue. Ich sprinte über unseren kleinen Flur und schließe mich im Bad ein.
Moms unausweichliches Klopfen folgt zehn Sekunden später.
Ich öffne die Tür.
Sie sieht mich an und seufzt.
Ich seufze zurück.
Derzeit verständigen wir uns hauptsächlich in Form dieser kleinen Ausatmungen. Ihre sind frustriert, leidgeprüft, entnervt, ungeduldig und enttäuscht.
Meine sind verwirrt.
»Wie lange willst du noch so weitermachen, Yvette Antoinette Thomas?«
Die Antwort auf ihre Frage – und ich finde sie durchaus berechtigt – lautet: bis in alle Ewigkeit.
Bis in alle Ewigkeit, so lange werde ich auf Dad sauer sein.
Die eigentliche Frage ist doch: Warum ist sie es nicht?
Sie lässt das Telefon wieder in ihre Schürzentasche zurückgleiten. Ihre Stirn und ihr kurz geschnittener Afro sind mit Mehl bestäubt; es sieht aus, als wäre sie plötzlich ergraut.
»Du gibst noch mehr Bücher weg?«, fragt sie.
Ich nicke.
»Du hast sie mal geliebt.« So, wie sie es sagt, könnte man meinen, ich wollte die Romane verbrennen, statt sie der Bibliothek zu spenden.
Ich erwidere ihren Blick. Womöglich haben wir ja gerade einen ehrlichen Moment miteinander. Wenn sie gewillt ist, darüber zu sprechen, warum ich meine Bücher weggebe, dann ist sie vielleicht auch gewillt, über etwas wirklich Wichtiges zu sprechen, zum Beispiel über Dad und die Scheidung und wie es uns seitdem geht.
»Mom …«, setze ich an.
Aber sie weicht meinem Blick aus, wischt sich die Hände an der Schürze ab und fällt mir ins Wort. »Danica und ich wollen Brownies backen. Komm doch runter und hilf uns.«
Das mit dem Backen ist neu. Es hat an dem Tag angefangen, als Dad aus unserem früheren Haus ausgezogen ist, und seitdem nicht mehr aufgehört. Wenn Mom keinen Dienst in der Klinik hat, dann backt sie.
»Ich treffe mich heute Abend mit Martin, Sophie und Cassidy. Wir müssen anfangen, unseren Roadtrip zu planen.«
»Du bist neuerdings mehr unterwegs als zu Hause«, erwidert sie.
Ich weiß nie, wie ich reagieren soll, wenn sie so etwas sagt. Es ist weder eine Frage noch ein Vorwurf und trotzdem schwingt ein bisschen was von beidem mit. Statt einer Antwort starre ich nur stumm auf ihre Schürze. Kiss the Cook prangt dort über einem riesigen roten Kussmund.
Es stimmt, dass ich in letzter Zeit häufig nicht zu Hause bin. Die Vorstellung, die nächsten Stunden mit ihr und meiner Schwester Danica beim Backen zu verbringen, erfüllt mich zwar nicht direkt mit Verzweiflung, aber es kommt dem sehr nahe. Danica wird sich dem Anlass entsprechend gestylt haben und eine Schürze im Vintage-Stil tragen, dazu passend eine Kochmütze, die mittig zwischen ihren Afro-Poufs thront. Sie wird über ihren derzeitigen Freund reden, von dem sie (sehr) begeistert ist. Mom wird grausige Geschichten aus der Notaufnahme erzählen und auf Reggae-Musik bestehen, irgendwelche alten Songs von Peter Tosh oder Jimmy Cliff. Oder wenn es nach Danica geht, werden sie Trip-Hop hören, während Danica die ganze Aktion für Instagram dokumentiert. Beide werden so tun, als wäre alles in bester Ordnung bei uns.
Aber es ist eben nicht alles in bester Ordnung.
Mom seufzt wieder und reibt sich die Stirn. Der Mehlstaub verteilt sich.
»Du hast Mehl auf der Stirn«, sage ich und strecke die Hand aus, um es wegzuwischen.
Sie weicht meiner Hand aus. »Lass nur. Ich werde sowieso schmutzig.«
Mom stammt aus Jamaika. Sie ist mit Grandma und Grandpa hierhergezogen, als sie vierzehn war. Ihr jamaikanischer Akzent bricht nur durch, wenn sie nervös ist oder aufgebracht. Jetzt im Moment ist ihr Akzent kaum wahrnehmbar, aber er ist vorhanden.
Sie dreht sich um und geht wieder nach unten.
Während ich mich anziehe, versuche ich, nicht über unsere Auseinandersetzung nachzudenken, die eigentlich keine war, denke aber letztendlich doch an nichts anderes. Warum hat es sie so aus der Fassung gebracht, dass ich meine Bücher weggeben will? Es ist, als sei sie enttäuscht, dass ich nicht mehr derselbe Mensch bin wie noch vor einem Jahr.
Aber natürlich bin ich nicht mehr dieselbe. Wie könnte ich? Ich wünschte, ich wäre von der Scheidung genauso unberührt geblieben wie sie und Danica. Ich wünschte, ich könnte unbeschwert gemeinsam mit ihnen backen. Ich wünschte, ich könnte wieder das Mädchen sein, das seine Eltern, ganz besonders seinen Dad, für unfehlbar gehalten hat. Könnte wieder das Mädchen sein, das gehofft hat, eine Liebe wie die seiner Eltern zu finden, wenn es erwachsen ist. Ich habe geglaubt, dass man auf immer und ewig glücklich zusammenleben kann, weil sie es mir vorgelebt haben.
Ich wünsche mir diesen Zustand der Ahnungslosigkeit zurück und würde am liebsten aus meinem Gedächtnis tilgen, was ich inzwischen weiß. Aber das geht nicht, man kann nicht im Nachhinein etwas nicht wissen, was man bereits weiß.
Ich kann nicht nicht wissen, dass Dad Mom betrogen hat.
Ich kann nicht nicht wissen, dass er uns alle drei wegen einer anderen Frau verlassen hat.
Mom vermisst die Version von mir, die diese Bücher geliebt hat.
Ich vermisse sie auch.
KAPITEL 2 (Ehemalige) Lieblings-Genres von Liebesromanen
Zeitgenössisch
Aus Feinden werden Liebende – Ständig fragt man sich, ob sie sich am Ende küssen oder umbringen werden. Kleiner Scherz. Selbstverständlich werden sie sich küssen.Dreiecksgeschichte – Dreiecksgeschichten werden gern verrissen, aber eigentlich sind sie toll. Es gibt sie, damit sich die Hauptfigur entscheiden kann, entweder die zu bleiben, die sie ist, oder eine andere zu werden. Nur so am Rande: Solltest du dich jemals zwischen einem Vampir und einem Werwolf entscheiden müssen, dann nimm den Vampir. Siehe hierzu auch Punkt 1, letzter Satz, dort steht, warum du (ganz klar) den Vampir nehmen solltest.Zweite Chance – Zurzeit wird mir klar, dass dies die unrealistischste Wendung ist. Denn wenn dich jemand schon einmal verletzt hat, warum solltest du ihm dann die Chance geben, es noch mal zu tun?Fantasy
Vampire – Sie sind sexy und werden dich ewig lieben.Engel – Sie haben Flügel, mit denen sie dich schützend umhüllen oder dich von hier fortbringen können, wohin auch immer du möchtest.Gestaltwandler – Meistens Jaguare und Leoparden, aber im Grunde alles aus der Familie der Großkatzen. Einmal habe ich versuchsweise etwas über Dinosaurier-Gestaltwandler gelesen. Tyrannosaurus Rex, Pteranodon, Apatosaurus und so weiter. Sie sind genauso gruselig, wie man es sich vorstellt.KAPITEL 3 Gib ein Buch, nimm ein Buch
ALS ICH AM NÄCHSTEN MORGEN nach unten gehe, ist Mom schon zu ihrer Schicht in der Klinik unterwegs. Danica sitzt am Esstisch und macht Bilder von den Brownies, die sie und Mom gebacken haben. Sie sind auf einer von Moms stylishen neuen Kuchen-Etageren zu einer Pyramide aufgeschichtet. Danica gehört zu jenen Vertreterinnen der Fotografie, die es lustig und schräg mögen. Sie hält ihr Smartphone schief und lässt es um die Brownie-Pyramide kreisen, während sie ein schräg-lustiges Foto nach dem anderen schießt.
Ich mache mir mein Müsli und setze mich zu ihr an den Tisch. Wir wohnen seit sechs Monaten in dieser Wohnung, aber mir kommt sie immer noch wie ein Provisorium vor, so als wäre ich nur zu Besuch. Ich warte darauf, wieder in mein richtiges Leben zurückzukehren.
Verglichen mit unserem früheren Haus ist es hier klein und beengt. Ich vermisse unseren eigenen Garten. Jetzt teilen wir uns einen begrünten Innenhof mit zwölf anderen Mietparteien. Unser altes Haus hatte zwei Bäder, jetzt haben wir nur noch eins. Am meisten fehlt mir aber, dass dort jeder Raum unsere Erinnerungen barg.
Danica entscheidet sich für ein Foto und schiebt mir ihr Handy zu, damit ich mir anschauen kann, was sie gepostet hat. »Man kann nicht mal erkennen, dass sie angebrannt sind«, verkündet sie stolz.
Es stimmt. Sie sehen wirklich perfekt aus. Ich scrolle durch ihre Posts. Da ist ein Selfie von ihr und Mom, beide mehlbestäubt, wie sie einen großen Block Schokolade ins Bild halten und lachen, was mich wünschen lässt, ich wäre geblieben und hätte mitgeholfen. Ich überfliege die Hashtags – #muttertochterbackabend, #schwarzesbackwunder, #perfektebrowniesperfektgelungen –, bevor ich ihr das Handy wieder zuschiebe.
»Wieso bist du nicht beim Brunch?«, fragt sie.
Normalerweise verbringe ich den Sonntagmorgen mit meinen besten Freunden im Surf City Waffle, dort gibt es die besten Waffeln in ganz Los Angeles. Aber heute Morgen hat keiner von ihnen Zeit.
»Die anderen haben alle schon was vor«, sage ich.
»Dann bleibst du also heute hier und hängst bloß ab?«, hakt sie nach, und für mich klingt es nicht so, als lege sie besonderen Wert darauf, dass ich heute hierbleibe und bloß abhänge.
Ich lasse den Löffel in die Müslischale zurücksinken und betrachte meine Schwester. An den meisten Tagen sieht sie aus wie ein Supermodel aus den Siebzigerjahren mit ihrem riesigen Afro, dem schimmernden Glitzer-Make-up und dem Vintage-Outfit.
Und gerade im Moment sieht sie sogar noch schöner aus als sonst. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, sie hat ein Date. Aber ich muss nicht raten, denn keine Sekunde später klingelt es. Ein strahlendes Lächeln lässt ihr Gesicht aufleuchten und sie sprintet mit einem glücklichen Aufschrei zur Tür.
Im letzten Jahr hatte Danica acht verschiedene Freunde, das macht im Durchschnitt 0,667 Freunde pro Monat oder 0,154 Freunde pro Woche. Mein Problem dabei ist nicht die Anzahl oder gar das Niveau ihrer Freunde (um es ganz klar zu sagen, das Niveau könnte besser sein. Ich weiß nicht, warum sie sich immer Typen aussucht, die so viel weniger klug und interessant sind als sie), sondern die Tatsache, dass sie überhaupt Dates hat. Warum bin ich die Einzige hier, die ihre Lektion aus Moms und Dads Scheidung gelernt hat?
Ich lasse meine Müslischale auf dem Tisch stehen und will mich durchs Wohnzimmer davonschleichen, um einer Begrüßung aus dem Weg zu gehen. Fehlanzeige.
»Hey Evie.« Der Typ sagt »Hey«, als hätte das Wort mehr als nur eine Silbe.
»Hi«, erwidere ich und versuche vergeblich, mich an seinen Namen zu erinnern. Er trägt Board-Shorts und ein ärmelloses T-Shirt, als wollte er zum Strand gehen oder käme gerade von dort. Er ist weiß, groß und muskulös und hat lange, zerzauste blonde Haare. Wäre er ein Einrichtungsgegenstand, wäre er ein wirklich hübscher Flokati.
Wir stehen ein paar Sekunden stumm und verlegen herum, bis uns Danica aus unserem Elend befreit. »Ben und ich überlegen, ob wir ins Kino gehen«, erklärt sie. »Du kannst mitkommen, wenn du willst.«
Aber ihre Mienen verraten mir zwei Dinge.
Erstens: Sie überlegen nicht, ins Kino zu gehen. Sie überlegen, hierzubleiben. Allein. In der Wohnung. Um rumzumachen.
Und zweitens: Wenn sie tatsächlich ins Kino gehen wollten, wollen sie mich nicht dabeihaben.
Warum fragt sie mich überhaupt? Tue ich ihr etwa leid?
»Ich kann nicht. Aber danke für das Angebot. Viel Spaß euch beiden«, erwidere ich. Das Einzige, was ich heute vorhabe, ist zur Bibliothek zu gehen und meine Bücher loszuwerden, aber wenn ich ihnen das erzähle, werde ich mich erst recht lausig fühlen. Ich gehe nach oben und ziehe mich an.
Zum Abschied sage ich »Bye«, als hätte das Wort mehr als nur eine Silbe.
Ich bin auf dem Fahrrad unterwegs und schon auf halbem Weg zur Bibliothek, als mir einfällt, dass ja heute Sonntag ist. Die Bibliothek hat sonntags geschlossen.
Jetzt wieder nach Hause zurückzukehren und Danica und Ben beim »Chillen« zu stören, ist nicht wirklich eine Option. Es ist ein wunderschöner Frühlingsmorgen, noch hängt ein Hauch von Nebel in der Luft, und es duftet feucht und frisch. Ich beschließe, zu den La Brea Tar Pits zu fahren und vorher eine kleine Runde durch Hancock Park zu drehen.
Das Stadtviertel Hancock Park liegt nur zehn Minuten von unserer Wohnanlage entfernt, könnte sich aber ebenso gut auf einem anderen Planeten befinden. Die Villen in dieser Gegend sind groß wie Paläste, nur ohne die dazugehörigen Palastgräben, Fallgitter, Drachen und holden Fräuleins in Nöten. Jedes Mal, wenn wir durch Hancock Park fahren, sagt Mom, es sei ein Verbrechen, dass es in einer Stadt mit so viel Obdachlosigkeit Häuser wie diese gibt. In der Notaufnahme behandelt sie viele obdachlose Menschen.
Ich fahre langsam, radle gemächlich eine Straße nach der anderen entlang und bestaune die enormen, perfekt gepflegten Rasenflächen und die enorm teuren, blitzenden Nobelkarossen.
Irgendwann finde ich mich auf einer Straße wieder, die zu beiden Seiten von Jasminbüschen und hohen Jacarandabäumen gesäumt ist. Letztere lassen ihre Äste weit über die Fahrbahn ragen und bilden einen Baldachin aus lilafarbenen Blüten. Ich fühle mich, als würde ich durch einen Tunnel mitten in ein Märchen hineinfahren.
Die Sonne verschwindet hinter einer Wolke und es wird auf einmal kühl. Ich fahre rechts ran und hole meine Jacke aus dem Rucksack. Als ich wieder aufs Rad steigen und weiterfahren will, fällt mir einer dieser öffentlichen Holzbücherschränke ins Auge, die in manchen Stadtvierteln stehen. Er ist hellblau und sieht aus wie ein Miniatur-Haus, mit einem Giebeldach und verwitterten weißen Türen, die durch Riegel verschlossen sind. Kleine Freie Bibliothek verkündet ein kleines Schild.
»Du hast gewiss viele Bücher für uns dabei, Liebes«, sagt eine Frauenstimme, als ich den Seitenständer noch einmal herunterklappe und mein Rad wieder abstelle.
Ich schreie auf und wirble herum. Eine alte Dame steht hinter mir, keinen halben Meter entfernt.
»Verfickte Glocken!«, entfährt es mir, und ich halte mir sofort die Hand vor den Mund. »Entschuldigung, ich wollte nicht fluchen. Ich bin nur so erschrocken.«
Sie schmunzelt und kommt näher. Ihre dünne hellbraune Haut erinnert an zerknittertes Pergamentpapier.
»Schon gut. Mach dir wegen des Fluchens keine Gedanken. Mich würde allerdings interessieren, was verfickte Glocken sind.«
Ich lächle, schaue aber an ihr vorbei. Wo ist sie überhaupt hergekommen?
»Ist das Ihr Bücherschrank?«, frage ich.
»Nun ja, ich habe ihn aufgestellt, aber er ist natürlich für alle da. Kennst du solche Bücherschränke? Die Idee dahinter ist, die Leute zum Lesen zu bewegen und womöglich sogar dazu, sich mit ihren Nachbarn zu unterhalten, anstatt lediglich Tür an Tür mit ihnen zu wohnen.« Sie reibt die Handflächen aneinander. »Was hast du uns denn Schönes mitgebracht?«
Ich schwinge meinen Rucksack auf den Boden und hole einen Armvoll Bücher heraus.
Sie nimmt mir ein paar davon ab und drückt sie an sich. »Die sind sehr beliebt«, stellt sie fest, als sie auf die Titel schaut. Sie gehört zu den Menschen, die beim Lesen die Worte mit den Lippen nachformen. Das lässt es so aussehen, als spräche sie einen bizarren Zauberspruch. Barely There – Cupcakes and Kisses – Destiny’s Duke – Love, Set, Match – Tiger’s Heart.
»Sie sind alle großartig.« Meine Stimme ist ein heiseres Krächzen. Ich räuspere mich. »Sie sollten sie lesen.«
»Warum gibst du sie weg?«
Sie steht jetzt noch näher bei mir, nach wie vor die Bücher umklammernd, die sie mir abgenommen hat.
Ich hole noch weitere aus meinem Rucksack und erwäge, ihr die Wahrheit zu sagen. Dass es sich nicht mehr so anfühlt, als wären es meine Bücher. Dass es sich mit Liebesgeschichten verhält wie mit Märchen: Man sollte nicht ewig an sie glauben.
Ich jedenfalls habe an dem Tag, als Dad ausgezogen ist, aufgehört, an sie zu glauben.
Schon komisch, dass ein Tag anfangen kann wie jeder andere und dann so vollkommen anders endet. Manchmal wünschte ich, es gäbe eine Wettervorhersage für das Leben. Laut Prognose eignet sich der morgige Vormittag hervorragend für den üblichen Highschool-Unfug, am späten Nachmittag hingegen ist mit einem schweren elterlichen Treuebruch zu rechnen, dessen Tiefausläufer sich bis in die Nacht hinein ziehen und in einem Sturmtief der Verzweiflung enden. Ausführlicheres hierzu nach der Werbepause.
Ich hatte den Schultag im Schockzustand verbracht und konnte immer noch nicht glauben, dass Dad nicht mehr da sein würde, wenn ich nach Hause kam. Gegen Mittag war ich mir sicher, ich würde ihn davon überzeugen können, dass er und Mom einen Fehler machten, wenn sie sich scheiden ließen. Daher stieg ich nach der Schule in den Bus nach Santa Monica und fuhr dort angekommen mit meinem Fahrrad über den Campus zum Institut für Geisteswissenschaften, wo er sein Büro hat. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend jagte ich die Treppe hoch, während ich darüber nachgrübelte, was ich sagen würde. Vielleicht war das Problem, dass ihm nicht klar war, wie sehr ihn Mom liebte. Sie zeigt es nicht immer so deutlich. Oder vielleicht brauchten die beiden etwas mehr Zeit füreinander, mindestens einen kinderfreien Abend in der Woche oder so was in der Art. Oder ein gemeinsames Hobby, um wieder »zueinanderzufinden«, wie es Experten für Beziehungsfragen immer empfehlen.
Ich rannte den Flur zu seinem Büro entlang, überzeugt, er würde es schon verstehen. Dad und ich haben uns immer verstanden.
Ich klopfte nicht an. Ich hätte anklopfen sollen, aber ich tat es nicht. Ich riss einfach die Tür auf und stürmte in sein Büro in der Hoffnung, dass er da sein würde. Er war da. Und er küsste eine Frau, die nicht Mom war.
Ich ließ den Blick zwischen ihnen hin- und herwandern. Ich versuchte mir einzureden, dass diese Beziehung vielleicht ganz frisch war, dass sie erst in den letzten beiden Tagen begonnen hatte. Aber das war natürlich dumm. Es war nicht ihr erster Kuss und es war auch nicht ihr letzter. Dieser Kuss sprach Bände, er sagte mir, dass es eine ganze Geschichte hinter ihrer Beziehung gab. Es war nur einer von den vielen, vielen Küssen, die unsere Familie in die Brüche gehen ließen und Mom das Herz brachen und mir auch.
Dad strich sich mit der Hand übers Gesicht. »Evie, Süße. Du hast nicht angeklopft.«
Ich bin mir nicht sicher, ob er mich dafür tadelte.
Als uns Mom und er eröffnet hatten, dass sie sich trennen würden, sagten sie, sie hätten sich auseinandergelebt. Dass sie sich noch lieben würden und dass sie uns liebten. Aber das war gelogen. Der Grund, warum uns Dad verließ, stand hier vor mir, trug ein jadegrünes Kleid und riesige goldene Creolen und hielt sich die Hände vor den Mund, als könnte das irgendwie ungeschehen machen, was ich gesehen hatte.
Ich wich vor ihnen zurück und rannte aus dem Büro, jagte den Flur entlang, die Treppe runter, bis ich draußen war. Dad rief mir hinterher, aber was gab es noch zu sagen? Es gab überhaupt nichts mehr zu sagen.
An diesem Abend berichtete mir Mom, dass Dad angerufen und ihr mitgeteilt hätte, was passiert war. Sie meinte, es täte ihr leid, dass ich es mit ansehen musste. Sie bat mich, Danica nichts davon zu erzählen. Sie sagte, sie würde nie wieder darüber reden wollen.
Natürlich verrate ich der alten Frau nichts von alldem. Stattdessen verstaue ich meine restlichen Bücher in ihrer kleinen Bibliothek. Als ich sie ansehe, wirkt sie mitfühlend, als hätte sie irgendwie alles das gehört, was ich nicht ausgesprochen habe.
Ich verriegle die Tür wieder. »Viel Freude beim Lesen.«
Sie deutet auf den Schrank. »Möchtest du denn kein Buch mitnehmen, Liebes? ›Gib ein Buch, nimm ein Buch‹, lautet das Motto.«
»Da ist aber keins drin«, erwidere ich.
»Wirklich nicht? Ich bin mir sicher, erst vorhin war jemand da und hat eins hineingestellt.«
Ich öffne die Tür noch einmal und entdecke das Buch, das sie meint, ganz hinten links in der Ecke.
Es heißt Tanzen lernen und ist ein schmales Taschenbuch, seine Seiten haben Eselsohren und wellen sich, als sei es jemandem mal ins Wasser gefallen. Unter dem Titel ist eine simple Strichzeichnung von zwei Fußpaaren abgebildet, die einander gegenüberstehen.
Ich blättere es durch und überfliege einige der Kapitelüberschriften: »Salsa«, »Bachata«, »Walzer«, »Tango«, »Merengue«, »East Coast Swing«, »Lindy Hop«. Zu jedem Tanz gibt es eine eigene Abfolge nummerierter Strichzeichnungen mit Pfeilen, die von einem Fußpaar zum anderen zeigen.
»Vielleicht sollte ich es für jemanden stehen lassen, der tanzen lernen möchte«, sage ich und will es wieder zurückstellen.
»Dieser Jemand könntest du sein, Liebes.« Sie kommt noch näher zu mir. »Ich bestehe darauf.«
Es scheint ihr so wichtig zu sein, dass ich das Buch schließlich in meinen Rucksack fallen lasse. »Hat mich sehr gefreut«, verabschiede ich mich, während ich auf mein Rad steige.
»Mich auch«, sagt sie. »Pass gut auf dich auf.«
An der nächsten Querstraße drehe ich mich um und will ihr noch einmal winken.
Aber als ich zurückblicke, ist sie nicht mehr da.
Ich fahre noch zwei Straßen weiter, bevor mir klar wird, dass ich Richtung Osten unterwegs bin statt heimwärts Richtung Westen. Was hat mich bloß so konfus gemacht? Ich halte am Straßenrand an und schaue auf mein Handy. Es ist schon nach drei. Ich bin seit vier Stunden unterwegs. Mein Magen knurrt, als hätte er ebenfalls gerade begriffen, wie spät es ist.
Für den Rückweg nehme ich die weniger schöne Strecke und trete hart in die Pedale, fahre aber trotzdem vorsichtig. Die Autofahrer in Los Angeles verhalten sich manchmal, als würde es keine Radfahrer geben. Daheim angekommen schließe ich erst mein Fahrrad ein und biege dann um die Ecke zu unserer Wohnung. Danica und Ben stehen auf dem Treppenabsatz und sind so damit beschäftigt, sich verliebt in die Augen zu schauen, dass sie mich nicht wahrnehmen, obwohl ich nur wenige Schritte entfernt bin.
Es gibt ein paar Dinge im Leben, die man nicht unbedingt sehen muss. Die kleine Schwester beim Knutschen beispielsweise. Ich will mich räuspern, um uns beiden das Trauma zu ersparen, aber da beugt sie sich bereits vor und küsst ihn.
Vor meinem inneren Auge wird es schwarz, wie im Kino, kurz bevor der Film beginnt.
Und ich sehe.
KAPITEL 4Danica und Ben
ICHSEHEDANICA in unserer Schulcafeteria. Sie sitzt von ihren Freundinnen und Freunden umgeben an ihrem gewohnten Tisch. In der Cafeteria ist wie immer viel los. Manche Schüler unterhalten sich, essen, lachen. Manche Schüler – diejenigen, die immer allein sind – unterhalten sich nicht, lachen nicht. Danica sticht heute ganz besonders hervor, sie trägt ein fuchsiafarbenes Outfit, das vermutlich einmal ein Abschlussballkleid war.
Von rechts rutscht ein Tablett heran und stößt gegen ihres. Am anderen Ende dieses Tabletts steht lächelnd Ben.
»Ich überlege, dich zu fragen, ob du Lust hast, dich mit mir zu verabreden«, sagt er.
»Hast du nicht eine Freundin?«, will Danica wissen.
»Nicht mehr.« Er beugt sich vor. »Wenn ich dich fragen würde, was würdest du sagen?«
Sie beugt sich ebenfalls vor. »Du musst mich schon fragen, um es herauszufinden.«
»Hast du Lust, dich mit mir zu treffen?«
»Klar«, sagt sie. »Warum nicht?«
Ich sehe diesen Moment jetzt, die beiden stehen auf der Treppe vor der Haustür und küssen sich, als würde es kein Morgen geben.
Ich sehe Danica nachts am Strand, ringsum Feuerstellen, die ihrerseits umringt sind von Danicas Freundinnen und Freunden, die tanzen und feiern oder ihre Hände und Gesichter über den Flammen wärmen oder einfach nur den Funkenflug beobachten. Sie läuft stolpernd durch den Sand, fort von alldem. Ihre Blicke sind rastlos und suchend. Sie kommt an Rettungsschwimmerstation 23 vorbei und dann an Station 24. Bei Station 27 findet sie Ben, aber er ist nicht allein. Er küsst seine Ex-Freundin, die, wie sich herausstellt, gar keine Ex ist.
Ich sehe Danica alleine in ihrem Zimmer. Sie liegt im Bett und scrollt durch ihre diversen Social-Media-Accounts, löscht Fotos und Posts und Kommentare. Sie ändert ihren Beziehungsstatus auf Single. Sie entfolgt und löscht ihre Likes, bis sich kein Hinweis mehr darauf finden lässt, dass Ben und sie jemals zusammen waren.
KAPITEL 5 Das Lagerfeuer
DIE VISION ENDET und die Wirklichkeit kehrt in mein Blickfeld zurück. Ich bin wieder da, wo ich war, draußen auf dem Weg zu unserer Wohnung.
Danica und Ben stehen immer noch auf dem Treppenabsatz vor der Tür, aber sie küssen sich nicht mehr. Sie starren mich beide an.
Ben schaut irritiert.
Danica schaut entrüstet. »Verdammt, was soll das, Evie?« Sie stapft aufgebracht die Stufen herunter auf mich zu. »Wieso glotzt du uns an wie eine Geisteskranke?«
Sie steht vor mir, real genug, um sie zu berühren. Keine Sinnestäuschung. Aber ich werde die Bilder von ihr in der Cafeteria und am Strandlagerfeuer und allein in ihrem Zimmer, wo sie ihre gemeinsame Geschichte mit Ben löscht, nicht los.
»Ich … was?«, sage ich. Mir ist leicht schwindelig.
Ich scheine zu schwanken, denn sie kommt noch näher. Ihr Ausdruck wechselt von genervt zu besorgt. »Alles in Ordnung mit dir?«
»Ja, mir ist bloß … keine Ahnung, was mit mir los ist. Das war das Merkwürdigste, was ich …«
»Lass uns reingehen.«
»Ich hab seit dem Frühstück nichts mehr gegessen«, erkläre ich, als sie mich in die Wohnung hineinmanövriert. »Und dann bin ich echt schnell gefahren und hab mich beeilt, nach Hause zu kommen.«
Sie lotst mich zur Couch. »Ich rufe Mom an.«
Das reißt mich aus meiner Benommenheit. »Nein, bitte nicht. Ich will nicht, dass sie sich Sorgen macht. Mir war nur kurz schummrig.«
Danica setzt sich neben mich und nimmt meine Hand. »Lass mich mal deine Augen sehen.« Sie klingt ein bisschen wie Mom im Krankenschwester-Modus.
Ich kann mich nicht erinnern, wann wir uns das letzte Mal körperlich so nah waren. Ihr ins Gesicht zu sehen, ist fast so, als würde ich in mein eigenes Gesicht blicken. Unsere Haut hat den gleichen warmen Braunton, wir haben die gleiche Gesichtsform, die gleichen hohen, runden Wangenknochen und die gleichen vollen, rosenfarbenen Lippen. Allerdings fügen sich diese Merkmale bei ihr auf wesentlich spektakulärere Art und Weise zusammen. Sie sieht aus wie ein Supermodel. Ich sehe aus wie die hübsche, aber weniger attraktive Schwester des Supermodels.
Sie umfasst mit einer Hand mein Kinn und dreht mein Gesicht nach rechts und links. Ich habe keine Ahnung, wonach sie Ausschau hält.
Wir waren noch nie die Sorte von Schwestern, die beste Freundinnen sind, aber wir waren uns einmal näher, als wir es jetzt sind. Sie hat ihre Schminkkünste perfektioniert, indem sie auf meinem Gesicht geübt hat. Ich habe sie immer mit neuen Liebesromanen versorgt (sie liest sie fast so gern wie ich früher) und mit den Songs der angesagtesten Bands. Damals, als ich noch mit Dwayne zusammen war – meiner ersten und einzigen Liebe –, hatten wir sogar ein paar Doppel-Dates.
Sie drückt meine Hand und sieht aus, als wollte sie etwas sagen, aber Ben kommt ihr zuvor. »Hey, ich muss los, D. Wegen dieser Sache.«
Geht es bei dieser Sache darum, meine Schwester mit deiner Ex-Freundin zu betrügen?, würde ich ihn am liebsten fragen. Was eine lächerliche Frage wäre, denn er hat sie ja nicht betrogen. Zumindest weiß ich nicht, ob er es getan hat.
Ich entziehe Danica meine Hand und straffe meine Schultern. »Es geht mir wirklich gut.«
Sie springt sofort auf und ist mit einem Satz bei Ben, gemeinsam huschen sie zur Tür raus.
Ich reibe mir die Schläfen und lasse mich wieder ins Polster zurücksinken, immer noch unter Schock. War das eine Wahnvorstellung? Kann man so etwas bekommen, wenn man sehr hungrig und erschöpft ist und extrem aufgewühlt? Oder vielleicht war es einer dieser lebhaften Träume, die man manchmal kurz vor dem Aufwachen hat?
Ich hatte immer schon eine blühende Fantasie, aber es war mehr als das. Es war absolut lebensecht.
Mein Magen erinnert mich daran, dass ich Hunger habe.
Danica kommt wieder rein und gesellt sich zu mir in die Küche, als ich gerade dabei bin, einen der Brownies zu verspeisen.
»Ein paar von uns gehen heute Abend zum Strand, wir wollen ein Lagerfeuer machen. Komm doch mit«, sagt sie.
Ich lasse fast den Brownie fallen. »Du gehst heute Abend zum Strand?« Das Bild von ihr, wie sie auf der Suche nach Ben durch den Sand stolpert und ihn dann mit einer anderen ertappt, blitzt vor meinem inneren Auge auf. »Kommt Ben auch?«
»Klar.« Sie verengt die Augen. »Wieso, was ist mit ihm? Oh, lass mich raten, du kannst ihn nicht leiden.«
»Das habe ich nicht gesagt …«
»Aber gemeint.«
Das ist ganz und gar nicht das, was ich gemeint habe, aber ich weiß nicht, wie ich ihr erklären soll, was ich meine. Wie sage ich ihr, dass ich eine merkwürdige Vision hatte und befürchte, ihr wird heute Abend das Herz gebrochen?
»Ach, was soll’s.« Sie dreht sich auf dem Absatz um und stürmt die Treppe hoch.
Später an diesem Abend liege ich mit meinem Laptop auf der Couch und bin in das Vorlesungsverzeichnis der NYU vertieft (die New York University, die ich ab Herbst besuchen werde), als Danica nach Hause kommt. Ihre Wimperntusche ist verschmiert, als hätte sie geweint.
Ich klappe den Laptop zu und setze mich auf. »Was ist los?«, frage ich, obwohl mich das dumpfe Gefühl beschleicht, dass ich es bereits weiß.
»Nichts«, antwortet sie und steuert sofort Richtung Treppe.
Ich folge ihr nach oben zu ihrem Zimmer. »Darf ich reinkommen?«
»Meinetwegen.« Es klingt nicht gerade einladend, aber zumindest hat sie nicht gesagt, ich soll verschwinden.
Ich bin noch nicht oft in ihrem Zimmer gewesen, seit wir hier eingezogen sind. Es sieht aus wie ihr altes, nur kleiner. Die Wände sind mit Coverseiten von Vintage-Magazinen und mit Fotos von ihr und ihren Freunden gepflastert. In unserem Haus waren ihre Wände lila gestrichen, aber da wir jetzt zur Miete wohnen, müssen wir sie weiß lassen. Es herrscht eine Art kunstvolles Chaos im Raum. Überall liegen Stoffreste und Skizzenbücher mit Entwürfen verstreut. Ihr Arbeitstisch ist übersät mit Zeichnungen und Garnspulen und Malutensilien. Die Nähmaschine ist halb unter Stoffen verborgen. Der einzige Gegenstand, auf dem nichts herumliegt, ist ihr Schminktisch. Es ist einer dieser altmodischen Frisiertische mit einem riesigen runden Spiegel, der von Glühbirnen umsäumt ist.
»Du wirkst aber nicht so, als ob nichts los wäre«, sage ich.
Sie setzt sich vor den Spiegel und beginnt, sich mit einem Papiertuch abzuschminken. »Mir geht’s gut«, erwidert sie in fröhlichem Tonfall. Sie wirft das Tuch in den Papierkorb und rupft ein neues aus der Box. »Ben und ich haben Schluss gemacht.«
Moment mal.
»Was ist passiert?«, frage ich.
Sie zuckt mit den Schultern. »Ich hab ihn beim Knutschen mit seiner Ex erwischt.«
Das hier geschieht wirklich.
»Wo?«, hake ich nach und stelle mir Ben im Schatten von Rettungsschwimmerstation 27 vor.
»Am Strand. Hinter einer der Rettungsschwimmerstationen.« Sie stößt ein abschätziges Schnauben aus und verdreht die Augen.
Auf einmal fühle ich mich wieder genauso wie schon vor ein paar Stunden. Schwindelig und erschöpft. Völlig verstört.
Ich setze mich auf ihre Bettkante.
»Es ist wirklich keine große Sache, Evie«, fügt sie hinzu.
»Wie kannst du so was sagen?«
»Weil es keine große Sache ist. Es gibt noch jede Menge andere Typen.«
»Aber warum gibst du dich überhaupt mit Typen ab?«, frage ich.
Sie hört auf, sich abzuschminken, und dreht sich zu mir um. »Nicht jede kann so sein wie du, Evie. Ich habe echte menschliche Gefühle.«
»Was soll das denn heißen?«
Sie wendet sich wieder dem Spiegel zu. »Das Einzige, was du fühlst, ist Wut auf Dad.«
So oft schon habe ich ihr im vergangenen Jahr erzählen wollen, dass Dad ein Verhältnis mit einer anderen Frau hat. Wenn sie es wüsste, wäre sie genauso sauer auf ihn wie ich. Aber Mom hat mich gebeten, es nicht zu tun. Manchmal denke ich, es wäre barmherziger, es ihr zu sagen. Ist es nicht immer besser, die Wahrheit zu kennen und sich keine Illusionen zu machen?
Ich stehe auf und gehe zur Tür.
Unsere Blicke begegnen sich im Spiegel. Ihr Gesicht ist jetzt ohne jedes Make-up. Obwohl sie behauptet, die Trennung von Ben wäre keine große Sache, wirkt sie traurig auf mich.
»Es tut mir wirklich leid wegen Ben«, sage ich und schlüpfe zur Tür hinaus.
Die Wahrheit ist, dass mich ihre Trennung wahrscheinlich mehr aufwühlt als Danica selbst. Ich verstehe nicht, was mit mir los ist.
Eine Vision zu haben, ist das eine. Etwas völlig anderes ist es, wenn das, was man in dieser Vision sieht, auch tatsächlich eintritt.
KAPITEL 6 Keine Hexe
ALS ICH JÜNGER WAR, ungefähr acht oder neun, dachte ich, Mom wäre eine Hexe. Irgendwie wusste sie ständig Dinge, die sie nicht hätte wissen dürfen. Zum Beispiel wenn ich gerade in der Nase gepopelt und den Popel verschluckt hatte. Oder wenn ich noch unter der Bettdecke las, statt zu schlafen.
Ich dachte, dass sie mich eines Tages, an meinem zehnten Geburtstag vielleicht, zu sich rufen würde, um ein klärendes Gespräch mit mir zu führen.
»Evie«, würde sie sagen, »ich bin eine Hexe, die einer langen Ahnenreihe von Hexen entstammt. Deine Grandma war eine Hexe und ihre Mutter vor ihr und davor deren Mutter.« Dann würde Mom ihre Hand an meine Wange legen und verkünden: »Du bist auch eine Hexe. Eine gute Hexe.« Anschließend würde sie mir alles über meine Zauberkräfte erzählen und was für eine unglaubliche Verantwortung sie darstellen.
Wir haben das Hexengespräch an meinem zehnten Geburtstag nicht geführt. Stattdessen haben sie und Dad mich über die schlimmen Abgründe der amerikanischen Geschichte und über Rassismus aufgeklärt. Sie sagten, ich sollte immer gut auf mich achtgeben und aufmerksam verfolgen, was auf der Welt vor sich geht, aber sie sagten auch, dass ich mein Leben so leben soll, wie ich es möchte. Dass ich froh und furchtlos sein soll.
Das Hexengespräch fand auch nicht an meinem elften Geburtstag statt, genauso wenig wie an meinem zwölften und dreizehnten. An meinem vierzehnten Geburtstag verschwendete ich keinen Gedanken mehr an Hexen und Magie.
Aber vielleicht hätte ich es tun sollen, denn wie soll ich mir sonst erklären, was gestern mit Danica und Ben vorgefallen ist? Vielleicht hat mir Mom Hexenkräfte verliehen, aber vergessen, es mir zu sagen.
»Was ist denn heute los mit dir?«, fragt Martin, der mir am Tisch in der Schulcafeteria gegenübersitzt. Martin ist einer meiner besten Freunde. Er ist sehr hellhäutig und hat blonde Locken, die schneller wachsen, als er mit dem Schneiden nachkommt. Seine Lieblingsklamotten sind Cordhosen und Pullover mit Zopfmuster. Was normal wäre, wenn er ein siebzigjähriger Englisch-Professor wäre, der im nasskalten England auf dem Land wohnt. Es ist weniger normal für einen achtzehnjährigen Jungen, der in Los Angeles lebt, wo die Durchschnittstemperatur eher selten nach Tweed schreit.
Wir sind seit der zweiten Klasse befreundet. Gleich am ersten Tag haben wir denselben Bibliothekskurs besucht und wollten dasselbe Buch ausleihen. Die Bibliothekarin meinte, wir sollten es uns teilen und uns gegenseitig daraus vorlesen. Ein Buch führte zum nächsten.


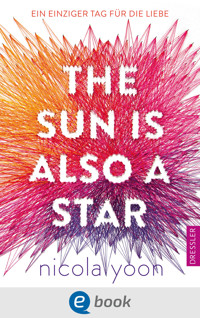













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












