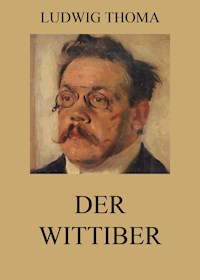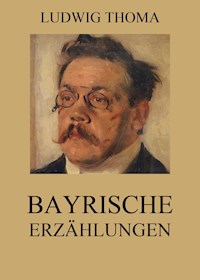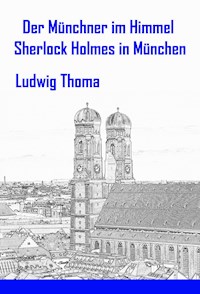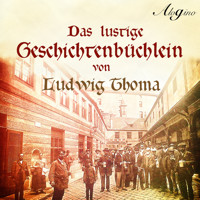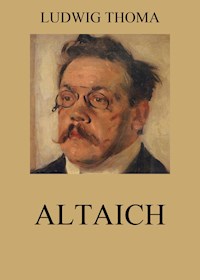
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Thomas heitere Sommergeschichte um die Ereignisse, die in dem Dorf Altaich für viel Unruhe sorgen, wurde 1968 mit großem Erfolg verfilmt. Ludwig Thoma wurde durch seine ebenso realistischen wie satirischen Schilderungen des bayerischen Alltags und der politischen Geschehnisse seiner Zeit populär.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Altaich
Eine heitere Sommergeschichte
Ludwig Thoma
Inhalt:
Altaich
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebentes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Altaich, Ludwig Thoma
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849637569
www.jazzybee-verlag.de
Ludwig Thoma – Biografie und Bibliografie
Geb. am 21. Januar 1867 in Oberammergau als fünftes Kind des Försters Max Thoma und dessen Ehefrau Katharina, gest. 26. August 1921 in Tegernsee. Mit 7 Jahren Umzug nach München-Forstenried und Tod des Vaters. Schon als Schüler war Thoma immer wehrhaft gegen die damalige Doppelmoral und besuchte bis zum Abitur 1886 insgesamt 5 Gymnasien. Es folgte ein Jura-Studium und eine Anstellung als Rechtspraktikant von 1890 bis 1893. Nach dem Tod der Mutter 1894 beginnt er in Dachau als Rechtsanwalt zu arbeiten und entdeckt alsbald seine literarische Ader. 1899 widmet sich Thoma mehr und mehr der Zeitschrift "Simplicissimus" und wird im folgenden Jahr dessen Chefredakteur. Es folgte seine produktivste Zeit, die 1906 in der Herausgeberschaft der Zeitschrift "März", zusammen mit Hermann Hesse, gipfelte. Im Ersten Weltkrieg dient Thoma als Sanitäter, erkrankt aber selbst an der Ruhr. Er stirbt 1921 an Magenkrebs in seinem Haus in Tegernsee.
Wichtige Werke:
1897: Agricola1899: Die Witwen1901: Die Medaille1901: Assessor Karlchen1902: Die Lokalbahn1904: Der heilige Hies, illustriert von Ignatius Taschner1905: Lausbubengeschichten1906: Andreas Vöst1907: Tante Frieda1907: Kleinstadtgeschichten1909: Moral1909: Briefwechsel eines bayrischen Landtagsabgeordneten1910: Erster Klasse1911: Der Wittiber1911: Lottchens Geburtstag1911: Ein Münchner im Himmel1912: Magdalena1912: Jozef Filsers Briefwexel1913: Die Sippe1913: Das Säuglingsheim1913: Nachbarsleute1916: Die kleinen Verwandten1916: Brautschau1916: Dichters Ehrentag1916: Das Kälbchen1916: Der umgewendete Dichter1916: Onkel Peppi1916: Heimkehr1916: Das Aquarium und anderes1917: Heilige Nacht1918: Altaich1919: Münchnerinnen1919: Erinnerungen1921: Der Jagerloisl1921: Der Ruepp1921: Kaspar Lorinser (Fragment)Altaich
Erstes Kapitel
Eine seit langer Zeit erhoffte Seitenbahn verband nun endlich den Markt Altaich mit der Welt, von der er lange genug abgeschieden gewesen war.
Man hat in Bayern für diese zahlreichen sich in einem Sacke totlaufenden Schienenwege die gemütliche Bezeichnung »Vizinalbahnen«, und sie dienen in der Tat dazu, die Nachbarn näher zusammenzubringen.
Etliche Meilen Weges genügen bei einer seßhaften Bevölkerung zur völligen Trennung, und nur Geschäfte konnten einen Altaicher nach Piebing und einen Piebinger nach Altaich führen.
Wer nicht Händler oder Käufer war, blieb sitzen und begnügte sich mit der Gewißheit, daß es drüben, droben oder drunten ungefähr so aussah und doch nicht so schön war, wie daheim.
Nun aber, weil die Bahn ging, mochte viele die Neugierde verführen, sich in der Nachbarschaft umzuschauen und Entdeckungen zu machen.
Wohl hatte man in Piebing oft gehört, daß die Wirtschaft zur Post in Altaich ein stattliches Anwesen sei, aber so geräumig hatte man sich Haus und Stallung, die für sechzig Pferde langte, doch nicht gedacht.
Die Stallung war noch in der guten Zeit gebaut worden, wo ungezählte Frachtwagen auf der Heerstraße fuhren und den Hausknechten die Säcke von den Trinkgeldern wegstanden, wo frühmorgens um vier Uhr angezapft und der Kessel mit Voressen ans Feuer gerückt wurde.
Dann kamen die Eisenbahnen, und auf den Landstraßen wurde es leer. Keine Peitsche knallte mehr lustig, um Hausknecht und Vizi zu grüßen, und die Stallungen verödeten.
Unterm Berg in Altaich hießen die Anwesen zum Schmied, zum Wagner, zum Sattler.
Die Namen erinnerten daran, daß hier das Handwerk geblüht hatte, als die Fuhrleute noch die steile Straße mit Vorspann hinauffahren mußten und alle Daumen lang was zu richten hatten.
Ja, das war die gute Zeit gewesen, und eine schlechte war hinterdrein gekommen.
Vierzig Jahre lang war Altaich wie Dornröschen im Schlafe gelegen. Der jetzige Posthalter, Michel Blenninger, der Sohn vom alten Michel Blenninger, der noch im vollen gesessen war, mußte sein Geld genauer zusammenheben und seufzen, wenn er die langgestreckten Dächer flicken ließ, unter denen nicht mehr die Scharen von Gäulen ein Unterkommen fanden. Es konnte ihm das Gähnen ankommen, wenn er über den weiten Hof hinschaute, auf dem sich ehemals die Plachenwägen angestaut und Fuhrmann, Hausknecht und Vizi ihr Wesen getrieben hatten, und der nun so verlassen dalag.
Es konnte ihm zumut sein wie seinem Tiras, der den Schweif einzog und die Ohren hängen ließ, wenn er in der prallen Mittagssonne über den Hof schlich.
Aber nun war ja die Vizinalbahn gebaut, und einsichtige Altaicher meinten, die alte Zeit oder ein Stück von ihr könne wiederkommen.
Der Posthalter war ungläubig.
»Papperlapapp!« sagte er. »Gehts mir weg mit der Bahn. Wer fahrt denn damit? D'Fretter. Dös san koane Wagelleut, de ausspanna, zehren, was sitzen lassen. Und überhaupts! Weil ma jetzt von Piebing herüber fahrn ko und von Altaich hinüber. Dös kunnt aa no was sei! Hörts ma'r auf!«
»Den Anschluß hamm mir, verstanden?« erwiderte ihm nicht selten der Kaufmann Karl Natterer junior, ein strebsamer, auf Fortschritt bedachter Mann. »Anschluß! Vastehst? Ma fahrt net bloß auf Piebing ummi; ma fahrt nach München, nach Augsburg, ma fahrt überall hi. Oder wenigstens, ma kann fahrn. Vastehst?«
»Papperlapapp! Is scho recht. Da wer'n jetzt glei d'Leut umanand surrn als wia d'Wepsn. Und übrigens, dös is ja grad, was i sag! Daß d'Leut umanandfahrn und durchfahrn und nimma dableibn. Mir wern's ja derlebn, daß sogar de Altaicher am Sunntag umanandroas'n, statt daß s' da bleib'n, wos s' hig'hörn. Dös is ja dös Ganze!«
»Es muß sich reguliern«, rief Natterer, der im Eifer ins Hochdeutsche geriet. »Laß die Sache sich reguliern! Zum Beispiel mit dem Verkehr ist es genau so, als wie zum Beispiel mit dem Wasser. Man muß es in Kanäle leit'n...«
»M-hm... daß 's schö wegrinna ko...«
»Nein, daß es an gewissen Plätzen zusammenströmt...«
»Und der Platz is wo anderst, und z'Altaich is da Kanal... net?«
»Warum denn? Das seh' ich gar nicht ein...«
»Papperlapapp! Siehgst, Natterer, für dös G'red kriagst d'jetzt gar nix. Aber scho gar nix. Laß di hoamgeig'n mit dein Kanal!«
Da gab der Kaufmann gewöhnlich den Streit auf, denn der Posthalter hatte eine Natur, die von selber gröber wurde, wenn sie einmal in die Richtung gedrängt war.
»Es is was Merkwürdigs«, sagte dann Natterer junior daheim zu seiner Frau. »Dieser Blenninger kann auch net logisch denk'n. Aber woher kommt's? Weil diese Menschen ihrer Lebtag in Altaich hock'n, nicht hinauskommen, nicht die Welt sehen... et cetera...«
Fürs erste schien aber doch die Meinung Blenningers die richtige zu sein, denn etliche Handlungsreisende ausgenommen, brachte die Vizinalbahn niemand in die aufgeschlossene Gegend, während die Möglichkeit des Ausfliegens von etlichen Leuten benützt wurde.
Manchen trieben der leichte Sinn und die in stiller Abgeschiedenheit gedeihende Vorstellung von Abenteuern bis nach München, wo er gegen seine Absicht erkannte, daß die Wirklichkeit nie den Erwartungen entspricht, und daß ein fühlender Mensch nirgends einsamer ist als in einer großen Menge.
Aber diese Einsicht verrät keiner dem andern.
Jeder muß sie selber gewinnen, und deswegen trat nach dem Herrn Hilfslehrer der Herr Postadjunkt und nach dem Herrn Postadjunkten der Herr Kommis Freislederer die Fahrt in die Stadt der Enttäuschungen an.
Der Blenninger sah das Hin- und Hergereise und nickte grimmig dazu. Er hatte vorher gewußt, daß die Eisenbahn die Jugend von Solidität und Abendschoppen weglocken werde. Aber auch wer nicht so vom Schicksal zum Mißtrauen erzogen war, konnte sich des Gefühls nicht erwehren, daß sogar dieses moderne Verkehrsmittel, die Eisenbahn, dazu diente, die Weltverlorenheit Altaichs recht anschaulich zu machen.
Wenn man die seltsam geformte Lokomotive vor zwei unansehnliche Wägen gespannt durch die Kornfelder dahinschleichen sah, fühlte man sich in Großvaterszeit zurückversetzt, und die Tatsache, daß man eine solche Maschine fauchen und keuchen hörte, gab einem die Gewißheit, daß man der Welt der Schnellzugslokomotiven, der Schlaf- und Speisewagen weit entrückt sei.
Altaich schien bestimmt zu sein, als Versteck für Raritäten und Überbleibsel dereinst das Entzücken eines Forschers erregen zu dürfen.
Allein die Tatkraft und das Genie seines rührigsten Bewohners, Karl Natterers junioris, bewahrten es vor diesem Schicksale.
Er, der in Landshut seine Lehrzeit verlebt und vier Jahre mit dem Musterkoffer ganz Süddeutschland bereist hatte, war ein Mann, der den Fortschritt verstand und im Auge behielt, und er war gesonnen, die Heimat zu fördern und zu heben.
Alle Welt im südlichen Bayern schien damals nur ein Mittel zu kennen, um dieses Ziel zu erreichen.
So wie man in früheren Zeiten von Handel und Wandel sprach oder glaubte, daß man mit einem Handwerk weiter komme als mit tausend Gulden, oder auch sagte, daß Arbeit Feuer aus Steinen gewänne, so schrieb man jetzt dem Fremdenverkehr allen Segen zu. Obwohl auch heute noch das Sprichwort gelten muß, daß das Jahr ein großes Maul und einen weiten Magen hat, bekannten sich doch gewichtige und kluge Männer zu dem Glauben, daß man in etlichen Wochen von der Erholung suchenden Menschheit soviel gewinnen könne, daß es für die andern vierzig Wochen lange.
Man entdeckte Schönheiten und Vorzüge der Heimat, um sie Fremden anzupreisen; man ließ die Berge höher, die Täler lieblicher, die Bäche klarer und die Lüfte reiner sein, um Leute anzulocken, die mehr Geld und solider erworbenes Geld zu haben schienen als die Bewohner der reizvollen Gegenden.
Da man wohl sah, daß sich die Fremdlinge von angestrengter Arbeit ausruhen wollten, ersparte man ihnen rücksichtsvoll den Anblick von Mühe und Fleiß, und an manchen Orten hatte es den Anschein, als lebte hier ein Volk, wie die Waldvögel bei Singen und Fröhlichkeit, nur von dem, was der Zufall bescherte. Ernsthafte Menschen ließen sich das neue Wesen gefallen, wenn sie Vorteile daraus zogen; wer aber auf schwachen Füßen stand, gab sich erst recht freudig den unsichern Hoffnungen hin, weil ihm die sicheren fehlten.
Herr Natterer baute also seine kleinen Luftschlösser neben die stolzen, die von den Herren Großstädtern schon vorher errichtet worden waren. Er ging eifrig daran, seinen Plan im Detail auszuarbeiten, wie er sagte, indem er nun gleich einen Fremdenverkehrsverein gründete. Bürgermeister Schwarzenbeck und Schneider Pilartz waren die ersten, die er als Mitglieder gewinnen konnte.
Härter war der Posthalter zu überreden.
Blenninger sagte, der Verein sei ein Schmarrn, und es sei ein Schmarrn, sich davon etwas zu hoffen.
Als der größte Wirt in Altaich durfte er freilich keinem andern den Vortritt lassen, und am Ende kostete es nicht viel Geld.
Deswegen ließ er sich gewinnen, aber nicht umstimmen.
»In Gottes Namen«, sagte er, »daß die arme Seel' ihr Ruh' hat, tu' i halt bei dem Schmarrn mit.«
Immerhin, der Verein war gegründet. Jetzt machte Natterer den kühnen Schritt in die Öffentlichkeit.
Er pries im Anzeigenteile großer Zeitungen die Vorzüge des Höhenluftkurortes Altaich an.
Dabei stellten sich ihm doch etliche Bedenken in den Weg, denn die Rücksicht auf den Geschmack des reisenden Publikums läßt sich nicht so ohne weiteres mit der Wahrheit vereinigen.
Der gewandte Kaufmann wußte, daß viele Leute die romantische Bergwelt suchen, und er kam nicht leichten Herzens um diese Wendung herum, aber die beträchtliche Entfernung Altaichs von jeder größeren Erhebung zwang ihn dazu.
Er bezeichnete seinen Heimatort mit etwas freier Anwendung des Begriffes als ein Schmuckkästchen im Voralpenlande, und er malte die Reize der Gegend mit Worten der höheren Bildung aus.
Er ließ Kinder der Flora die Wiesen schmücken und ozonreiche Waldparzellen mit Feldern abwechseln, er malte herrliche Gebirgskonturen in die Ferne und pries die magischen Mondnächte auf dem nahen Sassauer See.
Die Vils ließ er als sanften Fluß sich durch Terrainfalten schlängeln, und er versicherte ernsthaft, daß Jupiter Pluvius es mit Altaich gnädiger vorhabe als mit vielen berühmteren Kurorten.
Aber damit gab er sich noch nicht zufrieden.
Er kannte den Wert der Wissenschaft und wußte, daß sie immer das Zweckdienliche findet, und so wandte er sich an den Apotheker von Piebing, Herrn Doktor Aloys Peichelmayer, mit der Bitte, ihm über den heilkräftigen Inhalt des Vilswassers ein Gutachten zu schreiben. Er setzte voraus, daß irgend etwas Chemisches und Vollklingendes darin sein müsse, und war es darin, so wollte er Lärm schlagen.
Man wird Natterer schon deswegen als Menschenkenner achten, weil er einen Pharmazeuten als Sachverständigen wählte, denn nur ein Mann, der tiefere Einblicke gewonnen hat, kann wissen, wie feurig ein Apotheker wird, wenn man ihn als wissenschaftliche Autorität gelten läßt.
Dr. Peichelmayer erfüllte alle Hoffnungen.
Er bestätigte, daß die Vils, aus Holzmooren oder Arboreten herkommend, Eisenocker, Eisenkarbonat und Eisenphosphat enthalte, und das war genau so viel würdevolle Sachlichkeit, als Natterer brauchte, um sein Lob der Altaicher Heilbäder aufzuputzen.
Er hatte Ruhm davon und der Blenninger Michel Unkosten, denn weil ihm die passenden Ufer gehörten, mußte er drei Badehütten errichten lassen. Sie fielen nicht sehr stattlich aus, aber eine Tafel wurde vor sie hingestellt mit der Inschrift: Moor-Heilbad Altaich.
Natterers vorwärts drängender Geist litt unter der Vorstellung, daß man vieles einer ruhigen Entwicklung überlassen müsse, aber an seinen beflügelten Willen hing sich als Schwergewicht die behäbige Ruhe des Posthalters.
Manche Idee, die Natterer köstlich vorkam, verlor allen Glanz, wenn Michel Blenninger mit seiner in Fett erstickenden Stimme fragte: »Was hast denn scho' wieder für an Schmarrn?« Das konnte ihn verbittern und lähmen. Aber das ärgste war, daß er sich durch seinen redlichen Eifer die Feindschaft eines untergeordneten Menschen zuzog.
Der Hausknecht Blenningers, der alte Postmartl, den man nie anders als mit einer schief aufgesetzten Ballonhaube gesehen hatte, sollte nach der Ansicht Natterers die Kurgäste am Bahnhofe erwarten und, wie das nun einmal Brauch und Sitte ist, eine Schirmmütze tragen mit der Aufschrift: »Hotel Post«.
Um jedem Widerspruche zu begegnen, ließ er die Mütze anfertigen und übergab sie dem Posthalter, der sich nach ein paar brummigen Bemerkungen zufrieden gab und ihn an Martl verwies. Aber was für einen Lärm schlug der Hausknecht, als man ihn mit seinen neuen Pflichten bekannt machen wollte!
An sich schon eine rauhe Natur, wurde er grob, roh und unflätig gegen den angesehenen Bürger; er gab ihm verletzende Schimpfnamen und erklärte, daß er sich von keinem Hanswurste eine Narrenhaube aufsetzen lasse.
Natterer hatte eigentlich Mitleid mit dem Manne, der lange Jahre seinen Posten ausgefüllt hatte, und jetzt, weil die Sache eben doch zu weit gegangen war, die Stelle verlieren mußte.
Allein als Präsident des Fremdenverkehrsvereins durfte er sich der weichen Stimmung nicht hingeben, und er verlangte, wie es seine Pflicht war, vom Posthalter die Entlassung des ungebärdigen Menschen.
Blenninger fragte ihn ruhig:
»Was is dös für a Schmarrn?«
»Ja no«, erwiderte Natterer, »mir tut ja der Mensch auch leid, aber ich muß drauf bestehen, daß er sofort entlassen werd...«
»Der Martl?«
»Ja. Er tut mir leid...«
»Da tuast ma scho du leid, wann du so was Dumms glaabst, daß i mein alt'n Martl aufsag. Dös hättst da ja z'erscht denk'n kinna, daß der dein Bletschari, dein damisch'n, net aufsetzt...«
»Also dann muß ich mir als Bürger... ?«
»Ah was! laß ma mei Ruah mit dein Schmarrn!«
An diesem Tage trug sich Natterer mit der Absicht, sein Geschäft zu verkaufen und von Altaich fortzuziehen.
Seine Frau konnte ihn nicht beruhigen, aber als der Schreiner Harlander dem Verein beitrat und vier Ruhebänke stiftete, vergaß er den Vorfall.
Martl vergaß ihn nicht.
Er wurde und blieb ein Todfeind des hundshäuternen Kramers.
***
Ob nun ein Fremder kommen würde?
Das war das in Frage gestellte Ereignis, von dem vieles abhing. Vielleicht das zukünftige Glück Altaichs, jedenfalls das gegenwärtige Ansehen Natterers.
Es trat ein.
Zu Anfang Juli, als die Kinder der Flora mit allem Grase gemäht und gedörrt wurden.
Das Ereignis trat ein, unauffällig, schlicht, beinahe unbemerkt.
Eines Nachmittags um fünf Uhr, als die Leute auf dem Felde waren und sich kaum Zeit nahmen, den heranschleichenden Zug zu betrachten, vollzog sich die denkwürdige Begebenheit.
Die Lokomotive pfiff, der Zug hielt an. Ein dicker, mittelgroßer Mann stieg aus, und sein gerötetes Gesicht sah so altbayrisch aus wie die ganze Gegend.
Über den linken Arm hatte er einen gelben Überzieher geworfen; er trug einen Segeltuchkoffer und Schirm und Stock, die zusammengebunden waren.
Der Stationsdiener nahm ihm das Billett so gleichmütig ab wie dem andern Fahrgaste, dem Ökonomen Schöttl, der eine vierzinkige Gabel und eine mit Papier umhüllte Sense trug zum Zeichen, daß er nicht bloß so oder zum Vergnügen verreist gewesen sei.
Der Fremde ging auf der staubigen Straße in den Ort, und da er den weit ausladenden Schild sah, hielt er beim Gasthofe zur Post an.
Das Haus war wie ausgestorben; Knechte, Mägde und der Posthalter selbst waren auf dem Felde.
Als sich niemand sehen ließ, stellte der Fremde etwas unmutig seinen Koffer im Torgange nieder, rief ein paarmal: »He! Was is denn? He!« pfiff und schüttelte ärgerlich den Kopf.
Endlich öffnete er eine Türe, die in die Gaststube führte. Die Stube war leer, und es roch etwas säuerlich nach Bier.
Als der Fremde hinter den Verschlag schaute, wo der Bierbanzen stand, flog summend eine Schar Fliegen auf, die in einem kupfernen Nößel Bierreste gefunden hatten.
Der Mann pfiff wieder. Niemand gab Antwort.
Nun schaute er durch ein Schiebefenster in die Küche und sah zwei Weibspersonen neben dem Herd sitzen. Die eine stocherte mit einer Haarnadel in ihren Zähnen herum und schien die Kellnerin zu sein.
Die andere saß mit verschränkten Armen behaglich zurückgelehnt; die aufgekrempelten Ärmel und eine weiße Schürze ließen in ihr die Köchin erkennen.
Der Fremde klopfte ärgerlich ans Fenster, schob es in die Höhe und rief:
»Ja... Herrgott... was is denn eigentlich? Is denn in der Kalupp'n gar koa Bedienung vorhand'n?«
Die Kellnerin stand langsam auf, steckte die Haarnadel in den Zopf und fragte gleichmütig:
»Was schaffen S'?«
»Kommen S' halt her, gnä Fräulein! San S' so guat!« Es dauerte noch eine Weile, bis die Kellnerin in die Stube kam und nochmal fragte:
»Wollen S' a Halbe? A Maß?«
»Nix will i. A Zimma will i.«
»A Zim-ma?«
»Ja. Muaß i's no a paarmal sag'n? Wia g'stell'n Eahna denn Sie o?«
Man konnte das rechtschaffene Weibsbild nicht aus der Ruhe bringen. Es schüttelte den Kopf und rief in die Küche hinein:
»Du, Sephi!«
»Was?«
»Der Herr möcht' a Zimma.«
»A Zim-ma?«
Die Köchin fragte es genau so gedehnt.
»Was is denn dös für a Wirtschaft?« schrie der Gast.
»No ja«, sagte die Kellnerin, »d'Fanny is net dahoam. De is im Feld draußd.«
»Und Bett werd aa koans übazog'n sei«, bestätigte die Köchin.
»I leg' mi net ins Bett um fünfi namittag. Aber a Zimma möcht' i, mei Gepäck will i nei stell'n... Himmi... Stern... Laudon!...«
»Dös gang scho... a Zimma zoag'n«, meinte die Köchin.
Die Kellnerin zögerte.
»Wenn halt d' Fanny net da is...«
In diesem Augenblicke hörte man einen Wagen in den Hof fahren.
Die Köchin öffnete das Küchenfenster und schrie mit durchdringender Stimme:
»Herr Blenninga!«
»Wos ?« fragte eine tiefe, fette Stimme zurück.
»Sie soll'n eina kemma. Es is wer do...«
»So«, sagte die Köchin, »jetz is Gott sei Dank der Herr Posthalta selber da. Mit dem könna S' all's ausmacha.«
Sie schloß das Schiebefenster.
Die Kellnerin gähnte laut und ging hinter den Verschlag, ließ etwas Bier ins Nößel laufen und trank ohne Hast und ohne rechten Genuß, bloß zum Zeitvertreib.
Der Posthalter trat ein.
»Also was habts?« fragte er.
»Der Herr möcht' a Zimma«, sagte die Kellnerin hinteren Verschlag.
Der Fremde nahm selber das Wort.
»I möcht' bei Ihnen wohnen, aber dös is scheinbar mit solchene Schwierigkeit'n verbund'n...«
»Na... na, dös hamm ma glei. Resi! Gehst zu da Fanny naus, sie soll eina kemma, a Zimma richt'n... San S' gewiß a G'schäftsreisender?«
»Na. I bin zu mein Vergnüg'n da. Hoaßt dös, wenn ma hier zu sein Vergnüg'n sei ko... Sie hamm doch Eahna Höft...« Der Fremde war immer noch ärgerlich... »Sie hamm doch Eahna Höft als Sommafrisch'n ausschreib'n lass'n...«
»A Summafrischla?«
»Ja, wenn's erlaubt is, und wenn's mir gfallt... Bis jetzt siech i net viel...«
»No! No!« begütigte Blenninger. »Es werd Eahna scho g'fall'n... mir san jetzt in der Heuarbet, und überhaupts, mir san de G'schicht no net gewohnt... Fanny!« wandte er sich an die eintretende Magd, »zoagst dem Herrn a paar schöne Zimma... Sie könna's Eahna raussuach'n. Platz gibt's gnua.«
Der Gast stieg hinter Fanny die breite Treppe hinauf, und Blenninger schaute ihm nach.
»Jetzt so was! A Summafrischla! Wenn dös da Natterer hört, schnappt er ganz üba.«
Das Gesicht des Fremden wurde freundlicher, als er die großen, hellen Zimmer sah, die alle behäbig mit Möbeln aus der Großvaterzeit eingerichtet waren. An den Wänden hingen bunte Lithographien aus der Zeit König Ludwigs I.
König Otto von Griechenland war dargestellt, wie er in Palikarentracht von der Akropolis herunter ritt; auf anderen Bildern sah man König Ludwig inmitten einer großen Hofgesellschaft, und wiederum Prinzen auf sich bäumenden Rossen.
Alles in den Zimmern wies auf die gute, alte Zeit hin, und das ließ günstige Schlüsse zu.
Der Fremde nickte zufrieden. Er sah, daß auch die Betten reinlich und gut waren, und Fanny versicherte eifrig, daß sie Kissen und Decke mit frischen Linnen überziehen werde.
Als der Gast die Treppe hinunterschritt, war er besser gelaunt, und er nahm sich vor, einen Rundgang durch den Ort zu machen.
Auch hier gefiel ihm alles, was er sah. Wenn er schon nicht wußte, daß er das denkwürdige Exemplar des ersten Sommerfrischlers darstellte, so bemerkte er doch, daß die Wogen des Fremdenstroms noch nicht durch Altaich geflutet waren.
Auf dem Platze erhoben sich stattliche Bürgerhäuser; weiter hinaus standen niedere Gebäude neben Scheunen und Ställen.
Von links und rechts brüllte, meckerte, gackerte und grunzte es und erweckte Hoffnungen auf dicken Rahm und gelbe Butter, auf frische Eier und zartes Schweinefleisch.
»Unverdorbene Gegend...«, murmelte der Fremde.
Nur einmal stutzte er, als er auf den Marktplatz zurück zu einem modisch aufgeputzten Kaufladen kam.
In der Auslage hing ein Plakat, auf dem zu lesen war, daß Karl Natterer junior den titulierten Kurgästen sein wohlassortiertes Lager von Hamburger Zigarren empfohlen halte. Der Fremde trat ein und wurde von einem unansehnlichen Herrn überfreundlich begrüßt.
Er kaufte einige Zigarren und versuchte, im Gespräche etwas Näheres über den Altaicher Fremdenverkehr zu erfahren.
Er gab mehr, als er empfing.
Der beglückte Natterer erfuhr, daß er den ersten richtigen, durch ihn angelockten Kurgast vor sich habe.
Der Kurgast aber erhielt nur allgemeine Andeutungen über gute Entwicklungssymptome.
Zum Schlusse stellte sich Natterer als Vorstand des Vereins vor und erbat sich für die Altaicher Kurliste, die der Piebinger Vilsbote veröffentlichen wollte, die Personalien des sehr geehrten Gastes.
Der Fremde gab ihm seine Visitenkarte: »Oberinspektor Josef Dierl aus München.« Natterer nahm sie dankend entgegen und hoffte, daß der Herr Oberinspektor mit der gewählten Sorte zufrieden sein werde, versicherte dem Herrn Oberinspektor, daß der Herr Oberinspektor in der gleichen Preislage angenehme Abwechselung finden werde, und wünschte dem Herrn Oberinspektor gutes Wetter, gute Unterhaltung und guten Tag.
Als der Fremde den Laden verlassen hatte, mußte Frau Wally Natterer kommen und die frohe Kunde vernehmen, daß die Saison glückverheißend eröffnet sei.
Triumphierend hielt ihr der Eheherr die Visitenkarte vor.
»Ein Oberinspektor?« fragte Frau Wally. »Das is gewiß was sehr Feines?«
»Jedenfalls was Besseres«, antwortete Natterer. »Die Sach' reguliert sich. Ma sieht halt, was eine gute Reklame ausmacht.«
***
Vom Posthalter Blenninger, der viel zu faul war, um Lügen für den Glanz des neuen Höhenluftkurortes zu ersinnen, bekam es Herr Dierl bald zu wissen, daß er der erste Kurgast war.
Vielleicht hätte das einen andern stutzig gemacht, aber der Oberinspektor der Lebensversicherungsgesellschaft Artemisia, der eine kurze Offizierslaufbahn in Burghausen begonnen und beendet hatte, war ein Kenner und ein Freund des altbayrischen Lebens.
Er wußte, wie sehr die Biederkeit des Charakters und die Größe der Portionen durch Fremde vermindert werden.
Ihr Fehlen stimmte ihn hoffnungsfroh, und eine Kalbshaxe von altväterlichen Maßen bestätigte ihm seine Vermutung, daß er auf der Insel der Seligen gelandet sei.
Er schwor es sich zu, über dieses Eiland strenges Stillschweigen zu bewahren, und er faßte gleich eine Abneigung gegen Natterer, dem er Verrat zutraute.
Zweites Kapitel
Am Fuße des von Norden her sanft ansteigenden, gegen Süden ziemlich steil abfallenden Hügels lag unweit vor der Einmündung des Schleifbaches in die Vils die Ertlmühle.
Um das zwei Stockwerke hohe Gebäude lag ein Duft von Mehlstaub, der aus Fenstern und Türen drang und sich auf die Blätter der nächsten Bäume, wie auf die Grashalme der bis an den Hof hin reichenden Wiese legte.
Neben der Einfahrt lehnte an der Hausmauer ein beschädigter Mühlstein, in den die Jahreszahl 1724 eingemeißelt war, und der sich als Invalide die Sonne auf die alten Furchen scheinen ließ.
Er war ein braver, alter Sandstein von deutscher Art und hatte in der Neuzeit einem modischen Süßwasserquarz, einem Franzosen, Platz machen müssen, und das durfte ihn verdrießen, denn er war in seiner langen Dienstzeit ein flinker Läufer gewesen, der sich emsig gedreht hatte, nicht ein fauler Bodenstein, der unten liegt und geschehen läßt, was geschieht.
Aber das war nun so mit der Ausländerei, die bei den jüngeren Müllern aufgekommen war. Sie holten Franzosen her und stellten die abgerackerten deutschen Steine vor die Türe hinaus, wo hinter ihnen Brennesseln in die Höhe wuchsen und sich durch die Löcher drängten.
Wenn man schon Anno 1724 gedient hat, war man am Ende vornehmer, wie die ganze Mühle, die erst 1875 von dem aus dem Fränkischen zugereisten Michael Oßwald an Stelle der uralten Ertlmühle neu gebaut worden war.
Michael Oßwald war der Vater des jetzigen Eigentümers Martin Oßwald gewesen, der in dem sauberen Häuschen auf der andern Seite des Hofes wohnte und ein stiller Mensch war, der auch im Äußern nichts an sich hatte von den früheren Ertlmüllern, die lustige Altbayern mit ordentlichen Bäuchen gewesen waren.
Martin Oßwald war ein schmächtiger, zarter Mensch. Aus seinem schmalen Gesichte schauten ein Paar verträumte Augen in die Welt und eigentlich nie scharf auf einen Gegenstand, sondern daneben hin und in die Luft und ins Unbestimmte, wo sie etwas Fröhliches zu finden schienen, denn häufig flog ein Lächeln um den fein geschnittenen Mund, das sogleich verschwand, wenn jemand den Meister anredete, oder wenn ihn eine recht bestimmt klingende weibliche Stimme beim Namen rief.
Dann veränderte sich der Ausdruck in seinen Augen so, daß man merkte, wie er aus einem Traume erwachte oder seine Gedanken von einer weiten Reise zurückholte.
Die Stimme kam von seiner Ehefrau Margaret her, die in ihrem Wesen eine unverkennbare Klarheit des Willens zeigte.
Ihr dunkles Haar war durch einen geradlinigen Scheitel geteilt, von dem aus es sich nach rechts und links in gleichen Teilen straff an den Kopf preßte.
Die blauen Augen blickten ruhig, die Nase war wohl etwas scharf, aber um den Mund lag wieder ein gutmütiger Zug, der Wohlwollen und hie und da ein wenig Staunen über die sich ins Blaue verlierenden Gedanken ihres Eheherrn verriet.
Man konnte wohl glauben, daß in dem ansehnlichen, einige Schärfe erfordernden Geschäfte die Leitung eher der Frau Margaret zukam als ihrem Martin.
Wer es aber in landläufiger Weise so ausgelegt hätte, daß sie das Regiment führte, der wäre der klugen Frau nicht gerecht geworden.
Sie leitete durch ihren Einfluß auf ihren Mann das Ganze, aber sie wahrte nicht bloß den Schein, sondern sie brachte ihn sorgsam dazu, seine Rechte zu zeigen und auszuüben.
Niemals tadelte sie einen Müllerburschen, auch wenn sie was Unrechtes sah. Sie trug die Beschwerde ihrem Martin vor in einer längeren Rede, die alles enthielt, was er dem Burschen vorhalten mußte; wenn Kunden sie um etwas ersuchten, gab sie keine Zusage. Sie versprach, daß sie es dem Herrn sagen wollte, und ließ nie die Meinung gelten, daß sie zu entscheiden habe.
Die Frau soll nicht das Meisterlied singen, sagte sie, und wenn jemand meinte, der Martin sei doch gar zu still, dann antwortete sie, Reden komme von Natur, Schweigen aber vom Verstand.
Sie freute sich innerlich darüber, daß er nichts Grobes leiden mochte, des Abends gerne in einem Buche las oder auf seiner Geige spielte.
Sie dachte, daß sie es besser getroffen habe wie andere Frauen, deren Männer ihre Freude im Wirtshause suchten und meinten, Weib und Ofen könnten ruhig daheim bleiben.
Auch war ihr Martin nicht etwa gleichgültig, und in wichtigen Dingen zeigte er festen Willen und tüchtigen Verstand.
Er ging seinen Pflichten nicht aus dem Wege. Wenn ihm das Geschäft nicht über alles ging, so durfte sie sich darüber nicht grämen, denn sie wußte, daß er sich in seiner Jugend einen andern Beruf vorgesetzt hatte, und daß er schon sechzehn Jahre alt gewesen war, als man ihn aus dem Lehrerseminar ins väterliche Geschäft geholt hatte.
Dafür war sein nur anderthalb Jahre älterer Bruder Michel bestimmt gewesen, der seine Lehrzeit in einer Nürnberger Kunstmühle zugebracht hatte und darin auch noch als Gehilfe tätig geblieben war.
Aber eines Tages war er auf und davon gegangen und hatte aus Bremen an die Eltern geschrieben, daß er auf einem Segler Dienst genommen habe.
Erst etliche Monate später hatte der alte Oßwald erfahren, daß sein Michel vom Geschäftsführer verhöhnt und schwer gekränkt worden war, weil er der Tochter der Besitzerin in unbeholfener Art Zuneigung gezeigt hatte.
Das Mädchen hatte sich über den jungen Menschen lustig gemacht und die Sache weiter gegeben.
Der Spott der Angestellten und der Schmerz über diese Art der Zurückweisung hatten den frischen Burschen zur Flucht veranlaßt.
Es hätte auch Schlimmeres geschehen können. Zehn Jahre später, noch zu Lebzeiten der Eltern, kehrte Michel als vierschrötiger Untersteuermann auf Urlaub heim.
Er war der Heimat und dem seßhaften Wesen so sichtbar fremd geworden, daß nicht einmal die alte Mutter Oßwald hoffte, ihn halten zu können.
Er zeigte fröhliche Laune und den allerbesten Appetit und lachte gutmütig zu den Vorschlägen seines Bruders Martin, den der Gedanke plagte, daß er geborgen in der Ertlmühle sitzen sollte, indes der Michel ein hartes Leben führte.
Als etliche Wochen um waren, stand eines Morgens der Untersteuermann Oßwald mit seinem Koffer mitten in der Stube und sagte, daß er nun fort müsse, und es klang nicht anders, als wollte er nur geschwind nach Piebing hinüber gehen.
Und das war auch wieder gut, denn langer Abschied schmerzt alte Leute, besonders eine Mutter, die sich nicht große Hoffnungen aufs Wiedersehen machen kann.
»Bhüt Gott«, sagte Michel, »und bleibts gesund bis aufs nächstemal!«
Und ging.
Der Mutter schlug das Herz bis zur Kehle hinauf, als sie ihren Ältesten breitbeinig über den Hof gehen sah. Auf der Brücke blieb er stehen und schaute zurück und versuchte gutmütig zu lachen, als er die Mutter am Fenster stehen sah.
Es gelang ihm nicht recht, und er machte schnell kehrt, um nicht zu zeigen, wie hart ihm der letzte Gruß zusetzte.
Bhüt Gott, Michel!
Es ist kein weiter Weg über die Hügel, von denen herunter man noch einen Blick auf die Ertlmühle werfen kann, aber dann dehnen sich die Straßen und führen von kleinen Städten in große. Fremde Menschen schauen gleichgültig an einem vorbei, und fremde Glocken läuten den Morgen- und Abendgruß.
Bhüt Gott, Michel!
Es liegen Länder und Meere zwischen Altaich und Finschhafen oder Matupi, aber starke, unzerreißbare Fäden laufen mit und halten das Herz an die Heimat gebunden, wenn auch ein Seemann in polynesischen Stürmen nicht viel Zeit hat, von Deutschland zu träumen. Und wenn sich die Mutter Oßwald zum Sterben legt, läßt sie sich die Himmelsrichtung zeigen, in der ihr Michel auf fernen Meeren segelt, und ihre müde Hand macht das heilige Zeichen des Kreuzes gegen Osten hin.
Ihre welken Lippen murmeln den letzten Segen für den starken Mann, der einstmals als Kind sich an ihren Rock geklammert hatte.
Bhüt Gott, Michel!
Soweit du gehst, die Fäden laufen mit, die leise an deinem Herzen ziehen, und immer wieder kommt ein Tag, an dem du den Schleifbach um die Räder der Ertlmühle rauschen hörst, die Wassertropfen in der Sonne glitzern siehst und weißt, daß uns alle Dinge fremd bleiben, und daß uns nichts so gehört, wie die Heimat und die Erinnerung an die Kinderzeit.
In Martin blieb der Gedanke haften, daß er an Stelle eines andern in Wohlstand und Behaglichkeit sitze, und diese Vorstellung bedrückte ihn oft mehr, als die Gewißheit, daß er Pflichten übernommen hatte, die seinem Wesen fremd waren.
Er hatte, um den Wunsch der Eltern zu erfüllen, schon früh die Tochter Margaret des Kronacher Sägewerkbesitzers Wächter geheiratet, der von Mutters Seite mit den Oßwalds verwandt war.
Er liebte seine Frau und schätzte ihre altfränkische Tüchtigkeit; er war glücklich über die Geburt eines Sohnes, den ihm Margaret schon im ersten Jahre schenkte, und dem zwei Jahre später ein zweiter folgte.
Aber in Arbeit und Sorge und Freude war es ihm manchmal, als sähe er seinen Bruder breitbeinig über den Hof und die Brücke schreiten und zum letzten Male auf die Heimat zurückschauen.
Er war schon etliche Jahre Ehemann und Vater gewesen, als Michel damals heimkehrte und wieder Abschied nahm, aber er hätte ohne Bedenken und Reue mit ihm sein Anrecht geteilt und nicht gedacht, daß er ärmer geworden wäre.
Es war anders gekommen.
In den ersten zehn Jahren nach seiner Abreise hatte Michel zuweilen geschrieben. Aus Afrika, aus Indien, von Samoa her, dann einmal wieder von Hamburg, und dorthin hatte ihm Martin auch die Nachricht geschickt, daß die Mutter gestorben und der Vater nach zwei Monaten ihr nachgefolgt war.
Darauf kam nach dreiviertel Jahren eine Antwort aus Apia. In unbeholfenen Sätzen gab Michel seinem Schmerze darüber Ausdruck, daß er die Eltern nicht mehr gesehen habe. Einigemal sei ihm Gelegenheit geboten gewesen, aber er habe die Heimkehr verschoben in der Hoffnung, bald auf längere Zeit nach Altaich zu kommen. Nun müsse er erfahren, daß die Eltern von der Welt geschieden seien.
Der Brief war sichtlich nicht in einem hin, sondern in mehreren Absätzen geschrieben. Man sah es ihm an, daß er lange in der Tasche herumgetragen war.
Seitdem ließ Michel nichts mehr von sich hören. Martin schrieb nach Umlauf etlicher Jahre an den Lloyd und erfuhr, daß sein Bruder in Neu-Guinea geblieben war. Sein Aufenthalt in Australien konnte noch festgestellt werden. Von da ab verloren sich alle Spuren.
Als Jahr um Jahr verging, ohne daß eine Nachricht kam, mußte Martin glauben, daß sein Bruder den Tod gefunden habe.
In der Ertlmühle gab es wie überall gute und schlimme Stunden. Im ganzen ging alles seinen ruhigen Gang.
Tag ging um Tag, brachte Arbeit und zuweilen Sorgen und als das Gewisseste das Älterwerden.
Frau Margaret hatte, als sie zum dritten Male in gesegneten Umständen war, einen bösen Fall getan und mußte sich damit abfinden, daß ihr ferneres Mutterglück versagt blieb.
So vereinigten sich alle Hoffnungen und Sorgen auf die zwei Söhne Konrad und Michel.
Der ältere war ein kräftiger Junge, aber still und in sich gekehrt, wie der Vater. Der Jüngere war lebhaft, ein wenig vorwitzig und saß nicht gerne über den Büchern. Frau Margaret sah in ihm das Ebenbild ihres Vaters, der lebenstüchtig und etwas nüchtern seinen Sinn auf Arbeit und Erwerb gerichtet hatte.
Sie bemerkte fast ein wenig eifersüchtig, daß ihr Konrad anschmiegsamer an den Vater war.
Er wußte freilich dem Knaben Besseres und mehr zu erzählen als sie, und die beiden konnten wie Kameraden hinter der Mühle am Wasser sitzen und miteinander plaudern.
Ihr Michel tat sich dafür lieber in der Küche um und verstand es, sich für kleine Leistungen Vorteile zu verschaffen.
Frau Margaret dachte nichts anderes, als daß ihr Ältester zur rechten Zeit das Handwerk erlernen und in das elterliche Geschäft eintreten werde; sie malte sich die Zeit, da sie neben ihrem Konrad noch tüchtig schalten würde, mit angenehmen Farben aus.
Aber da erlebte sie eine große Enttäuschung.
Der stille Junge, dem sie kaum eigenen Willen zugetraut hätte, gestand ihr eines Tages, als er von München, wo er die Realschule besuchte, in den Ferien heimgekehrt war, daß er nichts anderes werden könne und wolle, als ein Maler.
Das ging so sehr über ihr Verständnis, daß sie sich über den Wunsch wie über eine unreife Torheit hinwegsetzen wollte.
Ihr Martin kam dem Jungen zu Hilfe und zeigte eine Festigkeit, über die sie erst recht in Erstaunen geriet.
Es ist etwas Merkwürdiges um ein Mannsbild, das sich jahrelang behüten läßt und auf einmal seine Überlegenheit zeigt, wie etwas Selbstverständliches, so daß die Frau betroffen merkt, daß ihr die eingebildete Macht in den Händen zerronnen ist.
Und so kam es im Hause des stillen Martin Oßwald, daß der hausbackene Verstand der Frau Margaret unterliegen mußte. Sie sagte oft und nachdrücklich, daß alter Sitz der beste sei, und daß, wer wohl sitze, nicht rücken solle, aber Martin gab nicht nach.
So wurde Konrad ein Maler, und seine Mutter seufzte manches Jahr darüber und wollte nicht verstehen, wie ihr Bub eine sichere Zukunft gering achten konnte.
Sie tröstete sich, da ihr Michel mehr Sinn fürs Geschäftliche zeigte und wohl damit zufrieden war, daß er frühzeitig in die Lehre nach Kronach kam.
In Altaich aber schüttelte jedermann den Kopf darüber, daß der Älteste vom Ertlmüller einen so unnützen Beruf ergreifen mochte, und noch mehr darüber, daß die kluge und resche Frau Oßwald ihre Einwilligung gegeben hatte.
Freilich, das bringen auch Gescheitere nicht heraus, was einem fünfzehnjährigen Buben die Gewißheit gibt, daß er ein Künstler werden müsse.
Es sind Geißhirten jahrelang auf den Almen herumgelegen, haben in den Himmel hineingeschaut und sich aus der blauen Luft eine Sehnsucht geholt, die sie hinunter in die Städte trieb und zu großen Künstlern werden ließ.
Wer aufmerksam dieses Wachstum betrachtet, wird verstehen, daß auch hier ein ins Ungefähr getragener Same in Licht und Luft besser aufgeht als einer, der künstlich in der Enge gepflanzt wird.
Selten wird aus einem Knäblein der Reichen, das man in Kunsterlebnissen aufzieht, was Rechtes; immer wieder lauft dem Herrlein ein barfüßiger Bauernbub den Rang ab; einer, der in Regen und Sonnenschein aufgewachsen ist und mit geschärften Sinnen Farben und Formen aufgenommen hat.
Vielleicht war Konrad in den Stunden, da er unter der Weide am Mühlbache saß, ein Künstler geworden, denn Wasser, das so geheimnisvoll fließt, sich ein bißchen dreht und ein bißchen murmelt und in die Ferne zieht, kann einen Buben wohl zum Bilden und Träumen anregen.
Jede Stimmung aber, die in Kinderherzen geweckt wird, gewinnt geheimnisvolle Kräfte, wenn sie sich nicht in Worte verliert.
Wir wollen den Heimlichkeiten nicht nachforschen, aus denen sich die Sehnsucht des Knaben formte; tröstete sich doch auch Frau Margaret mit dem Gedanken, daß Konrad eben ihres Martins Sohn sei.
Doch darf man erwähnen, daß ein Bild, das Deckengemälde in der Altaicher Kirche, nicht ohne Einfluß auf den Knaben geblieben war.
Es stellte die Schlacht bei Lepanto dar und war von einem Benediktinerpater aus dem Kloster Sassau um die Mitte des 18. Jahrhunderts gemalt worden. Es gab auf dem Bilde, das die ganze Decke der Kirche einnahm, unendlich viel zu sehen.
Fechtende Ritter, säbelschwingende Türken, schreiende Menschen, die im Wasser schwammen, Pulverrauch, lodernde Flammen, Engel, die um den Herrn Don Juan d'Austria schwebten und ihn mit Lorbeer krönten, sinkende Galeeren und oben in den Wolken den dreieinigen Gott, der auf den Christensieg herniederschaute. Wenn Weihrauch zur Decke emporwallte oder wenn heiter Sonnenschein durch die hohen Fenster auf einen Teil des Bildes fiel, indes ein anderer um so dunkler erschien, gewannen Personen und Dinge ein seltsames Leben, und der Orgelklang, der durch die Kirche brauste, verstärkte den Eindruck. Konrad weilte am liebsten auf dem Chore, wo sein Vater an Sonntagen die Geige spielte und dirigierte. Er bewunderte ihn, wenn er mit dem Fiedelbogen den Takt schlug und wiederum voll und kräftig die Saiten strich, daß sich der Lehrer auf seinem Sitz an der Orgel umdrehte und ihm beifällig zunickte.