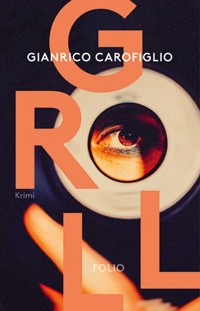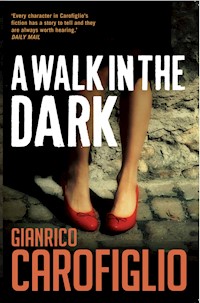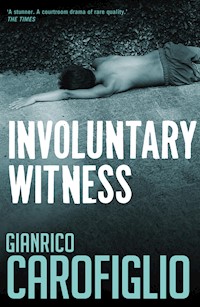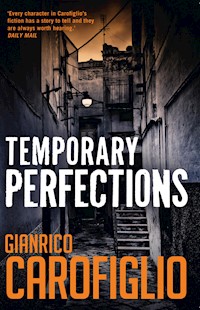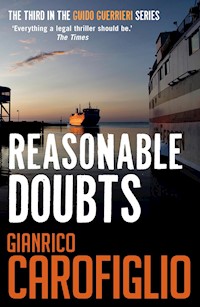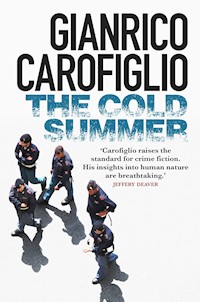9,99 €
Mehr erfahren.
Eine gefährliche Freundschaft, die Faszination des Bösen und die Sprache der Gewalt.
In der Umgebung von Bari wird ein Mann namens Salvatore bei einem Bankraub erschossen. Als Enrico Vallesi davon in der Zeitung liest, kommen lange verdrängte Erinnerungen an seine Kindheit hoch. Er war ein verschlossener Jugendlicher, der mit sechzehn Jahren beschloss, sich gegen Ungerechtigkeiten zu wehren. Salvatore, ein älterer Mitschüler, bot ihm damals an, mit ihm zu trainieren. In einer Wohnung fand die geheime Ausbildung zum Schläger statt, die äußerst brutal verlief. Enrico führte eine Art Doppelleben: zu Hause der angepasste Schüler, bei Salvatore der hartgesottene Kämpfer. Während seiner Spurensuche in der Vergangenheit merkt Enrico, dass die Stunde der Wahrheit gekommen ist und er endlich Frieden finden muss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Ähnliche
Buch
Enrico Vallesi, 47, ist ein sogenanntes One-Hit-Wonder. Nach dem großen Erfolg seines ersten Buches schreibt er nicht mehr weiter, sondern arbeitet als Ghostwriter und Lektor. Seinen Heimatort Bari hat er seit dreißig Jahren nicht mehr besucht, und zu den Menschen von früher hat er keinerlei Kontakt mehr. Doch dann liest er eines Tages zufällig in der Zeitung, dass ein gewisser Salvatore beim Überfall auf einen Geldtransporter im Zentrum von Bari erschossen wurde. Und damit kommen lange verdrängte Erinnerungen hoch. Enrico merkt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, sich endlich mit seiner Vergangenheit zu beschäftigen, und fährt spontan nach Bari.
Enrico war ein verschlossener Jugendlicher, der mit sechzehn Jahren beschloss, sich zu wehren. Salvatore, ein älterer Mitschüler, bot ihm damals an, mit ihm zu trainieren. In einer Wohnung fand die geheime Ausbildung zum Schläger statt, die äußerst brutal ablief. Enrico führte eine Art Doppelleben: zu Hause der angepasste Schüler, der in seine Philosophielehrerin verliebt war, bei Salvatore der hartgesottene Kämpfer. Und eines Tages nahm Salvatore ihn auf eine Mission mit, die alles verändern sollte …
Autor
Gianrico Carofiglio wurde 1961 in Bari geboren und arbeitete in seiner Heimatstadt viele Jahre als Antimafia-Staatsanwalt. 2007 war er als Berater des italienischen Parlaments für den Bereich organisierte Kriminalität tätig. Von 2008 bis 2013 war Gianrico Carofiglio Mitglied des italienischen Senats. Berühmt gemacht haben ihn vor allem seine Romane um den Anwalt Guido Guerrieri. Carofiglios Bücher feierten sensationelle Erfolge, wurden bisher in 25 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen literarischen Preisen geehrt, u. a. mit dem Radio Bremen Krimipreis 2008.
Gianrico Carofiglio
Am Abgrund aller Dinge
Roman
Aus dem Italienischen vonVerena von Koskull
www.goldmann-verlag.de
Vorrede
Wie jeden Morgen betrittst du die übliche Bar, um zu frühstücken. Seit du allein lebst – eine ganze Weile schon –, kannst du das zu Hause nicht mehr. Zu Abend essen ja, manchmal auch zu Mittag. Aber Frühstücken irgendwie nicht. Also gehst du jeden Morgen in die Bar. Mal stellst du dich an den Tresen, mal lässt du es gemütlicher angehen und setzt dich an ein Tischchen. Da bist du nicht festgelegt, es kommt ganz darauf an, wie du dich fühlst – oder wie du dich nicht fühlst –, aufs Wetter, darauf, ob du was zu tun hast oder nicht, auf den Zufall. Keine Ahnung, wieso du dich mal hinsetzt und mal nicht.
Heute setzt du dich hin, und auf dem Tischchen liegt eine Zeitung. Während du auf Kaffee und Croissant wartest, blätterst du sie abwesend durch und überfliegst die Schlagzeilen. Apropos Zufall: Zwei Seiten kleben zusammen. Sie lassen sich einfach nicht trennen, und du willst schon aufgeben, als sie sich schließlich doch voneinander lösen und du dich in der Rubrik Unglücksfälle und Verbrechen befindest. Die Festnahme eines Stadtrats; das Resümee in einem Mordfall, bei dem der Tatverdächtige der Lebensgefährte des Opfers ist; und dann ist da die Nachricht von einem versuchten Überfall auf einen Geldtransporter, der mit dem Eintreffen der Carabinieri, einem Schusswechsel, der Tötung eines der Täter sowie der Verhaftung zweier weiterer endete. Normalerweise liest du solche Meldungen nicht.
Diese allerdings schon, denn die Überschrift hat dich neugierig gemacht. Angst im Zentrum von Bari.
Der getötete Täter war fünfzig Jahre alt und wegen terroristischer Straftaten in den Achtzigern und zahlreicher Raubüberfälle vorbestraft. Die Rückfallquote dieser Art Straftäter sei sehr hoch, erklärt der Verfasser des Artikels, dessen pedantischer Unterton dich irgendwie nervt. Viele, die erst nach langen Haftstrafen freikommen, werden sofort wieder rückfällig. Weil sie Geld brauchen, natürlich. Aber nicht nur deshalb. Der Hauptgrund ist, dass sie es gern tun, es macht ihnen Spaß. Professionelle Räuber lieben ihre Arbeit und können nicht ohne den Adrenalinkick. In gewissem Sinne sind sie nicht anders als die, die mit dem Motorrad zweihundert Sachen fahren, Fallschirm springen oder sich in die Stromschnellen eines Flusses stürzen.
Du liest weiter, ohne auf die Namen der Täter zu achten. Du bist schon zwei oder drei Zeilen weiter, als dir aufgeht, dass du noch einmal zurückmusst. Wie bei etwas flüchtig im Vorbeigehen Gesehenem. Man nimmt ein Bild wahr, dessen Sinn oder Zusammenhang man erst ein paar Augenblicke später begreift. Die Verarbeitung hinkt hinter der Wahrnehmung her. Also gehst du noch einmal zurück und liest den Namen des getöteten Räubers, und erst lange Sekunden später merkst du, dass du den Atem anhältst. Mit gebannter Verstörung liest du das Stück zu Ende, sprichst es im Kopf Wort für Wort mit, damit dir nicht der kleinste Hintersinn entgeht. Aber es gibt keinen Hintersinn, abgesehen von diesem Vor- und Nachnamen.
Du verlässt die Bar, und alles um dich herum erscheint dir auf einmal fremd. Dabei lebst du schon seit Jahren hier.
Du überlegst, dass du an diesem Morgen wohl nicht arbeiten kannst.
1
Zum Bahnhof ist es nicht weit. Zwanzig Minuten, wenn man zügig geht. Doch seit du in der Bar warst, sind mindestens zwei Stunden vergangen. Ist dir gar nicht aufgefallen, aber bei einem Blick auf die Uhr stellst du fest, dass es schon halb zwölf ist, was bedeutet, dass du unmöglich auf direktem Weg von San Jacopino zum Bahnhof gelangt sein kannst. Du hast nicht den leisesten Schimmer, was in diesen gut zwei Stunden passiert ist; du hast nicht die leiseste Ahnung, welche Straßen du genommen hast oder was dir durch den Kopf gegangen ist. Flüchtige Materie, noch flüchtiger als sonst.
Dennoch betrittst du zielstrebig den Bahnhof. An den Fahrkartenschaltern ist kaum etwas los, und vielleicht hat das, was dann passiert – etwas an einem Bahnfahrkartenschalter recht Naheliegendes –, auch etwas damit zu tun. Du kaufst eine Fahrkarte. Hätte dort die übliche Schlange gestanden – die übliche? Seit Jahren hast du dir am Bahnhof keine Fahrkarte mehr gekauft, was weißt du schon, was üblich ist? –, hättest du womöglich kehrtgemacht, und es wäre nichts passiert.
Aber da ist keine Schlange. So viel zum Zufall.
Der Zug fährt um 13:30 Uhr, genug Zeit, um noch einmal nach Hause zu gehen und ein paar Sachen zusammenzupacken. Während du losgehst, das Ticket in der Hand, als könnte dich jeden Moment jemand danach fragen, fühlst du dich seltsam erleichtert. Als hättest du das Richtige getan: das Notwendige. Als hätte es nichts mit dem Zufall zu tun und als wäre alles – frühstücken gehen und sich ans Tischchen zu setzen, statt am Tresen zu stehen; auf diesem Tischchen eine Zeitung vorzufinden; diese Zeitung durchzublättern und unbedingt die beiden aneinanderklebenden Seiten trennen zu wollen; diese Meldung und diesen Namen zu lesen – ein wohlüberlegt zusammengesetztes Mosaik.
Ein wohlüberlegter Plan.
Du sagst dir, dass du diese Reise schon viel zu lange aufgeschoben hast, ohne dir dessen bewusst zu sein. Ein ziemlich scharfsinniger Gedanke, findest du; eine Eingebung. Seit Ewigkeiten die erste wirkliche Eingebung, die erste wirkliche Erkenntnis über dich selbst.
Zum Glück ist nicht mehr viel Zeit bis zur Abfahrt, und so bleibt dir keine Zeit für dein übliches entschlussloses, nervtötendes Kofferpackritual. Heute greifst du dir zielstrebig vier Hemden, vier Unterhosen, vier Paar Strümpfe und vier T-Shirts aus dem Schrank, dazu eine Zahnbürste plus Zahnpasta und so weiter, den Computer, ein Buch, stopfst alles in die Reisetasche und machst sie zu. Die Schnelligkeit und Klarheit machen dir gute Laune.
Zumindest den Vorteil hat dein Job, denkst du. Wenn du eines Morgens weshalb auch immer spontan beschließt wegzufahren, machst du’s einfach, sofern dir keine Abgabe im Nacken sitzt.
Ehrlich gesagt hat dein Job auch eine ganze Reihe nicht unerheblicher Nachteile, aber an die willst du an diesem Morgen nicht denken.
Du bist schon in der Tür, als dir einfällt, dass Mai ist. Du machst kehrt, öffnest den Schrank, durchwühlst die Sommerklamotten und ziehst eine Badehose hervor. Vielleicht brauchst du sie. Vielleicht hält diese Reise noch Überraschungen parat.
Hoffentlich.
2
Die Strecke Florenz-Bologna hat weniger als vierzig Minuten gedauert.
Der Bahnhof von Bologna ist genau wie immer. Das heißt, er ist nicht genau wie immer, aber er gibt einem das immer gleiche Gefühl. Ein Durchgangsort, ein Angelpunkt, ein Ort, an dem man auf der Schiene bleibt oder davon abkommt und im Graben landet.
Du sitzt im Zug, der dich nach Bari bringt. Ein schöner Zug, sauber und erstaunlich wohlriechend. Oder vielleicht, sagst du dir, ist es die Dame neben dir, die diesen zarten Geruch nach Seife und Puder verströmt. Sie sieht ganz unscheinbar aus, aber offenbar duftet sie. Geruch war schon immer ein diskriminierendes Element. Angenehm zu riechen ist ein mitunter geradezu entscheidendes Plus. Mal ehrlich: In manchen wegweisenden Momenten deines Lebens war es entscheidend. Du überlegst, dass das ein guter Aufhänger für eine Erzählung wäre, eine Liste der Düfte, die mit den wegweisenden Momenten deines Lebens verknüpft sind. Bisweilen passiert es dir noch, dass du überlegst, was ein guter Aufhänger für eine Erzählung oder einen Roman sein könnte. Aber die Ideen sind schneller wieder weg, als du sie notieren könntest – außerdem trägst du schon seit Ewigkeiten kein Notizbuch mehr bei dir. Sie flattern einfach davon, ohne noch Schmerz oder Traurigkeit zu hinterlassen. Nur einen Hauch Wehmut.
Einen Hauch.
Du lehnst dich zurück und denkst, dass dir die Vorstellung, nichts tun zu müssen, gefällt. Wenn du dich langweilst, kannst du dein Buch herausholen, aber im Augenblick willst du nur diesem kaum hörbaren Knistern der Seele lauschen. Dich auf etwas konzentrieren und den Gedanken freien Lauf lassen.
Und so geschieht es. Der Gedankenfluss rauscht dahin – zu anderen Zeiten hättest du gesagt: der Bewusstseinsfluss, aber diese Zeiten liegen weit zurück. So weit, dass du dich hin und wieder fragst, ob es sie je gegeben hat. Die nächste Frage lautet: Wieso stellst du dir dauernd so alberne Fragen?
Die Dame neben dir, die nach Seife und Puder duftet (inzwischen bist du dir sicher: Sie ist es, die duftet, und nicht der Zug), hat ein Sandwich gegessen und ein paar Schlucke Wasser getrunken. Jetzt holt sie ein Buch und einen Bleistift aus der Tasche und beginnt zu lesen. Ab und zu unterstreicht sie eine Stelle oder vermerkt etwas am Seitenrand. Die Neugier herauszufinden, was die Menschen, denen du begegnest, lesen, ist dir geblieben, und so verdrehst du möglichst unauffällig den Kopf, um zu sehen, welches Buch deine Nachbarin in der Hand hält. Du zuckst überrascht zusammen. Es ist Tonio Kröger, die Erzählung kennst du gut. Du hast sie vor Jahren in deiner Jugend gelesen, in der Phase, in der du alles verschlungen hast, was Thomas Mann je geschrieben hat. Lange Zeit hast du behauptet, er sei dein Lieblingsschriftsteller, und gedacht – auch wenn du es nie jemandem gesagt hast –, Tonio Kröger enthalte Wahrheiten, die auf geradezu erschreckende Weise etwas mit dir zu tun haben.
Als die Dame aufblickt, weil sie offenbar merkt, dass du sie musterst, sprichst du sie ganz selbstverständlich an.
»Gefällt es Ihnen?«
Sie hat ein herzliches Lächeln, es macht sie richtig hübsch.
»Ich bin mir noch nicht sicher. Manches ist brillant, anderes erscheint mir ziemlich altbacken. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an der Übersetzung. Haben Sie es gelesen?«
»Vor Jahren. Ich weiß nicht, wie es wäre, es jetzt noch einmal zu lesen. Alten Kram aufzuwärmen ist ja meistens keine besonders gute Idee.«
Sie lächelt abermals.
»Tja, meistens nicht. Aber manchmal kommt man nicht umhin. Alten Kram wieder aufzuwärmen, meine ich.«
Jetzt gefällt dir die Dame richtig gut, und so damenhaft erscheint sie dir gar nicht mehr.
»Sie meinten, einige Dinge fänden Sie …«
»Brillant. Ja, genau.«
»Zum Beispiel?«
Sie blättert zurück, findet schließlich, was sie sucht, und liest laut vor: »Wie ruhevoll und unverwirrbar Herrn Knaaks Augen blickten! Sie sahen nicht in die Dinge hinein, bis dorthin, wo sie kompliziert und traurig werden; sie wussten nichts, als dass sie braun und schön seien. Aber deshalb war seine Haltung so stolz! Ja, man musste dumm sein, um so schreiten zu können wie er; und dann wurde man geliebt, denn man war liebenswürdig.«
»Das ist die Beschreibung des Tanzlehrers, richtig?«
»Ja, ich finde sie phänomenal. ›In die Dinge hinein, bis dorthin, wo sie kompliziert und traurig werden‹.«
Du erinnerst dich genau, weil dir die Erzählung so gut gefiel. Man musste dumm sein, um geliebt zu werden und liebenswürdig zu sein. Wie sehr du diese Ansicht in deiner jugendlichen Arroganz teiltest! Ihr Dichter, unverstanden und zur Einsamkeit verdammt, derweil die Spießer fröhlich ihren niederen Machenschaften frönen. Was für ein Schwachsinn.
»Wie sind Sie zu diesem Buch gekommen? Das wird nicht oft gelesen, zumindest nicht heutzutage.«
»Ich war auf dem Sprung zum Zug, und weil ich etwas zu lesen mitnehmen wollte, hab ich rasch ins Regal geschaut und das hier gesehen, es lag da schon eine halbe Ewigkeit. Ich hab kurz reingelesen, es hat mir gefallen, und da hab ich’s eingesteckt.«
Na bitte, wieder der Zufall. So oft wie der dir heute begegnet, muss es etwas anderes sein, das sich als Zufall tarnt.
»Würden Sie mich hineinlesen lassen? Nur den Anfang, versteht sich.«
Sie lächelt wieder und hält dir das Buch hin.
»O Verzeihung, das Lesezeichen ist wohl weg.«
»Ich benutze gar keine Lesezeichen. Ich ziehe es vor, mir die Stelle zu merken, bis zu der ich gekommen bin, und eventuell ein paar Absätze noch einmal zu lesen. Das habe ich immer so gemacht.«
Du nimmst das Buch und blätterst zur ersten Seite. Die Wintersonne stand nur als armer Schein, milchig und matt hinter Wolkenschichten über der engen Stadt.
»Vor ein paar Jahren bin ich in Lübeck gewesen«, sagst du ohne besonderen Grund und gibst ihr das Buch zurück.
»Und wie ist die Stadt?«
»Interessant. Ich hab nicht viel Zeit gehabt, sie mir anzuschauen – eigentlich war ich auf der Durchreise –, aber immerhin habe ich ein bisschen mehr von den Buddenbrooks und Thomas Mann verstanden.«
»Darf ich fragen, was Sie beruflich machen? Es klingt, als wären Sie beruflich in Lübeck gewesen.«
»Verlagsberater«, entgegnest du ein wenig zu hastig. Wie immer, wenn es zu diesem Thema kommt. »Und Sie?«
»Was bedeutet Verlagsberater? Sind Sie Literaturagent?«
»Nein, ich habe eher mit der Veröffentlichung von Romanen zu tun.«
»Klingt interessant.«
»Kommt auf die Romane an.«
»Stimmt, kann ich mir vorstellen. Ich bin ebenfalls beraterisch tätig.«
»In welchem Bereich?«
»Entwicklung und Umgestaltung von Restaurants. Wenn Sie ein Restaurant eröffnen wollen oder bereits eines haben und es verändern möchten, sind Sie bei mir richtig.«
Das klingt nach einem guten Gesprächsthema. Also redet ihr über Restaurants – sie kümmert sich nicht nur um die Restaurants anderer, sondern hat auch selbst eines in Bologna – und Bücher über Restaurants und Filme über Restaurants und Essen und Wein und darüber, was für ein seltsamer und irgendwie kruder Ort Restaurantküchen sind, vor allem die der großen Chefs. Und was für seltsame Lebensläufe die Menschen haben – sie war Architektin, hatte jedoch nach ein paar Jahren genug davon. Und ihr plaudert weiter, bis die Stimme aus dem Lautsprecher ankündigt: nächster Halt Ancona.
»Ich muss aussteigen. Schauen Sie doch in meinem Restaurant vorbei, wenn Sie mal in Bologna sind.« Sie zieht eine orangefarbene, auffällige und zugleich dezente Visitenkarte aus der Tasche und gibt sie dir. Du sagst, dass du keine Visitenkarten hast und dass du natürlich vorbeikommst, wenn du in Bologna bist, und dass es dir ebenfalls ein Vergnügen war, sie kennenzulernen – wirklich –, und ein paar Minuten später ist sie ausgestiegen und der Zug wieder losgefahren, und du bist allein.
Mindestens eine Stunde lang sitzt du da, ohne an irgendetwas zu denken. Ohne dich zu fragen, was du tust, ohne an das zu denken, was du in der Zeitung gelesen hast, ohne zu überlegen, was du in Bari eigentlich willst. Dann plötzlich fällt dir ein, dass du dort gar keine Bleibe mehr hast und einen Platz zum Schlafen brauchst. Klar, dein Bruder wohnt dort, aber du hast keine Lust, ihn auf den letzten Drücker anzurufen und ihm zu sagen, dass du kommst und selbstverständlich davon ausgehst, bei ihm unterkriechen zu können. Ihr habt euch seit drei Jahren nicht gesehen und telefoniert auch nur sehr selten. Vielleicht rufst du ihn in den nächsten Tagen an und schaust bei ihm vorbei, aber jetzt ist das keine gute Idee. Also schaltest du den Computer an, steckst den Surfstick ein und suchst nach einem Hotel oder einem Bed and Breakfast im Zentrum. Überrascht stellst du fest, dass es tatsächlich etliche gibt. Du hattest Bari nicht als Bed-and-Breakfast-Stadt in Erinnerung, aber das hat sich offenbar geändert. Du suchst eines heraus, das Der geheime Garten heißt. Es sieht recht anständig aus und ist bezahlbar, also rufst du an. Haben Sie für heute Abend ein Zimmer frei? Ja, haben sie. Du buchst es, in ein paar Stunden bist du dort. In Ordnung, Signore, nur eine Nacht, oder bleiben Sie länger? Bleibst du länger? Ja, eher schon. Wie viele Nächte, Signore? Du weißt es nicht. Du weißt noch nicht einmal, wieso du überhaupt nach Bari fährst. Also überlegst du schnell, wie viele Wechselsachen du eingepackt hast, und sagst: vier. Du bleibst vier Nächte. In Ordnung, Signore, dann bis später. Bis später. Du überlegst, dass die Frau am Telefon einen seltsamen Akzent hatte. Wahrscheinlich keine Italienerin und bestimmt keine Baresin. Wie auch immer, vielleicht findest du es ja heraus, wenn du da bist.
Du hast keine Lust zu lesen. Du setzt dir die Kopfhörer auf, drückst auf zufällige Wiedergabe und denkst weiter an nichts, derweil links die Adria an dir vorüberzieht, bis der Zug pünktlich um 20:18 Uhr in den Bahnhof von Bari einfährt.
Enrico
Ich bin dreizehn Jahre zur Schule gegangen, habe also dreizehn erste Schultage gehabt, aber aus verschiedensten Gründen erinnere ich mich nur an drei. Der erste in der Grundschule ist mir vor allem wegen der Demütigung im Gedächtnis geblieben.
Ich kam ziemlich befangen in die Klasse, die anderen Kinder hingegen – zumindest die, die mir aufgefallen sind – schienen total entspannt zu sein, als hätte ihnen jemand vorher die Regeln, Rhythmen und Rituale dieses neuen Lebens erklärt. Was mich besonders beeindruckte, war, dass einige von ihnen fragten, ob sie mal ins Kämmerchen dürften. Die Lehrerin flüsterte ihnen etwas ins Ohr und erteilte ihre Erlaubnis, und sie verließen die Klasse und kehrten einige Minuten später mit – wie ich fand – zufriedener Miene wieder zurück. Aus unerfindlichen Gründen redete ich mir ein, das Kämmerchen wäre ein kleines Zimmer voller Spielzeug, in dem man eine kurze Entspannungspause einlegen konnte. Irgendwann nahm ich all meinen Mut zusammen und fragte, ob ich ins Kämmerchen dürfe. Die Lehrerin beugte sich zu mir und erkundigte sich flüsternd, ob ich Klein oder Groß müsse. Ich dachte, wenn ich schon die Wahl habe, stapele ich doch ein bisschen hoch, und entschied mich einigermaßen selbstsicher für Groß, in dem Irrglauben, das würde bedeuten, man könne länger oder mit einem tolleren Spielzeug spielen. Die Lehrerin schaute leicht beunruhigt und fragte mich, ob ich denn schon alles alleine könne. Die Sache begann irgendwie vertrackt zu werden. Was sollte das heißen: alles alleine? Ich hatte keine Ahnung, was ich antworten sollte, aber weil ich mich schon ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt hatte, nickte ich eifrig, in der Hoffnung, dass keine weiteren Fragen kommen würden. Sie holte eine Klopapierrolle aus der Schublade ihres Pults und drückte sie mir in die Hand. Ich fragte, was ich damit solle und für wen die sei, und sie sah mich an, als hätte ich sie angelogen.
»Bist du dir sicher, dass du alles alleine kannst?«, fragte sie streng.
Jetzt war ich vollends verwirrt, ich hatte keinen Schimmer, worüber wir hier eigentlich redeten, und allmählich bereute ich meine Kühnheit.
»Der kann sich den Arsch nicht allein abwischen«, sagte irgendjemand so laut, dass man es bis in die hinterste Ecke des Klassenzimmers hörte.
Es folgte eine schreckliche, tumultartige Szene. Die Klasse fing an zu lachen, die Lehrerin stürzte sich auf der Suche nach dem Störenfried zwischen die Bänke – das Wort Arsch in ihrer Klasse! –, und ich wurde rot, fing an zu weinen und konnte lange nicht mehr aufhören.
In der neunten Klasse kamen die Mädchen. Ich hatte die Mittelschule in einer Jungenklasse absolviert und fand mich, wie alle, in der Oberschule in einer gemischten Klasse wieder. Abgesehen von Nicola Capriati, der vierzehn war und aussah wie vierundzwanzig, waren wir Jungen noch völlig grün hinter den Ohren; die Mädchen hingegen sahen aus wie erwachsene Frauen, mit unfassbaren Brüsten in weit aufgeknöpften Blusen und viel zu eng anliegenden T-Shirts. Besonders von einer konnte man den Blick nicht losreißen: Mariella Longo. Im Gesicht sah sie eher aus wie Rocky Marciano, aber dafür hatte sie einen unverschämt großen Busen und den Ruf, ein – nun ja – recht frühreifes Mädel zu sein. Lange Zeit war Mariella Longo die Lieblingsprotagonistin unserer erotischen Träume und der damit einhergehenden verbotenen Handlungen, und jener erste Schultag bedeutete die erschütternde Erkenntnis, dass es Sex tatsächlich gab, nicht nur in den Pornocomics, die uns hin und wieder in die Hände fielen.
In der Elften tauchte Salvatore auf.
Fast alle waren im Klassenraum, und es hatte schon geklingelt, als ich ihn hereinkommen sah. Ich dachte, er hätte sich in der Klasse geirrt. Wahrscheinlich, sagte ich mir, gehört der in die Dreizehn – deren Raum direkt neben unserem lag – und hatte nicht richtig hingeguckt. Er wirkte erwachsen, sportlich und aggressiv: Aus dem kurzärmligen Hemd schauten gebräunte, sehnige, durchtrainierte Arme hervor, das Gesicht war mit einem dichten, drahtigen schwarzen Bart bedeckt. Der Bart beeindruckte mich am meisten. In dem Jahr spross mir der erste Flaum, den ich mir wie besessen rasierte, in der Hoffnung, er würde dadurch schneller und dichter wachsen. Verstohlen musterte ich die anderen Jungs und begann, sie in zwei Kategorien einzuteilen: die, die mehr, und die, die weniger Bartwuchs hatten als ich; Erstere beneidete ich, Letztere bemitleidete und verachtete ich. Salvatore hatte den dichtesten Bart, den ich je gesehen hatte, jenseits jedweden Neids, wie eine Art unerreichbares männliches Ideal.
Salvatore blickte sich um, als wäre er im Zoo gelandet oder in einem Hühnerstall; kopfschüttelnd verdrehte er die Augen und setzte sich links in die letzte Bank am Fenster und somit in meine unmittelbare Nähe, denn ich hatte mir den Platz in der letzten Mittelbank gesichert, wo ich laut meinen – falschen – Berechnungen den Lehrern am wenigsten ins Auge fiel.
Ich wollte ihm schon etwas sagen. Entschuldige, aber du hast dich in der Klasse geirrt, vielleicht gehörst du in die III G oder irgendwo anders hin? Das hier ist die I E, siehst du nicht, was für Milchbubis wir noch sind? Du gehörst nicht hierher. Vielleicht hätte ich wirklich etwas gesagt, hätte ich nicht bemerkt, dass die ganze Klasse ihn mehr oder weniger unverhohlen angaffte. Der Radau war fast vollkommen abgeebbt, und alle beäugten den Neuankömmling und stellten sich die mehr oder weniger gleiche Frage: Was hat der hier verloren?
Dann kam Conti herein, unser Latein- und Griechischlehrer. Er war um die sechzig, ziemlich klein und kräftig und trotz des warmen Septembertags in Jackett, Schlips und Weste. Er hatte den Ruf, nicht besonders sympathisch, aber ziemlich fähig zu sein, es hieß, er sei in der Lage, einen griechischen Text ohne Wörterbuch ins Lateinische zu übersetzen, und habe als junger Mann alle möglichen Übersetzerwettbewerbe gewonnen. Er siezte seine Schüler und nahm das eigene Können als Messlatte für seine Ansprüche. Seine Kurse hatten jedes Jahr die höchste Durchfallquote der Schule.
Er setzte sich ans Pult, öffnete das Klassenbuch und blickte minutenlang hinein, als müsse er eine geheime Botschaft entschlüsseln; als wolle er es irgendwie übersetzen. Dann musterte er uns eindringlich und überprüfte die Anwesenheit. Als er fertig war, schlug er das Klassenbuch theatralisch wieder zu und fing endlich an zu sprechen.
»Sie wissen, dass dies ein schwieriges Jahr wird. Die Mittelstufe ist recht anspruchslos, doch jetzt, da Sie in der Oberstufe sind, werden Sie allmählich begreifen, was es heißt, sich auf den Hosenboden zu setzen. Ich habe wenige Regeln, aber die müssen Sie einhalten. Die wichtigste ist folgende: Versuchen Sie nicht, mich auf den Arm zu nehmen. Wer meint, er könnte sich durchmogeln, hat bei mir keine Chance. Ein stoffliches Defizit lässt sich wettmachen, solange sich der Schüler korrekt verhält. Wer hingegen glaubt, sich durchlavieren zu können, oder dieses Fach für überholt und bedeutungslos hält, ist auf verlorenem Posten.«
Er machte eine Pause, um sicherzugehen, dass er unsere volle Aufmerksamkeit hatte. Ich schielte nach links zu unserem unsäglichen neuen Klassenkameraden hinüber. Er saß seelenruhig da, lässig und entspannt, und quittierte Contis drohende Reden mit mildem Desinteresse. Im Hemdsärmel – das bemerkte ich erst jetzt – hatte er ein Zigarettenpäckchen stecken; sein Bart reichte ihm bis zu den Wangenknochen.
»Was halten Sie davon, Scarrone?«, fragte Conti wie aus heiterem Himmel. Sein Tonfall verriet, dass die Frage nicht von ungefähr kam und Salvatore für ihn kein unbeschriebenes Blatt war.
Doch der schien nicht überrascht zu sein. Er rutschte ein wenig auf seinem Stuhl herum und antwortete dann bemüht gelassen, fast von oben herab: »Was halte ich von was, Signor Conti?«
»Haben Sie mir zugehört?«
»Mehr oder weniger.«
»Mehr oder weniger. Schön. Was halten Sie von dem, was ich hinsichtlich des Lernens sagte?«
Salvatore zuckte die Achseln, und ein ironisches, fast spöttisches Lächeln umspielte seine Lippen. Dann, als Conti fortfuhr, wurde seine Miene wieder ausdruckslos, geradezu apathisch.
»Wie ich weiß, haben Sie eine, wie soll ich sagen, politische Ader. Wissen Sie, was Antonio Gramsci hinsichtlich des Lernens sagte? Ich will es Ihnen verraten: ›Man muss viele Leute überzeugen, dass Lernen auch Arbeit ist und sehr ermüdend, eine nicht muskulär-nervöse, sondern intellektuelle Ausbildungszeit: Es stellt einen Anpassungsprozess dar; eine durch Anstrengung, Frustration und sogar Leiden erworbene Gewohnheit.‹ Was denken Sie darüber?«
»Ich denke, Gramsci war ein Revisionist.«
»Was haben Sie gesagt?«
»Ich habe gesagt, Gramsci war ein Revisionist.«
»Ich nehme an, Sie wissen, was Revisionismus bedeutet, oder?«
»Klar.«
»Und gewiss werden Sie uns den Begriff jetzt erklären. Mir und Ihren Mitschülern.«
Es war eine fesselnde Szene, als würde man einem Duell beiwohnen, dessen Sieger wohl nicht Signor Conti wäre.
»Revisionismus ist eine Strömung des Marxismus, die für eine abgeschwächte Form des Klassenkampfes zwischen Bürgertum und Proletariat eintritt. Gramsci war der größte italienische Revisionist, er sagte, Lernen sei Arbeit, und es ist vor allem ihm anzulasten, dass die Kommunistische Partei heute ein reaktionärer Haufen ist, der sich kaum noch von den Christdemokraten unterscheidet.«
Hätte ich nicht direkt neben ihm gesessen und gesehen, dass er keinen Spickzettel hatte, ich wäre mir absolut sicher gewesen, dass Salvatore mit der Frage gerechnet und die Antwort abgelesen hatte. Conti war kurz davor, die Fassung zu verlieren. Mit geballten Fäusten lehnte er sich über das Pult. Ich fand diesen ersten Schultag überaus interessant.
»Ich nehme an, Sie wissen, wie und wo Antonio Gramsci gestorben ist?«
»Im Faschistenknast, ich weiß. Aber das heißt nicht, dass man ihn nicht kritisieren und nicht sagen darf, dass er der erste theoretische Revisionist der Kommunistischen Partei war und ganz wesentlich für deren gegenwärtigen Zustand verantwortlich ist.«
Conti funkelte ihn zornig an.
»Wie alt sind Sie, Scarrone?«
Zum ersten Mal seit Beginn des Wortgefechts wirkte Salvatore auf dem falschen Fuß erwischt.
»Achtzehn.«
»Und Sie sind in der elften Klasse. Normalerweise müssten Sie in der Dreizehn sein, oder nicht?«
Auf diese Frage – die keine Frage war – gab es keine Antwort. Conti fuhr fort und schien ein Stück seiner verlorenen Selbstgewissheit zurückgewonnen zu haben.
»Man hat mir bereits von Ihnen berichtet und mich gewarnt, dass ich Sie hier antreffen würde, Scarrone. Sie haben schon so einiges auf dem Kerbholz und sind zweimal sitzengeblieben. Wenn Sie dieses Jahr wieder durchfallen, war’s das. Das ist Ihnen bewusst, oder?«
Salvatore antwortete nicht. Er blickte Conti scheinbar gleichgültig an. Von der Seite nahm ich jedoch das rhythmische Zucken seiner Kiefer wahr. Keiner in der Klasse tat einen Mucks, die Luft war zum Zerreißen gespannt.
Enrico
Hätte mich damals jemand gefragt, was ich nicht ausstehen kann, ich hätte wohl ungefähr Folgendes gesagt: Mittelmäßigkeit (den Begriff hatte ich mir seit Kurzem angeeignet und benutzte ihn gern und oft), Überheblichkeit, Konformismus und Faschismus. Eine recht oberflächliche Einstellung. Rückblickend betrachtet jedoch durchaus akzeptabel.
Hätte mich jemand gefragt, was ich mag, hätte ich gesagt: Gitarre spielen, lesen – egal was: vor allem Bücher, aber auch jede Art von Zeitungen und Comics –, Musik hören, ins Kino gehen. Und hätte mir der Fragende nahegestanden, hätte ich zögerlich oder zumindest weniger forsch hinzugefügt, dass ich schreibe und das Schreiben gern eines Tages zu meinem Beruf machen würde. Zwar hatte ich keine genaue Vorstellung, was ich eigentlich schreiben wollte – Romane, Erzählungen, Zeitungsberichte, Essays, Drehbücher, Comics –, aber mir war sonnenklar, dass ich damit mein Brot verdienen wollte, Satz für Satz.
Zu Hause waren wir zu viert. Mein Vater Mario war Internist und großer Sportler. In jungen Jahren war er Schwimm- und Tenniscrack gewesen und trainierte noch immer jeden Tag mit einer mich äußerst irritierenden Regelmäßigkeit. Meine Mutter Elisabetta war Fachoberschullehrerin für Rechnungswesen. Es hieß, als Teenager sei sie wunderschön gewesen und mein Vater habe gegen einen Haufen anderer Jungs der sogenannten guten Bareser Gesellschaft antreten müssen, die sich im Segel- und im Tennisklub tummelten. Ich hatte das Thema nie vertieft, weil es mich nervte, und noch mehr nervte es mich, mir den Kopf darüber zu zerbrechen, warum es mich nervte. Mein zwei Jahre älterer Bruder Angelo ging in die dreizehnte Klasse und war das genaue Ebenbild meines Vaters: Er war groß und durchtrainiert, sportbegeistert, kam bei Mädchen gut an und hatte mit Feingefühl nicht viel am Hut.
Wir bewohnten eine geräumige Wohnung in einem Sechzigerjahrebau im Zentrum, weshalb ich mir glücklicherweise kein Zimmer mit meinem Bruder teilen musste. In Angelos sehr ordentlichem Zimmer gab es Poster von Tennisspielern und Fußballern, Schläger, Bälle aller Arten und Größen – vom Tennis- bis zum Basketball –, Schulbücher, eine Stereoanlage, ein Radio und einen kleinen Fernseher.
Mein restlos chaotisches Zimmer war vollgestopft mit Büchern, Comics, Notenheften, einem Kassettenrecorder, einem Radio, meiner Gitarre und einem Keyboard. Auf die obersten Borde des großen Regals gegenüber dem Bett hatte ich das ausrangierte Spielzeug geräumt, von dem ich mich nicht trennen konnte: einen ferngesteuerten Ferrari, den Chemiekasten, die Steinsammlung, das Mikroskop, das Meccano-Kinderkino, den Zauberkasten, das Tipp-Kick, das Lego, zwei mit buntem Papier bezogene Kisten voller Soldaten, Tiere und Autos, einen Big Jim und ein paar Pistolen. An den Wänden hingen drei Poster: Bob Marley, Che Guevara und Tex Willer. Auf dem Kiefernholzschreibtisch drängten sich eine rote Lampe, Hefte, Papierstapel, ein Praxinoskop, meine Kodak Instamatic und – nicht zuletzt – meine Schreibmaschine: eine militärgrüne Lettera 22, die ich mir nach langen Diskussionen – »Aber wieso willst du denn kein neues Fahrrad?« – zu meinem fünfzehnten Geburtstag hatte schenken lassen.
Eine Ewigkeit lang hatte ich heimlich und unerlaubt die Lexicon 80 meiner Mutter benutzt. Das alte Ding stand im Arbeitszimmer, sprich, in dem Raum der Wohnung, zu dem der Zutritt verboten war, und somit dort, wo ich mich heimlich am liebsten aufhielt, wenn mein Vater und meine Mutter nicht da waren. Es gab dort eine Menge interessanter Dinge: den schwarzen Füller mit der goldenen Feder; das Klappmesser mit dem beinernen Heft, das ganz hinten in einer abgeschlossenen Schublade lag; den Revolver aus dem neunzehnten Jahrhundert, der – angeblich – einem aus Garibaldis Zug der Tausend gehört hatte. Aber vor allem gab es dort besagte Schreibmaschine, die auf dem kleinen Teakholzsekretär stand. Lange Zeit, ehe ich mich traute, ein Blatt einzuspannen und auf die Tasten zu drücken, hatte ich sie nur berührt. Ich ließ die Finger über den Koffer gleiten, öffnete ihn, streichelte die leicht raue Oberfläche, tippte behutsam auf eine Taste, um zu sehen, wie der Buchstabe sich hob und nach vorn reckte wie der Hals einer aufgestörten Giraffe. Dann begann ich, heimlich zu schreiben, wenn niemand zu Hause war. Erzählungen, Gedichte, eine Art Tagebuch, eine kleine Zeitung (in doppelter Ausführung, mit Kohlepapier dazwischen), bei der ich es auf fünf oder sechs Ausgaben brachte und die ich sogar an den einen oder anderen Schulkameraden loswurde. Obwohl ich nur die beiden Zeigefinger benutzte wie die Carabinieri in manchen Schwarz-Weiß-Komödien, war ich bald sehr flink und treffsicher.
Dass ich mit einem solchen Gerät bereits vertraut war, schmälerte nicht im Mindesten das überwältigende Gefühl, als ich meine Schreibmaschine aus ihrer Hülle holte, sie auf meinen Schreibtisch stellte, davor Platz nahm und überlegte, was ich schreiben könnte, das diesem bedeutenden Moment angemessen wäre und ihn gebührend würdigte. Lange saß ich unentschlossen davor und verwarf eine Idee nach der anderen, da sie mir unzureichend und banal erschienen. Irgendwann beschloss ich, dass ich, um kein Risiko einzugehen und jedweden eventuellen Fehltritt gänzlich auszuschließen, etwas Probates und Vollkommenes bräuchte. Ich holte ein Dutzend meiner Lieblingsromane aus dem Bücherregal und fing an, ihre Anfangssätze abzutippen. Ich füllte ein ganzes Blatt des Schreibmaschinenpapiers extra strong, das ich zur Maschine dazubekommen hatte. Ich kopierte die Worte anderer – ohne dazuzuschreiben, von wem oder aus welchem Buch sie stammten – und empfand dabei wahre Allmacht. Ich musste nur die Zeigefinger krumm machen, und schon entsprangen ihnen die herrlichsten Sätze. Und während ich sie schrieb, sie in sauberen tintenschwarzen Buchstaben auf dieses weiße, kräftige Papier brachte und dem gedämpften, trockenen Klacken der Tasten lauschte, fühlte ich mich wie ein wahrer Schriftsteller, wie der Hüter des Mysteriums, und mir war, als wäre der Flaschengeist bei mir und würde mich nie mehr verlassen.
Es war eine wundervolle Nacht, eine solche Nacht, wie sie vielleicht nur vorkommen kann, wenn wir jung sind, lieber Leser.
Damals war immerzu Festtag. Die Mädchen brauchten nur aus dem Haus zu treten und über die Straße zu gehen, da gerieten sie geradezu in einen Rausch; alles war, besonders nachts, so schön, dass sie, wenn sie todmüde heimkamen, noch immer hofften, dass irgendetwas passierte …
Dann begann das schlechte Wetter. Es kam eines Tages, als der Herbst vorbei war.
Ich war den ganzen Tag geritten, einen trüben, grauen und lautlosen Herbsttag lang – durch eine eigentümlich öde und traurige Gegend, auf die erdrückend schwer die Wolken herabhingen. Da endlich, als die Schatten des Abends herniedersanken, fand ich mich in Sichtweite des Hauses Usher. Ich weiß nicht, wie es kam – aber ich wurde gleich beim ersten Anblick dieser Mauern von einem unerträglich trüben Gefühl befallen.
Nur junge Menschen kennen solche Augenblicke. Ich meine nicht die ganz jungen. Die ganz jungen stehen, streng genommen, solchen Augenblicken noch fern. Es ist das Vorrecht der Herangewachsenen, im voraus, ja schon in vorweggenommener Zukunft zu leben und zusammen mit einer Hoffnung von unerhörter Ausdauer, die weder Pausen noch jähes zweifelndes Innehalten kennt.
Ich wollte ja nichts als das zu leben versuchen, was von selber aus mir herauswollte. Warum war das so sehr schwer?
Es war die beste und die schlimmste Zeit, ein Jahrhundert der Weisheit und des Unsinns, eine Epoche des Glaubens und des Unglaubens, eine Periode des Lichts und der Finsternis: Es war der Frühling der Hoffnung und der Winter der Verzweiflung; wir hatten alles, wir hatten nichts von uns; wir steuerten alle unmittelbar dem Himmel zu und auch alle unmittelbar in die entgegengesetzte Richtung.
Nachdem ich diese Worte zu Papier gebracht hatte, las ich sie noch einmal, und das Gefühl, sie zu besitzen, wurde umso stärker und heftiger. Jetzt gehörten sie mir, und es erschien mir ungerecht, sie der Welt nicht als die frühreife Schöpfung meines außergewöhnlichen Talentes präsentieren zu dürfen. Hätte die Möglichkeit bestanden, mich ungestraft als ihr Urheber auszugeben, ich hätte es ohne Weiteres getan. Es war gleichgültig, dass jemand anderes sie vor mir geschrieben hatte. Sie waren durch meine Finger und die glühenden Fasern meiner Fantasie geflossen, sie waren mein.
Von dem Tag an fing ich an, Sätze zu sammeln. Wenn ich ein Buch oder eine Zeitung las oder zu Hause ein Lied hörte und eine Passage oder eine Zeile mich besonders beeindruckte, tippte ich sie unverzüglich ab und schrieb das Datum – mein Datum –, jedoch nicht den Verfasser darunter. Meine Methode hatte weder mit Kalkül noch mit vorsätzlichem Betrug zu tun – die Blätter dienten einzig meinem persönlichen Gebrauch, niemand hat sie jemals gelesen, und inzwischen sind sie verloren gegangen –, doch indem ich diese Sätze schrieb und sie zu Papier brachte, als wären sie das ausgefeilte Produkt meiner Inspiration – und gewissermaßen waren sie es ja tatsächlich –, war mir, als durchliefe ich eine bereits weit fortgeschrittene Lehre mit unvermeidlichem Abschluss. Diese Worte neu zu erfinden und sie zu kopieren beschäftigte mich für Monate.
An manchen Abenden, wenn das Zimmer im Halbdunkel lag und der bläuliche Lichtkegel meiner Schreibtischlampe Schreibmaschine und Papier beleuchtete, stellte ich mir vor, ein wunderschönes, unbekanntes Mädchen stünde hinter den Vorhängen irgendeiner Wohnung, die auf denselben großen Innenhof hinausging wie mein Zimmer, und beobachtete mich heimlich. Sie war verliebt in mich, weil sie wusste, dass ich ein Schriftsteller war, und eines Tages würden wir uns begegnen und einander erkennen, und ich würde ihr meinen ersten Roman widmen, und dann würden wir gemeinsam zu fernen Horizonten voller Abenteuer und Verheißungen aufbrechen. Manchmal nickte ich über diesen Fantasien ein, und eine berauschende, geradezu erstickende Seligkeit durchschauderte mich. Nur wenn man jung ist, hat man solche Momente.
* * *
Dann war da die Gitarre. Mit zwölf hatte ich bei einer fähigen Musiklehrerin an der Mittelschule die Grundakkorde gelernt und dann mit dem Großen Buch der Akkorde, das ich mir von meinem monatlichen Taschengeld gekauft hatte, allein weitergemacht. Ich sang gern und hatte eine gute Stimme – auch wenn die Familie in diesem Punkt geteilter Meinung war, denn bisweilen stürzte mein Bruder entnervt in mein Zimmer und brüllte, ich solle aufhören, allen auf den Sack zu gehen; dieses Gejaule sei nicht zu ertragen, und wenn es unbedingt sein müsse, solle ich doch bei Beerdigungen auftreten oder mich bei dem Bestattungsinstitut zwei Blöcke weiter bewerben.
Ich glaube, er meinte vor allem meine mimetischen Interpretationen trübsinniger Liedermacherstücke. Das Hereinplatzen meines Bruders war für mich damals nur der x-te Beweis seiner Stumpfheit und Unempfänglichkeit für Schönheit und Poesie. Heute sehe ich es nicht mehr ganz so drastisch, denn wer weiß, wie ich reagieren würde, wenn jemand am frühen Nachmittag im Nebenzimmer auf der Gitarre klampfte und dazu voller Inbrunst Stücke wie Auschwitz, La ballata degli impiccati oder Per i morti di Reggio Emilia zum Besten gäbe.
* * *
Mein Verhältnis zum Sport war zwiespältig. Jede Art von Training und sämtliche Versuche meiner Eltern – meine Mutter war die Vollstreckerin, mein Vater der Anstifter –, mich zum Tennisspielen, Fechten oder Rudern zu bewegen, scheiterten nach wenigen Wochen, bestenfalls Monaten. Ganz zu schweigen von endlosem, unerträglichem Schwimmtraining: Bahn um Bahn in diesem Mikrokosmos aus zu grellem Licht, hellblauen Krankenhauskacheln und Chlorgeruch, der sich beim Duschen selbst mit Shampoo und Seife nicht herunterschrubben ließ.
Aber ich war gut in Fußball und Tischtennis. Während meines Jahres im Jugendklub der San-Rocco-Gemeinde hatte ich beides regelmäßig gespielt. Vielleicht hätte ich sogar eine Zukunft in der Mannschaft gehabt, die an den städtischen Pfarreimeisterschaften teilnahm, wenn meine Besuche im Jugendklub nicht ein abruptes, selbst verschuldetes Ende genommen hätten.
Wir kickten gerade auf dem Bolzplatz der Pfarrgemeinde. Plötzlich verpasste mir ein Junge namens Giovanni, genannt Pinuccio u’ gress – Pinuccio der Dicke –, der genauso alt war wie ich, aber mindestens fünfzehn Kilo schwerer, bei einem Zusammenstoß vor dem Tor einen Schultercheck, und ich stürzte. In diesen Partien gab es keinen Schiedsrichter. Wutschnaubend rappelte ich mich hoch, beschimpfte ihn aufs Übelste mit nicht gerade sakristeitauglichen Bemerkungen über die Moral seiner Mutter und forderte Elfmeter.
Ich war ihm dabei sehr nahe gekommen, und er, ein ziemlich friedfertiger Junge, jedoch stark wie ein Ochse, hatte mir die Hand aufs Gesicht gedrückt und mich wie ein lästiges Tier beiseitegeschoben. Es war offensichtlich, dass er mich in der körperlichen Auseinandersetzung nicht als ebenbürtig erachtete.
Nun kam es recht häufig vor, dass wir Jungs nach der Schule oder nach besagten Fußballspielen auf dem Bolzplatz der Pfarrgemeinde miteinander rauften. Wenn es Streit gab und ernst wurde, regelte man die Sache in einem der geräumigen Hausflure der alten Mietshäuser des Viertels Libertà. Der einleitende Standardsatz lautete: Gehen wir in die Einfahrt, wobei das Wort Einfahrt eine Art ungewollte Synekdoche für den gesamten Hausflur war. Diese Kämpfe besaßen einen gewissen Ereigniswert und wurden von einem mehr oder weniger zahlreichen Publikum verfolgt.
Die Regel lautete, dass man kämpfen durfte – das heißt, einander festhalten, schubsen, den anderen zu Boden reißen und ihn niederdrücken, bis klar war, wer gewonnen und wer verloren hatte –, jedoch ohne Boxen, Schlagen oder Treten. Bei einem derartigen Kampf hätte ich keine Chance gegen Pinuccio u’ gress