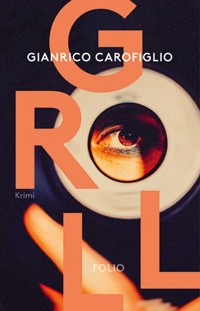
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Carofiglio, der Meister feinster psychologischer Nuancen, entwickelt eine Geschichte von Schuld und einem tiefen, menschlichen Groll. Ein einflussreicher Mailänder Chirurg und Universitätsprofessor stirbt unerwartet an einem Herzinfarkt, der Arzt bescheinigt den natürlichen Tod, die Leiche wird eingeäschert. Doch die Tochter geht von einem Verbrechen aus und wendet sich an Penelope Spada. Die ehemalige erfolgreiche Staatsanwältin und Stabhochspringerin hat unter rätselhaften Umständen ihre Karriere abrupt beendet. Von nagenden Schuldgefühlen geplagt, betäubt sie seitdem den Schmerz mit Alkohol und Zigaretten, treibt exzessiv Sport und schlägt sich mit privaten Ermittlungen durch. Widerwillig übernimmt sie den schier aussichtslosen Fall, der zur dramatischen Abrechnung mit der eigenen Vergangenheit wird. Sie muss sich ihren Dämonen stellen. The Italian Grisham – ein Meister des "legal thriller" "Was wollen die Opfer eines Verbrechens? Die Bestrafung der Täter? Natürlich, auch das. Aber was die Opfer wirklich wollen, ist die Wahrheit." (Gianrico Carofiglio)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carofiglio, der Meister feinster psychologischer Nuancen, entwickelt eine Geschichte von Schuld und einem tiefen menschlichen Groll.
Ein einflussreicher Mailänder Chirurg und Universitätsprofessor stirbt unerwartet an einem Herzinfarkt, der Arzt bescheinigt den natürlichen Tod, die Leiche wird eingeäschert. Doch die Tochter geht von einem Verbrechen aus und wendet sich an Penelope Spada.
Die ehemalige erfolgreiche Staatsanwältin und Stabhochspringerin hat unter rätselhaften Umständen ihre Karriere abrupt beendet. Von nagenden Schuldgefühlen geplagt, betäubt sie seitdem den Schmerz mit Alkohol und Zigaretten, treibt exzessiv Sport und schlägt sich mit privaten Ermittlungen durch. Widerwillig übernimmt sie den schier aussichtslosen Fall, der zur dramatischen Abrechnung mit der eigenen Vergangenheit wird. Sie muss sich ihren Dämonen stellen.
Foto: Giorgia Carofiglio
GIANRICO CAROFIGLIO, geboren 1961 in Bari, arbeitete jahrelang als Richter, Senator und Anti-Mafia-Staatsanwalt und beschäftigte sich schon früh intensiv mit Verhörtechniken und Aussagepsychologie. Ihn faszinieren die Tiefen der menschlichen Seele, die Ursachen einer Straftat, die Kluft zwischen Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit, der Gebrauch und Missbrauch von Sprache. Nebenbei besitzt er den schwarzen Gürtel in Karate und kritisiert die westliche Kultur des Narzissmus. Seine Bücher, inzwischen millionenfach verkauft, sind in 28 Sprachen übersetzt.
VERENA VON KOSKULL lebt und arbeitet in Berlin als Literaturübersetzerin, u. a. auch für die Wochenzeitung Die Zeit. Sie übersetzte Edoardo Albinati, Roberto Andò, Chiara Gamberale, Carlo Levi, Antonio Scurati u. v. a. Deutsch-Italienischer Übersetzerpreis 2020.
GIANRICO CAROFIGLIO
GROLL
Krimi
Aus dem Italienischen von Verena von Koskull
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
1.
Er kam immer samstags oder sonntags in den Park. Bei den Sportgeräten, an denen ich normalerweise trainiere, setzte er sich in gebührendem Abstand auf eine Bank, holte ein Buch und ein Schreibheft aus seinem kleinen Rucksack, begann zu lesen und machte sich hin und wieder Notizen. Auch an kalten Tagen. Manchmal hob er den Kopf und schaute sich neugierig um, als hätte er gerade erst bemerkt, wo er war.
Eines Tages waren wir uns über den Weg gelaufen und er blieb stehen, um Olivia zu streicheln. Olivia ist ein Bullterrier; sie ist nicht aggressiv – solang man ihr oder ihrer Freundin Penelope nicht dumm kommt –, aber Fremden gegenüber nicht sonderlich aufgeschlossen. Man darf sie streicheln und sie lässt es geschehen, wenn auch mit ostentativer Gleichgültigkeit. Ich weiß, solche Deutungsmuster gelten für Menschen (und längst nicht für alle), doch ich mag die Vorstellung, dass Olivia paternalistisches, gönnerhaftes Getue ebenso wenig ausstehen kann wie ich und entsprechende Leute lieber nicht an sich heranlässt.
Jedenfalls sagte der Typ Guten Tag, und ohne zu fragen, ob es gefährlich sei, bückte er sich, um sie zu streicheln. Er legte die Hand auf ihren Hals und fuhr ihr mit Daumen und Mittelfinger über die Lefzenwinkel. Olivia war sichtlich hingerissen, genüsslich reckte sie die Kehle und wedelte, offenbar selbst überrascht über das, was geschah, heftig mit dem Schwanz.
„Verraten Sie mir ihren Namen?“
Fast hätte ich geantwortet: Penelope. Natürlich meinte er den Hund.
„Olivia.“
„Schöner Name. Wunderschöner Hund. Gutes Training noch“, sagte er und ging davon.
Seitdem grüßten wir einander, wenngleich auf Entfernung.
So auch an jenem Morgen, einem Sonntag: Er saß mit seinem Buch auf der Bank, ich absolvierte wie üblich verbissen mein Training.
Es waren vielleicht zehn Minuten vergangen, als hinter mir plötzlich verzweifeltes Rufen, wütendes Knurren und Jaulen losbrach. Ich drehte mich um und sah ein Knäuel balgender Hunde, ein schwarzer oben, ein weißer unten; daneben stand eine hilflos zeternde Frau.
Alles ging sehr schnell, zu schnell, um es zu beschreiben. Ich sprang vom Barren, sagte zu der an einem Baum angeleinten Olivia, ich sei gleich zurück, und lief, ohne recht zu wissen, was zu tun wäre, zu der Rauferei. Suchend blickte ich mich nach einem Stock oder irgendeinem Gegenstand um, der mir nützlich sein könnte. Plötzlich trabte der Mann von der Bank an mir vorbei, packte den schwarzen Hund bei den Hinterbeinen, riss ihn hoch und schleuderte ihn ein paar Meter weit fort. Das Riesenbiest – offenbar ein Cane Corso – überkugelte sich mehrmals, rappelte sich wieder hoch und stand wie belämmert da. Der Mann ging gefährlich nah auf ihn zu und redete leise auf ihn ein, während der weiße Hund – ein Dalmatiner – Reißaus nahm, gefolgt von seiner aufgelösten Halterin. Kurz darauf trat ein Herr um die sechzig ins Blickfeld und eilte mit einer Leine in der Hand leicht hinkend auf uns zu. Der Molosser stand noch immer da wie hypnotisiert. Als sein Halter endlich bei uns war und sich unverbindlich nach allen Seiten entschuldigt hatte, ließ er sich widerstandslos anleinen und fortziehen. Es erschien unvorstellbar, dass dasselbe Tier noch vor wenigen Augenblicken fast einen Dalmatiner zerfleischt hätte. Kaum waren die Hunde nebst Halter verschwunden, war alles auf geradezu gespenstische Weise genau wie zuvor.
„So etwas habe ich noch nie gesehen“, sagte ich.
„Um raufende Hunde zu trennen“, erwiderte er, „gibt es nur zwei wirksame und einigermaßen ungefährliche Methoden. Ein Eimer Wasser oder das, was ich gerade gemacht habe.“
„Das nennen Sie einigermaßen ungefährlich? Was, wenn man gebissen wird?“
„Wenn man weiß, wie es geht, und entschlossen handelt, ist das relativ unwahrscheinlich. Packt man einen Hund bei den Hinterläufen, kann er nicht beißen, und normalerweise ist ihm danach sowieso die Lust vergangen. Zumindest fürs Erste. Bei abgerichteten Kampfhunden sieht die Sache natürlich anders aus.“
„Zum Glück war dieser Koloss keiner.“
„Ja, zum Glück.“
„Es sah aus, als würden Sie ihm etwas zuflüstern.“
„Um ihn zu beruhigen und dem anderen Hund nebst Frauchen Zeit zum Verschwinden zu geben. Was man sagt, ist egal, es kommt auf den Tonfall an.“
Er sah gar nicht aus wie ein Rambo. Brille, mittelgroß, normale Statur, fast ein bisschen hager. Eher Typ Langstreckenläufer als Kugelstoßer.
„Mit Hunden können Sie umgehen.“ Was für ein bescheuerter Satz, dachte ich sofort. „Und übrigens gebe ich manchmal auch intelligenteres Zeug von mir.“
„Ich mag Hunde. Früher hatte ich Spaß daran, sie abzurichten, jetzt fehlt mir die Zeit. Meiner ist vor ein paar Monaten gestorben.“
„Das tut mir leid.“
„Ich habe immer dazu geraten, sich sofort einen Welpen anzuschaffen, sobald der heiß geliebte Hund stirbt. Das ist das Vernünftigste: Dann bleibt man im Lot und fängt nicht an, das Tier zum Menschen zu verklären. Aber obwohl es das Vernünftigste ist, habe ich mich nicht daran gehalten. Ich habe den gleichen Fehler wie alle anderen gemacht und gedacht, ein neuer Welpe wäre Verrat an Buck. Schön blöd, oder?“
„Buck, wie der Hund in Ruf der Wildnis?“
„Genau. Nicht schlecht, an das Buch erinnert sich so gut wie niemand mehr.“
„Was war er für ein Hund?“
„Eine Mischung aus Berner Sennenhund – also die Rasse von Buck aus dem Roman – und einem Belgischen Schäferhund. Er sah ein bisschen beängstigend aus, war aber wahnsinnig lieb.“
So standen wir ein paar Sekunden lang da. Ich war kurz davor, mich zu erkundigen, was er las, doch angesichts seiner Hundetrauer erschien mir die Frage taktlos.
In dem Moment ließ Olivia, die geduldig gewartet hatte, ein einzelnes, berechtigt frustriertes Protestkläffen hören. Sie ist nicht besonders gesprächig: Wenn sie sich bemerkbar macht, gibt es dafür meistens einen triftigen Grund.
„Sie ruft nach Ihnen, zu Recht. Also, wir sehen uns die Tage“, sagte er.
„Wir sehen uns“, antwortete ich.
2.
Wenn ich meine Mandanten (sie so zu nennen fällt mir noch immer schwer) in Diegos Bar treffe, komme ich etwas früher, um noch ein bisschen mit ihm zu plaudern, wenn er nicht zu beschäftigt ist. Das erinnert mich an die Zeit, als ich noch eine richtige Arbeit hatte. Eine halbe Stunde vor jedem Termin – Verhandlung, Ermittlungsverfahren, Anwaltstreffen – traf ich in der Staatsanwaltschaft ein und wechselte ein paar Worte mit meinen Mitarbeitern. Das ist eines der Dinge, die ich vermisse.
„Ciao, Diego.“
„Ciao, Penny, hast dich schon ein Weilchen nicht mehr blicken lassen. Alles gut?“
„Alles gut wäre übertrieben. Bei dir?“
Er zog eine Miene, die ich an ihm nicht kannte und nicht zu deuten vermochte, und sah mich an, als wollte er etwas sagen, fände aber die Worte nicht. Dann fragte er: „Brauchst du das Büro?“
Ich nickte.
„Ist etwas nicht in Ordnung?“
Am Tresen standen nur zwei Gäste. Diego sagte zu seiner jungen kolumbianischen Angestellten Maria, er würde draußen eine rauchen gehen.
„Was ist los?“, fragte ich, als wir beide mit einer brennenden Zigarette vor der Tür standen. Es war kalt, der Himmel war grau und schwer, bald würde es regnen.
„Gestern waren wir wegen der Scheidung beim Richter.“
„Ah, verstehe. Der Moment ist gekommen.“
Er zog die Nase hoch. Blickte mich verzagt und niedergeschlagen an. Seine Augen waren feucht. Wenn jemand weint oder kurz davor ist, macht mich das befangen. Ich fühle mich verantwortlich, auch wenn ich nichts dafürkann, und ich mag es nicht, mich verantwortlich zu fühlen. Ich versetzte ihm einen linkischen Klaps auf die Schulter.
„Komm schon, das war doch eine gemeinsame Entscheidung.“
„Ich habe dir den Grund nie erzählt.“
„Nein, stimmt.“
„Ich bin schwul.“
Ich schwieg. Rauchte.
„Sag nicht, du wusstest es.“
„Na schön, ich sag’s nicht.“
„Wie bist du draufgekommen? Wann?“, fragte er mich halb verblüfft, halb erleichtert.
Ich war kurz davor zu antworten: Weil du mich nie angebaggert hast. Doch wäre das in mehrfacher Hinsicht daneben gewesen.
„Ich habe mir darüber keine besonderen Gedanken gemacht. Ich habe nur gedacht, du könntest schwul sein. Vielleicht wegen der Art, wie du mich umsorgst, wegen deiner Freundlichkeit, deiner Aufmerksamkeit für gewisse Kleinigkeiten. Bei heterosexuellen Männern findet man das nicht oft. Ich weiß, das ist ein Klischee, aber ich kann es nicht besser auf den Punkt bringen. Keine Ahnung, wann mir das zum ersten Mal durch den Kopf ging, aber jetzt, wo du es sagst, überrascht es mich nicht.“
„Findest du es schräg?“
„Dass du homosexuell bist oder dass du dich von deiner Frau getrennt hast?“
„Beides.“
„Dass du homosexuell bist, finde ich kein bisschen schräg. Dass du dich getrennt hast, schon. Ich weiß, das klingt widersprüchlich.“
Er drückte die Zigarette im Aschenbecher neben der Bartür aus.
„Du bist der erste Mensch, dem ich es sage. Danke.“
„Danke wofür?“
„Keine Ahnung. Ich will einfach Danke sagen. Dass du da bist, vielleicht. Dass du es bemerkt hast, dass du hier bist und mit mir redest.“
„Wann ist es dir klar geworden? Dass du homosexuell bist, meine ich.“
„Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls reichlich spät. Ich habe sogar ein Kind gezeugt. Rückblickend betrachtet, war es eigentlich schon immer klar. Aber offenbar sträubte ich mich dagegen und hatte nicht den Mumm, es mir einzugestehen.“
„Das ist oft so. Wir lügen uns in die Tasche, weil uns die Wahrheit samt allen Konsequenzen unerträglich erscheint. Dabei ist sie es fast nie.“
„Was denn?“
„Unerträglich. Wie kam es zu eurem Entschluss, euch zu trennen? Ist was vorgefallen oder hast du die Initiative ergriffen, um reinen Tisch zu machen?“
Ein tieftrauriges Lächeln erschien auf Diegos Gesicht.
„Ich wäre nie in der Lage gewesen, die Initiative zu ergreifen. Loredana ist dahintergekommen, dass ich eine Affäre hatte. Wenig später fand sie heraus, dass es ein Mann war. Daraufhin hat sie mich rausgeschmissen.“
„Bestimmt ist sie stinkwütend.“
„Sie tobt vor Wut. Wer weiß, ob sie genauso sauer wäre, wenn ich sie mit einer Frau betrogen hätte.“
„Natürlich wäre sie sauer geworden, aber diese Situation ist schon etwas anderes. Sie stellt die Weiblichkeit einer Frau infrage, ihre Selbstwahrnehmung. Das ist bestimmt hart, sie hat jedes Recht, wütend zu sein.“
„Es tut mir entsetzlich leid, ihr so wehgetan zu haben. Ich liebe sie genauso sehr wie vorher, sogar noch mehr. Aber sie hasst mich, und bestimmt wird sie mich für immer hassen.“
Er zog die Nase hoch.
„Sie sagt, sie wird bei der Sacra Rota gegen mich klagen. Allerdings verstehe ich den Unterschied zu einer normalen Scheidung nicht …“
„Juristische Feinheiten. Mit der Entscheidung der Sacra Rota wird die Ehe vollständig annulliert. Puff, als hätte es sie nie gegeben. Sie wird sich darauf berufen, dass du von Anfang an einen geheimen Vorbehalt hegtest und nicht wirklich die Absicht hattest, das Eheversprechen einzuhalten.“
„Ja, das sagte sie. Weißt du, Penny, ich habe Angst, dass sie unseren Sohn benutzt, um mich dafür bluten zu lassen.“
„Das ist nicht ausgeschlossen. Wie kommen eure Anwälte miteinander klar?“
„Gut, glaube ich. Die sind entspannt.“
„Dann sag deinem Anwalt, er soll seinem Kollegen gemeinsame Treffen mit einem Psychologen vorschlagen, im Interesse des Kindes. Sollten eure beiden Anwälte es tatsächlich gut meinen, werden sie sich vielleicht einig. Das könnte ihr zumindest helfen, ihre Wut in den Griff zu kriegen.“
„Das mache ich.“
Einen Moment lang starrte er gedankenverloren auf die Straße, dann seufzte er. „Weißt du, wovor ich mich am meisten fürchte?“
„Davor, es deinem Sohn zu sagen?“
„Genau.“
„Das kriegst du schon hin. Manchmal ist es viel schwieriger, sich etwas vorzustellen, als es tatsächlich zu tun.“
Ich war – bin – von dieser Behauptung nicht restlos überzeugt. Manche Dinge zu tun ist mindestens genauso schwierig. Doch wäre das zu viel der Ehrlichkeit gewesen; zumindest in diesem Moment.
„Zum Glück bist du vorbeigekommen. Ich wollte schon seit Tagen mit dir reden.“
„Ich bin nie da, wenn man mich braucht. Das musste ich mir schon verdammt oft anhören. Sei’s drum: Wieso hast du mich nicht angerufen?“
„Ich habe immer wieder daran gedacht, aber ich wusste nicht, was ich sagen oder wo ich anfangen sollte.“
„Der Typ, mit dem du die aufgeflogene Affäre hattest … seid ihr noch zusammen?“
„Nein. Als der ganze Ärger losging, hat er sich dünngemacht.“
„Na schön. Wenn dir das nächste Mal nach Reden ist, ruf mich an. Auch spätabends. Nur nicht in aller Herrgottsfrühe, sofern dir an unserer Freundschaft was liegt. Ich gehe wieder rein, gleich kommt eine Frau, die mich sprechen will.“
Diegos hinterer Gastraum ist praktisch mein Büro. Dorthin verirrt sich so gut wie nie jemand, selbst die Stammkunden wissen kaum, dass es ihn gibt. Wenn ich ihn brauche, schließt Diego die Tür, und bei Bedarf kann ich das Hoffenster öffnen und rauchen.
Die Frau kam zwei oder drei Minuten zu spät. Wir hatten uns um vier Uhr verabredet. Die friedlichste Stunde in den Mailänder Bars und in Bars überhaupt. Wenn man das Bedürfnis hat, allein etwas zu trinken, ohne angequatscht oder schief angeguckt zu werden, ist die Nachmittagsstunde zwischen vier und fünf die beste Zeit.
Zur Pünktlichkeit habe ich meine eigene Theorie. Stets auf die Sekunde pünktlich zu sein ist leicht zwanghaft; stets zu früh dran zu sein ist ein Zeichen von Unrast; stets zu spät zu kommen ist manipulative Ichbezogenheit. Ein paar Minuten zu spät zu kommen ist bedeutungslos. Oder lässt zumindest scheinbar auf einen ausgeglichenen Menschen schließen. Mit zwei Minuten Verspätung ist man pünktlich, aber nicht zwanghaft. Verliert man sich allerdings gedanklich, mündlich oder schriftlich in solcherlei Überlegungen, ist man garantiert zwangsgestört.
Sie klopfte, schaute zur Tür herein, und ich forderte sie zum Eintreten auf. Sie sah unscheinbar aus. Manche Leute hätten sie sicherlich hübsch genannt, doch in ihrem Blick lag etwas Verdrossenes, das mich, wäre ich ein Mann oder eine Frau gewesen, die auf Frauen steht, davon abgehalten hätte, sie attraktiv zu finden. Aber woher will ich schon wissen, auf wen ich stünde, wenn ich eine Frau wäre, die auf Frauen steht? Oder gar ein Mann? Mein Leben lang ziehe ich aus wackeligen Annahmen hypothetische Schlüsse. Nicht nur bei belanglosen Themen.
Sie trug eine teure Daunenjacke, Jeans, Rollkragenpullover. Der einzige exzentrische Touch war eine himmelblau gefärbte Haarsträhne. Ihr Händedruck war fest, aber ohne jede Wärme.
„Ich bin Marina Leonardi.“
„Wer hat Ihnen geraten, mich aufzusuchen?“
„Mein Anwalt, allerdings kennt er Sie nicht persönlich. Ein von ihm geschätzter Strafrechtskollege nannte ihm Ihren Namen. Er sagte, bei einer wirklich heiklen Angelegenheit würde er sich an Sie wenden, Sie hätten einen scheußlichen Fall mit einem kleinen Mädchen aufgeklärt, das in einen Kinderpornoring geraten war. Und Sie würden nicht lockerlassen, hätten Sie sich einmal festgebissen.“
Ich machte eine abfällige Handbewegung und fragte nicht nach, wer der Strafrechtler war. Ich war mir nicht sicher, ob ich es wissen wollte, sowieso machte mich nur die Eitelkeit neugierig. Mich in der Bewunderung eines ehemaligen Gegners aus meiner Zeit als Staatsanwältin zu sonnen war keine gute Idee. Der Genugtuung wäre unweigerlich Beklommenheit darüber gefolgt, wie ich alles vor die Wand gefahren hatte.
„Worum geht es?“
„Vor knapp zwei Jahren ist mein Vater gestorben. Ich war im Ausland; ich lebe schon seit einer ganzen Weile nicht mehr in Italien.“
Ich hob leicht den Kopf. Fast hätte ich sie gefragt, woran ihr Vater gestorben sei und wo, und aus welchem Grund sie im Ausland lebe. Aber ich hielt mich zurück, so gehört es sich nun einmal, wenn jemand eine Geschichte erzählt. Eine ebenso selbstverständliche wie selbst von erfahrenen Ermittlern ständig missachtete Regel: Man muss den Zeugen ausreden lassen und darf ihn nicht unterbrechen, bis er alles in seinen eigenen Worten dargelegt hat. Aus einem ganz praktischen und gern vergessenen Grund: Wenn der Leiter, ganz gleich welcher Art von Ermittlung (privat, gerichtlich oder gar – und vielleicht vor allem – psychologisch), sofort nachhakt, Einzelheiten wissen will, Fragen stellt, die von den Tatsachen wegführen, schadet er der Sache, so unlogisch das auch klingen mag. Statt die unverfälschte Version eines Ereignisses darzulegen, wird der Zeuge darauf „gepolt“, sich nur an das zu erinnern, was den Ermittler interessiert. So gehen wichtige Informationen unwiederbringlich verloren. Wir neigen nun einmal dazu, eine auf bestimmte Weise erzählte Geschichte immer gleich zu wiederholen, statt uns bewusst zu machen, wie sie wirklich passiert ist. Viel besser ist es also, den anderen reden zu lassen und seine Ausführungen und unsere Konzentration nicht zu unterbrechen. Hinterher bleibt noch genug Zeit, um Einzelheiten zu klären und Vermutungen anzustellen. Das Problem ist, dass wir uns schwertun, aktiv zuzuhören und das Gehörte unkommentiert auf uns wirken zu lassen. Das hat wohl mit Unsicherheit und mit unserem Ego zu tun. Mehr als die Version unseres Gegenübers interessieren uns die Antworten auf unsere Fragen. Deshalb sind selbst erfahrene Ermittler gegen diesen Fehler nicht gefeit. Ich gehöre natürlich auch zu denen, die diese Regel kennen und zuweilen missachten.
Richtig, ich bin abgeschweift.
Jedenfalls beschränkte ich mich auf ein Nicken, und Marina fuhr fort.
„Es ist gar nicht so leicht, die Dinge der Reihe nach zu erzählen. Eines Morgens kam die Haushälterin in die Wohnung und fand meinen Vater tot im Bett. Er war angezogen. Ohne Schuhe, aber ansonsten angezogen.“
„Lebte er allein?“
„Genau das ist der Punkt. Nach der Scheidung von meiner Mutter heiratete mein Vater eine sehr viel jüngere Frau; sie ist sogar zwei Jahre jünger als ich. Die Beziehung mit meiner Mutter war nicht zuletzt wegen seiner ständigen Seitensprünge in die Brüche gegangen: Er war ein notorischer Fremdgänger.“
„Und wo war seine Frau, als Ihr Vater starb?“
„Nicht in Mailand.“
Ich ließ den Satz so stehen. Ihre Art zu reden hatte etwas Seltsames, wie schwankend zwischen einer zurechtgelegten Geschichte und einer Dringlichkeit und Erregung, die ihren Erzählfaden durcheinanderbrachte. Welches Gefühl sich hinter dieser Erregung verbarg, war nicht ganz klar: Zweifellos steckte Wut darin, eine Prise Verachtung, vielleicht sogar Hass. Fragte sich nur, gegen wen.
„Am Morgen vor seiner Auffindung“, fuhr sie fort, „war sie in ein Wellnesscenter in die Toskana gefahren.“
„Messen Sie dieser Tatsache irgendeine besondere Bedeutung bei?“
„Ja. Ich erkläre es Ihnen. Zunächst sei gesagt, dass ich seit einiger Zeit kein gutes Verhältnis zu meinem Vater hatte, aus zahlreichen Gründen. Das lag vor allem daran, wie und weshalb die Ehe mit meiner Mutter in die Brüche gegangen war. Und dass er danach eine so viel jüngere Frau geheiratet hat, erschien mir … Sie sollen nicht den Eindruck bekommen, ich würde das verurteilen, aber …“
Genau den Eindruck bekam ich. Ich schüttelte unmerklich den Kopf und zuckte die Schultern. Eine Geste, die alles bedeuten konnte.
„Jedenfalls“, redete sie weiter, „kam es mir so … so offensichtlich falsch vor. Mein Vater hatte seit jeher einen Schlag bei Frauen und wusste das auszunutzen. Er zog immer am richtigen Hebel: Geld, Macht, persönlicher Charme. Wenn es der Sache diente, setzte er auch auf Verletzlichkeit. Er wurde von vielen geliebt und war ein geschickter Verführer, aber finden Sie nicht, dass eine Ehe mit dreiunddreißig Jahren Altersunterschied irgendwie schräg ist?“
Das war eine dieser Fangfragen, die ich nicht leiden kann. Meine natürliche Antwort würde lauten: Ja, das ist irgendwie schräg. Das signalisiert einem der gesunde Menschenverstand, und häufig hat der gesunde Menschenverstand recht. Doch mein natürlicher Impuls – der manchmal richtig- und häufig falschliegt – drängt mich, das Gegenteil zu behaupten. Aus Prinzip, weil ich nun einmal so bin: Das Gegenteil zu sagen ist mein natürlicher Impuls. Seit einiger Zeit versuche ich diese Eigenschaft in den Griff zu kriegen. Mit wenig Erfolg.
„Sie sprachen von Macht. Sie haben mir noch nicht gesagt, was Ihr Vater beruflich tat.“
„Er war Chirurg und Hochschulprofessor. Vor Jahren war er eine Legislaturperiode lang auch Abgeordneter. Womöglich haben Sie schon von ihm gehört, in Mailand war er eine recht bekannte Persönlichkeit. Nicht nur in Mailand.“
Als sie sich vorgestellt hatte, hatte die Frau ihren Vor- und Nachnamen genannt. Den Vornamen hatte ich mir gemerkt, den Nachnamen mal wieder nicht.
„Verzeihung, sagen Sie mir noch einmal Ihren Nachnamen?“
„Leonardi. Mein Vater war Professor Vittorio Leonardi.“
Der Name hallte durch meinen Kopf wie ein Glockenschlag. Wie ein Metronom, das Zeit und Schicksal skandiert (ist das nicht fast das Gleiche?). Warum hatte ich beim Hören ihres Nachnamens nicht sofort an ihn gedacht? Und war die Tochter rein zufällig hier, oder steckte hinter unserem Treffen irgendein vertrackter Zusammenhang? War es Zufall oder Schicksal (ist das nicht fast das Gleiche?)?
Fünf Jahre zuvor
Es war Frühling, welcher Monat genau, könnte ich nicht mehr sagen. April vielleicht: An manche Dinge erinnere ich mich deutlich, an andere nur verschwommen.
Ich kam gegen neun Uhr ins Büro und wurde wie üblich von meinem Büromitarbeiter Maresciallo Portincasa erwartet. Er hatte die Angewohnheit, die neuen Zuweisungen zu überfliegen, um mich auf die dringenden oder wichtigen oder auf solche hinzuweisen, die aus irgendeinem anderen Grund einen sofortigen Blick wert waren.
An jenem Morgen gab es nichts Besonderes, bis auf eine eigenartige Eingabe 45. Im Staatsanwaltsjargon steht Eingabe 45 für das Nachrichtenregister über „nicht strafbare Handlungen“. Theoretisch wandern diese Akten nach einer raschen Durchsicht unverzüglich und ohne Ermittlungen ins Archiv. Praktisch laufen die Dinge anders. Die Eingabe 45 ist ein riesiger Kessel, in den alles hineingeworfen wird: von absurden Anzeigen wie „jemand hat den Trevi-Brunnen geklaut“ bis zu Meldungen ernster Verdachtsfälle, die mitunter wichtige Ermittlungen nach sich ziehen.
„Schauen Sie sich das hier mal an, sobald Sie eine Minute haben, Dottoressa. Wenn der Verfasser der Anzeige kein mythomanischer Irrer ist, könnte die Sache interessant sein“, sagte Portincasa.
Ich unterschrieb ein paar Akten, ging zu einer Vorverhandlung, um einen krankgemeldeten Kollegen zu vertreten, setzte mich gegen Mittag an den Schreibtisch und begann zu lesen.
Ich bin mir nicht sicher, ob Sie diese Anzeige ernst nehmen werden. Dennoch sah ich es als meine Pflicht, sie zu schreiben, denn es gehen haarsträubende Dinge vor sich, ohne dass es jemanden schert. In Mailand existiert eine sich quer durch alle Parteien (oder durch das, was von ihnen übrig ist) ziehende Machtgruppe mit Verästelungen in ganz Italien. Erinnern Sie sich an das bis 1992 bestehende System, das von der Antikorruptions-Operation Mani pulite hinweggefegt wurde? Das hier ist genauso, wenn nicht gar schlimmer. Stellen Sie sich eine Fusion des bis 1992 agierenden Systems mit einer Art hochentwickelter, gefährlicher Freimaurerloge vor. An dieser Stelle sei gesagt, dass ich, wenn ich von Freimaurerloge spreche, eine sogenannte „irreguläre Loge“ meine. Um zu verstehen, worum es sich handelt, reicht eine einfache Google-Suche. In Italien gibt es neben den drei offiziellen und gut zu kontrollierenden Freimaurerlogen mindestens zweihundert irregu läre, die sich jeder Kontrolle entziehen. Die hier erwähnte ist so eine: eine gleichsam durch natürliche Auslese geschaffene neue Raubtierart, nachdem ihre Vorgänger durch gerichtliche Schritte ausgerottet wurden.
Ihr Staatsanwälte seid zu einem Schlag gegen dieses neue Phänomen nicht in der Lage, nicht aus mangelndem Willen, sondern weil ihr blind dafür seid. Es hat sich ähnlich entwickelt wie die Mafia. Nach den blutigen Anschlägen der Neunzigerjahre erfolgten etliche Festnahmen, Prozesse und Verurteilungen. Zumindest in ihrer militärischen und mörderischen Ausprägung schien die Mafia auf dem Rückzug zu sein.
1991 gab es in Italien fast zweitausend Morde. In den letzten Jahren etwas über dreihundert. Ein eklatanter Unterschied.
Der Großteil der in den Neunzigern verübten Morde waren Mafia morde. Heute tötet die Mafia kaum noch. Aber bedeutet das, dass sie verschwunden ist?
Natürlich nicht. Ich will die Effizienz der erfolgten Gegenschläge und deren Bedeutung nicht abstreiten: Zahlreiche Mörder undganze Killerclans wurden festgenommen, vor Gericht gestellt und verurteilt. Fraglos ist die Mordrate auch deshalb gesunken.
Doch der springende Punkt ist ein anderer: Die Mafia und kriminelle Phänomene überhaupt sind wie Viren oder Krankheitserreger. Sie mutieren, um überlebensfähig zu bleiben. Tatsächlich ist der Mafiavirus in unserem Land mutiert. Er mordet (fast) nicht mehr, doch macht er auf andere, stillere, unsichtbare Art krank. Um ihn zu sehen, braucht man ein Mikroskop. Verzeihen Sie meine Angewohnheit, mich der Metaphern zu bedienen, doch geht es mir darum, dass Sie hochentwickelte Instrumente brauchen, um Verbrechen zu erkennen, von denen Sie nicht die leiseste Ahnung haben.
Das Gleiche gilt in besonderem Maße für Wirtschaftskriminalität (die mit der Mafia übrigens häufig Hand in Hand geht). Die Herren mit den weißen Kragen haben sich angepasst und wissen das Geflecht aus Verwaltung, Politik und öffentlicher Macht sehr viel geschickter und unbemerkter zu durchdringen. Womöglich liegt in dieser Fähigkeit der Unterwanderung, die auch die Staatsanwaltschaft mit einschließt, ein Teil des Problems.
Unter Mailands funkelnder Oberfläche einer europäischen Metropole schwelt heute wie damals einer der gefährlichsten Ansteckungsherde. Mehr noch als früher ist es heute an euch Staatsanwälten, sich auf die Suche nach den Straftaten des von solchen neuen kriminellen Kräften gelenkten Systems zu machen. Tun Sie es nicht, verdammen Sie sich – sofern es nicht bereits geschehen ist – zu vollkommener Bedeutungslosigkeit.
Allerdings muss man wissen, wo man suchen soll, und (verzeihen Sie die lange Vorrede) genau dabei möchte ich Ihnen helfen.
In dem Haus, in dem ich wohne (Sie werden sehen, ein ganz normales, unverdächtiges Wohnhaus), versammelt sich fast jede Woche eine Gruppe von Herren, die, wie es sich für wirklich mächtige Männer gehört, kaum jemand kennt. Es sind Politiker, Unternehmer, Finanzleute, hohe Beamte, bedeutende Uniprofessoren undeben auch Staatsanwälte. Sie treffen sich in den Räumlichkeiten eines scheinbar harmlosen und geradezu manieriert altmodischen Vereins: dem ausschließlich Männern vorbehaltenen Klub der Freunde der Zigarre. Anliegen des Klubs – so entnehme ich der Satzung – ist die Pflege des langsamen Rauchgenusses. Es mag durchaus Mitglieder geben, die tatsächlich dort sind, um ihrer arglosen Leidenschaft zu frönen, doch die Vereinsräumlichkeiten im dritten Stock dienen vor allem weniger harmlosen Zwecken. Die „speziellen“ Treffen finden jeden Dienstag um neunzehn Uhr statt, wenn der Ort für normale Mitglieder geschlossen ist.
Die Adresse entspricht, wie gesagt, meiner Wohnadresse; Sie finden sie neben meiner Unterschrift unter dieser Meldung.
Während dieser Versammlungen wird über den Ausgang von Bewerbungsverfahren für Dozenturen, Berufungen von Staatsanwälten in leitende Positionen, öffentliche Ausschreibungen, Finanzierungen und sogar über den Inhalt regionaler und überregionaler Gesetze entschieden.
Hinter der vorgeblichen, harmlosen Fassade eines Raucherklubs verbirgt sich eine der eingangs erwähnten irregulären Logen.
Es wird sich leicht herausfinden lassen, wer die Herren sind, auf die ich mich beziehe. Ein Beobachtungsposten unweit des Hauseingangs wird genügen. Eine Abhöraktion dürfte sich schwieriger gestalten, sollte tatsächlich jemand an einer Ermittlung interessiert sein. Sowieso könnte dieses Schreiben in die Hände eines Sympathisanten oder gar eines Logenmitglieds geraten. Doch wenn Sie, verehrter Herr Staatsanwalt, nicht zu dieser Clique gehören, sollen Sie bedenken, dass Personen aus Ihrem unmittelbaren Umfeld in diese Sache verwickelt sein könnten. Womöglich einer Ihrer Vorgesetzten.
Sollten Sie selbst dazugehören, nun ja … Es zu versuchen empfand ich dennoch als meine moralische Pflicht.
Jedenfalls dürfte es schwer sein, an diesem Ort eine Abhöraktion durchzuführen. Ein bekanntes Unternehmen, dessen Dienste auchdie Staatsanwaltschaft häufig in Anspruch nimmt, führt jede Woche vor den Dienstagsversammlungen eine gründliche Säuberung durch.
Der Bericht setzte sich noch über mehrere Seiten fort und wiederholte im Grunde immer das Gleiche. Er war per Mail gekommen; darunter standen ein Vor- und Nachname und eine Adresse. Nicht eine Sekunde lang streifte mich der Gedanke, es könnten die Personalien des Verfassers sein. Eine klassische und scheinbar naive Methode, Ermittlungen zu einer anonymen Meldung anzustoßen, besteht darin, eine glaubhafte Unterschrift darunterzusetzen. Laut Gesetz dürfen anonyme Dokumente in keiner Weise verwendet werden. Nicht alle halten sich streng an diese Regel, häufig werden anonyme oder pro forma unterschriebene Anzeigen an die Gerichtspolizei weitergereicht, um eine sogenannte Voruntersuchung einzuleiten. Im Gesetzbuch gibt es diesen Begriff nicht, aber er ist gängige Praxis.
Das Kassationsgericht hat festgelegt, dass auf Grundlage einer anonymen Anzeige keine Durchsuchungen, Beschlagnahmungen und Telefonüberwachungen durchgeführt werden dürfen. Allerdings können der Staatsanwalt oder die Gerichtspolizei anhand der darin gemachten Angaben selbst aktiv werden und Anhaltspunkte zusammentragen, um festzustellen, ob sich aus dem anonymen Schreiben Hinweise auf eine notitia criminis ableiten lassen.
Verschraubte Formulierungen, um zu sagen: Auf Grundlage einer anonymen Anzeige darfst du qua Gesetz nicht ermitteln, aber im höheren Interesse der Justiz sei es dir gestattet.
Ich zündete mir eine Zigarette an und ließ eine Kopie des Berichts machen, um darin herumkritzeln zu können. Einige Sätze waren merkwürdig. Der Text ließ sich nicht auf Anhieb einordnen, es war schwer, sich über den Verfasser ein Bild zu machen. Manche Wendungen klangen nach einem Beamten im öffentlichen Dienst, nach einem Staatsanwalt gar. Zwischen den wohlformulierten Zeilen blitzte eine für anonyme Verfasser untypische Beschlagenheit und Kultiviertheit hindurch.
Am Ende war es vielleicht doch nur eine der zahllosen, verschwurbelten Pseudoanzeigen, die täglich in die Büros der Staatsanwaltschaft flattern. Obwohl … nun ja, für eine Schwurbelei war sie sehr klar, sehr durchdacht und sehr überzeugend.
3.
Nach dieser Erkenntnis schwieg ich ein paar Sekunden. Auch wenn es mir sehr viel länger vorkam. Marina blickte mich fragend an und ich schüttelte den Kopf, wie um das Gedankenknäuel loszuwerden, das sich darin verfangen hatte.
Sollte ich sofort klarstellen, dass ich mich in meiner Zeit als Staatsanwältin gewissermaßen mit ihrem Vater befasst hatte? Was war korrekter? Oder sollte ich sie darüber erst informieren, nachdem ich mir ihre Beweggründe, mich aufzusuchen, angehört hatte? Sollte ich sie einfach unterbrechen und sagen, ich könnte (oder wollte?) diesen Fall nicht übernehmen, ganz gleich, was dieser Fall war?
Wie so häufig entschied ich, nichts zu entscheiden: Ich würde sie ausreden lassen und basta. Das wäre wohl das Beste: Ich würde warten, bis sie geendet hatte, dann fände sich schon ein Weg, sich aus der Affäre zu ziehen. So ist es korrekter, sagte ich mir, obwohl das eine nachträgliche Rechtfertigung war. Manchmal handeln wir auf eine bestimmte Weise und erklären unser Verhalten hinterher damit, dass wir sehr gute Gründe dafür hatten. Das Problem ist, dass diese Gründe uns nicht zu unserer Handlung bewogen haben, sondern sie lediglich rechtfertigen sollen. Das passiert auch bei Gerichtsurteilen: Man trifft eine Entscheidung, weil sie sich richtig anhört (mit dem Gehör ist es allerdings so eine Sache, wenn man Leute in den Knast schickt oder sie freispricht, obwohl sie verurteilt werden müssten), und lässt sich die rationale Begründung erst hinterher einfallen. Jedenfalls wollte ich Marinas Geschichte hören und dahinterkommen, was es mit dem Glockenschlag in meinem Kopf auf sich hatte.
„Kannten Sie meinen Vater?“, fragte sie.
„Nur dem Namen nach.“ Was theoretisch der Wahrheit entsprach. Einem Teil der Wahrheit.
„Er war ein brillanter Mann fortgeschrittenen Alters, als er diesem jungen Ding begegnete. Eine ehemalige Miss irgendwas, die im Leben nichts gelernt hat. Sechs Monate später waren sie verheiratet. Die Ehe wurde quasi heimlich geschlossen, mit einer Handvoll geladener Gäste auf einem apulischen Landgut. Er war fast sechsundsechzig, sie dreiunddreißig.“
„Und Sie halten das für unpassend, wenn nicht gar unschicklich.“
„Schauen Sie, ich sehe ein, dass man mich für moralinsauer halten mag. Als Außenstehende würde ich das womöglich genauso sehen, doch wenn Sie meine persönliche Geschichte kennen würden, dächten Sie anders. Ich will versuchen, die Sache vom Standpunkt dieser Frau zu betrachten. Männer sind schlichte Wesen, es ist nicht verwunderlich, dass sich ein Herr, der auf die siebzig zusteuert, verknallt oder den Kopf für eine Frau verliert, die lediglich damit punkten kann, jung und schön zu sein. Es ist ein Versuch, die Zeit und den Verfall aufzuhalten, den Gedanken an das Ende zu verdrängen; übrigens scheint dieses Verhalten unter mächtigen Männern besonders verbreitet zu sein. Es ist schwer, einem schönen Körper zu widerstehen, der glatten Haut, den Wangenknochen am richtigen Platz … Aber die Frage ist: Aus welchem Grund sollte eine junge, schöne Frau einen so viel älteren Mann heiraten? Immer wieder habe ich zu hören bekommen, der Ehe sollte ein gemeinsamer Plan zugrunde liegen, eine Zukunftsvision. Welchen gemeinsamen Plan können zwei Menschen haben, die an so unterschiedlichen Punkten des Lebens stehen?“
Dagegen war nicht viel einzuwenden, also beschränkte ich mich auf ein Nicken.
„Ich habe viele Jahre in den Vereinigten Staaten gelebt. Ich war verheiratet und habe mich scheiden lassen. Zuletzt lebte ich in Miami und arbeitete in einer Kunstgalerie. Dort erfuhr ich vom Tod meines Vaters. Ich habe rasch noch ein paar Dinge geregelt und bin so schnell wie möglich aufgebrochen, doch aus verschiedenen Gründen brauchte es ein paar Tage. Als ich in Mailand eintraf, hatte die Beisetzung bereits stattgefunden: Der Leichnam war eingeäschert worden.“
„Wer hatte das entschieden?“
„Diese Frau. Sie sagte, mein Vater habe immer behauptet, er wolle es so.“
„Und das stimmt nicht?“
„Ich weiß es nicht. Ich habe nie mit ihm darüber gesprochen. Sowieso habe ich kaum mit ihm gesprochen, in den letzten Jahren gar nicht. Insofern hielt ich es nicht für ausgeschlossen, dass er eingeäschert werden wollte. Für mich ist die Frage eine andere.“
„Nämlich?“
„Die Eile, mit der alles vonstattenging.“
„Wieso Eile? Nach der Trauerfeier erfolgt die Einäscherung, wenn sie denn erfolgen soll, es gibt keine Wartezeit, es sei denn, das Krematorium ist überlastet.“
Sie räusperte sich, ehe sie antwortete.
„Ich bin überzeugt, dass mein Vater nicht eines natürlichen Todes gestorben ist. Ich bin überzeugt, er wurde ermordet. Und ich bin überzeugt, dass auf die eine oder andere Weise diese Frau damit zu tun hat.“
Obwohl mich der Verlauf der Unterhaltung schon damit hatte rechnen lassen, zuckte ich auf.
„Das ist ein sehr schwerer Verdacht.“
„Ich weiß. Er kam mir sofort, aber weil mir die Ungeheuerlichkeit bewusst war, behielt ich ihn für mich. Ich habe sogar versucht, den Gedanken loszuwerden. Dann sind Dinge passiert, die mir zu denken gegeben haben.“
„Zum Beispiel?“
„Ich habe eins und eins zusammengezählt. Wie heißt es in Krimis so schön? Zwei Zufälle sind ein Indiz, drei Zufälle ein Beweis?“
„Welche Zufälle meinen Sie?“





























