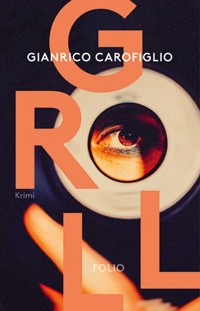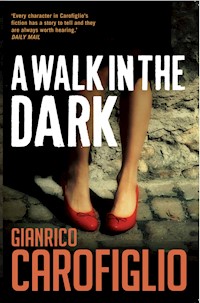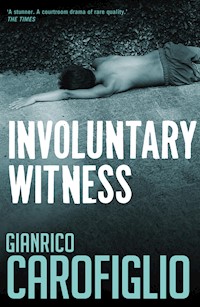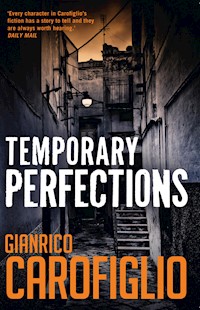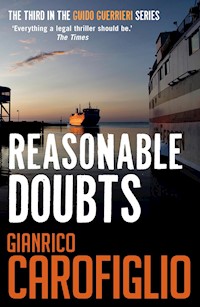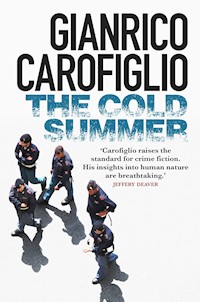Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Transfer Bibliothek
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Schlaflos in Marseille: Die bewegende Geschichte der Annäherung von Vater und Sohn. Eine Fahrt nach Marseille wird für Antonio und seinen Vater zu einer Reise in die Erinnerung und nach innen. Der verschlossene Gymnasiast muss zu einer neurologischen Untersuchung, die vorschreibt, zwei Tage und zwei Nächte ohne Schlaf zuzubringen. Sein Vater, der früh die Familie verlassen hat und zu dem er ein kühles Verhältnis hat, begleitet ihn. Erstmals erfahren die beiden eine nie gekannte Intimität: Der Vater erzählt von seiner Jugend, von der Bekanntschaft mit der Mutter des Jungen – der Sohn von seinen Hoffnungen und Ängsten. Der Aufenthalt vollzieht sich zwischen Wachzustand und Erschöpfung, er führt in anrüchige Viertel, an atemberaubende Strände, ins Herz der pulsierenden Stadt. Eine Begegnung, die zwei Menschen für immer verändert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 181
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
© Francesco Carofiglio
Gianrico Carofiglio, geboren 1961 in Bari, war viele Jahre Antimafia-Staatsanwalt in Bari, 2007 Berater des italienischen Parlaments im Bereich organisierte Kriminalität, 2008–2013 Senator. Autor zahlreicher preisgekrönter Krimis, die in 24 Sprachen übersetzt wurden.
Auf Deutsch bei Folio:
Carlotto/Carofiglio/De Cataldo: Kokain. Crime Stories (2013) und Trügerische Gewissheit (2016).
GIANRICOCAROFIGLIO
DREIUHRMORGENS
ROMAN
Aus dem Italienischen von Verena von Koskull
Anmerkung des Autors
Dieses Buch und seine Figuren (bis auf eine) sind frei erfunden.Dennoch beruht die Geschichte auf wahren Begebenheiten.Ich danke denen, die sie mir erzählt haben.
Ich bin jetzt fünfzig, genauso alt wie mein Vater damals. Deshalb dachte ich, es sei an der Zeit, über diese zwei Tage und Nächte zu schreiben.
Würde Papa noch leben, wäre er inzwischen vierundachtzig. Wie seltsam, ihn mir alt vorzustellen; es gelingt mir nicht, sosehr ich mich auch bemühe.
Mama ist jetzt einundachtzig und eine wunderschöne, rüstige alte Dame. Als sie jung war, sagten alle, sie sehe aus wie Antonella Lualdi. Dass sie alt wird, merkt man eigentlich nur daran, dass sie immer öfter Geschichten von früher erzählt. Meistens geht es um sie und meinen Vater, als sie noch jung waren.
Marianne war siebenunddreißig, und das wird sie für immer bleiben. Ich weiß nichts über sie, nicht einmal, ob sie noch lebt. Ich weiß nur, dass sie in der Rue du Refuge wohnte, im alten Panier-Viertel in Marseille.
Damals war ich noch keine achtzehn. Das sollte ich erst ein paar Wochen später werden, am 30. Juni 1983.
INHALT
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Epilog
1.
Ich weiß nicht genau, wann es anfing. Ich war vielleicht sieben, vielleicht ein wenig älter, ich erinnere mich nicht mehr. Als Kind durchschaut man nicht, was normal ist und was nicht.
Als Erwachsener eigentlich auch nicht. Doch ich schweife ab, und Abschweifungen möchte ich möglichst vermeiden.
Jedenfalls passierte mir ungefähr einmal im Monat etwas Seltsames und ziemlich Unheimliches. Völlig unvermittelt und ohne den geringsten Anlass fühlte ich mich wie weggetreten, losgelöst von allem, was mich umgab, und nahm zugleich jeden Sinnesreiz überdeutlich wahr.
Normalerweise filtern wir die Stimuli, die von außen auf uns einwirken. Wir sind von Geräuschen, Gerüchen und jeder Art von optischen Reizen umgeben. Doch sind wir dabei nicht objektiv, wir hören nicht alles, was uns ans Trommelfell schlägt, wir riechen nicht alles, was uns in die Nase steigt, wir sehen nicht alles, was auf unsere Netzhaut trifft. Das Gehirn entscheidet, welche Wahrnehmungen es in unser Bewusstsein dringen lässt und welche Informationen es speichert.
Der Rest bleibt draußen, ausgesperrt und dennoch überaus gegenwärtig. In Lauerstellung sozusagen.
Hört auf zu lesen und konzentriert euch auf die Geräusche ringsum, die euch bis vor wenigen Sekunden nicht bewusst waren. Selbst wenn ihr im stillen Kämmerlein sitzt, hört ihr ein fernes Rumoren; ein Rauschen; ein Brummen; gedämpfte Stimmen, die unverständlich, aber dennoch da sind. Ihr nehmt die Bewegungen und Regungen eures Körpers wahr: den Atem, den Herzschlag, das Gurgeln des Verdauungsapparats.
Ein nicht unbedingt angenehmes Gefühl, jedenfalls nicht für mich. Mein Gehirn hörte einfach auf, eine Auswahl zu treffen, und winkte alles durch. Damit einher ging eine vorübergehende Unfähigkeit, mit meiner Umwelt in Kontakt zu treten: Die Reizüberflutung machte das schlicht unmöglich. Minutenlang brachte ich keinen Ton heraus und saß einfach nur wie betrunken da.
Jahrelang sprach ich mit niemandem darüber. Ich dachte, so sei ich nun mal, und außerdem hätte ich gar nicht gewusst, was ich hätte sagen sollen. Mir fehlten die Worte, um dieses Phänomen zu beschreiben.
Eines Tages passierte es mir bei einem Schulfreund zu Hause. Ernesto war der Sohn eines Carabinieri-Offiziers und wohnte in einer riesigen Dienstwohnung. Wir waren im Esszimmer, hatten Karamellbonbons gegessen und spielten Subbuteo – keine Ahnung, warum ich mich an dieses Detail erinnere.
Seine Mutter saß im Sessel, ich glaube, sie strickte.
Ich wollte gerade angreifen und aus einer vielversprechenden Position aufs Tor schießen, doch ich tat es nicht. Mit ungeahnter Heftigkeit brach eine gigantische Kakofonie wie ein geröllgesättigter Sturzbach über mich herein. Ihre Wucht war so groß, dass ich für einen kurzen Moment das Bewusstsein verlor.
Ich wachte in dem Sessel wieder auf, in dem zuvor Ernestos Mutter gesessen hatte. Sie beugte sich über mich, streichelte mein Gesicht und redete besorgt auf mich ein.
„Antonio, Antonio, wie geht es dir?“
„Gut“, erwiderte ich zögerlich.
„Was war mit dir los?“
„Was war denn mit mir los?“
„Du hast keinen Ton gesagt, als würdest du nichts mitbekommen. Dann bist du ohnmächtig geworden.“
Die Geräusche waren verschwunden, doch ich war noch ganz benommen und brachte kein Wort heraus. Also rief Ernestos Mutter meine Mutter an und erzählte ihr, was vorgefallen war. Als ich wieder zu Hause war, wurde ich einer erneuten Befragung unterzogen.
„Was war mit dir los, Antonio?“
„Ich weiß nicht. Also eigentlich nichts.“
„Ernestos Mutter sagt, sie hätten mit dir geredet und du hättest nicht geantwortet, als wärst du weggetreten oder eingeschlafen.“
„Das passiert mir manchmal …“
„Wie, das passiert dir manchmal?“
Ich versuchte zu beschreiben, was von Zeit zu Zeit mit mir vor sich ging und an diesem Nachmittag besonders heftig aufgetreten war.
Das Gefühl, dass jemand in meiner Brust Trommel spielte. Mein Atem, den ich so überdeutlich wahrnahm, dass ich glaubte, wenn ich nur einen Moment nicht aufpasste und aufhörte, ans Atmen zu denken, müsste ich ersticken.
Die banalsten Geräusche, die in wirres Getöse umschlugen.
Und dann war da noch etwas, das mir recht häufig passierte: der Eindruck, den gerade gelebten Moment schon einmal erlebt zu haben. Bald darauf erklärte man mir, das nenne sich Déjà-vu und sei relativ normal. Doch damals wusste ich das noch nicht, und manchmal war mir, als lebte ich in einer Geisterwelt.
Meine Mutter rief meinen Vater an, und eine halbe Stunde später war er da. Offenbar war die Sache ernst, vielleicht hatte ich die Symptome unterschätzt. Meine Eltern hatten sich getrennt, als ich neun Jahre alt war, und seitdem hatte Papa Mamas Wohnung – die bis dahin auch seine gewesen war – nur noch sporadisch und niemals abends betreten. Wenn ich zu ihm ging, holte er mich ab, und ich lief die Treppe hinunter, stieg ins Auto und wir fuhren los.
Er stellte mir die gleichen Fragen, auf die ich ihm vermutlich die gleichen Antworten gab. Daraufhin riefen sie unseren Hausarzt Doktor Placidi an. Er war ein netter älterer Herr mit einem großen weißen Schnauzer, geplatzten Äderchen auf der Nase und einem süßlichen Atem, dessen Ursprung mir erst viele Jahre später klar werden sollte. Wer weiß, ob meine Eltern sich der Tatsache bewusst waren, dass unser geschätzter Doktor dem Alkohol nicht abhold war.
Er kam, untersuchte mich und stellte mir eine Menge Fragen. Ob ich Krämpfe hätte? Er erklärte mir, was das sei, und ich sagte, nein, so etwas hätte ich nie gehabt. Ob ich bunte Halluzinationen und totale Blackouts hätte? Nein, auch das nicht.
Da waren nur diese übersteigerten Sinneswahrnehmungen, während derer ich jedoch vollkommen gegenwärtig blieb und – wenn auch mit Mühe – wusste, wo ich war.
An jenem Nachmittag bei Ernesto war die Sache zwar besonders heftig ausgefallen, doch im Grunde fühlte es sich genauso an, wie wenn ich in der Schule abdriftete, den Lehrern nicht mehr zuhörte und mich in meinen Tagträumen verlor.
„Bist du in der Schule manchmal abgelenkt?“, fragte der Arzt.
„Hin und wieder.“
„Als würdest du nicht mitbekommen, was die Lehrer sagen?“
Ich blickte verstohlen zu meiner Mutter und zu meinem Vater hinüber. Ich war mir unsicher, ob ich sie in diese Dinge einweihen musste, beschloss dann aber, aufrichtig zu sein, und nickte. Der Arzt lächelte zustimmend, als hätte ich die richtige Antwort gegeben. Sein Atem roch ein wenig stärker als sonst.
Er ließ mich ein paar seltsame Übungen machen. Ich musste auf einem Bein balancieren; die Augen schließen und meine Nasenspitze berühren, zuerst mit dem rechten, dann mit dem linken Zeigefinger; seinen Daumen in die Hand nehmen und kräftig zudrücken.
„Nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste“, sagte er schließlich zu meinem Vater. „Eine ganz normale neurovegetative Störung, gerade bei besonders sensiblen Kindern kommt das mitunter vor. In der Jugend verwächst sich das.“
Dann wandte er sich an mich und sagte: „Dein Gehirn hat eine hohe elektrische Aktivität, das ist ein Zeichen für Intelligenz.“
Mal ehrlich: Die Diagnose war ziemlich schwammig. Neurovegetative Störung heißt alles und nichts. Als würde man mit Kopfschmerzen zum Arzt gehen und nach der Untersuchung zu hören bekommen, dass man Kopfschmerzen hat.
Doch weil Doktor Placidi ein beruhigendes Auftreten und – von seinem Atem abgesehen – eine beruhigende Art zu sprechen hatte, beruhigten sich meine Eltern. Das Leben ging weiter wie bisher und der nachmittägliche Zwischenfall war schon bald vergessen.
2.
Die Jahre vergingen relativ normal.
Trotz der recht vagen Diagnose erwies sich die Voraussage des Arztes als zutreffend.
Inzwischen trat das Phänomen höchstens einmal im Monat auf und die Symptome wurden allmählich schwächer und diffuser. Das Einzige, was mich weiterhin beunruhigte, war dieses Déjà-vu mit seiner leicht übernatürlichen Aura.
Doch es waren nur winzige Augenblicke, und so legte ich die ganze Sache ad acta, wie wenn man die Schränke und Regale seines Kinderzimmers ausmistet und die großkarierten Hefte, die ersten Schulbücher, die Grundschulkittel mit der Schleife, die Schachteln voller Spielzeugsoldaten, Plastiktierchen und Matchboxautos für immer einmottet.
Ich besuchte die neunte Klasse und war eben von der Schule nach Hause gekommen. Auch meine Mutter war gerade von der Uni zurück; sie machte Mittagessen oder war am Telefon. Ich weiß es nicht mehr.
Ich saß in meinem Zimmer im Schaukelstuhl und las ein Tex-Heftchen.
Plötzlich fingen die Fenster an zu vibrieren – wohl wegen des Windes – und das Geräusch war so laut, dass ich unwillkürlich an ein Erdbeben dachte. Vorsichtig stand ich auf und wurde von einer Geräuschlawine überrollt: der Fernseher im Nebenzimmer, ein Moped auf der Straße, das flatternde Herz in meiner Brust, mein röchelnder Atem wie in manchen Unterwasser-Dokus oder Thrillern; sogar meine wenigen wackeligen Schritte über den Fußboden.
Ich hatte eine himmelblaue Tagesdecke. Plötzlich nahm ihre zarte, beruhigende Farbe etwas geradezu Bedrohliches an, sie wurde lebendig, sprang wie eine psychedelische Wesenheit auf mich zu und durchdrang mich mit transzendenter Wucht. Gleich darauf ging von der Bettdecke ein Lichtbündel aus, eine Art Regenbogen, hellblau, dunkelblau, gelb und noch andere Farben, wurde grellweiß und verwandelte sich in leuchtende Streifen, die sich kreuzten, vereinten, teilten, vermehrten und nach und nach mein gesamtes Gesichtsfeld einnahmen.
Der Lärm wurde ohrenbetäubend. Ich presste mir die Hände auf die Ohren und versuchte um Hilfe zu rufen. Ich weiß nicht, ob es mir gelang: Es ist das Letzte, an das ich mich erinnere.
Viele Jahre später erzählte mir meine Mutter, sie habe mich von Krämpfen geschüttelt, mit verdrehten Augen und bewusstlos auf dem Fußboden gefunden.
In meinem persönlichen Film ist die Szene nach der Aufblende ein POV-Shot von einem Krankenhausbett: ein Zimmer mit dosenmilchfarbenen Möbeln.
Da waren Leute um mich herum, doch niemand sah mich an. Da waren meine Mutter, mein Vater und Männer in weißen Kitteln. Sie unterhielten sich leise. Dann bemerkte jemand, dass ich aufgewacht war.
Meine Eltern traten zu mir.
„Antonio, wie fühlst du dich?“, fragte meine Mutter, nahm meine Hand und streichelte mir über die Stirn. Eine ungewohnte Geste, die mich aus irgendeinem Grund zum Weinen brachte.
„Was ist passiert?“, fragte ich nach langen Sekunden.
„Du … du hattest einen Schwächeanfall, einen heftigen Schwindel …“ Sie klang seltsam. Sonst redete sie immer geradeheraus und in ganzen Sätzen, als würde sie aus einem guten Drehbuch ablesen. Diesmal nicht.
„Du hattest einen Schwächeanfall“, bestätigte mein Vater, „aber du musst dir keine Sorgen machen, jetzt sind wir im Krankenhaus. Sobald die Ärzte mit ihren Untersuchungen fertig sind, bringen wir dich wieder nach Hause.“
Selbst in meinem benommenen Zustand – das lag am Valium – war mir sonnenklar, dass die beschwichtigenden Worte und der Gesichtsausdruck meines Vaters nicht zusammenpassten. Er sah aus wie ein kleiner Junge, dem man soeben eröffnet hatte, wie lebensgefährlich es tatsächlich in der Welt zuging.
Einer der Weißkittel trat neben ihn. Er hatte dunkle Haut, einen schwarzen Bartschatten, der ihm bis über die Wangenknochen reichte, und eine niedrige Stirn. Er fragte mich, wie es mir gehe, was ich gefühlt hätte, ehe ich das Bewusstsein verlor, und noch andere Dinge, die ich nicht recht verstand.
Ich war schläfrig, als hätte ich nur kurz die Augen aufgeschlagen, um gleich wieder wegzunicken.
Auch die Erinnerung an das, was in den darauffolgenden Tagen geschah, ist ziemlich diffus.
Jedenfalls lief es nicht so, wie mein Vater versprochen hatte. Ich kam nicht sofort wieder nach Hause und musste noch über eine Woche im Krankenhaus bleiben.
In jenen Tagen löste die Zeit sich auf. Morgen, Abend und Nacht zerflossen in Dauerbenommenheit und erschöpfendem Schlaf, derweil Männer und Frauen in Weiß mich untersuchten, mir Blut abnahmen, Spritzen setzten und alle möglichen Tabletten und Tropfen verabreichten.
Hin und wieder brachten sie mich in einen Behandlungsraum voller altertümlich und ein wenig gruselig aussehender Apparate; dort klebten sie mir Elektroden an den Kopf, ließen mich Gleichgewichtsübungen machen und studierten mit gelangweilten Mienen die bedruckten Blätter, die die Maschine ausspuckte.
Dann brachten sie mich in mein Zimmer zurück, wo ich mich zurück aufs Bett fallen ließ und vor mich hin vegetierte, ohne jemals aufzustehen. Ich hatte auf nichts Lust, nicht einmal auf die Bücher oder Comics, die mir meine Eltern oder die besorgten Verwandten mitbrachten, die mich besuchten und so taten, als wäre nichts. In meinem Zimmer war noch ein weiterer Junge, der noch übler dran war als ich. Auch er lag dauernd im Bett, mit einem Tropf im Arm und vollkommen weggetreten. Nur seine Mutter kam ihn besuchen, eine vorzeitig gealterte, freudlos wirkende Frau mit dumpfem Groll in den Augen.
Ich hatte noch zwei weitere, wenn auch sehr viel schwächere Anfälle und erfuhr den Namen meiner Krankheit. Idiopathische Epilepsie. Will heißen: eine Epilepsie, deren Ursache die Ärzte nicht kennen und über die sie allenfalls mehr oder weniger schlüssige Vermutungen äußern. Vielleicht rührte meine Epilepsie von einem Geburtstrauma oder vielleicht hatte sie andere Gründe, die man vielleicht niemals herausfinden würde.
Auf der Grundlage dieser nicht sonderlich beruhigenden Hypothesen erstellten die Ärzte einen komplizierten Behandlungsplan und beschlossen, mich zu entlassen.
Das Schlimmste sollte noch kommen.
3.
In meiner Erinnerung bilden die Tage, die ich matt und antriebslos im Bett des Krankenhauses verbrachte, und die Tage, die ich matt und antriebslos im Bett zu Hause verbrachte, ein farbloses Kontinuum.
Bei meiner Entlassung hatten uns die Neurologen seitenweise Verschreibungen mitgegeben. Ich musste vier Tabletten am Tag schlucken – das Antiepileptikum, die Vitamine, das andere Antiepileptikum und ein viertes Mittel –, jede zu einer unterschiedlichen Uhrzeit; das allein reichte schon, um das Leben zu verkomplizieren.
Doch das eigentliche Problem waren nicht die Medikamente. Auf einem dieser Blätter waren Verhaltensregeln aufgeführt, die es strikt zu befolgen galt. Sie waren bunt zusammengewürfelt und – rückblickend betrachtet – ziemlich absurd.
Allzu belebte Orte und insbesondere solche „mit erhöhtem Geräuschpegel“ meiden; keine Kontaktsportarten einschließlich Fußball; früh zu Bett gehen, neun Stunden pro Nacht schlafen, auf Kaffee und sonstige Alkaloide oder anregende Stoffe verzichten, ein geregeltes Leben führen.
Außerdem sollte ich keine kohlensäurehaltigen Getränke zu mir nehmen, Mineralwasser inbegriffen.
Kohlensäurehaltige Getränke. Ihre Einnahme – so hatte der Chefarzt meinen Eltern erklärt, die bezüglich der wissenschaftlichen Stichhaltigkeit dieser abstrusen Vorschrift sogleich stutzig geworden waren – konnte irgendeine Reaktion hervorrufen, die wiederum einen weiteren epileptischen Anfall auslösen konnte.
Na bitte. Das eigentliche Problem waren diese Worte, ihr unangenehmer Klang, ihr fataler Beigeschmack.
Epileptischer Anfall. Epilepsie. Epileptiker.
Ich war Epileptiker. Ein unsagbarer Zustand, der irgendwie an Geisteskrankheit denken ließ und den man besser verheimlichte.
Was ich schon während des Krankenhausaufenthalts geahnt hatte, wurde zur Gewissheit, als ich in die Schule zurückkehrte und meine Mutter mir einen seltsam unbeholfenen Vortrag hielt.
„Morgen geht’s wieder in die Schule. Du freust dich doch, oder?“
Ich freute mich nicht besonders. Ich war antriebslos, alles in mir und um mich herum erschien mir fade. Gleichgültig zuckte ich mit den Schultern. Das machte ihr die Sache nicht leichter.
„Ich bringe dich hin“, fuhr sie fort, „dann kann ich auch das Attest abgeben, damit sie sehen, dass alles in Ordnung ist.“
Alles in Ordnung?
„Auf dem Attest steht, dass du gestürzt bist und eine Gehirnerschütterung hattest, dass du zur Untersuchung im Krankenhaus warst und dass jetzt alles wieder in Ordnung ist.“ Es war eine Feststellung, doch sie klang zögerlich, fast fragend, als äußerte sie eine Vermutung oder einen Vorschlag und bäte um meine Zustimmung.
„Wie der Arzt erklärt hat, könnte sich dein … Zustand in wenigen Jahren legen, das heißt, er legt sich bestimmt, wenn du die Medikamente nimmst und so weiter. Aber man muss ja nicht haarklein erzählen, was los war.“
Sie sah mich an, um sicherzugehen, dass ich ihr folgen konnte. Ich konnte ihr folgen. Meine Mutter hatte meinen dumpfen Verdacht in Worte gefasst: Ich hatte eine beschämende Krankheit, die man am besten verheimlichte.
„Kinder und auch Erwachsene können sehr dumm sein. Sie drücken jemandem einen Stempel auf, nur weil er ein bestimmtes Problem hatte. Wenn sie dich also fragen, weshalb du weg warst, sagst du, du bist zu Hause gestürzt und hast dir heftig den Kopf angeschlagen, und um Schäden mit Sicherheit auszuschließen, warst du im Krankenhaus, aber jetzt ist alles in Ordnung. Abgemacht?“
Die letzten Sätze hatte sie in einem Atemzug gesprochen, als müsste sie sich einer unangenehmen, peinlichen Pflicht entledigen. Meine Mutter, der Wahrheitsliebe über alles ging, hatte gerade gegen eines ihrer urinnersten Prinzipien verstoßen.
„In Ordnung“, sagte ich knapp.
Wieder sah sie mich an. Die Unterhaltung war noch nicht beendet.
„Antonio …“
„Ja?“
„Du solltest eine Weile nicht Fußball spielen, schlag nicht über die Stränge, schone dich. Der Arzt hat gesagt, diese Störung wird wahrscheinlich nicht wieder auftreten, aber man sollte Situationen vermeiden, die … das Problem wieder herbeiführen könnten. Es braucht ein bisschen Geduld, in ein paar Monaten haben wir die Kontrolluntersuchung, und ich bin mir sicher, dass du schon bald wieder tun und lassen kannst, was du willst.“
„Wie lange?“
„Das kann ich dir nicht genau sagen …“ Sie seufzte. Sie war es nicht gewohnt, nicht weiterzuwissen. Ich glaube, meine Krankheit gab ihr ein ungewohntes und unerträgliches Ohnmachtsgefühl.
„In ein paar Monaten haben wir die Kontrolluntersuchung und dann sehen wir weiter“, fuhr sie fort und machte eine Geste mit der flachen Hand, die entschlossen wirken sollte und resigniert rüberkam.
Dann zählte sie mir noch einmal die Verhaltensregeln auf.
Die Aussicht, auf das Kicken hinter der Schule und die anschließende Limonade am Kiosk im Park verzichten zu müssen, erschien mir von allen die schmachvollste.
Ich fühlte mich invalide und anders. Die Sache war schmerzlich simpel: Ich war krank und litt an einer Krankheit, die man geheim halten musste, und mein Leben würde sich verändern, genauer gesagt, verschlimmern.
„Es wird alles gut, keine Sorge“, schloss Mama und lieferte, genau wie mein Vater im Krankenhaus, ein perfektes Beispiel für kognitive Dissonanz: Ihre Worte sagten das eine, ihr Gesicht und der Ausdruck darin etwas ganz anderes.
4.
Wie zu erwarten, wurde nicht alles gut.
Ich wurde vom Sportunterricht befreit, was nicht gerade zu meiner Resozialisierung beitrug. Ich weiß nicht, ob meine Mitschüler die Geschichte von dem Sturz in der Wohnung schluckten oder ob jemand ahnte, dass meine gesundheitlichen Probleme weniger banal waren als die Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung. Jedenfalls fühlte ich mich beobachtet.
Schon möglich, dass man in solchen Situationen zu Paranoia neigt, doch ich hatte den Eindruck, die anderen Schüler, die Lehrer und sogar die Hausmeister behandelten mich mit absichtlicher, übertriebener und verletzender Zurückhaltung. Wenn ich an einem Grüppchen Klassenkameraden vorbeikam, war mir, als hörten alle plötzlich auf zu reden und wechselten mitleidige oder vielsagende Blicke.
Kurzum, ich fühlte mich nicht nur wie ein Invalide, sondern wie ein Aussätziger. Morgens schleppte ich mich auf das Drängen meiner Mutter zur Schule, doch ansonsten ging ich nicht mehr vor die Tür. Ich durfte nicht mehr Fußball spielen und hatte keine Lust, meinen Freunden irgendwas zu erklären oder sie anzulügen. Also fläzte ich die Nachmittage allein auf dem Sofa, sah fern, ohne wirklich etwas mitzukriegen, stopfte mich mit allem voll, was der Kühlschrank oder die Speisekammer hergab, und versank immer öfter in düsteren Grübeleien über eine von Vorherbestimmung, Krankheit und Tod beherrschte Welt.
Schon in der dritten Klasse war meine Leidenschaft für das Lesen entflammt. Es war mein liebster Zeitvertreib, und da unsere Wohnung mit allen möglichen Büchern vollgestopft war, einschließlich mehreren Enzyklopädien und Gesamtausgaben von Salgari, Dumas, Conan Doyle sowie einer umfangreichen Maigret-Sammlung, war ich in dieser Hinsicht durchaus verwöhnt.
Nach meinem Anfall und dem Krankenhausaufenthalt war es damit vorbei. Ich blätterte höchstens gelangweilt durch ein altes Comicheft, hingelümmelt auf demselben Sofa, auf dem ich fernsah, doch die Lust am Lesen war mir vergangen; allein bei dem Gedanken daran war mir schleierhaft, was mich daran einmal so begeistert hatte, gerade so, als hätte ich in meinem Leben kein einziges Buch aufgeschlagen.
Schwer zu sagen, ob diese Antriebslosigkeit von den Medikamenten rührte oder weil ich in meiner Krankenrolle aufging. Womöglich beides, doch fest stand, dass es mit der Zeit immer schlimmer wurde.
Unmöglich, dass meine Eltern nichts davon mitbekamen.
An einem Februartag kam mein Vater zu uns. Er und meine Mutter begrüßten sich mit der gewohnten Liebenswürdigkeit, die mir heftig gegen den Strich ging. Es war mir schleierhaft, wieso Mama, die meines Wissens verlassen worden war, keinen gesunden, handfesten Groll gegen ihn hegte.
„Nächsten Montag fahren wir nach Marseille“, sagte Papa unvermittelt. Meine Mutter schwieg, offenbar war sie bereits im Bilde.
„Wohin?“, fragte ich.
„Nach Marseille, Frankreich.“
„Und was machen wir da?“