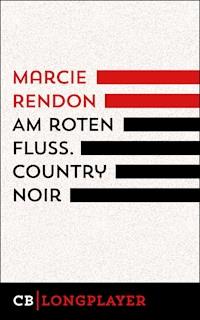
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie ist neunzehn und in der Gegend um Fargo bekannt wie ein bunter Hund: Cash, eine trinkfeste indianische Landarbeiterin, die ihren Feierabend meist am Pooltisch verbringt. Eines Morgens liegt ein Toter im Stoppelfeld. Indianer wie Cash. Landarbeiter. Keine Papiere. Cash macht sich auf zur Red Lake-Reservation und sucht nach der Familie des Toten. Doch ihre Einmischung ist nicht allen willkommen … Marcie Rendons Roman spielt 1970 am Grenzfluss zwischen Norddakota und Minnesota, tief im amerikanischen Weizengürtel. Das Porträt der ländlichen USA aus Sicht einer einzelgängerischen jungen Indianerin ist historisch gesättigt, so lakonisch wie illusionslos, mit einem leisen, rebellischen Humor. »Cash, aufgewachsen bei einer endlosen Reihe von Pflegefamilien, ist kratzbürstig, empfindlich, klug, eine Landarbeiterin und Pool-Zockerin. Die coole 19-jährige Cash bringt Rendons um Fargo angesiedelten Krimi zum Leuchten.« Publishers Weekly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2017
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Titel der amerikanischen Originalausgabe
bei Cinco Puntos Press, El Paso:
Murder on the Red River
© 2017 by Marcie R. Rendon
Printausgabe: © Argument Verlag 2017
Covergestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: November 2017
ISBN 978-3-95988-099-2
Über das Buch
Sie ist neunzehn und in der Gegend um Fargo bekannt wie ein bunter Hund: Cash, eine trinkfeste indianische Landarbeiterin, die ihren Feierabend meist am Pooltisch verbringt. Eines Morgens liegt ein Toter im Stoppelfeld. Indianer wie Cash. Landarbeiter. Keine Papiere. Cash macht sich auf zur Red Lake-Reservation und sucht nach der Familie des Toten. Doch ihre Einmischung ist nicht allen willkommen …
Marcie Rendons Roman spielt 1970 am Grenzfluss zwischen Norddakota und Minnesota, tief im amerikanischen Weizengürtel. Das Porträt der ländlichen USA aus Sicht einer einzelgängerischen jungen Indianerin ist historisch gesättigt, so lakonisch wie illusionslos, mit einem leisen, rebellischen Humor.
»Cash, aufgewachsen bei einer endlosen Reihe von Pflegefamilien, ist kratzbürstig, empfindlich, klug, eine Landarbeiterin und Pool-Zockerin. Die coole 19-jährige Cash bringt Rendons um Fargo angesiedelten Krimi zum Leuchten.« Publishers Weekly
Über die Autorin
Marcie Rendon, Stammesangehörige der Anishinabe White Earth Nation, ist Dichterin, Stückeschreiberin und Performancekünstlerin, engagiert sich als kulturpolitische Aktivistin, kuratiert indigene Künstler/innenförderung, schreibt Sach- und Geschichtsbücher für Kinder, hält Schreibkurse in Gefängnissen ab und unterstützt indianische und mexikanische Nachwuchskunst. Vier ihrer Theaterstücke sind veröffentlicht, und sie ist der kreative Kopf hinter Raving Native Theater, Raving Native Cabaret und Raving Native Radio. Am roten Fluss
Marcie Rendon
Am roten Fluss
Deutsch von Laudan & Szelinski
gigawabamin, Jim –
also bis nächstes Mal,
nächstes Mal
und übernächstes Mal.
Vorbemerkung von Else Laudan
Wenn gute Kriminal- und Noir-Romane, wie ich gern behaupte, Fenster zur Welt sind, dann ist die Geschichte von Cash vielleicht die Fensteröffnung einer Blockhütte, durch die der Blick in die Vergangenheit fällt, auf die fruchtbare Ebene am Red River im Jahr 1970.
Countryballade. In eigentümlich entschleunigtem Erzählrhythmus führt Marcie Rendon in den täglichen Trott der Farmer/innen, der Wander- und Landarbeiter, wie sie ihrem Tagwerk nachgehen in diesem Spätsommer des Jahres 1970, während der Weizenpreis noch bodenständig ist, Nixon fest im Sessel sitzt, in Vietnam Tausende sterben und Charley Pride die Countrycharts anführt.
Erntezeit im Valley. Erdklumpen unter Stiefelsohlen sagen, was wichtig ist, Kaffee kochen oder ein Bad nehmen. Doch es gibt noch anderes Volk, mit eigener Bindung ans Land und Wurzeln, die weiter zurückreichen. Und Cash, zwischen den Welten, kurze Lunte im Umgang mit Bigotterie, eine kantige, wehrhafte Jugendliche, mittendrin und doch auch außerhalb, sucht sich ihren eigenen Weg.
Marcie Rendon, die Dichterin, erzählt von einem Mikrokosmos mit wenig Stimulanzien, der überschaubar, fast hermetisch daherkommt und doch alles enthält, Geschichte, Streben und Dominanz, Konflikt und Verdrängung, Macht und Ohnmacht. Ich hoffe sehr, dass ihrem ersten Roman noch viele folgen.
Fargo, Norddakota-Ufer des Red River
Sonnensattes Weizenland. Der Refrain spielte in Cashs Kopf, als sie die Fliegentür des Casbah aufzog. Sie blieb reglos stehen. Kurzfristig blind, wartete sie, bis ihre Augen sich an den dunklen Schankraum angepasst hatten. Draußen lehnte sich die Sonne auf den westlichen Horizont. Im Casbah herrschte immer Nacht. Hinter ihr schlug dumpf die hölzerne Fliegentür in den Rahmen. Die Kneipengerüche – schales Bier, Zigarettenrauch, Sägemehl und Billardkreide – hießen sie in ihrem Feierabend-Zuhause willkommen.
Sonnensattes Weizenland, warm strahlt gottes Gunst herab, heilt mein Herz so sanft. Cash mochte das Wort Gott nicht. Schrieb es deshalb innerlich in Kleinbuchstaben. Was hatte er je für sie getan? Aber: Sonnensattes Weizenland, warm strahlt die Gunst der Sonne herab… nee, das war es nicht, hatte keinen Klang. Warm strahlt gottes Gunst herab – ja, das ging.
Ihr Geist komponierte immerzu Songs oder Geschichten. Die langen Arbeitstage auf dem Feld ließen ihr reichlich Zeit, sich auszudenken, worüber sie schreiben könnte. Ob sie je dazu kam, die Zeilen zu Papier zu bringen, stand auf einem anderen Blatt. Von Wörtern im Kopf ließ sich keine Miete zahlen. Und kein Bier. Vielleicht kaufte sie sich vom nächsten Lohn eine Gitarre. Dann konnte sie in der Fahrerkabine des Lasters drauflossingen, ohne erst alles aufschreiben zu müssen. Mal sehen.
Ole Johnson kauerte auf einem Barhocker an dem ellenlangen Mahagonitresen. Über seinem Kopf tanzte der Bär von Hamms Bier auf kühl sprudelnden Wassern. Ole schob seinem Bruder Carl, der rechts neben ihm saß, fünfzig Cent rüber. Die beiden hatten eine allabendliche Wette laufen: Würden Cashs Haare, die ihr bis über den Arsch reichten, in der zuklappenden Fliegentür hängen bleiben oder nicht? Wenn ihr das passierte, gab sie der Tür mit dem rechten Fuß einen Tritt und zerrte die Mähne hinter sich her ins Innere der Bar.
Heute entging ihr Haar der Falle.
Wie an jedem Abend, seit sie vor einem Jahr erstmals das Casbah betreten hatte, legte sie ein paar Vierteldollarstücke auf den Billardtisch, ehe sie zum Tresen ging, um zwei Budweiser zu ordern.
Ohne dass ein Wort fiel, öffnete Shorty Nelson, Barmann des Casbah, eine Flasche Bud und ließ sie über die Holztheke auf sie zuschliddern. Sie rollte sich die kühle schwitzende Flasche über die Stirn. Der Schock drang durch die Haut bis tief in den Schädelknochen. Es erinnerte Cash an den Kältekopfschmerz, den sie als Kind manchmal von Eiscreme gekriegt hatte.
Sie trank einen großen Schluck und spürte das kühle Lindern in ihrer ausgedörrten Kehle, ehe es schäumend in ihrem leeren Magen auftraf. Ah. Sie ergriff die zweite Flasche, drückte sie ans linke Schlüsselbein und schlenderte zu einer leeren Sitznische bei den Pooltischen, ihre Queuetasche über der Schulter. Es war ein ledernes Futteral, das sie vor einigen Sommern gefertigt hatte, während sie in der Kabine eines Rübenlasters auf dem Gelände von Crystal Sugar aufs Abladen wartete. Die Lederfransen schwangen bei jedem ihrer Schritte.
Ihr Baumwollhemd roch nach Weizen. Sie hatte sich umgezogen, ehe sie ins Casbah ging, aber selbst ihr Ranchero Pickup-Truck, der den ganzen Tag bloß am Feldrand herumstand, dünstete Weizen aus. Ihre ganze Welt bestand aus Weizen, Spreu und Stoppeln, aus dem Dröhnen der Mähdrescher und den Ford-Lastwagen, deren Kupplungspedale ihre kurzen Gliedmaßen hart auf die Probe stellten. Manchmal, wenn sie Glück hatte, gab es im Laster ein Radio, sodass sie Countrymusik dudeln lassen konnte.
Heiliger Strohsack, da lag Old Willie schon wieder bewusstlos in einer der Sitznischen. Noch in Arbeitsklamotten. Sein stoppeliger deutscher Schnauzbart, so stümperhaft gestutzt wie die halb ergrauten Ponyfransen über seiner Stirn, hing kraftlos über schlaffen Lippen. Cash unterdrückte ein leichtes Schaudern. Nach der Hamms Bier-Uhr hinterm Tresen war es fünf nach halb zehn. Willie musste früh Feierabend gemacht haben. Falls er überhaupt noch aufs Feld ging. Cash hatte eher den Eindruck, dass sein Sohn inzwischen die ganze Landarbeit übernahm. Oller Suffkopp. Unwillkürlich prüfte sie mit einem kurzen Blick, ob seine Hose vorne noch trocken war. Doch, ja. Noch ein unterdrücktes Schaudern. Armer alter Mann. Wann immer sie ins Casbah kam, also an so ziemlich jedem verdammten Abend, hatte Old Willie schon gewaltig getankt.
Sie lehnte sich an eine halbhohe Wand und schaute zu, wie ein paar Farmerjungs am Pooltisch einen auf Großstadtzocker machten. Sie hatten noch vier Vierteldollarstücke liegen. Cash war noch nie aus dem Red River Valley herausgekommen, aber sie wusste, die zwei hier hatten keinen blassen Dunst. Es waren mal zwei Kerle auf Urlaub hier gewesen, von der Arbeit auf den Montana-Ranches. Sie trugen dicke Silbergürtelschnallen und dazu passende Stetsons, neben denen die Schnabelmützen der Farmer recht beschränkt wirkten. All die blonden Farmermädchen waren ganz aus dem Häuschen in der Woche, die diese Jungs in Fargo blieben. Die beiden, die hatten sich aufs Zocken verstanden. Und noch ein anderer Kerl, ein Kriegsheimkehrer von der Front in ’Nam, der hatte richtig Ahnung vom Billard gehabt. Aber an den meisten Abenden war Cashs einzige Herausforderung das Glück von Anfängern oder Besoffenen.
»Bist du dabei, Cash?«, fragte einer der Farmerjungs. Sie nickte, nahm einen schnellen Zug von ihrer Zigarette und einen großen Schluck Bier.
Für die nächsten zwei Stunden hörte man außer dem Hintergrund aus halblauten Farmergesprächen an der Bar und gelegentlichem Konservengelächter aus dem Fernseher hinterm Tresen nur das Klacken der Billardkugeln sowie das Poltern, wenn eine versenkt wurde und zur Sammelstelle rollte, wo sie mit einem Klonk auf die schon dort liegenden Kugeln traf.
Cash hielt den Tisch und trank die ganze Zeit umsonst. Sie verlor erst, als Jim Jenson, ein schlaksiger Farmer aus Hendrum, hinter ihr auftauchte, während sie gerade den Lauf der nächsten fünf Kugeln plante. Er schlang seine Arme um ihre Taille und raunte ihr ins Ohr: »Nimm mich mit zu dir, Cash.«
Cash hatte Jim bei einem Poolturnier drüben im Flame kennengelernt, nur ein paar Querstraßen vom Casbah entfernt. Sie nahm dort am allmonatlichen Einzelwettbewerb teil und war gerade am Stoß, als die Barkeeperin ihr ein Budweiser brachte und auf den hochgewachsenen, sehnigen Farmer zeigte, der es spendiert hatte. Nachdem sie abgeräumt und die Acht versenkt hatte, kam er rübergeschlendert und fragte, ob sie im gemischten Doppel seine Partnerin sein wollte. Sagte, dass er Jim hieß und glaubte, als Team hätten sie gute Chancen auf das Preisgeld. Er war nicht so sehr viel älter als Cash, und es störte ihn offenbar nicht, dass sie weder blond noch blauäugig war. Er meinte, ihm hätte der Effet gefallen, mit dem sie die Acht in der Ecktasche versenkt hatte.
An diesem Abend wurden sie Dritte und strichen einschließlich Spielkasse und Wetten pro Nase fünfzig Mäuse ein. Hinterher standen sie rauchend draußen auf dem Parkplatz, er fragte, wo sie sonst so spielte, und als sie sagte, im Casbah, lachte er in sich hinein und machte einen Spruch über den vornehmen Teil der Stadt. Sie blickte langsam hoch zu der neonbeleuchteten Stripperin, die über dem Eingang des Flame dekorativ ihr Bein um eine Stange schlang. Er gluckste erneut. Sagte, er würde demnächst mal im Casbah vorbeischauen und ein paar Stöße machen. Gute Übung für das Turnier im kommenden Monat. Aber jetzt müsste er heim zu Frau und Kindern.
Cash dachte nicht weiter an ihn, bis er zwei Wochen später im Casbah auftauchte, seinen Queuekoffer in der Hand. Er wurde Stammgast, und sie wurden feste Partner bei den Flame-Turnieren. Billard, Bier und Siege – eins führte zum anderen. Nämlich direkt in Cashs Bude, wo Cash dann fragte: »Was ist jetzt mit Frau und Kindern?«, und Jim erwiderte: »Mach dir darüber keine Sorgen.« Also hielt sie sich daran.
Sie hatte ja ihr Leben lang Zeit, sich darüber keine Sorgen zu machen.
Heute Abend stellte sein Atem ihre Nackenhärchen auf, Gänsehaut überzog ihre Arme. Sie schüttelte ihn ab, beugte sich über den Tisch und zog ein Stellungsspiel über fünf Kugeln durch. Die letzte Tasche verfehlte sie. Der Kerl, gegen den sie spielte, trumpfte auf: »Wusste doch, dass ich dich schlage, Mädchen. Deine Glückssträhne ist vorbei.«
Er lochte seine letzten vier Kugeln ein, aber schaffte es nicht, die Acht in der Mitteltasche zu versenken.
Cash vermurkste ihren Stoß.
Er vermurkste seinen.
Nur Carl und Ole sahen Cashs leichtes Achselzucken in Jims Richtung, mit dem sie fragte: Wie willst du’s haben?
Jim schlang den Arm um ihre Hüfte und drückte erneut seine Nase in ihren Nacken. Sie schob ihn weg, beugte sich über den Tisch und setzte die Acht schnurgerade in ihre Tasche, direkt gefolgt vom Spielball.
»Du schuldest mir ’n Hamms, Mädchen«, krähte ihr Gegner. »Bau gleich wieder auf.«
Cash nahm stattdessen ihr Queue auseinander, ging zur Bar und bestellte ihrem Gegner ein Hamms. Trank ihr Bud aus.
Jim legte erneut seinen Arm um sie. Im Rausgehen klopfte sie Carl und Ole auf die Schultern. »Wieder mal umsonst getrunken, was?«, sagte Carl.
»Guck mal«, Ole zeigte mit seiner Flasche auf den Fernseher. »Noch mehr von unseren Jungs sind tot.«
Jim und Cash blieben stehen und starrten auf die körnigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von in Reisfeldern landenden Hueys. Der Beitrag schloss mit der Vietnam-Todeszahl des Tages, dann wechselte das Bild zu den Lokalnachrichten. Cash konnte den Sprecher nicht mehr hören, da vom Pooltisch ein vielstimmiges Johlen ertönte. Als der Lärm erstarb, kam der Ansager schon zum abendlichen Wetterbericht.
Cash stemmte sich gegen Jim, bugsierte ihn weiter Richtung Tür. Der Abend war abgekühlt. Grillen zirpten. Am Red River, der nur ein paar Straßen entfernt durch die Stadt floss, riefen Frösche nach anderen Fröschen.
Cash und Jim gingen die zwei Blocks zu ihrer Wohnung über Maytags Elektroladen zu Fuß. Eine behelfsmäßige Holztreppe an der Straßenfront des Gebäudes verlief im Zickzack hoch zum ersten Stock. Die Brettertür führte in eine schäbige kleine Küche. Eine Kochplatte auf einem rissigen Linoleumtresen. Schmutziges Geschirr in der Spüle. Motten und Moskitos knallten gegen die Fliegengitter der offenen Fenster.
Cash zog den gewölbten Kühlschrank auf und schnappte sich vom obersten Bord zwei Langhalsflaschen Bud. Mit der Hüfte schlug sie die Tür zu und ging ins Wohnzimmer, das ihr zugleich als Schlafzimmer diente. Eingestaubte Jeans hingen über der Lehne eines Holzstuhls.
Sie hockte sich aufs Fußende des Betts und trank einen Schluck, bevor sie ihre Schuhe abstreifte und in eine Ecke kickte. Noch ein Schluck, dann stand sie auf, öffnete den Reißverschluss, stieg aus ihrer Jeans und ließ sie liegen. Sie ging ums Bett herum, setzte sich im Schneidersitz hin, Kissen auf dem Schoß, Rücken ans eiserne Kopfteil gelehnt, und nahm einen weiteren Schluck.
Jim zog sich aus bis auf seine weiße Unterwäsche und kroch unter die zerknautschte Decke. Er legte ihr einen Arm um die Taille und versuchte sie zu sich runter zu ziehen. »Lass mich austrinken«, sagte sie.
Nach dem letzten Schluck stellte sie die Flasche auf den Boden und fiel gründlich über ihn her.
Fünfzehn Minuten später zerrte sie ihr zerzaustes Haar unter seinem Rücken hervor, stieß sich von seiner Brust ab und setzte sich auf. »Zeit zum Aufbruch, Farmer Jim.« Sie zündete eine Zigarette an. »Frau und Kinder warten.«
Jim stöhnte und vergrub den Kopf unterm Kissen. Cash zog ihm das Kissen weg und sagte: »Komm schon, hoch mit dir. Ich muss früh raus.« Sie ging in die Küche, holte sich noch ein Bud und nahm einen großen Schluck, während sie zurück ins Schlafzimmer tappte. Das Bier war halb leer, als sie es auf dem abgestoßenen Couchtisch abstellte. Sie kroch ins Bett, zog Jim die Decke weg und wickelte sich hinein. Drehte sich von ihm weg. »Los jetzt. Mach die Tür richtig hinter dir zu.« Sie rauchte zu Ende, trank ihr Bier aus und schlief sofort ein.
Jim wälzte sich an die Bettkante, setzte sich auf, zog Socken und Jeans an. Im Dunkeln tastete er nach seinen Schuhen. Als er sich das Hemd zuknöpfte, beugte er sich über Cash und küsste sie auf die Stirn. Ohne aufzuwachen schlug sie ihn beiseite wie einen zudringlichen Moskito, der auf ihr gelandet war.
Er drückte den Knopf, der die Schlossfalle einschnappen ließ, bevor er die Tür hinter sich zuzog.
Moorhead, Minnesota-Ufer des Red River
Am nächsten Morgen, Freitag, stand Cash auf, lief zum Casbah und holte sich ihren Ranchero Truck. Sie fuhr über die Brücke nach Moorhead, dann nach Norden ins Farmland am Minnesota-Ufer des Flusses. Beide Kleinstädte – Fargo und Moorhead – sind durch den Red River verbunden, der sich bis weit hinter die kanadische Grenze schlängelt. Während Cash fuhr, ging die Sonne auf, erwärmte die morgendliche Luft, ließ Nebel aus den Bäumen am Flussufer steigen.
Niemand in dieser Gegend, und das galt auch für Cash, fand etwas dabei, im Laufe eines Tages hundert Meilen am Steuer zurückzulegen. Hier war praktisch alles gleich um die Ecke. Wobei um die Ecke locker dreißig Meilen und mehr bedeuten konnte. Wenn ein Fremder anhielt und fragte, wo die Wang-Farm war, bekam er vielleicht eine ähnliche Antwort: Bloß ein Stück die Straße lang – was fünf Meilen heißen mochte oder auch zehn.
Farmer standen um halb fünf auf und frühstückten, bevor sie nach Fargo zum Landmaschinenkontor fuhren, um Ersatzteile für den Traktor zu kaufen, wenn es um halb acht öffnete. Sie tuckerten zur Farm zurück, bauten die Teile ein und verbrachten bis Sonnenuntergang auf dem Feld. Ohne sich erst zu säubern, fuhren viele dann noch drei oder vier oder zehn Meilen auf ein Bier in die nächste Ortschaft, bevor sie heimkehrten, duschten, das von der Ehefrau gekochte Abendessen verspeisten, ins Bett gingen und am nächsten Morgen wieder um halb fünf loslegten.
In diesen frühen Morgenstunden war Cash am liebsten unterwegs. Die einzigen Leute, die man traf, waren Farmer und Farmarbeiter wie sie. Sie hob zum Gruß vier Finger vom Lenkrad, wenn ihr jemand entgegenkam.
Sie liebte die Weite des Farmlands, grenzenlos auf allen Seiten. Weizen- oder Haferfelder in Erwartung des Mähdreschers. Die Kartoffeln noch in der Erde. Untergepflügte Heufelder, schnurgerade schwarze Furchen von einem Ende zum anderen, die Baumlinie des Red River eine grüne Schlange, die sich nordwärts wand. Das Laub mit nur einer Andeutung von Herbstfarben.
Sie erinnerte sich, dass ihr jemand erzählt hatte, Anfang des neunzehnten Jahrhunderts habe der Fluss als Transportweg gedient, um Felle zur Hudson Bay zu schaffen. Als die Gegend zur Besiedelung freigegeben wurde, füllte sich das Flachland zu beiden Seiten des Flusses mit skandinavischen Einwanderern, die Bäume fällten und sich staunend am fetten Mutterboden ergötzten. Ein paar von ihnen wurden zu den reichsten Farmern Amerikas, zumeist solche, die Leute wie Cash für sich arbeiten ließen. Andere rackerten sich ab und kamen kaum über die Runden bei den strengen Wintern, den Frühjahrshochwassern und der kurzen Anbausaison.
Das Red River Valley – oder einfach das Valley, wie es Leute nannten, die hier geboren und aufgewachsen waren – war nicht mal ein richtiges Tal. Cash hatte in der siebten Klasse im Heimatkundeunterricht gelernt, dass es sich eigentlich um einen eiszeitlichen Gletschersee handelte. Das Land war so flach, weil ein gigantischer Gletscher auf dem Weg nach Norden es plattrasiert hatte. Und Jahr um Jahr wurde es überflutet.
Dieses Jahr war es nicht allzu übel gewesen. Im Frühling brachten die Schneeschmelze und das Anschwellen der Nebenflüsse des Red River immer starke Hochwasser. In den schlimmsten Flutjahren sah man in jeder Richtung nichts als einen See aus schlammigem Schmelzwasser, so weit das Auge reichte. Cash hatte so manchen Frühling damit verbracht, Sandsäcke aufzustapeln – in Fargo am Flussufer entlang oder auf den Farmen der Umgebung, immer im Kampf gegen die steigende Flut. In solchen Jahren nahm das Valley wieder die Gestalt des Sees in seiner ursprünglichen Größe an. Ostwärts bedeckten die Fluten die Gegend siebzehn bis zwanzig Meilen weit. Der Fluss verschwand völlig. Das Einzige, woran man seine Existenz noch erkennen konnte, waren die mäandernden Linien der Baumkronen, an denen Cash jetzt entlangfuhr.
Der Heimatkundelehrer, ein Farmerssohn, der aufs North Dakota State College gegangen und Lehrer geworden war, weil sein Vater für seine Kinder etwas Besseres wollte als Farmarbeit, verkündete stolz, dass die Fluten jedes Jahr die zwei Fuß dicke, nährstoffreiche Ackerkrume des Tals wieder aufstockten.
Schwarzes Gold, so nannten es die Farmer. Und obwohl die Anbausaison so weit im Norden kurz war – gewöhnlich von Mai bis August, mit Kartoffel- und Rübenernte bis in den September und Oktober hinein –, war dieser Teil des Landes, das Cash ihr Land nannte, den Einheimischen als Brotkorb der Welt bekannt.
Cash war schon Landarbeiterin, seit sie elf war und eine ihrer Pflegemütter – eine aus einer langen Reihe von Pflegemüttern – befand, dass sie ihren Anblick nicht ertrug. Etwas an Cashs nachtdunklen Haaren und immerbrauner Haut in Kontrast zu dem sich pellenden Sonnenbrand ihrer hellblonden Tochter machte die Frau rasend. Sie verbannte Cash aufs Feld zu den Männern.
Mit elf maß Cash kaum eins vierzig und wog weit unter hundert Pfund. Eins vierundfünfzig war sie heutzutage und wohl auch schwerer als ein Sack Kartoffeln, nahm sie an. Damals aber war sie kleiner als die Heuballen, die sie werfen sollte, und die Kartoffelsäcke, die sie füllen musste. Aber sie war fix und klug, und was ihr an körperlicher Stärke fehlte, glich sie mit schierer Willenskraft aus.
Die Männer lachten über ihre Größe, bewunderten ihre Entschlossenheit und ließen sie bald Traktoren und Laster fahren, schnürten Holzklötze auf die Pedale, damit sie überhaupt herankam.
Wenn die Jungs sie hänselten, weil sie als Mädchen mit den Männern ackerte, und fragten, warum sie Trecker fuhr, statt Rüben einzudosen, sagte sie immer: »Ich brauch Cash.« Nur bekam sie kaum je Cash, außer von ihrem Pflegevater, wenn er sie an Nachbarfarmer auslieh – und auch dann gab er ihr bloß zehn Dollar, egal was die ihm zahlten. Jedenfalls, zum Ende der Rübenernte in diesem ersten Jahr war Renee Blackbear vergessen, und Cash war die kleine Landarbeiterin, die alle Männer kannten.
Nach einer Saison auf den Feldern beschloss Cash, dass sie auf keinen Fall zurückwollte – nie wieder Geschirr spülen, Lebensmittel eindosen und Porzellan-Nippes aus der Alten Welt abstauben. Von da an stand sie jeden Morgen eine halbe Stunde eher auf und machte Rumpfbeugen, Liegestütze und isometrisches Muskeltraining, das sie in der Sechsten im Gymnastikunterricht gelernt hatte. Sie sabotierte die Hausarbeit, indem sie beim Bügeln Löcher in die Laken brannte und ganze Kessel voll Eintopf überwürzte, von dem der gesamte Haushalt satt werden sollte. Auch wenn sie jedes Mal Schläge kassierte, dauerte es nicht lange, und sie wurde wieder nach draußen verbannt, um mit den Männern zu arbeiten.
Jetzt, mit neunzehn, plackte Cash das ganze Jahr als Landarbeiterin. Zum Ende jeder Ernteperiode fuhr sie von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang Getreidekipper.
An diesem Morgen brauste sie auf dem Highway 75 nordwärts. Eine nach der anderen zogen die schlafenden Kleinstädte am Minnesota-Ufer des Flusses vorbei: Kragnes, Georgetown, Perley und Hendrum. Nichts rührte sich, nur hier und da rollte ein Pickup dahin.
Als sie nach Halstad kam, verließ sie den Fluss und steuerte auf die aufgehende Sonne zu. Sie parkte beim Farmhaus der Andersons, kletterte in einen Massey Ferguson-Getreidekipper und kutschierte zum nördlichsten Acker der Farm. Sie verbrachte den Tag mit Auf-und-ab-Fahren, Seite an Seite mit dem Mähdrescher, der ihr Weizen auf die Ladefläche schüttete. Wenn die Kippbrücke voll war, fuhr sie zur Anderson-Farm und lud ab. Der Laster knirschte und ächzte, wenn sie die Ladefläche kippte und dann Wache stand, damit nichts überlief. Das Getreide floss in einem dicken weichen Schwall in den Schlund der Förderschnecke, die einen stählernen Silo mit dem Korn füllte. Der Motorenlärm des Förderbands übertönte alle anderen Geräusche auf der Farm.
Mittags aß sie ihren Lunch im Schatten des Trucks. Spülte ein Thunfischsandwich mit Kaffee aus ihrer roten Thermoskanne runter und zupfte vor jedem Abbeißen die Weizenspreu von ihrem Brot. Zum Nachtisch brachte Anderson ihr ein Weckglas voll hausgemachter Limonade und einen Schokoladencookie, den seine Tochter für ihr 4-H-Schulprojekt gebacken hatte. Und dann ging es wieder an die Arbeit.
Als die Dämmerung einsetzte, stieg Cash in ihren Ranchero, gondelte nach Halstad und dann südwärts durch dieselben Ortschaften wie am Morgen. Pickups parkten in jedem Städtchen vor den Schnapsläden und Bars, die Nase zum Eingang. Vor den Getreidespeichern standen die Kipper Schlange und warteten darauf, gewogen zu werden. Die Straßenbeleuchtung ging an.
Cash fuhr durch bis Moorhead und überquerte den Fluss nach Fargo. Sie rannte die Treppe zu ihrer Wohnung hoch, warf ihre Arbeitsklamotten als Knäuel auf den Boden und zog etwas sauberere Sachen von dem Stapel auf dem Sessel an, dann eilte sie die Treppen wieder runter und rüber ins Casbah.
Die Bude war rammelvoll. Jemand hatte die Jukebox mit Vierteldollars gefüttert, und ein Pärchen Besoffene versuchte sich an Walking after Midnight mit Patsy Cline. Cash orderte ihre zwei Buds und deponierte ihre Vierteldollars auf dem Pooltisch. Sie spielte bis Ladenschluss und verlor den Überblick über die Anzahl gewonnener Partien und getrunkener Flaschen. Irgendein Farmerknabe packte sie um die Hüfte und tanzte eng, streichelte ihre langen Haare und murmelte ihr ah, Baby ins Ohr.
Jim kreuzte genau zur Sperrstunde auf. Cash nahm an, er hatte die Gattin ins Bett gebracht, war vielleicht mit ihr noch in Moorhead im Kino gewesen. Sie fragte nie nach seiner Frau, aber laut Gerüchteküche war sie auf der Highschool Cheerleader-Captain gewesen. Cash wusste auch, dass er um die Einberufung herumgekommen war, weil seine älteren Brüder schon Dienst taten. Als Jüngster war er freigestellt, um auf der Farm zu bleiben. Jetzt kam Jim ins Casbah, um sich seine Ladung Cash zu holen. Sie tat ihm den Gefallen und warf ihn wieder mal im Morgengrauen raus.
Am Samstag erwachte Cash bei Sonnenaufgang. Jahrelanges Aufstehen um fünf zum Hühnerfüttern, Hundetränken, Kühemelken und Frühstückbraten war ihr in Fleisch und Blut übergegangen und saß tiefer als der Kater vom Alkohol, den sie jeden Abend trank. Sie schwang sich aus dem Bett und stieg in die Jeans, die sie am Vorabend fallen gelassen hatte. Streifte das Hemd vom Stuhl neben dem Bett über und knöpfte es zu.
Sie brauchte Kaffee. Sie besaß eine Blechkanne, wie man sie in Cowboyfilmen sah. Es gefiel ihr, dass sie einfach eine Handvoll Folgers reinwerfen und sie auf die Herdplatte stellen konnte. Als sie sich in dem kleinen Badezimmer Wasser ins Gesicht gespritzt und über der gesprungenen Porzellanspüle die Zähne geputzt hatte, kochte der Kaffee. Sie stellte die Platte ab und ließ ihn sich setzen. Er konnte ein bisschen abkühlen, während sie ihre Haare bürstete.
Cash gab sonst nicht viel auf ihr Äußeres, aber von ihrem Haar schwärmten alle in der Bar. Es hing ihr bis weit über die Taille. In einer Pflegefamilie hatte man sie mal geschoren, sodass sie ein Jahr lang wie ein Junge aussah. Bis heute kaufte sie bei JC Penney in der Knabenabteilung ein, denn Jungsklamotten waren billiger, und auf ihren mageren Hüften saßen die Jeans viel besser als die aus der Damenabteilung. Aber die Demütigung des geschorenen Schädels ging ihr immer noch nach. Ihr langes dunkelbraunes Haar war die einzige Eitelkeit, die sie sich zugestand.
Cash stellte das Radio an und setzte sich an den kleinen Tisch in ihrer kargen Küche, um ihren Morgenkaffee zu trinken. Das Fenster gewährte einen Blick auf die Gleise der Northern Pacific Railroad. Wenn sie sich etwas vorbeugte und nach links lehnte, konnte sie wohl eine Ecke des Casbah erkennen. Aber der Radiosprecher lenkte sie mit der Meldung ab, dass man im Stoppelfeld eine Leiche entdeckt hatte, dreißig Meilen nördlich vom Raum Fargo/ Moorhead nahe dem Highway 75.
Der Sprecher berichtete, Sheriff Wheaton sei hingefahren, um einen fragwürdigen Haufen Plunder mitten auf dem Feld zu überprüfen, und auf eine Leiche gestoßen.
Cash sprang auf, zog die saubersten dreckigen Socken an, die sie finden konnte, und schlüpfte in ihre Tennisschuhe. Sie schüttete den verbliebenen Kaffee in ihre Thermoskanne und hakte ihre Schlüssel über den kleinen Finger der Hand mit dem weißen Becher. Binnen fünf Minuten war sie am Minnesota-Ufer auf dem Highway 75 unterwegs nach Norden.
Dreißig Minuten später lehnte sie an ihrem schlammbespritzten Ranchero und beobachtete, wie Wheaton mit zwei Männern sprach. Alle drei starrten auf den Boden, wo die Stoppeln plattgedrückt waren. Da lag eine Leiche, mit dem Kopf Richtung Fluss. Wenn man von den schwarzen Anzügen und Wheatons Sheriffuniform absah, hätten es einfach drei normale Männer sein können, die den Maisertrag des nächsten Jahres besprachen, den Weizenpreis an der Getreidebörse in Minneapolis oder die Chancen der Socks, die Saison zu gewinnen.
Cash griff in die Jackentasche und förderte ein zerknautschtes Päckchen Marlboro zutage. Sie klopfte eine heraus, steckte sie in den Mund, fischte aus ihrer Jeanstasche ein Briefchen Streichhölzer. Mit geübter Bewegung gab sie sich linkshändig Feuer, indem sie ein Streichholz über den Rücken der Packung bog. Den Trick hatte sie von einem Vietnamheimkehrer. Ende des vorigen Sommers hatten sie nach einer Sauftour zu zweit draußen im Maisfeld gesessen und gezecht. Da zeigte er ihr den einhändigen Streichholztrick. Das brauchst du im Dschungel, sagte er, damit du die andere Hand am Gewehr lassen kannst. »Natürlich gibt’s auch Zeiten, da gehst du auf Patrouille und zündest dir besser gar keine an, denn die Zigarettenglut zeigt den Schlitzaugen genau, wo dein Kopf ist.«
Cash übte den einhändigen Trick, bis sie ihn konnte, was ihr kleine schwarze Schwefelbrandmale am Daumen eintrug, ehe sie den Bogen raushatte. Der Soldat hatte sich so bald wie möglich wieder verpflichtet. Er kam noch mal ins Casbah, um sich einen letzten Kater zu verpassen, bevor er eingeschifft wurde. Sagte, er käme hier draußen in der normalen Welt nicht mehr klar. Er wollte zurück, bis der Krieg vorbei war oder sie ihn in einem Sack heimschafften. Manchmal dachte Cash an ihn und fragte sich, wo er wohl war, manchmal wollte sie es gar nicht wissen.
Sie blies den Rauch himmelwärts, wo er sich mit trägen Herbstwolken vereinigte, die fett wie Zuckerwatte gemächlich über den strahlenden Augusthimmel zogen.
Das Feld, auf dem die Männer standen, grenzte an die Baumlinie des Red River. So dicht am Fluss zog der Farmer wahrscheinlich Futtermais für Silage, mit der er im Winter seine Tiere ernähren konnte – keine marktgängigen Sorten wie auf den größeren Feldern ein, zwei Meilen weiter weg.
Cash stemmte die linke Ferse auf die Stoßstange des Ranchero. Sie lehnte sich gegen die Haube, ließ sich von der Spätsommersonne wärmen und fragte sich, ob der Tote auf dem Feld kalt war oder ob die Sonne auch ihn erwärmte. Sie konnte schlecht einschätzen, was ihm zugestoßen war. Kein natürlicher Tod, nahm sie mal an, sonst wäre Wheaton nicht hier, und die beiden Kerle im Anzug auch nicht. Hier in der Gegend trugen Männer nur Anzüge, wenn sie zur Kirche gingen oder bei der Bank arbeiteten.
Einer der Anzüge bückte sich und hob die linke Schulter des Toten an. Da sah Cash, dass der Mann Indianer war. Wheaton warf einen raschen Blick in ihre Richtung.
Gleich als sie ankam, hatte er ihr Eintreffen mit einem unmerklichen Nicken quittiert, dann eine diskrete Handbewegung gemacht, die sie als komm nicht näher deutete. Also stieg sie aus, lehnte sich an den Kühler, sah zu, wartete ab.
Sie und Wheaton kannten sich seit langem. Als sie drei war, katapultierte ihre Mutter den Wagen – mit ihren drei Kindern drin – in den großen Graben am nördlichen Stadtrand. Cashs einzige Erinnerung an diese Achterbahnfahrt war, wie ihr Bruder und ihre Schwester auf sie draufpurzelten. Viele Male, wenn sie es recht bedachte.
Wheaton setzte Cash im Warteraum vom Gefängnis auf der langen Holzbank ab. Er ging wieder nach draußen und trug ihre Mutter herein, obwohl ihre Mutter doch allein aus dem Graben geklettert war und recht klar und vernünftig gewirkt hatte, als sie Wheaton erklärte, dass sie nichts weiter getan hatte, als einem Stinktier auszuweichen. Aber dann musste sie wohl umgekippt sein.
Wheaton legte sie in einer der Arrestzellen auf die Pritsche, ohne die Gittertür zu verschließen. Cash sah zu, wie er im hinteren Teil des Zellentrakts verschwand und mit einer grauen Armeedecke und einem Kopfkissen zurückkam. Er sprach wohl mehr mit sich selbst als mit dem kleinen Mädchen, das mitten in der Nacht auf der Holzbank in seinem Gefängnis hockte, als er knurrte: »Du schläfst hier draußen. Ich steck doch keine Zweijährige in eine Zelle, egal ob da ein Bett drinsteht. Das ist keine Erfahrung, die du unbedingt brauchst. So, bisschen hart, aber na ja. Hey, musst du nicht mal aufs Klo oder so?«
Cash schüttelte den Kopf. Sie hielt es für das Beste, sich nicht von der Stelle zu rühren. Und sie sagte ihm auch nicht, dass sie drei war, nicht zwei.
Sie hörte ihre Ma atmen. Streckte sich auf der Bank aus. Die war hart. Und die Wolldecke kratzig. Aber schon mit drei wusste sie, es war besser, nicht zu reden oder sich zu beschweren.
Ihr Bruder und ihre Schwester lagen im Bezirkskrankenhaus, aber sie hatte man nicht dabehalten wollen, weil ihr anscheinend nichts fehlte. Die Schwestern hatten erklärt, die zwei Älteren würden diese Woche nicht mehr in die Schule gehen, und die Jüngste sollte am besten bei der Mutter bleiben. Wheaton hatte versucht zu protestieren. Aber vielleicht hatte die Aussicht, gleich für drei Kinder sorgen zu müssen – zwei davon verletzt – und obendrein eine betrunkene Mutter, ihn dem Krankenhauspersonal gegenüber nachgiebig gemacht.
Cash hatte keinerlei Erinnerung ans Aufwachen an ihrem ersten Morgen im Gefängnis. Und keine Erinnerung daran, was dann mit ihrer Ma passiert war. Oder ihrem Bruder und ihrer Schwester.
Auf diese Nacht folgte eine lange Reihe Pflegschaften in weißen Familien, und an die meisten davon dachte sie entschieden ungern zurück. Sobald sie Laster fahren gelernt hatte, übernahm sie jeden Farm-Hilfsjob und alle Landarbeit, für die jemand sie anzuheuern bereit war.
Und aus irgendeinem Grunde war zwischen ihr und Wheaton ein Band entstanden, zwischen dem County-Bullen und dem einsamen Pflegekind des Countys. Er war es, der kam, wenn in der Schule ein Elternabend stattfand. Der ihr zu Weihnachten einen Wollpullover kaufte, jedes Jahr. Sie brachte es nicht über sich, ihm zu sagen, wie sehr die Wolle auf ihrer Haut kratzte, wahrscheinlich weil es sie an die Nacht in seinem Gefängnis erinnerte.





























