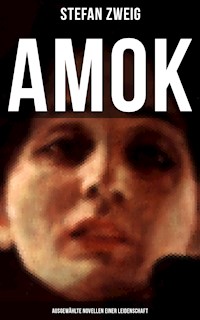
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stefan Zweigs 'Amok: Ausgewählte Novellen einer Leidenschaft' ist eine Sammlung von Novellen, die den Leser in die tiefe psychologische Welt menschlicher Leidenschaften eintauchen lassen. Der literarische Stil von Zweig zeichnet sich durch seine präzise Sprache und seine eindringlichen Beschreibungen aus, die die emotionalen Konflikte und inneren Kämpfe der Protagonisten nuanciert darstellen. Die Novellen in diesem Band reflektieren die gesellschaftlichen und psychologischen Spannungen des frühen 20. Jahrhunderts und zeigen, wie die Leidenschaften die Vernunft der Menschen überwältigen können. Stefan Zweig gelingt es meisterhaft, die abgründigen Seiten der menschlichen Natur zu beleuchten und den Leser tief in die Psyche seiner Figuren eintauchen zu lassen. Stefan Zweig, ein österreichischer Schriftsteller und Zeitgenosse des 20. Jahrhunderts, war bekannt für seine psychologisch eindringlichen Werke, die die Abgründe der menschlichen Seele erforschen. Inspiriert von persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen der Gesellschaft seiner Zeit schuf er eine Vielzahl von Werken, die bis heute Faszination und Bewunderung hervorrufen. 'Amok' ist ein weiteres Meisterwerk in seiner Bibliographie, das die Leser mit seiner tiefgründigen Darstellung von Leidenschaft und Verzweiflung fesselt. 'Amok: Ausgewählte Novellen einer Leidenschaft' ist ein Buch, das sich für Leser eignet, die an psychologisch dichten Erzählungen interessiert sind und sich von literarischen Werken mit tiefgründigen Charakterstudien faszinieren lassen. Stefan Zweigs meisterhafte Erzählkunst und sein feines Gespür für die Abgründe der menschlichen Psyche machen dieses Buch zu einem fesselnden Leseerlebnis, das noch lange nach der Lektüre nachhallt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amok: Ausgewählte Novellen einer Leidenschaft
Books
Inhaltsverzeichnis
Geschichte eines Unterganges
Als Madame de Prie an jenem Tage, da der König ihrem Geliebten, dem Herzog von Bourbon, die Leitung der Staatsgeschäfte entzog, von ihrer morgendlichen Spazierfahrt zurückkehrte, fing sie gleichzeitig mit dem devoten Bückling der beiden Türsteher ein unterdrücktes Lächeln auf, das sie irritierte. Sie ließ zunächst nichts merken, schritt gelassen an ihnen vorbei und die Treppe hinauf, wandte aber, als sie zum ersten Absatz der Stufen kam, jäh den Kopf zurück, und nun sah sie das Lachen breit auf den geschwätzigen Lippen der beiden schmatzen, rasch freilich untertauchend in einen erschreckten neuerlichen Bückling.
Jetzt wußte sie genug. Und oben in ihrem Salon, wo ein betreßter Offizier der königlichen Leibgarde sie mit einem Brief in der Hand erwartete, zeigte sie ein so unbesorgtes und fast übermütiges Wesen, als ob sie nur einen konventionellen Besuch in einem befreundeten Hause machte. Wiewohl sie das königliche Siegel auf dem Briefe sah und die ein wenig verwirrte Art des Offiziers, der seiner peinlichen Botschaft bewußt war, verriet sie weder Neugier noch Besorgnis. Ohne den Brief zu öffnen oder nur näher anzusehen, plauderte sie mit dem jungen und adeligen Soldaten, erzählte ihm, als sie an der Aussprache einen Bretonen in ihm erkannte, von einer Dame, die partout die Bretonen nicht leiden mochte, weil einer einmal gegen ihren Willen ihr Liebhaber wurde. Sie war frivol und übermütig, halb aus Berechnung, ihre Sorglosigkeit zu zeigen, halb aus Gewohnheit, wie überhaupt eine vergeßliche und unbeschwerte Leichtfertigkeit jede ihrer Verstellungen natürlich scheinen ließ und sie sogar wirklich in Aufrichtigkeit verwandelte. Sie plauderte so lange, bis sie wirklich an den königlichen Brief vergaß, den sie knitternd in den Händen hielt. Aber schließlich brach sie doch das Siegel auf.
Der Brief enthielt kurz und mit bedenklich geringem Aufwand an Höflichkeit den königlichen Befehl, unverzüglich den Hof zu verlassen und sich auf ihr Landgut Courbépine in der Normandie zurückzuziehen. Sie war in Ungnade, ihre Feinde hatten endlich gesiegt: am Lächeln ihrer Türhüter hatte sie das schon gewußt, ehe die königliche Botschaft kam. Aber sie verriet sich nicht. Der Offizier beobachtete sorgsam ihre Augen, wie sie den Zeilen auf und nieder folgten. Sie zuckten nicht, und nun, da sie sich ihm wieder entgegenwandte, funkelte ein Lächeln darin. »Seine Majestät ist sehr besorgt um meine Gesundheit und wünscht, daß ich die heiße Stadt verlassen und mich auf mein Schloß zurückziehen solle. Melden Sie Seiner Majestät, daß ich seinem Wunsche unverzüglich Folge leisten werde.« Sie lächelte bei den Worten, als sei geheimer Sinn in ihrer Rede. Der Offizier schwenkte den Hut und trat mit einer Verbeugung ab.
Aber kaum, daß die Tür sich hinter ihm schloß, fiel das Lächeln von ihren Lippen wie ein welkes Blatt. Sie zerknitterte zornig den Brief. Wie viele solcher Briefe, jeder ein Schicksal, waren mit dem königlichen Namen in die Welt gegangen, denen sie die Feder geführt hatte! Und nun wagte man sie, die durch zwei Jahre ganz Frankreich regiert hatte, mit einem solchen Blatt vom Hof zu verbannen: so viel Mut hatte sie von ihren Feinden nicht erwartet. Freilich, der junge König hatte sie nie geliebt, er war ihr übel gesinnt; aber hatte sie dazu Maria Leszińska zur Königin von Frankreich gemacht, daß man sie exilierte, nur weil ein Volkshaufe vor ihren Fenstern gelärmt hatte und irgendeine Hungersnot im Lande war? Sie überlegte einen Augenblick, ob sie Widerstand leisten sollte: der Regent von Frankreich, der Herzog von Orleans, war ihr Geliebter gewesen, wer heute Macht und Stellung bei Hof besaß, dankte es einzig ihr. An Freunden fehlte es ihr nicht. Aber sie war zu stolz, um als Bettlerin zu erscheinen, wo man sie als Herrin kannte, niemand in Frankreich sollte sie je anders als lächelnd gesehen haben. Die Verbannung konnte ja nur Tage dauern, bis die Gemüter beruhigt waren, dann würden ihre Freunde die Rückberufung durchsetzen. Sie freute sich schon voraus im Gedanken der Rache und betrog ihren Ärger damit.
Madame de Prie betrieb ihre Abreise mit der größten Heimlichkeit. Sie gab niemandem Gelegenheit, sie zu bedauern, und empfing keinen Besuch, um nicht ihre Abreise ankündigen zu müssen. Sie wollte plötzlich, geheimnisvoll, abenteuerlich verschwunden sein, ein Rätsel mit ihrem Fortsein dauernd verbinden, das den ganzen Hof verwirren sollte: denn diese merkwürdige Eigenschaft war ihrem Charakter eigen, immer betrügen zu wollen, immer eine Lüge über ihr wirkliches Tun zu breiten. Der einzige, den sie besuchte, war der Comte de Belle-Isle, ihr Todfeind, derjenige, der ihre Verbannung erwirkt hatte. Sie suchte ihn auf, um ihm ihr Lächeln zu zeigen, ihre Unbesorgtheit, ihre Sicherheit. Sie erzählte ihm, wie willkommen es ihr sei, einmal von den Anstrengungen des höfischen Lebens ausruhen zu dürfen, sie log und zeigte ihm durch die Offenkundigkeit ihres Lügens all ihren Haß, ihre Verachtung. Der Comte lächelte nur kühl und meinte, sie würde die lange Einsamkeit schwer ertragen können, und betonte das Wort »lange« so merkwürdig, daß sie erschrak. Aber sie hielt sich zusammen und lud ihn höflich zur Jagd auf ihr Gut. Nachmittags traf sie sich noch in ihrem Häuschen in der Rue Apolline mit einem ihrer Geliebten, beauftragte ihn, sie genau von allen Vorgängen bei Hofe zu benachrichtigen. Abends reiste sie ab. Sie wollte nicht bei Tage in der offenen Chaise durch die Stadt fahren, weil das Volk ihr seit jenem Aufstande, der Menschenleben gekostet hatte, feindlich gesinnt war, und dann, weil sie das Geheimnis ihres Verschwindens zäh festhielt. Sie wollte bei Nacht fortreisen, um bei Tag wiederzukehren. Ihr Haus ließ sie unverändert, als bliebe sie nur ein oder zwei Tage aus, und sagte im Augenblicke, wo der Wagen sich in Bewegung setzte, vernehmlich – denn sie wußte, die Worte würden den Weg zu Hofe finden – sie beabsichtige eine kurze Reise zu ihrer Erholung und käme bald zurück. Und so sehr hatte sie sich eingelernt, Masken der Verstellung zu tragen, daß sie durch ihre eigene Lüge tatsächlich beruhigt in der holpernden Karosse bald in unbesorgten Schlummer versank und erst weit hinter Paris, bei der ersten Relaisstelle, erwachte, erstaunt, sich in einem Wagen zu finden und in einem neuen Schicksal, von dem sie noch nicht wußte, ob es ihr gut oder böse war. Sie fühlte nur, daß Räder unter ihr rollten und sie ihnen nicht gebieten konnte, daß sie hinglitt in ein Unbekanntes, aber sie war zu leichtfertig, um ernstliche Besorgnis zu haben, und schlief bald wieder ein.
Die Fahrt in die Normandie war lästig und lang gewesen, aber schon der erste Tag in Courbépine gab ihr die Heiterkeit ihres Wesens wieder. Ihr unruhiger, verspielter, ständig nach Neuem lüsterner Sinn entdeckte einen ungewohnten Reiz darin, sich der kristallenen Reinheit eines ländlichen Sommertages hinzugeben. Sie verlor sich an tausend Torheiten, belustigte sich damit, mit blassen Schleifen im Haar in einem blühweißen Kleid wie das kleine Mädchen, das sie einst war und das sie in sich längst schon gestorben meinte, durch die Alleen zu laufen, über Hecken zu springen und schwirrenden Schmetterlingen nachzuhaschen. Sie ging und ging und empfand seit Jahren zum erstenmal, welche Wollust darin liegt, seine Glieder im Schreiten rhythmisch zu entspannen, wie sie überhaupt all die Dinge des primitiven Lebens, die sie in den höfischen Tagen vergessen hatte, mit Entzücken wiederentdeckte. Sie lag im smaragdenen Gras und sah den Wolken zu. Wie seltsam das war, seit Jahren hatte sie niemals eine Wolke angesehen, und sie fragte sich, ob sie über den Häusern von Paris auch so schön gerändert, so weißgebläht, so rein und schwebend seien. Zum erstenmal sah sie den Himmel wie ein wirkliches Ding an, und seine blaue, mit seinen weißen Flecken durchsprenkelte Wölbung erinnerte sie an die wundervollen chinesischen Vasen, die ihr jüngst ein deutscher Fürst zum Geschenk gemacht hatte, nur daß er noch schöner war, voller und blauer und gefüllt mit milder, duftender Luft, die wie Seide weich anzufühlen war. Das Nichtstun ergötzte sie, die in Paris immer von einem zum anderen Divertissement gejagt war, und die Stille um sie war köstlich wie ein frischer Trunk. Es kam ihr jetzt zum erstenmal zu Bewußtsein, daß alle die Menschen, die sie in Versailles umringten, ihr gleichgiltig seien, daß sie keinen liebte und keinen haßte, alle waren ihr gleichgiltig wie dort die Bauern, die am Waldrand mit großen blitzenden Sensen standen und manchmal mit überschattetem Auge neugierig zu ihr herübersahen. Immer übermütiger ward sie: sie trieb loses Spiel mit den jungen Bäumen, sprang hoch, bis sie die niederhängenden Zweige fing, ließ sie abschnellen und lachte laut, wenn ein paar weiße Blüten wie pfeilgetroffen herabfielen, in ihre haschende Hand, in ihr seit Jahren zum erstenmal wieder freies Haar. Mit jener wunderbaren Vergeßlichkeit, die leichtfertige Frauen an jeden Augenblick ihres Lebens haben, verlor sie das Erinnern, daß sie verbannt sei und daß sie vordem Herrscherin in Frankreich war, mit Schicksalen so lässig spielen durfte wie jetzt mit Schmetterlingen und flimmernden Bäumen, sie verlor fünf, zehn, fünfzehn Jahre und war nur mehr Mademoiselle Pleuneuf, die Tochter des Genfer Bankiers, ein kleines, mageres, übermütiges Mädchen von fünfzehn Jahren, die im Klostergarten spielte und nichts wußte von Paris und der ganzen Welt.
Nachmittags half sie den Mägden beim Einlesen des Getreides: es kam ihr ungemein lustig vor, die großen Garben binden zu dürfen und sie dann mit einem wilden Schwung auf den Wagen zu werfen. Und mitten unter ihnen allen, die zuerst befangen waren und ehrfürchtig sich verhielten, saß sie hoch oben am vollgeladenen Wagen mit baumelnden Beinen, lachte mit den Burschen und dann, wie es zum Tanze ging, wirbelte sie mitten hinein. Sie empfand all das wie ein gelungenes Maskenspiel am Hofe und freute sich schon, in Paris erzählen zu können, wie köstlich sie ihre Zeit verbracht, wie sie, mit Feldblumen im Haar, den Reigen getanzt und mit den Bauern vom gleichen Kruge getrunken habe. Daß dies Wirklichkeiten waren, merkte sie ebensowenig, als sie in Versailles die Schäferspiele als Trug empfand. Ihr Herz verlor sich immer an den Augenblick, log, indem es die Wahrheit sagte, und war aufrichtig, während es betrügen wollte: sie wußte immer nur, was sie fühlte. Und jetzt fühlte sie in allen Adern Glück und Überschwang, der Gedanke, daß sie in Ungnade sei, hätte sie lachen gemacht.
Am nächsten Morgen mengte sich schon ein dunkler Tropfen Mißmut in die kristallene Heiterkeit ihrer Stunden. Das Erwachen allein schon tat weh: Man stürzte aus der schwarzen Nacht traumlosen Schlafes in den Tag hinein, wie aus warmer schwülender Luft in ein eisiges Wasser. Sie wußte nicht, was sie erweckt hatte. Das Licht war es nicht, denn fahl schimmerte der Regentag vor den verweinten Fenstern. Und auch der Lärm war es nicht, denn hier waren keine Stimmen, nur von der Wand sahen sie tote Menschen aus ihren Bildern mit starren bohrenden Augen an. Man war wach und wußte nicht, warum und wozu: nichts rief sie hier und verlockte sie.
Und sie dachte, wie anders doch das Erwachen in Paris war. Abends hatte man getanzt, geplaudert, mit Freunden die halbe Nacht verbracht, und dann kam jener wunderbare Schlaf der Erschöpfung, in dem die erregten Sinne farbige Bilder weiterzittern ließen. Und morgens, mit geschlossenen Augen, hörte sie noch wie aus dem Traum heraus, gedämpfte Stimmen aus den Vorsälen, und kaum daß ihr Lever begann, strömten sie herein: die Herzöge von Frankreich, die Bittsteller, die Geliebten, die Freunde, alle warben um ihre Gunst und brachten die Gabe der Werbenden: beflissene Heiterkeit. Jeder erzählte, lachte, schwatzte, man brachte den Tratsch, die Neuigkeiten an ihr Bett, und geradeswegs aus den farbigen Träumen trug sie das Erwachen mitten in die Flut des Lebens, das Lächeln, das sie im Traume auf den Lippen hatte, flog nicht fort, blieb an den Mundwinkeln hängen und schaukelte sich übermütig wie ein Vogel im Bauer.
Von den Bildern der Menschen führte der Tag zu den Menschen selbst, und sie blieben bei ihr, beim Anziehen, beim Ausfahren, beim Speisen, bis wieder in die Nacht hinein. Unablässig fühlte sie sich murmelnd weitergetragen von dieser wie Wellen rastlos erregten Flut, die tanzend in unaufhörlichem Rhythmus das blumige Boot ihres Lebens schaukelte.
Aber hier warf er das Erwachen an eine Klippe, es saß fest, reglos und unnütz am Strand der Stunden. Nichts lockte sie, aufzustehen. Die harmlosen Vergnügungen von gestern hatten keinen Reiz mehr, ihre verwöhnte Neugier war von der Art, daß sie sich rasch abnutzte. Das Zimmer war leer, wie ohne Luft, und leer fühlte sie sich selbst in dieser Einsamkeit, wo keiner sie verlangte, leer, nutzlos, ausgewaschen, ausgelaugt: sie mußte sich erst langsam erinnern, warum sie hier sei und wie sie hierher gekommen sei. Was erwartete sie von dem Tage, daß sie so nach der Uhr starrte, die mit ihrem zittrigen, leisen Schritt rastlos durch das Schweigen ging?
Endlich fiel es ihr ein. Sie hatte den Prinzen von Alincourt, den einzigigen ihrer früheren Geliebten, mit dem sie innigere Neigung verband, gebeten, ihr täglich durch einen reitenden Boten die Nachrichten vom Hofe zu übermitteln. Den ganzen gestrigen Tag hatte sie daran vergessen, daß sie Paris durch ihr Verschwinden in Aufregung versetzt hatte, nun lüstete es sie, diesen Triumph auszukosten. Der Bote traf auch bald ein, nicht aber die Botschaft. Alincourt schrieb ihr ein paar gleichgiltige Floskeln, Nachrichten über das Befinden des Königs, die Besuche fremder Prinzen, und ließ den Brief in freundliche Wünsche für ihr Wohlbefinden zerrinnen. Von ihr und ihrem Verschwinden kein Wort. Sie wurde ärgerlich. War die Nachricht denn nicht publik? Oder hatte man ihrer Lüge, sie sei zur Erholung in dieses langweilige Nest gereist, wirklich Glauben geschenkt?
Der Bote, ein einfältiger, stiernackiger Reitknecht, zuckte die Achseln. Er wußte von nichts. Sie verheimlichte ihren Ärger und schrieb Alincourt zurück – ohne ihren Unwillen zu zeigen –, sie danke ihm für seine Nachrichten und bitte ihn dringend, weiterhin ihr genau Bericht zu erstatten. Sie hoffe, nicht lange hier zu bleiben, aber immerhin gefiele es ihr hier vortrefflich. Sie merkte gar nicht, daß sie ihn schon belog.
Aber wie lange wurde dann hier noch der Tag. Die Stunden schienen hier wie die Menschen selbst mit bedächtigerem Schritt zu gehen, und sie wußte kein Mittel, sie zu beschleunigen. Sie wußte nichts mit sich selbst anzufangen; stumm war alles in ihr, all die geistreiche Musik ihres Herzens tot wie eine Spieluhr, deren Schlüssel verlorengegangen ist. Sie versuchte allerhand, sie ließ sich Bücher bringen, aber die geistreichsten schienen ihr bedruckte Blätter. Eine Unruhe kam über sie, ihr fehlten die vielen Menschen, unter denen sie jahrelang gelebt. Sie trieb die Diener unnütz hin und her mit eigensinnigen Befehlen: sie wollte Schritte auf den Treppen knarren hören, Menschen sehen, künstlich dies Geschwirre von Botschaften erzeugen, wollte sich belügen, aber es gelang ihr schlecht, wie jetzt alle ihre Pläne. Das Essen ekelte sie wie das Zimmer und der Himmel und ihre Diener: sie wollte eines nur noch, Nacht, tiefen, traumlosen schwarzen Schlaf bis morgen, wo die bessere Botschaft kam.
Endlich kam der Abend. Aber wie traurig war er hier! Nichts als ein Dunkelwerden, ein Wegschwinden aller Dinge, ein Verfinstern des Lichts. Ein Ende war er hier, der in Paris doch erst Anfang war aller Vergnügungen. Hier goß er Nacht aus, dort entflammte er die goldgerandeten Kerzen in den königlichen Sälen, ließ die Luft auffunkeln in den Blicken, entzündete, wärmte, berauschte, befeuerte das Herz. Hier machte er nur noch ängstlicher. Sie irrte von Zimmer zu Zimmer: in allen hockte das Schweigen wie ein böses Tier, gemästet mit all den Jahren, da niemand hier gegangen war, und sie hatte Angst, es möchte sie anspringen. Die Dielen stöhnten auf, die Bücher knackten in den Bänden, sobald man sie anfaßte; im Spinett ächzte etwas schreckhaft auf wie ein geschlagenes Kind, da sie an die Tasten rührte und einen weinerlichen Klang aufrief. Alles wehrte sich gegen den Eindringling, hielt fest im Dunkel zusammen.
Da ließ die Fröstelnde im ganzen Hause die Lichter anzünden. Sie versuchte, in einem Raum zu bleiben, aber immer trieb es sie weiter, sie flüchtete von einem Zimmer ins andere, als wäre darin eine Beruhigung. Aber überall stieß sie gegen die unsichtbare Wand des Schweigens, das seit Jahren hier Herrenrecht hatte und sich nicht verweisen lassen wollte. Selbst die Lichter schienen es zu fühlen, sie zischten leise und tränten heiße Tropfen herab.
Von außen aber blinkte das Schloß mit seinen dreißig funkelnden Fenstern, als würde hier ein Fest gefeiert. Die Leute vom Dorfe standen in Haufen davor, staunten und schwatzten, woher die vielen Menschen plötzlich gekommen wären. Aber die Gestalt, die sie bald an der einen, bald an der anderen Scheibe schattenhaft vorüberstreifen sahen, war immer die gleiche: Madame de Prie, die verzweifelt wie ein wildes Tier in dem Gefängnis ihrer inneren Einsamkeit auf und ab irrte und durch die Fenster nach irgend etwas spähte, was nicht kam.
Am dritten Tage verlor ihre Ungeduld alle Fassung und wurde gewalttätig. Die Einsamkeit erdrückte sie, sie brauchte Menschen oder wenigstens Nachricht von Menschen, vom Hof, wo ihr ganzes Wesen mit tausend Fasern verästelt war, von ihren Freunden, irgend etwas, was sie erregte oder nur anrührte. Sie konnte den Boten nicht erwarten und ritt ihm frühmorgens drei Stunden entgegen. Es regnete und stürmte: das mit Wasser vollgesaugte Haar riß ihr den Kopf zurück, ihre Augen sahen nichts mehr, so fegte ihr der Sturm den Regen ins Gesicht, ihre Hände erstarrten und vermochten kaum mehr den Zügel zu halten. Schließlich jagte sie zurück, ließ sich die nassen Kleider abnehmen und flüchtete wieder ins Bett. Sie wartete wie im Fieber, die Decke zwischen die Zähne geknüllt. Jetzt verstand sie das drohende Lächeln des Comte de Belle-Isle, wie er sagte, sie würde die lange Einsamkeit schwer ertragen können. Und es waren erst drei Tage!
Endlich kam der Kurier. Sie verstellte sich nicht mehr, sondern riß gierig mit den Nägeln, wie ein Hungernder die Schale von der Frucht, das Siegel ab. Es standen viel Dinge vom Hofe darin: ihr Auge rann darüber fort, sie suchte ihren Namen. Nichts, nichts. Aber da brannte ein Name sie an: ihre Stelle als Palastdame war vergeben an Madame de Calaincourt.
Einen Augenblick zitterte sie, und ihr ward ganz schwach. Es war also keine momentane Verstimmung, sondern dauernde Verbannung: das war ihr Todesurteil, und sie liebte das Leben. Mit einem Ruck sprang sie, ohne Scham vor dem Kurier, aus dem Bett und schrieb halbnackt, schlotternd vor Kälte, in wilder Gier Brief auf Brief. Sie gab die Komödie ihres Stolzes auf. Sie schrieb an den König, obwohl sie wußte, daß er sie haßte; in den demütigsten, erbärmlich kriecherischesten Worten versprach sie, sich nie mehr in die Staatsgeschäfte einmengen zu wollen. Sie schrieb an die Leszcyńska, erinnerte sie daran, daß nur durch ihre Vermittlung sie die Königin Frankreichs geworden war, sie schrieb an die Minister, bot ihnen Geld, sie wandte sich an ihre Freunde. Sie beschwor Voltaire, den sie vor der Bastille gerettet hatte, er möge eine Elegie dichten auf ihren Abgang und vorlesen. Sie befahl ihrem Sekretär, Pasquillanten gegen ihre Feinde zu dingen und die Blätter in Abschriften zu verbreiten. Zwanzig Briefe riß sie so aus ihrer fiebernden Hand, die alle nur eines erflehten: Paris, die Welt, Rettung vor dieser Einsamkeit. Schreie waren es, keine Briefe mehr. Dann griff sie in eine Schatulle, gab dem Kurier eine Handvoll Goldstücke, er möge sein Pferd zu Tode reiten, aber er müsse nachts in Paris sein. Hier erst hatte sie gelernt, was eine Stunde wirklich war. Er wollte erschreckt danken, sie trieb ihn hinaus.
Dann flüchtete sie zurück ins Bett. Ihr fror. Ein harter Husten schüttelte ihren vermagerten Körper. Sie lag und starrte vor sich hin, wartete immer nur, bis endlich die Uhr auf der Konsole ansetzte und schlug. Aber die Stunden waren störrisch, man konnte sie nicht mit Flüchen, mit Bitten, mit Gold hetzen, schläfrig gingen sie ihren runden Gang. Die Diener kamen, sie wies alle hinaus, sie wollte niemandem ihre Verzweiflung zeigen, sie wollte kein Essen, keine Worte, wollte nichts von niemandem. Unentwegt rauschte der Regen draußen und sie fröstelte, als stände sie draußen schauernd wie das Gesträuch mit seinen hilflos gespreizten Armen. Eine Frage ging in ihr auf und nieder, ein Wort wie Pendelschlag: Warum, warum, warum, warum? Warum hatte ihr Gott das getan? Hatte sie zu viel gesündigt?
Sie riß an der Klingel: man solle den Priester des Ortes holen. Der Gedanke beruhigte sie, daß irgendein Mensch hier lebte, mit dem sie reden könnte und dem sie ihre Angst vertrauen konnte.
Der Priester ließ nicht lange auf sich warten, um so mehr, als man ihm berichtet hatte, Madame sei krank. Unwillkürlich mußte sie lächeln, wie er eintrat. Sie dachte an ihren Abbé in Paris mit seinen zarten, feinen Händen, dem glitzernden Blick, der fast zärtlich anrührte, an seine mondäne Konversation, die vergessen ließ, daß er die Beichte abnahm. Der Abbé von Courbépine war wohlbeleibt und breitschultrig, mit knarrenden Stulpen stapfte er zur Tür herein. Alles war rot an ihm, die plumpen Hände, das Gesicht, das der Wind gegerbt hatte, und die großen Ohren, aber er wirkte doch irgendwie freundlich, da er ihr die Tatze zum Gruße bot und auf einem Fauteuil Platz nahm. Vor seiner wuchtigen Gegenwart schien das Grauen im Zimmer sich zu fürchten und duckte sich in eine Ecke hinein: es schien wärmer, lebendiger geworden zu sein in dem Raum, den seine laute Stimme voll anfüllte, und Madame de Prie war, als atmete sie freier in seiner Gegenwart. Er wußte nicht recht, weshalb er berufen worden war, und begann eine ungelenke Konversation, sprach von seiner Pfarrei und von Paris, das er nur vom Hörensagen kannte, er zeigte seine Gelehrsamkeit, redete über Cartesius und die gefährlichen Werke des Herrn von Montaigne. Sie sprach, ohne recht zu denken, hie und da ein Wort: ihre Gedanken summten wie ein Mückenschwarm, sie wollte nur hören, eine menschliche Stimme hören, sie wie einen Damm aufbauen gegen das Meer von Einsamkeit, in dem sie zu ertrinken drohte. Als er, in der Furcht, sie zu stören, aufbrechen wollte, umwarb sie ihn mit leidenschaftlicher Liebenswürdigkeit, die nichts anderes war als Bangen, sie versprach dem höchlichst Geehrten ihren Besuch, lud ihn ein, oft zu ihr zu kommen; das Verführerische ihres Wesens, das in Paris bezaubert hatte, brach verschwenderisch aus ihrer versonnenen Schweigsamkeit. Und der Abbé blieb, bis es dunkel ward.
Aber sogleich, wie er ging, war ihr, als stürzte die Last des Schweigens mit verdoppelter Wucht auf sie herab, als müßte sie allein die hohe Decke tragen, allein das andrängende Dunkel weghalten. Nie hatte sie gewußt, wie viel ein einzelner Mensch einem anderen bedeuten kann, weil sie nie einsam gewesen war. Sie hatte Menschen immer nur gewertet wie die Luft, die man nicht spürt, aber jetzt, da ihr die Kehle umschnürt war von Einsamkeit, spürte sie erst, wie sehr sie ihrer bedurfte, erkannte, wie viel doch Menschen waren, selbst wenn sie logen und betrogen, wie sie selbst von ihrer Gegenwart alles empfing, ihre Leichtigkeit, ihre Sicherheit und Freudigkeit. Sie hatte in Gesellschaft jahrzehntelang geschwommen und nie gewußt, daß diese Flut sie nährte und trug, jetzt aber, wie ein Fisch an den Strand der Einsamkeit geschleudert, zuckte sie in Verzweiflung und gebäumtem Schmerz. Sie fror und fieberte zugleich. Sie befühlte ihren Körper, schrak zurück, wie kalt er war, alles sinnlich Warme schien abgestorben darin, das Blut nur schwerflüssig wie Gallert durch die Adern zu quellen, ihr war, als läge sie in ihren eigenen Leichnam eingesargt hier in der Stille. Und plötzlich brach es heiß auf in ihr, ein verzweifeltes Schluchzen. Sie erschrak zuerst und wollte dem wehren. Aber hier war ja niemand, hier mußte sie sich nicht verstellen, sie war zum erstenmal mit sich allein. Und willig gab sie sich der schmerzlichen Süße hin, die heißen Tränen über ihre eisigen Wangen rinnen zu fühlen und in der entsetzlichen Stille ihr eigenes Schluchzen zu hören.
Sie beeilte sich, dem Abbé den Besuch zu erwidern. Das Haus war öde, die Briefe kamen nicht – sie wußte ja selbst, daß man in Paris nicht viel Zeit hatte für Bittsteller und Petenten, und sie wollte etwas tun, irgend etwas, nur Trictrac spielen oder schwätzen oder nur sehen, wie ein anderer redete, mit irgend etwas die Langeweile belügen, die immer drohender und immer mörderischer gegen ihr Herz andrängte. Rasch eilte sie durch das Dorf; sie hatte ja einen Ekel vor allem, was irgendwie Bestandteil dieses Namens Courbépine bildete, was sie erinnerte an ihre Verbannung. Das Häuschen des Abbé lag am Ende der Dorfgasse, schon ganz im Grünen. Kaum höher war es wie eine Scheune, aber Blumen rahmten die winzigen Fenster und hingen im wirren Gerank über der Tür herab, daß sie sich bücken mußte, um nicht in ihrem lieblichen Netz gefangen zu werden.
Der Abbé war nicht allein. Neben ihm, an seinem Arbeitspulte, saß ein junger Mann, den er, höchlichst verwirrt durch so erlauchten Besuch, als seinen Neffen präsentierte. Der Abbé bereitete ihn für die Gelehrsamkeit vor; freilich sollte er nicht Priester werden – man versäume zu viel dabei. Das sollte ein galanter Scherz sein. Madame de Prie lächelte aber nicht so sehr über das ein wenig plump vorgebrachte Kompliment, sondern über die amüsante Verlegenheit dieses jungen Menschen, der tief errötete und nicht wußte, wohin mit seinen Blicken. Er war ein hochgewachsener Bauernbursche mit einem knochigen, rotbackigen Gesicht, gelben Strähnen und ein wenig einfältigen Augen: er wirkte plump und brutal mit seinen ungelenken Gliedern, aber jetzt bändigte der übergroße Respekt seine Bäurischkeit und gab ihm eine kindische Hilflosigkeit. Er wagte kaum, Antwort auf ihre Fragen zu geben, stammelte, stotterte, versteckte die Hände in den Taschen, zog sie wieder hervor, und Madame de Prie, ergötzt durch seine Verlegenheit, fragte ihn immer mehr – es tat ihr wohl, wieder jemanden zu finden, den ihre Gegenwart verwirrte, der klein, flehend, untertänig vor ihr war. Der Abbé sprach für ihn, rühmte seine Leidenschaft für das edle Studium, seine Vorzüge, und erzählte, daß es seine höchste Sehnsucht wäre, in Paris an der Universität die Studien vollenden zu können. Freilich, er selbst sei arm und könne dem Neffen kaum aushelfen, auch mangle es ihm an Protektion, die ja in Paris einzig den Weg zu den Staatsstellen ermögliche, und mit eindringlichen Worten empfahl er ihn ihrer Gunst. Sie sei ja allmächtig bei Hofe, ein einziges Wort würde genügen, um die verwegensten Träume des jungen Studenten zu erfüllen.
Madame de Prie lächelte bitter ins Dunkel hinein: sie sei allmächtig bei Hofe, und konnte nicht einmal Antwort erzwingen auf einen einzigen Brief, auf eine einzige Bitte. Aber doch tat es ihr wohl, daß man hier von ihrer Ohnmacht, von ihrem Sturze nichts wußte, schon der Schein einer Gewalt beglückte sie jetzt. Sie beherrschte sich: Gewiß wolle sie den jungen Mann empfehlen, der nach den Worten eines so geschätzten Fürsprechers sicher aller Gunst würdig sei. Er möge morgen bei ihr vorsprechen, damit sie seine Qualitäten prüfen könne. Sie wolle ihn bei Hofe empfehlen, ihm ein Geleitschreiben geben an ihre Freundin, die Königin, und an die Herren der Akademie (und erinnerte sich, während sie es sagte, daß keiner von all denen nur mit einer Zeile auf ihre Briefe geantwortet hatte).
Der alte Abbé zitterte vor Freude, Tränen liefen über seine dicken Wangen herab. Er küßte ihre Hände, irrte hin und her wie ein Trunkener, während der junge Bursche mit dem Ausdruck eines Betäubten dastand und kein Wort fand. Als Madame de Prie sich zum Aufbruch entschloß, rührte er sich nicht, blieb wie angewurzelt an seiner Stelle, bis der Abbé ihm heimlich mit einer energischen Bewegung andeutete, er möchte seine Gönnerin zum Schlosse zurückbegleiten. Er ging an ihrer Seite, stammelte Danksagungen und verfing sich jedesmal in der Rede, wenn sie ihn ansah. Sie ward ganz froh dabei. Zum erstenmal empfand sie wieder diese mit leiser Verachtung gemengte Wollust, einen Menschen zu sehen, der vor ihr alle Gewalt verlor, ihr Gelüst, mit anderen zu spielen, das ihr in den Jahren der Macht Lebensbedürfnis geworden war, erwachte wieder neu. Beim Schloßtore blieb er stehen, machte eine linkische Verbeugung und hastete mit seinen steifen Bauernschritten fort, kaum daß sie noch Zeit hatte, ihn an seinen Besuch zu erinnern.
Sie sah ihm nach und lächelte in sich hinein. Er war plump und naiv: aber immerhin, lebendig war er und leidenschaftlich, nicht abgestorben, wie alles ringsum. Er war Feuer und ihr fror. Auch ihr Körper, gewöhnt an die Liebkosungen und Umarmungen, hungerte hier, ihr Blick brauchte, um lebendigen Glanz zu haben, diesen Widerschein von funkelndem Begehren der Jugend, der ihr in Paris täglich entgegenstrahlte. Sie sah ihm lange nach: das konnte ein Spielzeug sein, aus hartem Holz freilich, plump und einfältig, aber immerhin ein Spielzeug, die Zeit zu betrügen.
Am nächsten Morgen meldete sich der junge Mann. Madame de Prie, die matt vor Untätigkeit und Unlust, den Tag zu beginnen, meist erst spät nachmittags aufstand, beschloß, ihn im Bett zu empfangen. Vorerst ließ sie sich von der Zofe sorgfältigst herrichten und ein wenig Rot auf die immer mehr bleichenden Lippen legen. Dann gebot sie, den Besucher hereinzuführen.
Die Tür knarrte langsam auf. Zögernd und sehr linkisch schob sich der junge Mann herein. Er hatte seine beste Gewandung angetan, die freilich noch immer sehr bäuerisch-feiertäglich war, und duftete übermäßig nach allerhand fettigen Salben. Sein Blick irrte vom Boden suchend zum Gebälk des abgedunkelten Zimmers hinauf und wollte schon beruhigter sein, weil er niemand fand, da kam vom Bette her, unter der rosa Wolke des Baldachins, aufmunternde Begrüßung. Er schrak zusammen, denn er wußte nicht, daß die hohen Damen in Paris beim Lever empfingen, oder er hatte es vergessen. Er machte irgendeine Bewegung zurück, als wäre er in tiefes Wasser getreten, und starke Röte überflutete seine Wangen, eine Verlegenheit, an der sie sich weidete und entzückte. Mit schmeichelnder Stimme lud sie ihn ein, näherzutreten: es belustigte sie, gegen ihn sehr höflich zu sein.
Er kam vorsichtig heran, als ginge er über ein schmales Brett und rechts und links sei schäumende Untiefe. Und sie hielt ihm die kleine, magere Hand entgegen, die er vorsichtig mit seinen derben Fingern umfaßte, als hätte er Angst, sie zu zerbrechen, und ehrfürchtig zu den Lippen führte. Sie hieß ihn mit freundlicher Handbewegung auf einem behaglichen Lehnsessel neben ihrem Bette Platz nehmen, und er sank hinein wie mit jäh zerbrochenen Knien.
Ein wenig sicherer fühlte er sich, als er so saß. Nun konnte das ganze Zimmer nicht mehr wild um ihn kreisen, der Boden nicht so wellig schwanken. Der ungewohnte Anblick verwirrte ihn aber noch immer, das lose Seidengewebe der Decke schien die nackten Formen ihres Körpers wiederzugeben und die rosa Wolke des Baldachins niederzuschweben als Nebel: er wagte nicht hinzublicken und fühlte doch, daß er die Blicke nicht immer in den Boden bohren konnte. Seine Hände, seine unnützen großen, roten Hände tasteten die Lehne auf und nieder, als müßte er sich hier festhalten, dann erschraken sie wieder vor ihrer eigenen Unruhe und lagen erfroren wie schwere Klumpen ihm im Schoß. In den Augen hatte er ein brennendes, fast weinerliches Gefühl, an allen Muskeln riß eine Angst, und in der Kehle spürte er keine Kraft, ein Wort wegzuschwingen.
Sie entzückte sich an seiner Verlegenheit. Es bereitete ihr Vergnügen, das Schweigen unbarmherzig lang werden zu lassen, lächelnd zu beobachten, wie er nach dem ersten Wort rang und wie es doch immer wieder nur Stammeln blieb, zu sehen, wie dieser baumstarke Mensch zitterte und mit hilflosen Augen um sich griff. Schließlich hatte sie Mitleid mit ihm und begann, ihn um seine Absichten zu fragen, für die sie ungemeines Interesse zu heucheln wußte, so daß er allmählich wieder Mut bekam. Er erzählte von seinen Studien, von den Kirchenvätern und Philosophen, sie plauderte mit, ohne viel davon zu wissen. Und da die breitspurige Sachlichkeit, mit der er seine Anschauungen vorbrachte und erörterte, sie zu langweilen begann, ergötzte sie sich damit, ihn durch allerhand Bewegung aus der Contenance zu bringen. Sie zog manchmal an der Decke, als wollte sie herabgleiten, holte plötzlich bei einer jähen Geste des Sprechens einen blanken Arm aus der zerklüfteten Seide heraus, wippte mit den Füßen unter der Decke; und immer hielt er inne, überstürzte sich, verschluckte Worte oder sprudelte sie heraus, immer mehr bekam sein Gesicht einen gequälten, gespannten Ausdruck, und sie sah hin und wieder eine Ader hastig wie eine Schlange über seine Stirn laufen. Das Spiel amüsierte sie. Er gefiel ihr tausendmal besser in dieser knabenhaften Verwirrung als in seiner wohlgesetzten Rhetorik. Und sie suchte ihn nun auch mit Worten zu beunruhigen.
»Denken Sie nicht immer so viel an Ihre Studien und Verdienste! In Paris entscheiden die Geschicklichkeiten, Sie müssen lernen, sich vorzudrängen. Sie sind ein hübscher Mensch, seien Sie klug und nützen Sie Ihre Jugend aus, vergessen Sie vor allem die Frauen nicht, die bedeuten alles in Paris, unsere Schwäche muß Ihre Stärke sein. Lernen Sie Ihre Geliebten gut wählen und ausnützen, und Sie werden Minister sein. Haben Sie hier schon eine Geliebte gehabt?«





























