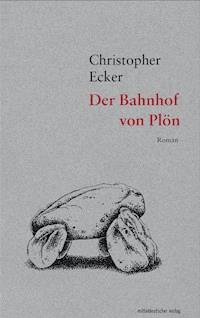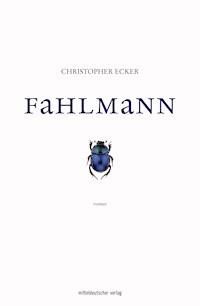Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mdv Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neue Erzählungen – Christopher Ecker macht es kurz Bergleute verschwinden spurlos in einem Harzer Silberbergwerk; jemand entdeckt nach der Wohnungsauflösung des Elternhauses ein Polaroid-Foto, das sein Leben auf den Kopf stellt; ein Aufenthalt in Paris verwandelt die Stadt in ein unlösbares Rätsel; eine Familie geht einkaufen, doch der Supermarkt erweist sich als Welt, aus der es kein Entkommen gibt … In 87 Erzählungen zeigt Christopher Ecker, wie ein Autor heutzutage schreiben kann und muss. »Andere Häfen« ist ein umfassendes Kompendium der Stile und Ideen – zum Staunen, zum Erschrecken, zum Genießen. Eine Feier des reflektierten Erzählens, das in sich selber ruht und zugleich aus sich selbst heraus explodiert. In Konsequenz, Ideenreichtum und enzyklopädischem Anspruch erweist sich »Andere Häfen« vielleicht als Christopher Eckers innovativstes Buch, das seinem Tausendseiter »Fahlmann« und seinem nihilistischen Rundumschlag »Der Bahnhof von Plön« mindestens ebenbürtig ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHRISTOPHER ECKER
ANDERE HÄFEN
mitteldeutscher verlag
INHALT
Cover
Titel
Impressum
Zum Geleit
Auf dem Boden
Für ein Lesebuch der Oberstufe
Als wer wir erwachen
Andere Häfen
Zwei Kätzchen
Kühles Glas
Das Museum zu Knossos
Magst du mich?
Das Auge der Sphinx
Die erste Geschichte
Im Keller des Uhrmachers
Vom Fagaröm
Auf glühenden Kohlen
Die letzten Jahre
Wir waren zum Abendessen eingeladen
Wieso ich überlebte
Die dritte Katze
Rückkehr zur Erde
Südwärts
In dunklen Brauntönen
Ochsengalle
Spiele und Türen
Dosenwerfen für Terra
Böhmische Gärten, abgeschminkte Clowns
Der Brennende Berg
Erfolg und Trost
Abschied
Mein bester Trick
Das Schild
Gebäude
Allerhöchste Eisenbahn
Der leere Spiegel
Fremdkontakt
Unter Wasser
Zugelaufen
Die Planke
Die Reparatur
Die Tür
Zitronenarm
Die Vermählung
Der Schacht
Die Wege
Im Treppenhaus
Die Krankheit
Letzte Durchsage
Schneebedeckte Sonnenuhren
Das eigentliche Erbe
Einen See zuschaufeln
Jenseits
Die Überkopf-Welt
Die Wand des Gästezimmers
Geistergerätschaften
Verlorenheit
Das Ende
Die nächste Nachricht
Die Meisen Alaskas
Existentialismus im Bilderbuch
Das Wesen der Buddha-Natur
Die letzte Seite der Geschichte
Vom Teilen der Beute
Wartet auf das Hermelin!
Vor der Versammlung
Le Cercle Rouge
Ashley
Bauopfer
Schokoladeneis
Alles zu Capgras
Morgen ist ein neuer Tag
Du in den Katakomben von Malta
Südamerika
Reste
Vom Trichter
Keine Geschichte
Die Viper
Doktor Cotard
Blutwurst aus Eigenblut
Invasionen
Die Kluft
Beinfrauen
Armrudernd am Zeilenende
Die Zukunft Böhmens
Geheimnisse und Zusammenhänge
Alte Blinde
Pregasina 1974
Raum und Werk
Ave atque vale
Pressestimmen
ZUM GELEIT
Das Badezimmerfenster war geschlossen. Er schüttelte amüsiert den Kopf. Natürlich war es geschlossen. Das hatte er eben doch schon kontrolliert. Der Geldbeutel steckte in der Gesäßtasche, das Handy in der Jackentasche, den Schlüssel hielt er in der Hand. Wasserkocher? Ausgeschaltet. Herd? Alles bestens. Wasserhahn in der Küche? Alles bestens. Er ging zurück ins Badezimmer: Fenster zu, Wasser aus, alles bestens. Wieso auch nicht? Das hatte er doch schon kontrolliert. Licht im Arbeitszimmer: aus, Computer: aus, Stereoanlage: aus. Er war für alles allein verantwortlich, da sie mit dem Kleinen zu ihren Eltern gezogen war. Er betrachtete sich im Badezimmerspiegel, versuchte sich an einem Lächeln, schnitt eine Grimasse, griff nach Geldbeutel und Handy, alles bestens. Er öffnete die Haustür, zog sie hinter sich zu, sperrte ab, prüfte zwei Mal, ob sie auch wirklich verschlossen war, sperrte wieder auf und ging ins Badezimmer. Er war für alles allein verantwortlich. Das stimmte. Der Herd war ausgeschaltet, er berührte sicherheitshalber die Platten, alle kalt, der Stecker des Wasserkochers war gezogen, er berührte ihn, alles bestens. Aber dass sie mit dem Kleinen zu ihren Eltern gezogen war, stimmte nicht. Er schaltete das Licht im Badezimmer an, nickte ernst und schaltete es wieder aus. Herzlich willkommen in meinem Erzählungsband Andere Häfen! Ich freue mich sehr, Sie an Bord zu wissen. Inhaltsverzeichnis ist hinten, auf Zitate wird nicht gesondert hingewiesen, der Stecker des Wasserkochers ist gezogen, der Herd ist aus – fangen wir an!
AUF DEM BODEN
Die Wohnungsabnahme nahm kein Ende. Unser Hund hatte sich auf den Balkon geflüchtet, wo er hechelnd in der Sonne lag, während sich die Wohnung von Minute zu Minute mehr mit Menschen füllte. Es waren bereits ein gutes Dutzend Vermieter anwesend und es trafen unaufhörlich weitere ein, wie mir meine Frau, die mit einem Tablett voller Häppchen verloren in der Menge stand, in einem Moment der Panik zuflüsterte. Bald war kein Durchkommen mehr möglich.
„Meine Herren“, versuchte ich mir Gehör zu verschaffen, „die Lackierung des Heizkörpers war schon beim Einzug schadhaft.“
Niemand beachtete mich. Soeben war ein neuer Schwung Vermieter eingetroffen und wurde von den Anwesenden, es mussten inzwischen mindestens fünfzig oder sechzig sein, lautstark begrüßt.
„Meine Herren“, rief ich, „der Spiegelschrank im Badezimmer …“
Jemand rempelte mich an, ich fuhr herum und sah, während ich mich bemühte, nicht das Gleichgewicht zu verlieren, den Arm meiner Frau mitsamt dem Tablett aus dem Leibermeer ragen. Der hochgereckte Arm zitterte, das Tablett neigte sich bedenklich in die Schräge, wieder wurde ich angerempelt. Diesmal von vorn. „Sie stehen uns im Weg“, sagten mehrere Vermieter im Chor. „Machen Sie Platz! Da ist eine Dame, die uns mit Schnittchen milde zu stimmen versucht. Doch uns milde stimmen zu wollen, ist sinnlos. Es bleibt unübersehbar: Die Wohnung ist in einem katastrophalen Zustand!“
Ich öffnete den Mund, um zu einer Rechtfertigung anzusetzen, doch da nahm mir ein klein gewachsener Herr den Mietvertrag aus der Hand und verschwand damit übertrieben armrudernd in der Menge, wo sich eine schmale Gasse geöffnet hatte, die sich hinter ihm wieder schloss wie ein aufrecht stehendes Lippenpaar. Im Gänsemarsch drängten Neuankömmlinge in die Wohnung. Man begrüßte sie mit Jubelrufen. Hände wurden geschüttelt, Schultern wurden beklopft. Um dem nicht abreißenden Strom der Neuankömmlinge Platz in der bis zum Bersten überfüllten Wohnung zu schaffen, wurden an den merkwürdigsten Stellen Türen zu Räumen geöffnet, die ich nie zuvor gesehen hatte. Jemand hielt meinen Kopf eine Weile von hinten fest, aber aus den Augenwinkeln sah ich, wie ein Vermieter auf den Rücken eines anderen kletterte, knapp unter der Decke die Tapete löste und ein rechteckiges Loch in der Wand freilegte, worin mehrere mit bräunlicher Flüssigkeit gefüllte Gläser standen.
„Meine Herren“, rief ich, „meine lieben Herren! Da gibt es einen kleineren Wasserschaden, das gebe ich gerne zu, aber dieses Loch in der Wand ist mir unbekannt. Wir haben, und ich bitte Sie, dies zur Kenntnis zu nehmen, mit diesem Loch nichts zu tun!“ Hilfesuchend sah ich mich nach meiner Frau um, doch die Leiberwalze drängte mich, wobei alle Vermieter Zischlaute ausstießen wie Ganter, die ihre Brut beschützen, aus dem Raum in eine hohe Halle, deren Leere jedoch nur für kurze Zeit wohltuend war, hatte sie sich doch in Windeseile mit Vermietern gefüllt. Ich hob den Blick zur stuckverzierten Decke des Saales und dachte halb befremdet, halb belustigt: Deshalb also die horrend hohen Heizkosten für eine Dreizimmerwohnung. An manchen Stellen war der Stuck schwarz von Ruß. Ein Korken glitt in unmittelbarer Nähe aus einem Flaschenhals. Mehr bekümmerte mich jedoch das ferne Hundegebell. Einige Vermieter lachten, Papier wurde zerrissen, jemand trug eine Wanne auf dem Kopf vorüber, aus der eine trübe, zähe, teigähnliche Masse auf den Boden schwappte.
„Die Dielen im Wohnzimmer“, insistierte ich, die Arme schwenkend wie ein Fluglotse, „waren im Fensterbereich schon beim Einzug abgewetzt und verkratzt. Der Boden müsste an dieser Stelle bloß abgeschliffen werden.“ Jemand rammte mir etwas in den Rücken. Ich drehte mich um, wollte den Rüpel zur Rede stellen, wurde aber zugleich von vielen Händen gepackt und zu Boden gezogen. Das Gesicht auf den Dielen, roch ich feuchtes, vermodertes Holz.
„Meine Herren“, schrie ich, „das ist doch keine Art!“ Ein Fuß setzte sich mir ins Genick, übte gleichmäßig anwachsenden Druck aus. Meine Schneidezähne gruben sich in butterweiche Bodendielen. Wirbel knackten, als ich mich dem Druck widersetzte. Schließlich gelang es mir, den Kopf in eine halbwegs erträgliche Lage zu bringen. Den Geräuschen nach zu schließen, traf gerade ein weiterer Schwung Vermieter ein. Lackierte Schuhe, Hosenbeine mit Bügelfalte, mehr sah ich nicht. Und als die Schuhe von allen Seiten immer näher auf mich zurückten, begriff ich, wie ich enden würde: auf dem verrotteten Boden eines mir gänzlich unbekannten Raums meiner verwüsteten Wohnung, zertrampelt von meinen eigenen Vermietern.
FÜR EIN LESEBUCH DER OBERSTUFE
In ihrem angeborenen Bedürfnis, sich nützlich zu machen, stößt man bisweilen auf die alten Götter. Einmal sah ich Prometheus, der auf dem Bahnsteig der Untergrundbahn für Ordnung sorgte. Etwas größer als ein Normalsterblicher ermahnte er Jugendliche, keine Zigarettenkippen auf die Gleise zu werfen, oder warnte eine Gruppe Rucksackreisender, sich nicht zu nahe an die Bahnsteigkante zu stellen. Hatte er das getan, drückte er sich mit katzenhaft gewölbtem Rücken an die gekachelte Wand, mit der er sogleich zu verschmelzen schien, als wäre die helfende Tätigkeit weit unter seiner Würde und schlimmer, als in Ketten am kaukasischen Fels auf die Wiederkehr des Adlers zu warten.
Dies oder Ähnliches erzählte ich gerade, wie ich mit leichtem Erstaunen feststellte, der jungen Frau, die sich an meinen Tisch gesetzt hatte, da alle übrigen Plätze in dem Café belegt waren. Draußen regnete es in Strömen.
„In Paris“, hörte ich mich weitersprechen, „flüchtete ich einmal vor einem Wolkenbruch unter die Markise eines Cafés und wie ich da zusammen mit anderen Passanten stand und in den Regen starrte, kam auf einmal ein Kellner mit einem Tablett aus dem Inneren des Cafés und servierte uns Gläser gekühlten Eiswassers.“
„Das war bestimmt einer der neuen Götter“, warf die junge Frau lächelnd ein.
„Oh, nein!“, sagte ich und berührte mit unendlicher Wehmut ihren bloßen Unterarm. „Dies war nur ein Kellner, der es gut mit uns meinte.“
Sie wollte etwas entgegnen, unterließ es aber, als sie sah, dass ich mit den Tränen kämpfte. Wir starrten beide aus dem Fenster in den Regen, der seit Tagen fiel, ein kühler Regen, als wäre es schon Herbst. Über uns drehten sich die Ventilatoren.
Unter den Gästen machte sich erst Unruhe breit, als ich aufstand und betont langsamen Schrittes das Café verließ. Und noch in der Drehtür wusste ich, dass mein größter Fehler der war, sie nicht gefragt zu haben, weshalb sie keine Angst vor mir hatte, oder sich, sofern sie Angst hatte, diese nicht anmerken ließ wie ein Kind, das sich mit einem Stöckchen einem schlafenden Hund nähert.
ALS WER WIR ERWACHEN
Es ist jedes Mal ungewiss, als wer wir erwachen. Erwacht Mama als Mama, Papa als Papa und Pauli als Pauli? Oder erwacht Mama als Papa oder Pauli? Oder ist der erwachte Papa in Wahrheit Mama oder Pauli? Und wer ist Pauli beim Erwachen, wenn er nicht er selbst ist? Gerne erwacht Pauli als Mama und lässt sich, wenn Papa und Pauli aus dem Haus sind, ein Schaumbad ein. Manchmal jedoch ist es auf Papas Arbeit auch spannend, vor allem, wenn etwas schiefgeht und alle ausgeschimpft werden müssen. Doch am liebsten erwacht Pauli als Pauli, obwohl er dann zur Schule muss und nie sicher sein kann, ob derjenige, der am Vortag als Pauli erwacht ist, die Hausaufgaben gemacht hat. Seltsam ist es, wenn zwei der drei als Mama und Papa erwachen, bevor Pauli zur Welt kam. Einer von beiden geht dann stets ins Kinderzimmer, um Pauli zu wecken, doch dort steht nur Mamas Hometrainer. Ist Pauli als einer der beiden erwacht, ist ihm die ganze Sache immer ein wenig unangenehm. An solchen Tagen meldet man sich als Papa am besten krank und bleibt bei Mama. Vielleicht lässt man sich gemeinsam ein Schaumbad ein und tut danach etwas, was es Monate später notwendig macht, den Hometrainer in den Keller zu verbannen. Einige Mal wurde Pauli als Mama wach und spürte in sich einen Pauli, der Papa war und sich hin und her warf. „Was hast du?“, fragte Papa, der Mama war. – „Nichts“, sagte Mama, die Pauli war, „das Kind strampelt wie verrückt.“ – „Du nennst es immer das Kind“, beschwerte sich Papa, „das ist doch unser kleiner Pauli!“ Dann füllte er den Flachmann und ging zur Arbeit. Eine Sache gibt es jedoch, die schlimmer als alles ist, nämlich, wenn einer der drei als Pauli erwacht und Mama und Papa sind schon lange tot und derjenige, der heute Pauli ist, schleppt sich ans Fenster und wartet auf den Kleinbus vom Fahrbaren Mittagstisch. Freitags gibt es Fisch, an den anderen Tagen bloß die übliche lauwarme Schonkost. Also ist es ein wenig Glück im Unglück, wenn man als alter Pauli an einem Freitag erwacht und das Essen rechtzeitig kommt, bevor man stirbt.
ANDERE HÄFEN
Im Hafen zu liegen und auf Ladung zu warten, die sich aufgrund von unverständlichen und schikanösen Zollbestimmungen kaum fünfzig Meter entfernt in einer mit Backsteinen ausgemauerten Grube unter Zeltplane türmte, war nichts Neues für uns. Unangenehm war jedoch die Witterung. Alle paar Stunden schickte ich die Mannschaft mit Hacken hinaus aufs Eis, um zu verhindern, dass das Schiff festfror, und wenn sie rotgesichtig ihre tauben Hände am Ofen der Kombüse wärmten, verfluchten sie mich und ihr Los, aber sie hatten, wie sie wahrscheinlich ahnten, keine andere Wahl.
Ich saß fast die ganze Zeit, in mehrere Mäntel und Decken gehüllt, in der Koje und fühlte mich wie ein auf den Rücken gefallener Taschenkrebs, was kein unvertrautes, wohl aber bei dieser Kälte ein schwer zu ertragendes Gefühl war. Bisweilen sah ich meine Eltern, die tadelnd in der Kajüte erschienen, um sie mit staksenden, vogelähnlichen Schritten zu durchmessen. Und einmal erschien ein alter Herr, in dem ich den Vater einer Frau vermutete, die ich vor Jahren verlassen hatte. Er stützte sich mit beiden Händen auf den Knauf seines Stockes und sah mich mehr neugierig als mitleidig an.
„Nun wartest du wieder“, sagte er, indem er seine Unterlippe wie ein Kind benagte, das erwartet, für das, was es sagt, getadelt zu werden.
„Sie werden die Fracht bald freigeben“, sagte ich.
„Es steht schlimm um dich, wenn du schon mit“, er gluckste, „Phantomen redest.“
Ich zuckte die Achseln und wiederholte, da ich dem Vorwurf nichts entgegenzusetzen wusste: „Sie werden die Fracht bald freigeben.“
Der Alte stieß mit dem Stock zornig auf die Planken und rief: „Niemals! Die Fracht, auf die du wartest, freizugeben, ist strengstens untersagt. Man lässt dich warten und nährt deine Hoffnung, aber selbst die Zöllnergehilfen wissen, dass dieses Schiff nie beladen werden darf. Und sie wissen das, weil kein Schiff im Hafen liegt. Deine Eltern versuchten sie vergeblich zu überzeugen, aber als sie schließlich von einem der leitenden Direktoren ans Fenster geführt wurden, mussten sogar sie zugeben, dass das Hafenbecken leer ist. Und wenn nicht einmal deine Verwandten dir helfen können, wer dann?“
Ich zog mir die Decke über den Kopf und lauschte dem dumpfen, mit einem Mal beruhigenden Geräusch der Hacken auf dem vorrückenden Eis. Was ist wichtig?, überlegte ich, bevor sich der Schlaf über mein Bewusstsein stülpte wie ein Kohleneimer. Die Fracht, die ausblieb und möglicherweise nie eintraf, war es jedenfalls nicht.
ZWEI KÄTZCHEN
Kurz bevor ich zum ersten Mal straffällig wurde, brachte mein Pflegevater zwei Kätzchen mit nach Hause. Er kam in die Küche, wo wir gerade zu Abend aßen, und stellte einen zugebundenen Leinensack auf den Tisch: Darin bewegte sich etwas Lebendiges.
„Was soll das?“, fragte meine Pflegemutter in dem Tonfall, den sie immer anschlug, wenn ihr etwas gegen den Strich ging. „Nimm das dreckige Zeug vom Tisch! Wir essen zu Abend.“
„Kätzchen“, erklärte mein Pflegevater, ohne sie anzusehen. „Ich hab’ den Jungs zwei kleine Kätzchen mitgebracht.“
„Die brauchen keine Kätzchen! Bring sie dahin, wo du sie herhast!“
Und so blieb der Sack ungeöffnet. Und so sahen wir nie die beiden kleinen Kätzchen. Wenige Minuten später kehrte mein Pflegevater zurück und hängte, ehe er sich zu uns an den Tisch setzte und sich ein Glas Wein einschenkte, den leeren Sack über die Lehne des freien Stuhls, auf dem bis vor wenigen Wochen Lina gesessen hatte. Wir aßen schweigend weiter. Mein Pflegevater hatte frische Kratzer auf beiden Handrücken. In der Nacht, als ich im Bett lag und meine Stiefbrüder schon schliefen, erfüllte mich plötzlich ein Gefühl, das ich anfangs nicht einordnen konnte. Aber kurz bevor ich einschlief, begriff ich, wie sehr es mich mit einer tiefen, düsteren Zufriedenheit erfüllte, dass die Kätzchen sich gewehrt hatten.
KÜHLES GLAS
Zu meinem Fünfzigsten erschien ein von verhaltenem Wohlwollen getragener Geburtstagsartikel in der hiesigen Lokalzeitung, etwa achtzig weitgehend kenntnisfreie Zeilen, die ein Porträtfoto verunstaltete, auf dem ich wie ein feister Hamster aussah. Am Tag danach rief sie zum ersten Mal an. Ich meldete mich, wie ich es seitdem nicht mehr tue, mit Vor- und Nachnamen, wartete eine Weile ab. Schließlich sagte eine Stimme, die ich einer jungen – und attraktiven – Frau zuordnete: „Ich wollte Ihre Stimme hören.“
Ich versuchte, die Sache von der humoristischen Seite zu nehmen, und erwiderte lachend: „Zumindest das ist Ihnen ja jetzt gelungen!“
„Was?“, fragte sie.
„Was?“, fragte ich zurück.
„Was“, sie schrie fast, „ist mir jetzt gelungen?“
Mir wurde bewusst, dass ich die Situation weder beherrschte noch durchschaute. Ich legte die Hand flach auf die Rauputztapete, dachte nach. „Nun“, begann ich großväterlich (und fühlte mich dabei wie der fette Hamster auf dem Foto in der Zeitung), „Sie sagten mir doch eben, Sie hätten meine Stimme hören wollen. Und ich … äh … wies Sie sodann lediglich darauf hin, dass Sie sie jetzt hören.“
Am anderen Ende der Leitung wurde leise geatmet. Dann nach einem Seufzer fragte die Frau mit leicht schneidendem Unterton: „Waren Sie 1994 mal mit einer Frau aus Trier befreundet? Bitte antworten Sie ehrlich!“
Ich unterbrach die Verbindung. 1994, nach einer Vernissage, war es, wie soll ich es ausdrücken, ohne den fürchterlichen Begriff „One-Night-Stand“ zu verwenden … also nach dieser Vernissage in Trier hatte ich die Nacht mit … was, fragte ich mich, wenn es sich bei der Anruferin um meine zwanzigjährige Tochter handelte, von deren Existenz ich bisher weder geahnt noch gewusst hatte?
Zwei Tage später rief sie wieder an. Und wieder eröffnete sie das Gespräch mit der Feststellung, sie habe meine Stimme hören wollen.
„Woher haben Sie diese Nummer?“, fragte ich.
„1994“, sagte sie. „Nach der Eröffnung Ihrer Ausstellung in Trier. Die Ausstellung, in der Sie zum ersten Mal Ihre Arbeiten aus Gips …“
Ich unterbrach die Verbindung, ging ins Wohnzimmer, schenkte mir einen Likör ein, dann einen weiteren und machte mich, nach einem Kontrollblick in beide Kinderzimmer, wieder an die Arbeit. Längst arbeitete ich nicht mehr mit Gips. Das war ein Irrweg! Sowieso ist alles Dreidimensionale ein Irrweg, weil kein Künstler versuchen sollte, die Natur zu übertreffen. Seit vielen Jahren zeichnete ich nur noch und auch das erschien mir inzwischen zu kompliziert. Mir schwebte eine Kunst vor, die sich in ihrer völligen Schlichtheit der Natur Untertan macht und sie so durch, nennen wir es mal, Bescheidenheit, übertrifft. Damals in Trier … ich wünschte, ich könnte alles, was damals passiert ist, ungeschehen machen!
Die folgenden Tage verliefen ohne Belästigung. Fast erleichtert fiel ich in den üblichen dumpf-betäubenden Trott zwischen Atelier und Kinderbelustigung zurück, aber am Samstagabend, als ich mich längst in Sicherheit wiegte, klingelte zu einer Unzeit das Telefon. Ich wusste sofort, dass sie es war.
„1994“, sagte sie.
„Was wollen Sie von mir?“, fragte ich und beinahe hätte ich entschuldigend hinzugefügt: „Damals in Trier war ich sehr betrunken gewesen.“
„1983“, sagte sie.
Ich ließ den Hörer sinken, merkte, dass mein Mund offen stand, hob den Hörer langsam ans Ohr. „Was meinen Sie mit 1983?“
Sie antwortete: „Eine Wohnung ohne fließendes Wasser über einer Autowerkstatt.“
Mir stockte der Atem. Das, worauf sie, und da gab es keinen Zweifel, anspielte, hatte ich nur einem einzigen Menschen erzählt und der war seit Jahren tot. Ich zog mit der Fingerkuppe die sich verzweigenden Grate des Rauputzes nach. Dann fragte ich mit einer Stimme, die seltsam hohl klang: „Wer sind Sie?“
„Schau’n Sie aus dem Esszimmerfenster!“, sagte die Frau.
Draußen, auf der anderen Straßenseite, unter einer Laterne, stand jemand. Ich setzte die Brille auf, die vor meiner Brust baumelte. Unten auf dem Bürgersteig stand eine ältere Frau. Eine Frau in meinem Alter. Sie sah zu mir hoch. Sah hoch zu einem dicken, erschrockenen Nagetier, das am erleuchteten Fenster stand. In der einen Hand hielt sie ein Mobiltelefon, in der anderen ein großes Küchenmesser. Ich vollführte eine beschwichtigende Geste. Doch schon legte die Frau die Klinge an ihre Kehle und zog sie mit einer raschen, fast triumphierenden Bewegung zur Seite. Ich hörte, wie ihr Handy aufs Pflaster schlug, dann unterbrach ich die Verbindung, als ob das zu diesem Zeitpunkt noch Sinn gehabt hätte. Mit einer Behutsamkeit, als würde ich ein Ei in kochendes Wasser senken, legte ich den Hörer hinter mir auf die Anrichte, nahm die Brille ab und presste die Stirn an das Glas der Fensterscheibe.
Oft vergisst man, wie angenehm kühl Glas sein kann.
DAS MUSEUM ZU KNOSSOS
Er hatte die Geschichte nie niedergeschrieben. Oh, wie gut hätte sie in den Band Der Garten der Pfade, die sich verzweigen gepasst! Diese Geschichte nicht niederzuschreiben, war für ihn, wie eine Wanderung zu einem reizvollen Ort so lange aufzuschieben, bis man auf einmal feststellen muss, dass es diesen Ort seit Ewigkeiten nicht mehr gibt. Trotzdem kam es ihm vor, als hätte er die Geschichte irgendwann einmal geschrieben, in einem Traum, einem anderen Leben, als ein anderer, der doch er selbst war. Motivisch hätte sie sich nahtlos und nicht ohne Eleganz zwischen Die Lotterie in Babylon (nichts als Zufall gestaltet unser Dasein) und Die Bibliothek von Babel (die Welt ist eine Bibliothek) eingefügt. Es ist hier leider nicht der Ort, über die Gründe zu spekulieren, weshalb er nie Das Museum zu Knossos schrieb, einen im sachlichen Ton gehaltenen Bericht über jenes riesige Museum, von dem schon der Bildhauer Apollodoros in einem Fragment berichtet. Das Museum, erfährt man dort, „stellte Verschiedenes mit dem Anspruch der Vollständigkeit aus“. Offenbar kennzeichneten Tontäfelchen die Exponate. Eines Tages jedoch beschloss ein Fürst oder eine Gruppe von Fürsten, die erklärenden Tontäfelchen zu entfernen, damit „das Staunen ohne Grenzen“ sei. Von nun an war für die Besucher nicht mehr ersichtlich, wie die Künstler hießen, die für die Ausstellungsstücke verantwortlich zeichneten. Und auch das, was die Kunstwerke darstellten, befand sich von nun an im Bereich der Mutmaßung. Dennoch erfreute sich das Museum eines großen Zustroms von Besuchern, die zum Teil von weither angereist kamen. So erwähnt Apollodoros beispielsweise einen König mit Haut wie Lavagestein oder einen Krieger mit einem Bart, der „als lodernde Flamme“ vom Kinn auf den Brustpanzer hing, „ohne das Metall zu schmelzen“. Wie es zu der zweiten großen Veränderung des Museums kam, ist hingegen ungewiss. Jedenfalls tauchten plötzlich zahlreiche neue Ausstellungsstücke auf, über die niemand zu sagen vermochte, ob sie der Fürst oder ein geheimes Konsortium angekauft oder ob sie einige der Wärter absichtlich oder unabsichtlich platziert hatten. Der Gang durch das Museum war, so Apollodoros, „wie vor der Sphinx zu stehen und sie reden zu hören“, womit er bildhaft ausdrückt, dass es für den Besucher nicht mehr klar begreiflich war, ob er überhaupt ein Exponat bewunderte, wenn er staunend vor etwas innehielt. Des ungeachtet erfreute sich das Museum zu Knossos auch weiterhin größter Beliebtheit. Wir wissen von Aristoteles, dass er sich erst nach einer Reise nach Kreta reif dazu fühlte, seine Gedanken vor Publikum zu äußern. Doch die Geschichte ist hiermit noch nicht zu Ende. Ob die Wärter mit ihren Familien in die Räume des Museums einzogen und dort offene Feuer entfachten, um die sie allabendlich saßen und sangen, ist ungewiss. Ungewiss ist auch, ob das Konsortium eines Tages tatsächlich beschloss, die Mauern einzureißen. Vermutlich war es eher so, wie es bei Raimundus Lullus heißt: Die Mauern des Museums stürzten ein, die Räume wurden endlos. Was war die Folge? Der Besucher des Museums konnte seitdem nie sicher sein, ob er sich noch im Museum befand und, weitaus bedeutender, ob das, vor dem er andächtig staunend verharrte, ein Exponat war oder „etwas anderes“ (Robert Louis Stevenson). Und Reiche vergingen, Paläste wurden zu Trümmern, zu Staub, den der Wind davontrieb, dann vergessen, aber das Museum blieb bestehen. Dachte er als alter Mann an die nie aufgeschriebene Geschichte, sah er stets den letzten Satz, sah ihn so deutlich vor Augen, als hätte er ihn seiner Sekretärin diktiert: An jenem Abend im Jahr 1939 stieg ich aus der Straßenbahn, flanierte in der Müßigkeit des Ortsfremden durch die Stadt und blieb sinnend vor etwas stehen, von dem ich nicht wusste, ob es ein Mülleimer oder eine Zierurne oder etwas anderes war.
MAGST DU MICH?
Die Wahl zum Präsidenten der Insel veränderte meinen Tagesablauf in einigen wenigen, entscheidenden Punkten. Kostümierte Lakaien weckten mich um 6.30 Uhr, wuschen mich mit in warme Kokosmilch getauchten Schwämmen, applaudierten bei der Verrichtung des Morgenstuhls (6.45 Uhr), parfümierten mich, kleideten mich an und reichten mir um 6.49 Uhr die Maske, hinter der ich mich ab 7.15 Uhr allmählich wohlzufühlen begann. Nach einem kleinen Frühstück am Schreibtisch brachte man mich in der Sänfte zum Richtplatz. Richten bis 10.30 Uhr. Kopulation. Regierungsgeschäfte am Schreibtisch. Reichhaltiges Mittagessen mit anschließendem Stuhlgang um 12.15. Danach lange Gespräche mit der Maske bis zum Sonnenuntergang.
„Bist du glücklich?“
„Ja“, sagte ich.
„Magst du mich?“, fragte die Maske.
„Natürlich“, sagte ich – aber was hätte ich denn anderes sagen sollen? Ich war doch Präsident der Insel! Abends trennten sich gegen 21.45 im Sommer und 22.45 Uhr im Winter unsere Wege. Ich las die Klassiker oder dilettierte in allegorischer Dichtung, und die Maske begann ihren Streifzug durch die übel beleumundeten Viertel der Hauptstadt, um in Kontakt zu meinen Untertanen zu bleiben.
Um Punkt 24 Uhr ging ich zu Bett.
DAS AUGE DER SPHINX
„Was sind wir?“, fragte er mit diesem überlegenen Lächeln, das seine Reden begleitete, sobald er sicher war, nicht mehr verstanden zu werden. Nichtsdestotrotz sahen wir ihn erwartungsvoll an, hörten wir ihn doch nach wie vor gerne sprechen und schätzten ihn für all das, was er glaubte, nicht zu sein – und dennoch für uns war. „Was sind wir denn anderes“, fuhr er lächelnd fort, „anderes“, wiederholte er, „als eine Sammlung von Eindrücken, ein Album voller Collagen, die man staunend betrachtet: Das weiche Polster, auf dem ich sitze. Das Abteil, aus dessen geöffnetem Fenster ich hinausschaue. Die Dackel auf dem Bahnsteig – oder sind das da draußen Ratten? Der Mann mit dem Bowler und dem Vogelgesicht. Die Silhouette des Mont-Saint-Michel am Horizont. Die bloßen Beine der Schlafenden, unter deren zu kurzen Rock man, wie ihr sicher selbst schon bemerkt habt, sehen kann. Meine Schuhe auf dem schraffierten Boden.“ – Wir warteten geduldig, dass er weitersprach, doch anstatt die Lektion fortzuführen, hob er die rechte Hand und spreizte die Finger. Dann ballte er die Hand zeitlupenlangsam zur Faust und schüttelte sie, als wollte er ein gefangenes Insekt benommen und fluchtunfähig machen. Erst dann entließ er uns mit einem Kopfnicken. Es war, wussten wir, höchste Zeit, ins Bett zu gehen und darauf zu warten, dass der Schlaf Seite um Seite des Albums umblätterte, dessen Bilder so stark mit Bedeutung aufgeladen waren, dass jedes Blatt aus sich selbst heraus zu leuchten schien.
DIE ERSTE GESCHICHTE
Am zweiten Tag auf dem Dach stießen wir auf einen anderen Trupp, eine Gruppe zerlumpter Frauen und Kinder, die im Schatten eines Schornsteins lagerte. Als sich Johann, der damals unser bester Späher und Fährtenleser war, den Lagernden näherte, hoben sie die Hände, als wollten sie einen bösen Zauber abwehren. Hinter mir drängten sich die Kinder zusammen wie aus dem Nest gefallene Vögel.
„Johann!“, rief ich. „Frag sie, wie lange sie schon unterwegs sind!“
„Sie reden nicht mit mir“, rief Johann über die Schulter. Er hatte uns den Rücken zugekehrt, die Fremden sahen ihn ausdruckslos an und streckten ihm die Handflächen entgegen. Nach einer Weile spuckte Johann zur Seite aus und kehrte zu uns zurück.
„Die Kinder sind müde“, klagte die Frau mit dem Kropf, die sich uns am späten Vormittag angeschlossen hatte.
„Gehen wir weiter!“, sagte ich, hob die Standarte und hörte, wie der Trupp sich hinter mir murrend in Bewegung setzte.
In den folgenden Tagen begegneten wir niemandem mehr auf unserem Marsch über die Dachschrägen und Betonflächen. Manchmal stießen unsere Vogeljäger auf die Reste von Lagerfeuern. Einmal fanden wir einen ausgeweideten Leichnam, der sich allerdings in einem so fortgeschrittenen Zustand der Verwesung befand, dass man nicht sagen konnte, ob die Verstümmelungen das Werk anderer Wanderer oder das der allgegenwärtigen Raben waren. Einige in unserem Trupp hatten bereits damals, was mich mit Sorge erfüllte, begonnen, die Raben um Hilfe zu bitten und ihnen, wenn sie glaubten, ich sähe es nicht, kleinere Opfergaben darzubringen. Als wir dem Trupp mit den zerlumpten Gestalten ein zweites und möglicherweise letztes Mal begegneten, hatten die Kinder, die uns begleiteten, ihrerseits Kinder bekommen. Johanns Ältester, der nach dessen Absturz das Amt des Spähers und Fährtenlesers innehatte, näherte sich den Gestalten, die im Sonnenlicht über das Ziegeldach verteilt lagen wie vom Himmel gefallene Seesterne, und streckte ihnen dabei abwehrend oder vielmehr beschwörend die Handflächen entgegen, wie es ihn die Raben gelehrt hatten.
IM KELLER DES UHRMACHERS
Es war einmal ein kleines Märchen, das lebte mit seinen Eltern in einem prächtigen Haus in der Hauptstadt des Reiches. Wie bei allen jungen Märchen war seine Handlung verworren: Es handelte, so viel war gewiss, von einer schönen Prinzessin, die sich in zahlreichen Prüfungen bewähren muss, um als Belohnung einen tapferen Prinzen zum Gemahl nehmen zu dürfen. Allerdings war die Art der einzelnen Prüfungen unklar (das Märchen war ja noch sehr klein) und der tapfere Prinz war nicht einmal aufgetreten. Aber die Zeit, wussten die Eltern des Märchens, würde alles zum Guten wenden, denn so war das immer schon gewesen. Das Haus, in dem das kleine Märchen lebte, hatte keine Fenster (so wohnen Märchen am liebsten, weil sie so ganz bei sich sind), doch aus einem Grund, den keiner kannte oder kennen wollte, gab es gleichwohl ein Zimmer mit einem Fenster zur Straße. Natürlich war die Tür dieses Zimmers stets verschlossen. Der Vater des Märchens, ein sehr strenges Märchen mit religiöser Moral, und seine Mutter, ein eher weitschweifiges Märchen voller unlogischer Wendungen und alberner Rätsel, liebten ihr Kind so sehr, dass sie ihm verboten hatten, den Raum mit dem Fenster zu betreten. Aber eines Tages, als die Eltern Mittagsschlaf hielten, nahm das kleine Märchen den Schlüssel vom Haken, schlich sich hinauf, öffnete die Tür und sah aus dem Fenster. Draußen kämpften zwei Bettelknaben um eine Rübe. Erst schubsten sie sich, dann schlug der eine den anderen nieder, entwand ihm die Rübe und schritt triumphierend von dannen, wobei er mit Genuss das Diebesgut verzehrte. Am nächsten Tag schlich sich