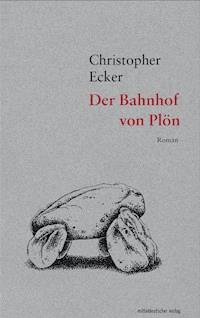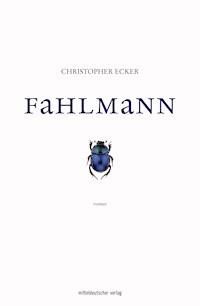Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Provokativ, hintergründig und boshaft-komisch Vom Feuilleton hoch gelobter Autor Deutsche Gegenwartsliteratur vom Feinsten Literatur wie Dynamit – mind-blowing! Kunstpreis des Saarlandes und Friedrich-Hebbel-Preis u. a. Christopher Eckers Literatur gilt als spannend, provokativ und hintergründig, aber er hat auch eine boshaft-komische Seite – und diese kommt in seinem neuen Roman »Herr Oluf in Hunsum« voll zum Tragen. Während seine beiden letzten Romane herausragende Beispiele für literarische Phantastik sind, kehrt Ecker jetzt in eine Realität zurück, die sich als ähnlich abgründig erweist – aber mit mehr Ironie aufwartet. Mit seinem »Herrn Oluf« ist Ecker nicht nur in psychologischer Hinsicht das überzeugende Porträt eines zutiefst verunsicherten Mannes gelungen, dem alle liebgewordenen Gewissheiten entgleiten. Außerdem unterzieht der Autor in diesem Buch auch den akademischen Betrieb einer schonungslosen Bestandsaufnahme. Du hättest nicht fahren dürfen! Und zwar nicht, weil du dich derart blamiert hast, dass man dich nie wieder zu einem Kongress einladen würde und du dir vermutlich eine neue Stelle suchen müsstest, sondern weil du Frau und Kind, beide krank, alleine zu Hause zurückgelassen hast. Dennoch fährst du, Professor Oluf Sattler, zu diesem Kongress nach Norddeutschland und der wird weit schlimmer, als du es dir ausgemalt hast. Du machst dich lächerlich, verstrickst dich in einem Gemenge aus alter und neuer Schuld und gerätst auf der grotesken Heimfahrt zu allem Überfluss noch in einen Mordfall. Der könnte zwar peinlicher nicht sein, öffnet dir aber dennoch die Augen für alles, was dir im Leben wesentlich ist – und was du bislang souverän beiseite gewischt hast. Christopher Ecker legt mit »Herr Oluf in Hunsum« ein außergewöhnliches Buch vor, das je nach Blickwinkel ein sehr komischer tragischer Roman oder ein sehr tragischer komischer Roman ist. Spannend und irritierend zugleich, geht es um Verantwortung, späte Sühne und die Frage, wie man als Philosoph berühmt wird, wenn man alle Skrupel fahren lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Herr Oluf in Hunsum
Du hättest nicht fahren dürfen! Und zwar nicht, weil du dich derart blamiert hast, dass man dich nie wieder zu einem Kongress einladen würde und du dir vermutlich eine neue Stelle suchen müsstest, sondern weil du Frau und Kind, beide krank, alleine zu Hause zurückgelassen hast. Für das Institut indessen ist deine Teilnahme von größter Wichtigkeit, geht es doch um das „Abstauben von Fördergeldern“, ohne die, wie Professor Götzloff nie zu betonen müde wird, an ernsthaftes akademisches Arbeiten nicht zu denken ist. Diesmal hat man dich auserkoren (zum zweiten Mal in sieben Jahren), um in einem zehnminütigen Impulsvortrag das „gewohnt hohe Niveau der geförderten Forschungsarbeit zu demonstrieren“, „eine reine Formalie“ (auch wieder Götzloff), damit der Geldhahn weiterhin aufgedreht bleibt. Da dies nicht nur für deine berufliche Zukunft, sondern auch – und das macht es kaum besser! – für den Fortbestand des Instituts von größter Bedeutung ist, hat dich die Erkrankung von Frau und Kind, ausgerechnet am Vorabend der Abreise, in ein klassisches Dilemma gestürzt wie eine kegelförmige Spielfigur mit Murmelkopf, die vom Schicksal, dem launigen, dem Zufall, dem lustigen, oder mit voller Absicht angehoben und in eines dieser Fallbeispiele gesetzt wird, die in der Moralphilosophie ersonnen werden, um Oberschüler und Erstsemester zu tyrannisieren: Bleibst du daheim, ist das ein Fehler, fährst du zu dem Kongress, ist auch dies ein Fehler, und obwohl beide zur Wahl stehenden Optionen offenkundig falsch sind, musst du dich dennoch für eine von ihnen entscheiden.
Überholspur, Autobahn, helllichter Tag. Im linken Seitenspiegel des Wagens vor dir scharf umrissen und gleichsam aus sich selbst heraus leuchtend die Teilansicht eines Frauenantlitzes, überirdisch schön wie geschnitten aus einem Gemälde von Vermeer. Du bist den Tränen nahe. Neben dir auf dem Beifahrersitz des Mietwagens steht, eine plumpe Anklage, die lederne Reisetasche; obenauf liegt in einer Folienmappe die bescheuerte Rede. „Sehr geehrte Damen und Herren“, sagst du leise, „es ist mir eine große Ehre, Ihnen heute einen kleinen Überblick …“ Große müsstest du ein wenig übertrieben betonen. Kleinen müsstest du ebenfalls ein wenig übertrieben betonen. Jedoch kleinen, beschließt du, ein kleines wenig mehr als große. Das käme beim Auditorium sicherlich gut an, vermittelte diese offensive Witzelei doch den Eindruck sympathischer Bescheidenheit. „Es ist mir eine große Ehre“, sagst du selbstsicherer und fädelst dich nach einem knapp missglückten Überholmanöver wieder in den Verkehr auf der rechten Fahrspur ein, „Ihnen heute einen kleinen Überblick darüber zu geben, was wir … ach, du lieber Gott!“ Vielleicht wirst du erst übermorgen erfahren, was gerade daheim los ist, nämlich genau in dem Augenblick, wenn du die Tür aufsperrst, um mit schräg geneigtem Kopf ins Haus hineinzuhorchen, während du dich der Schuhe entledigst.
Du schaltetest das Radio ein und sofort wieder aus.
Auf einem würfelförmigen, grün gestrichenen Stromkasten am Straßenrand wartet ein Falke in lauernd geduckter Haltung auf die Autobahn kreuzendes Kleingetier: Kaum noch Vogel, fast die Jagd selbst.
Bei einem Becher Tee bist du gestern Abend das Skript der Rede durchgegangen. In aller Ruhe hast du Pausen markiert und stilisierte Augen an Stellen gemalt, an denen du bedeutungsvoll den Blick ins Auditorium heben willst, da hat sich hinter dir die Tür des Arbeitszimmers geöffnet.
Den Becherrand an der zugbrückenhaft gesenkten Unterlippe drehst du dich um. Im Türrahmen lehnt deine Frau. Ihre Augen glänzen.
Erst denkst du, Miriam hätte geweint, und überlegst, was du denn nun schon wieder falsch gemacht hast, aber schnell wird dir klar, dass sie Fieber hat. An ihren Schläfen kleben Haarsträhnen und sie trägt anstelle eines Nachthemds eine Jogginghose, die du nicht kennst, und den Wollpullover mit den Löchern an den Ellenbogen, den sie nur zur Gartenarbeit anzieht.
„Der Kleine“, sagt sie.
„Was ist mit dem Kleinen?“
„Er hat Fieber. Nicht schlimm. Ich hab ihm ein Zäpfchen gegeben.“
Das, was du als Nächstes sagst, muss sorgfältig abgewogen werden. Daher stellst du erst einmal den Becher auf den Schreibtisch. Sodann setzt du eine hoffentlich besorgt wirkende Miene auf und fragst: „Und wie geht es dir?“
„Fieber“, sagt Miriam und fixiert den Schirm der Deckenlampe.
„Du hast auch Fieber?“, fragst du, als zähltest du jedes Wort einzeln ab.
„39,3“, antwortet sie in bitterer Zufriedenheit.
Die Temperaturangabe stürzt dich in derart panische Konfusion, dass du, ohne nachzudenken, erschrocken ausrufst: „Kann ich morgen fahren?“
„Das musst du selber wissen!“, sagt sie und schlägt die Tür zu.
Wo ist sie bloß! Sie müsste doch bei der Geldbörse und dem Schlüssel in der Schale … nein, seltsam … in der Küche ist sie auch nicht … halt, du hast sie doch vorhin, ehe du ins Bad gegangen bist, um dir die Hände zu waschen … ah, richtig, da ist sie ja! Du legst das schuppige Lederarmband ums Handgelenk, fummelst den Dorn der Schließe ins Loch, bevor du einen Blick aufs Zifferblatt riskierst. Kurz nach elf. Viel zu spät, um noch Götzloff anzurufen. Und außerdem: Was willst du ihm denn sagen? Etwa: „Ich kann morgen nicht zu dem Kongress fahren, meine Frau ist krank, das Baby ist krank, jemand muss sich doch um meine Frau kümmern und um das Baby muss ich mich doch auch kümmern, ich kann wirklich nicht zu dem Kongress, sie haben beide Fieber, hohes Fieber, könnten Sie vielleicht bitte fahren oder wäre es möglich, dass Frau Dr. Schauper hinfährt, ich könnte ihr auch meinen Vortrag leihen, nein geben, sie kann ihn gerne halten, meinen Vortrag, den … Impulsvortrag, sie kann ihn sehr gerne haben und halten, Frau Dr. Schauper müsste ihn sich allerdings bei mir zu Hause abholen, denn meine Frau und mein Kind sind ja beide krank, sehr krank, sie haben, aber das sagte ich bereits, Fieber, hohes Fieber, ich kann das Haus, das verstehen Sie doch sicherlich, Herr Götzloff, Sie haben doch selbst Kinder, nicht verlassen, auf gar keinen Fall kann ich weg, oder bessere Idee, hören Sie bitte: Ich könnte auch Ihnen meinen Vortrag …“
Nein, es ist undenkbar, absolut undenkbar, dass du nicht fährst!
Du legst das Gesicht in die erstaunlicherweise nach Waldboden riechenden Handflächen. In dieser Haltung verharrst du einige Minuten über den Schreibtisch gebeugt. Wieso Waldboden?, wunderst du dich nach geraumer Zeit, und doch riechen deine Handflächen eindeutig nach Kastanien, Walnüssen, Erde, Pilzen und vergammeltem Laub. Du hebst den Kopf und betrachtest, nachdem sich dein Blick geklärt hat, die Bücher. In offener Feindseligkeit haben sie sich von dir abgewandt: Die Arme grimmig vor der Brust verschränkt, stehen sie Rücken an Rücken in den Regalen. Sie können oder wollen dir nicht helfen. Früher hast du gerne gelesen, nun aber leidest du darunter, lesen zu müssen. Immerzu musst du lesen, Buch um Buch, um über das Gelesene oder Quergelesene schlaue Sachen zu sagen oder zu schreiben. Lesen, reden, lesen, schreiben, nie, aber auch wirklich niemals lesen, um zu lesen. Ich muss fahren, denkst du. Mir bleibt nichts anderes übrig.
Du gehst ins Bad, wäschst dir lange das Gesicht wie eine Figur in einem Spielfilm. Die Tür des Schlafzimmers ist geschlossen. Miriam hat das Baby bei sich. Du klopfst leise an. Im Zimmer bleibt es still. Behutsam öffnest du die Tür, verharrst auf der Schwelle, lehnst dich unbeholfen, was dich an Jasper denken lässt, an den Türrahmen, schluckst laut, beginnst zu reden. „Ich muss fahren“, sagst du. „Es tut mir so leid, aber ich muss fahren.“
Miriam gibt keine Antwort, hat dir den Rücken zugekehrt. Das Baby liegt neben ihr und schläft. Es schnarcht leise und hat rote Wangen.
„Ich verliere sonst den Job.“
Keine Antwort.
„Wäre das irgendein x-beliebiger Vortrag, würde ich ihn sofort absagen. Aber das ist eine Sache, die ich einfach nicht canceln kann.“ Canceln, denkst du, ich habe eben „canceln“ gesagt, was ist bloß los mit mir? „Mir sind die Hände gebunden“, hörst du dich stockend und mit stark bebender Stimme weitersprechen, hättest auch diese Phrase gerne ungesagt gemacht, denn mit einem Schwung, der dich erschreckt, wirft Miriam sich aus dem Ehebett, kommt schwankend auf dem Vorleger zu stehen und zeigt auf dich. Doch sie schreit dich nicht an. „Fahr!“, sagt sie tonlos, was viel schlimmer als Gebrüll oder Vorwürfe ist, und lässt in dramatischer Langsamkeit oder schierer Kraftlosigkeit den Arm mit dem anklagend ausgestreckten Zeigefinger sinken. Da sie aussieht, als hätte sie sich gerne an etwas festgehalten, bietest du ihr impulsiv deinen angewinkelten Arm an. Sie bedenkt dich mit einem mitleidigen Blick und legt sich wieder hin.
„Miriam“, sagst du.
Sie schüttelt den Kopf.
„Miriam, du kannst doch nicht …“
Sie schließt die Augen. Unter ihren Lidern bewegen sich die Augäpfel, als rollten sie von elektrischen Impulsen getrieben hin und her.
Um wieder halbwegs klar denken zu können, flüchtest du dich in deinen allabendlichen Kontrollgang durch die Wohnung. Die Küche ist in Ordnung. Das ist gut. Im Arbeitszimmer ist auch alles in Ordnung. Gut. Du trinkst den Tee aus, trägst den Becher in die Küche, wo noch immer alles in Ordnung ist, und räumst ihn in die Spülmaschine. Im Wohnzimmer läuft der Fernseher. Das ist nicht gut. Du suchst nach der Fernbedienung, findest sie schließlich unter einer aufgeschlagenen Zeitschrift auf dem Sofa, schaltest ihn aus. Jaspers Zimmer ist aufgeräumt. Gut. Jaspers Zimmer ist jedoch leer und aufgeräumt und das, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut!
Dein ältester Sohn, fällt dir nämlich wieder ein, ist auf Klassenfahrt und muss morgen am Bahnhof abgeholt werden. Mit einem animalischen Wimmern sinkst du auf sein gemachtes Bett. Miriam kann ihn nicht abholen. Sie hat Fieber. Aber irgendjemand muss ihn doch morgen am Bahnhof abholen! Vielleicht, überlegst du, ist es ja doch machbar. „Miriam“, würdest du aufmunternd sagen, „das ist bloß eine kurze Fahrt. Das schaffst du! Du packst das Baby in den Maxi-Cosi, und wenn ihr wieder zu Hause seid, hilft dir Jasper sicher beim Reintragen. Er kann dir ja auch eine Kleinigkeit zum Abendessen einkaufen. Irgendein Fertiggericht. Suppe, Tiefkühlpizza. Oder noch besser, du bestellst Pizza beim Lieferdienst. Für dich und Jasper. Das Baby kriegt Brei und die Großen essen Pizza.“
Da springt eine nächste Erkenntnis aus dem Nichts in den Boxring und schlägt direkt zu: Womit soll Miriam den Jungen denn abholen? Du fährst doch mit eurem Auto zu dem beschissenen Kongress.
Kein Auto. Miriam hat kein Auto, um Jasper abzuholen.
„Mietwagen“, murmelst du, „Mietwagen, Mietwagen …“
Nähmst du einen Mietwagen, könnte Miriam den Jungen bequem mit dem Auto abholen. Vorausgesetzt, sie wäre in der körperlichen Verfassung dazu. Aber mit dem Baby muss sie morgen ohnehin zum Kinderarzt. Gleich um acht Uhr ab in die Praxis. „Mein Kind, mein Kind …“ – „Ihrem Kind geht es gut. Es braucht nur Ruhe und frische Luft.“ Pause, Erholung, Wecker stellen, kleines Schläfchen mit dem Baby. Und nachmittags sind sie beide dann fit genug, um Jasper am Bahnhof abzuholen. „Hast du geraucht?“ – „Nein.“ – „Du hast wohl geraucht!“ – „Ich doch nicht!“ – „Und wieso riechen deine ganzen Kleider nach Zigarettenrauch?“ – „Das waren die anderen. Jannis und Moritz. Die haben im Zimmer geraucht, ich nicht.“ Würde sie ihm glauben? Du würdest es vielleicht. Jasper ist vernünftig. Jedenfalls meistens. Er kann ihr auf jeden Fall beim Reintragen helfen. Ist ja nicht viel zu schleppen. Bloß der Maxi-Cosi, in dem das Baby keucht, und die Wickeltasche. Den Rucksack mit den nach Tabak stinkenden Klamotten hat Jasper auf dem Rücken. Und wenn Miriam auch zum Arzt muss? 39,3 Grad sind kein Pappenstiel. Im Mund gemessen? Das Baby röchelt besorgniserregend und sagt, als Jasper es eine Spur zu ruppig aus der Plastikschale nimmt, leise und vorwurfsvoll etwas, das wie „Ökre?“ klingt. Stopp! Das bringt alles nichts! Stopp!
Du atmest tief ein und aus.
Jetzt muss erst einmal der Mietwagen her!
Laptop suchen, finden, hochfahren. Kaum hast du den Wagen bestellt, nimmt ein durchaus brauchbarer Plan Konturen an: Um fünf Uhr in der Frühe willst du aufstehen, gegen halb sechs ein Taxi anfordern, um Punkt sechs dann den Wagen bei der Autovermietung abzuholen. Frühstücken wirst du unterwegs an einer Autobahnraststätte. Rührei, Brötchen, was es da so gibt. Blick auf die Uhr: Zum Schlafen bleiben dir noch vier Stunden.
Vorsichtig klopfst du an die Schlafzimmertür.
Keine Antwort.
Du öffnest sie dennoch.
Miriam scheint nicht zu schlafen. Das Baby liegt zu ihrer Rechten wie ein Semikolon. Wenigstens es schläft.
„Miriam?“
Keine Antwort.
„Wie geht es dir?“
Keine Antwort.
„Kann ich morgen fahren?“
Keine Antwort.
„Zu dem Kongress … Kann ich morgen bitte fahren? Kann ich morgen zu dem Kongress fahren? Hast du noch Fieber?“ Du fasst an Miriams Stirn, die sich heiß und nass anfühlt wie ein frisch gespülter Porzellanteller. „Ich will ja nicht rumnerven. Äh, weißt du noch, dass Jasper …“
„Lass mich!“, sagt sie.
„Ich wollte nur …“
„Lass mich in Ruhe!“
„Ich … ich schlaf in Jaspers Zimmer“, sagst du schnell und ziehst die Tür zu. Kurz bevor sie ins Schloss fällt, hältst du inne und hörst dich hysterisch plappern: „Soll ich bei dem Kleinen mal Fieber messen? Oder lassen wir ihn besser schlafen? Sobald er wach ist, musst du aber sofort Fieber bei ihm messen. Ich könnte mir den Wecker stellen und dann komme ich in zwei Stunden noch mal nach euch kucken. Ich kann ja danach noch zwei Stunden schlafen. Das Taxi kommt so gegen viertel vor sechs. Und falls er Fieber hat, dann könnten wir … Hast du eigentlich noch mal Fieber gemessen? 39,3 Grad ist eine Hausnummer. Bei dir, meine ich. Fieber …“
„Tür zu!“, zischt Miriam.
Was hast du diesmal bloß falsch gemacht? Am liebsten hättest du sofort wieder angeklopft und dich entschuldigt. Aber wofür? Das ist immer das große Rätsel. Und störst du Miriam jetzt wieder, bringt sie das bestimmt vollends zum Ausrasten. Das liegt am Fieber, sagst du dir, denn so hast du sie noch nie zuvor erlebt. 39,3 Grad. Vielleicht jetzt 40? Solltest du ihr kalte Wadenwickel machen? Besser nicht. Auch deine Stirn ist inzwischen feucht und heiß. Fühlt sich allerdings mehr wie nasse Pappe als heißes Porzellan an. Das Thermometer liegt auf dem Rand des Waschbeckens. Du hältst es kurz unter fließendes Wasser, steckst es in den Mund: 36,8 Grad. Und doch schwitzt du wie ein Weltmeister.
In Jaspers Bett schwitzt du noch stärker. Viel zu heiß! Decke weg! Außerdem dreht sich alles, als hättest du zu viel getrunken. Was erwartet sie von dir? Dass du zu Hause bleibst? Oder braucht sie zum Genesen nur ihre Ruhe und morgen sieht alles ganz anders aus?
In Jaspers Zimmer riecht es nach Turnbeutel, faulem Apfel und Käsefuß. Auf dem Nachttisch türmen sich Comics und Musikzeitschriften. Über dem Bett, in Kopfhöhe, hängt ein Poster, das einen schwarzen Typen zeigt, dem man Anne Frank ins Gesicht tätowiert hat. Genau genommen hat der Typ kein Anne-Frank-Porträt im Gesicht, sondern dessen rechte Hälfte wird komplett von einem unbeholfenen, aber bemüht realistischen Porträt von Anne Frank eingenommen. Wann, fragst du dich, habe ich Jasper verloren? Der Junge weiß sicherlich nicht, wen sich der Typ da ins Gesicht hat tätowieren lassen. Woher auch? Seine Lehrer wissen sowas doch auch nicht! Kretins, bescheuerte! Anne Franks Vater hat auch alles falsch gemacht. Vielleicht nicht alles, aber ihr Tagebuch hätte er nicht zensieren dürfen. Selbst er hat also sein Kind nicht verstanden. Totale Zensur im Hinterhaus. Oder hat er Anne nicht verstehen wollen? Können? Ab welchem Alter versteht man seine Kinder eigentlich nicht mehr? Ab zwölf? Ab dreizehn?
Über derartigen Gedanken schläfst du ein und sofort klingelt der Wecker.
Duschen kannst du in Norddeutschland.
„Bist du wach?“
Keine Antwort.
„Kann ich fahren?“
Keine Antwort.
„Wie geht es dem Baby?“
Du trittst näher ans Bett. Sie atmet. Das Baby atmet auch.
Im Schlafzimmer riecht es nach Schweiß und nassem Hund. „Soll ich mal kurz stoßlüften?“
Keine Antwort.
Du tust es trotzdem, sagst dabei „So!“ wie ein Lehrer, lüftest, schließt das Fenster wieder. „Ich melde mich nachher bei dir … Ich … soll ich bleiben? Sag doch bitte was! Ich kann gerne bleiben, wenn du willst.“
Keine Antwort.
Du lässt die Tür einen Spalt breit geöffnet, damit die beiden nicht im eigenen Mief ersticken, rufst ein Taxi und verzichtest darauf, Miriam eine Nachricht zu hinterlassen. Nachher wirst du sie mit dem Handy anrufen. Noch vor der Frühstückspause. „Mir geht es viel besser!“, wird sie dann sagen. „Es tut mir leid, dass ich dich gestern Abend angeschrien habe.“ – „Nicht der Rede wert“, wirst du ihr heiter entgegnen. „Du hattest Fieber. Ich habe euch übrigens das Auto dagelassen und einen Wagen gemietet. Dann kannst du heute Nachmittag Jasper am Bahnhof abholen.“ – „Das ist aber lieb von dir. Ich freue mich auf Jasper. Er hat bestimmt viel von der Klassenfahrt zu erzählen. Wann bist du wieder da?“ – „Übermorgen. Ihr fehlt mir jetzt schon. Halt die Ohren steif!“ – „Hör mal, Oluf! Dem Baby geht es inzwischen auch schon viel besser.“
Nicht in den Kofferraum. Das ist zu umständlich, denkst du und sagst, während du es bereits tust: „Ich stelle die Tasche auf den Rücksitz.“
„Nur zu!“ Der Taxifahrer riecht, als wäre er die ganze Nacht um sein Leben gefahren. „Wo soll’s denn hingehen? Wieder zum Bahnhof?“
Wieso „wieder zum Bahnhof“? Du beäugst ihn misstrauisch. Er sieht gelangweilt zur Seite, ein junger Kerl mit glänzendem Gesicht und absurd vorgewölbter Stirn. Ein ehemaliger Student? Du blickst leicht ratlos zum Haus zurück. Zwei Krähen schreiten im Vorgarten umher, als suchten sie etwas auf dem Boden, das sie verloren haben. Ihre Körperhaltung erweckt den Eindruck, als hätten sie die Hände hinter dem Rücken verschränkt. „Und nun? Geht’s jetzt wieder zum Bahnhof?“
„Nein“, sagst du, verkneifst dir die Frage, wieso er zu wissen meint, dass du zum Bahnhof willst – und das „wieder“ – und nennst stattdessen Namen und Straße der Autovermietung.
„Die Hausnummer“, schließt du heiter, „weiß ich leider nicht.“
„Das ist im Industriegebiet.“
„Mag sein“, sagst du.
„Aha!“, sagt der Taxifahrer.
Wieso „Aha!“, fragst du dich.
„Ich hab ja ein Navi“, sagt der Fahrer.
„Wie bitte?“
„Ein Navi“, wiederholt der Fahrer unwirsch und fährt los.
Obwohl du viel lieber hinten säßest, nimmst du im Taxi stets auf dem Beifahrersitz Platz, um nicht herablassend zu wirken. Redet man mit Taxifahrern?, fragst du dich nicht zum ersten Mal. Und wenn ja – worüber? Außer dem Wetter fällt dir nichts ein, worüber du mit dem jungen Mann, vermutlich einem Studienabbrecher, sprechen könntest. Es überrascht dich, wie viele Menschen zu dieser frühen Uhrzeit bereits unterwegs sind. Das Taxi fährt die Gellertstraße hinunter in die Innenstadt, biegt kurz vorm düsteren Quader des Bahnhofs scharf rechts ab und folgt einige Minuten einem comichaft hell erleuchteten, voll besetzten Omnibus. Selbst im Mittelgang stehen die Menschen dicht gedrängt. Die anderen, denkst du.
„Wenn ich Bauchweh hab, trink ich immer ne Tasse heißen Tee“, offenbart der Fahrer unvermittelt. „Am besten hilft mir da immer Hagebuttentee.“
„Im Mittelalter galt die Hagebutte als Symbol für die Jungfrau Maria“, hörst du dich flüssig dozieren, „was sich erstaunlicherweise in der populistischen Traumdeutung in ein Symbol für Ehelosigkeit verwandelte. Die Wurzeln der Hundsrose, wie man die Hagebutte auch oft nennt, wurden ehemals gegen Bisse von tollwütigen Tieren verwendet. Bemerkenswert finde ich, dass diese Frucht in der albernen Deutungswut der Traumwühler zum Symbol für den Hagestolz wurde.“ Du lachst. Zu lange und zu laut. „Als Kinder pflegten wir Hagebutten aufzupulen und sie uns gegenseitig in die Kragen zu stopfen. Im Dorf, aus dem ich komme, nannte man Hagebutten daher ‚Arschkratzer‘. Das funktioniert wie Juckpulver. Ist nur billiger.“
Der Rest der Fahrt verläuft in peinigendem Schweigen.
Du hättest besser eine kluge Bemerkung über das Wetter gemacht.
Aus unerfindlichen Gründen lehnte der Taxifahrer das großzügig bemessene Trinkgeld ab. Oder: Im Büro der Autovermietung war es noch dunkel und Sattler musste eine gute Viertelstunde warten, bis eine junge Frau im dunkelblauen Hosenanzug angeradelt kam und aufsperrte. Oder: Inzwischen war er bereits viel zu weit von zu Hause entfernt, um noch umzukehren. Wie viel lieber hättest du über all das in einem Roman gelesen! Du schaltest das Radio ein und sofort wieder aus.
Schon zum zweiten Mal an diesem Vormittag erinnert dich etwas an Vermeer. Dieses Mal ist es der morgendliche Himmel über der Autobahn, genauer gesagt, eine gewisse scherenförmige Wolkenkonstellation, die pinselgenau aus Vermeers Ansicht von Delft zu stammen scheint.
Vor Jahren, als du noch ambitioniert und vor allem interessiert gewesen bist, hast du mal erwogen, einen Aufsatz über Prousts Vermeer-Rezeption zu schreiben. Der Text ist nie fertig geworden und du bist dir auf einmal gar nicht mehr sicher, überhaupt jemals ein Wort davon zu Papier gebracht zu haben. In einem der letzten Bände der Recherche stirbt der Schriftsteller Bergotte, während oder nachdem er (du erinnerst dich nur undeutlich) im Jeu de Paume Vermeers Ansicht von Delft sieht oder gesehen hat. Bergotte stirbt, weil ihm auf dem Gemälde etwas derart Perfektes aufgefallen ist, das ihm in seiner makellosen Absolutheit blitzartig sein eigenes Unvermögen bewusst macht und in aller Grausamkeit aufzeigt, wie vergebens sein lebenslanges Mühen war, Kunst von Bestand zu schaffen.
Bei dieser Winzigkeit, die zu Bergottes Tod führt, handelt es sich ironischerweise um ein kleines gelbes Mauerstück mit einem Vordach. Und dieses „petit pan de mur jaune avec un auvent“, von der Sonne beleuchtet, ja, beinahe scheinwerferhaft angestrahlt wie vorhin das Frauenantlitz im Seitenspiegel, ist trotz seiner Schlichtheit eine gewaltige Epiphanie, das Hineingreifen einer Gottheit in ihre ureigene Schöpfung, jedoch, was für Bergotte schmerzhaft und tödlich zugleich ist, der metaphysische Griff einer irdischen, rein menschlichen Gottheit, deren heilige Insignien Staffelei, Pinsel, Camera obscura sowie diverse Spiegel und Linsen sind.
Problematisch macht die ganze Sache allerdings der Umstand, dass sich auf Vermeers Gemälde kein kleines gelbes Stück Mauer mit einem Vordach oder Dachvorsprung befindet. Ein Irrtum Prousts ist ausgeschlossen. Im Mai 1921, kurz vor seinem Tod, rafft er sich nämlich auf (zuvor hat der Sterbenskranke, heißt es, drei in ungesalzenem Wasser gekochte Kartoffeln verzehrt), um Vermeers Gemälde in der Galerie nationale du Jeu de Paume ein zweites und letztes Mal in seinem Leben zu bewundern.
Wenn du dich recht entsinnst, hast du in dem Aufsatz ausführen wollen, dass sich das gelbe Mauerstück nicht auf dem Gemälde befindet, weil es als Prousts eigene Schöpfung eine persönlich an Bergotte adressierte Epiphanie ist, die kein anderer sehen kann und darf. Und all jene Exegeten, die glauben, das Mauerstück in dem Gemälde lokalisieren zu können, hast du in geschickt terminologisch verborgener Frechheit mit dem jubelnden Volk in Des Kaisers neue Kleider gleichsetzen wollen, denn natürlich beansprucht derjenige, der das Mauerstück gefunden zu haben vorgibt, Teilhabe an Bergottes Erleuchtung und ist somit ebenfalls ein Erleuchteter.
Am Ende des Aufsatzes hast du in kryptischer Ironie über Trap Towns auf Landkarten schreiben wollen. Nicht selten lassen Hersteller von Karten darauf falsche Orte als Plagiatsfallen einzeichnen, um später gegen Kopisten juristisch vorgehen zu können. Trap Towns, Trap Streets, Trap Mountains, Little Yellow Trap Walls. Plötzlich fällt dir wieder ein, weshalb du den Aufsatz weder fertiggeschrieben noch überhaupt begonnen hast: Du kennst Vermeers Bild nur von Reproduktionen. Vielleicht gibt es darauf wirklich das kleine gelbe Mauerstück mit dem Vordach. Außerdem hast du Prousts Recherche nicht gelesen – wieso auch immer! – und die Lektüre bis heute erfolgreich aufgeschoben. Über die Recherche – wie du sie selbst in Gedanken wichtigtuerisch nennst – hast du lediglich Aufsätze gelesen und auch die Kenntnis über alles, was mit dem kleinen gelben Mauerstück zu tun hat, stammt nur aus zweiter oder dritter Hand.
Dieses ganze Reden und Schreiben über Texte und Bilder, die man nur aus Texten oder von Abbildungen kennt, die alle Farben und Formate rücksichtslos nivellieren, ist symptomatisch, denkst du, als du (diesmal erfolgreich) einen Kleinbus voller aufgedrehter, auf der Rückbank tobender Kleinkinder überholst, für die Sackgasse, in die dich die Lehre getrieben hat: Das Original verschwindet wie Gott Vater im Dunst der Aufklärung. Und, überlegst du weiter, als hieltest du eine Brandrede vor deinen Eltern, die du so bitter enttäuscht hast, weil du die Schlosserei nicht übernehmen wolltest: Spätestens seit Kants unseligem „Sapere aude!“ ist nichts einfach nur da und nur da als es selbst. Das ist der Preis der Vernünftelei, den wir moderne Menschen zahlen, und wir begleichen die Schuld in eselhafter Bereitwilligkeit, ohne zu wissen, dass wir etwas bezahlen, und ohne auch nur annähernd zu ahnen, was wir dadurch verlieren: Nichts, wirklich nichts, geschieht mehr unmittelbar. Man schreibt Texte über Texte, über die man nur in Texten gelesen hat. Man schreibt Texte über Texte über Texte über Bilder, von denen man – wenn überhaupt – nur Abbildungen gesehen, meist jedoch nur tendenziöse Beschreibungen in Texten über Texte gelesen hat. Alles geschieht über Umwege. Nur dein eigenes Leben, das musst du ganz alleine leben.
Mit einem Anflug tiefer Zufriedenheit stellst du fest (und setzt zu einem gewagten Überholmanöver an), dass dies die ersten brauchbaren, einem roten Faden folgenden Gedanken seit Monaten sind. In letzter Zeit funktioniert dein Intellekt fast nur noch auf Autopilot. Für die Seminare und Vorlesungen reicht es dicke, auch für Gespräche im Flur oder in der Mensa, aber darüber hinaus macht sich in deinem Denkorgan immer mehr eine Leere breit wie in einem Theater nach der Vorstellung: Das Publikum ist gegangen, eine Handvoll Bühnenarbeiter räumt verschlafen die Kulissen weg, während die nicht minder verschlafen wirkende Putzkolonne einrückt, um Bonbonpapierchen aufzulesen und vollgerotzte Papiertaschentücher aus den Sitzritzen zu klauben. Nachdem die Limousine überholt ist, bleibst du auf der linken Spur, lässt einige daherzockelnde Kleinwagen sowie einen nach Schweinestall stinkenden Viehtransporter hinter dir zurück und hättest in deiner Euphorie fast das Schild mit dem gekreuzten Essbesteck übersehen.
Noch vier Kilometer, denkst du erfreut, dann gibt es endlich Frühstück! Es ist kurz nach halb elf. Unbestritten zu spät! Eigentlich hast du Miriam erheblich früher anrufen wollen. Nun ist sie bestimmt längst mit dem Bus zum Kinderarzt gefahren. Oder kann sie möglicherweise das Haus gar nicht verlassen, weil sie zu geschwächt dazu ist? Ärgerlich, das Ganze! Aber immerhin könnte sie Jasper heute Nachmittag noch immer mit dem Auto abholen. Oder er nimmt den Bus. Das ist doch nicht zu viel verlangt! Und was kannst du denn dafür, dass sie gestern keine Absprachen mit dir hat treffen wollen? Hoffentlich ist sie nicht allzu sauer auf dich. Neues Hinweisschild: In drei Kilometern gibt es endlich Frühstück!
Trotz nagender Sorgen bist du, was dich in ernsthaftes Erstaunen versetzt, gerne unterwegs. Das Fahren auf der Autobahn lullt ein, betäubt alle Nöte und sogar die aktuellsten und gehässigsten Zumutungen des Alltags wie in Telefonwarteschleifen dudelnde Muzak oder ein Hörbuch von Derrida.
Erfreulich auch dies: Der Streckenverlauf ist so simpel, wie er nur sein kann. Seit du nach einigem Gefrickel rund um Frankfurt auf der A 7 bist, geht es nur noch nach oben, quer durch Deutschland, nach Norden.
Weil der Tank laut Anzeige (und diese wird wohl kaum defekt sein) noch mehr als dreiviertel voll ist, steuerst du hart links an der ins Megalomane aufgeblasenen Tankstelle vorbei, gerätst leider zu weit links und findest dich plötzlich auf dem Stellplatz für Lkws und Busse wieder. Da nur wenige der jachtgroßen Parkplätze besetzt sind, glaubst du, das Wagnis eingehen zu können, neben einem weiß-grauen Sattelzug zu halten. Kaum hast du den Schlüssel aus dem Zündschloss gezogen, öffnet sich die Beifahrertür und den teigigen Hintern voran klettert eine Frau aus der hoch über dem Mietwagen schwebenden Führerkabine. Sie hat monroeblond gefärbtes Haar, trägt mattrote Strumpfhosen, knallrote Pumps, einen schwarzen Lederminirock und eine ärmellose kanariengelbe Bluse, die den Blick auf leichenhaft bleiche Puttenarme preisgibt. Schlingernd hält die Frau auf die Raststätte zu. Ob sie betrunken oder nicht gut mit den hochhackigen Schuhen zu Fuß ist, vermagst du nicht zu beurteilen.
Inzwischen bist du aus dem Wagen gestiegen und siehst ihr mit leicht geöffnetem Mund nach, ein schlaksiger großer Mann mit schmalem Schnurrbart und schütter werdendem Haar, der wie viele dünne großgewachsene Männer gerne in eine leicht gebeugte Körperhaltung verfällt. Eine Bewegung im Augenwinkel lässt dich den Kopf eulenhaft zur Seite drehen, wo sich soeben mit affenartiger Anmut ein massiger Typ aus dem Führerhaus des Sattelzugs schwingt. Dass er ebenfalls die Beifahrertür zum Aussteigen nutzt, stört dich auf indifferente Art. Der Typ, etwa in deinem Alter, hat eine graue Meckifrisur und ein Gesicht wie ein freundlicher Oger in einem Bilderbuch für Leseanfänger. An Kleidung trägt er lediglich eine kurze Sporthose (ohne Innenslip) und verkündet nicht ohne Stolz, indem er mit dem Daumen auf die davonschwankende Dame im Minirock zeigt: „Ob Sie’s glauben oder nicht: Die hab ich eben gefickt!“
Was entgegnet man auf eine solche Offenbarung?, fragst du dich.
Ihr seht der Frau nach, die mit einem Mal, als wüsste sie, dass man sie beobachtet, kokett das Handtäschchen zu schlenkern beginnt.
Kunstleder, denkst du. Kein echtes Leder würde so glänzen.
Der Lkw-Fahrer ist schwer tätowiert, jedoch nicht mit so befremdlichen Motiven wie Anne Franks Gesicht, sondern mit blassblauen, beinahe grünlichen Beliebigkeiten, die dich an lange Haftstrafen denken lassen.
„Tut das nicht weh?“, fragst du.
Der Lkw-Fahrer grunzt überrascht.
„Wenn man tätowiert wird, meine ich?“, sagst du schnell.
„Ja, schon, aber was muss, das muss!“ Der Lkw-Fahrer grinst frech. „Sie wissen schon, Herr Doktor, dass Sie grad nem Kollegen den Parkplatz wegnehmen?“ Ohne deine Antwort abzuwarten, schickt er sich an, ein dreibeiniges, hüfthohes Gestell aufzubauen, krönt es mit einer flachen Metallschüssel, gießt dampfendes Wasser aus einer überdimensionalen Thermosflasche hinein und beginnt sich ohne Hemmungen den Oberkörper zu waschen. Er hat Hängebrüste wie eine Halbweltvettel auf einem Gemälde von Dix. Auf einmal hält er mitten beim Einschäumen inne, starrt dich an. „Ham wohl noch nie sich nen Mann waschen sehn?“
Du entschuldigst dich stammelnd und gehst, ergebnislos über die Grammatikprobleme des Anwurfs nachdenkend, quer über den Parkplatz hinüber zur Raststätte, einer architektonischen Totalkatastrophe aus den Neunzigern, deren Inneres aufgrund von an Ketten baumelnden Schildern mit Aufschriften wie „Selbstbedienung“, „Kaffee“ oder „Schnitzelstraße“ mehr als nur selbsterklärend ist. Für dich jedenfalls, der du dich im Inneren der Raststätte mit einer Gründlichkeit umsiehst, als analysiertest du eine vom Kunstbetrieb gefeierte Rauminstallation eines Außenseiterkünstlers. Der Terminus „bildungsferne Schichten“ kommt dir in den Sinn. Professor Kornbluth, dein Doktorvater, selig, hat ihn gerne gebraucht und in diesem Zusammenhang stets vom „marche des imbéciles“ gesprochen: Ließe man alle Vollidioten der Welt in Viererreihen am Eiffelturm vorbeimarschieren, endete diese Parade niemals, da die marschierenden Vollidioten unterwegs unentwegt Kinder zeugten und bekämen und diese wiederum unentwegt weitere Kinder zeugten und bekämen und so weiter und so fort.
Schlaffes Mischbrötchen mit großzügig Butter, durchgehend hellgrauem, jedoch an mehreren Stellen blau-grün, fast seifenblasenartig schillerndem, zu salzigem Kochschinken und einer hauchdünnen, wässrig schmeckenden, eiskalten Gurkenscheibe. Schlaffes Roggenbrötchen mit großzügig Butter, winzige klare Tröpfchen ausschwitzender Käsescheibe und einem eiskalten fingerdicken Stück unreifer Tomate. Rührei (hellgelb, lauwarm) mit beachtlicher Pfefferpigmentierung sowie ein tadelloser Schokopudding (hellbraun, von der Struktur sämig-glatt, eiskalt), den du, da du verabsäumt hast, einen Dessertlöffel aus der Besteckwanne neben der Kasse zu nehmen, mit der Gabel verzehrst, was sich leichter als befürchtet erweist.
Nun ist es aber höchste Zeit, zu Hause anzurufen! Als Erstes – sofort nach den Mitleidsbekundungen und Entschuldigungen – müsstest du Miriam sagen, dass du einen Mietwagen genommen hast. Oh je, schon fast elf! „Und“, würdest du danach beiläufig oder, besser gesagt, in gespielter Beiläufigkeit anmerken, „du weißt schon, dass Jasper heute Nachmittag am Bahnhof abgeholt werden muss. Er kommt ja von der Klassenfahrt zurück.“
Der tätowierte Lkw-Fahrer trägt sein Tablett an dir vorbei. Micha hat einen Hintern wie ein Liliputaner, denkst du. Etwas, das du nicht denken oder – noch schlimmer – jemals sagen oder schreiben dürftest. Woher weißt du überhaupt, dass der Kerl Micha heißt? Dein Wissen befremdet dich, bis dir das Schild in Nummernschildoptik mit den fünf Großbuchstaben hinter der stirnhaft gewölbten Windschutzscheibe des Lkws einfällt, das du vorhin unbewusst zur Kenntnis genommen haben musst. Micha trägt noch immer die Sporthose ohne Innenslip, hat sich hingegen mit einer grauen Kapuzenjacke der Marke University of Irgendwo und braunen Alpargatas, deren Hanfsohlen an den Rändern tabakhaft ausfransen, halbwegs den Gepflogenheiten eines Restaurantbesuchs angepasst.
Und dann in Viererreihen am Eiffelturm vorbei.
Drei Minuten nach elf. Auf Michas Tablett bewachen zwei klobige Schornsteine qualmenden Kaffees einen quadratischen Teller mit hummerpanzerrotem, extrem salzig aussehendem Kassler zwischen Bratkartoffel-Trümmerfeld und Mount Sauerkraut. Nach einem heiter-verschwörerischen Nicken, das dir gilt, setzt sich der Mensch mit dem Ogergesicht und dem Liliputanerhintern gegenüber von dir an einen Tisch direkt bei dem würfelförmigen Kirmesautomaten mit Glasaufsatz, worin man mit einer dreizinkigen Greifzange nach Plüschtieren angeln kann.
Du nickst geistesabwesend, aber nicht unfreundlich zurück und nimmst das Handy aus der Jackentasche. Nach fünfmaligem Klingeln meldet sich der heimische Anrufbeantworter. Du unterbrichst die Verbindung, siehst, wie dein Spiegelbild in der Frontscheibe des Plüschtierautomaten langsam das Handy sinken lässt. Dahinter: blaue Hasen, grüne Kätzchen, gelbe Piepmätze mit orangefarbenen Plastikschnäbeln und als König der Menagerie – rosa und riesig wie ein ausgewachsener Hund – Barbapapa.
Du bist wohl der Einzige in der ganzen Raststätte, der weiß, wie Barbapapa entstanden ist (in der Erde gewachsen) und wie Annette Tison und Talus Taylor auf den Namen des freundlichen Gestaltwandlers gekommen sind (barbe à papa, frz., Zuckerwatte). Seit Jahren verrottet im Keller ein Karton mit VHSKassetten, die dir früher mal wichtig waren. Wieso denke ich jetzt daran?, überlegst du, doch da erinnerst du dich, dass auf einer der Kassetten Barbarella aufgezeichnet sein müsste, ein Spielfilm, den du, obwohl du ihn aus ästhetischen Gründen verachten solltest und willst, stets gemocht hast. Im Gegensatz zu Miriam. Dabei hätte sie ihn, da sie ihr Studium nicht beendet hat, durchaus mögen dürfen. Dein Spiegelbild macht sich erneut am Mobiltelefon zu schaffen … Kontakte … Miriam … Handynummer … verflucht, sie geht nicht dran! Wieso geht sie nicht an ihr gottverdammtes Handy? Micha fixiert dich die ganze Zeit und kaut dabei sein salziges Essen. Du siehst auf und ihn fragend an. Langer Augenkontakt. Wie in Zeitlupe streckt er auf einmal den Zeigefinger der rechten Hand aus und schiebt ihn immer noch peinigend langsam – und dabei den Mund zum Kuss gespitzt – im Daumen-Zeigefinger-Rund der linken Hand vor und zurück.
Du machst eine ungehaltene Gebärde, die eher in südlichere Länder gepasst hätte, und tippst einfingrig, jedoch nicht unflott: Wie geht es Dir? Ich bin unterwegs. Im Mietwagen. Das Auto habe ich Dir dagelassen, damit Du mit dem Baby zum Arzt und nachmittags Jasper am Bahnhof abholen kannst. Das Auto … Wo hast du es gestern nach dem Einkaufen geparkt? Verdammt noch eins! Du löschst die letzten beiden Wörter, denkst kurz nach, schickst die SMS trotzdem ab.
Miriam mag zwar nicht ans Handy gehen, weil sie sauer auf dich ist, aber ihre SMS wird sie ja wohl lesen. In einem schlechten Buch hättest du dir jetzt die Haare gerauft. Kontakte … Miriams Handynummer … sie geht immer noch nicht dran … das sieht ihr gar nicht ähnlich … du wartest auf die Ansage ihres Anrufbeantworters, atmest tief ein und sprichst nach dem Signalton: „Hallo. Ich wieder. Oluf. Ich bin mit einem Mietwagen unterwegs. Weißt du, dass du Jasper heute am Bahnhof abholen musst? Das wäre gut. Der Brief seiner Klassenlehrerin mit der genauen Uhrzeit hängt am Kühlschrank oder liegt auf meinem Schreibtisch. Das Auto habe ich vermutlich in der Nähe geparkt. Oder Bus. Nimm den Bus! Nein, besser. Nimm ein Taxi!“ Ihr wohnt jetzt schon seit fast acht Jahren in der Stadt und noch immer kennt ihr niemanden, den man Jasper abholen lassen könnte. Freunde habt ihr leider noch keine gefunden. Nicht einmal gute Bekannte habt ihr. Wie auch? Neue Stelle,