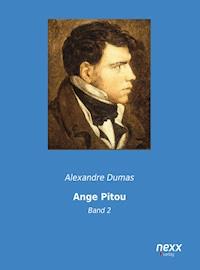
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: NEXX
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ange Pitou
- Sprache: Deutsch
Ange Pitou erzählt die Geschichte eines jungen, einfachen Mannes aus der Provinz, der ungewollt in die Wirren der Französischen Revolution gerät und die dramatischen Ereignisse rund um den Sturm auf die Bastille und den Sturz der Monarchie aus der Perspektive des Volkes miterlebt. Im nexx verlag erscheint "Ange Pitou" in 3 Bänden. Insgesamt ist »Ange Pitou« ein Teil der insgesamt vierbändigen Romanreihe »Memoiren eines Arztes«, zu der auch »Joseph Balsamo«, »Das Halsband der Königin« und »Die Gräfin von Charny« gehören, die Dumas zwischen 1846 und 1855 in den Feuilletons der Pariser Zeitung La Presse veröffentlichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Alexandre Dumas
Ange Pitou oder:
Die Erstürmung der Bastille
Band 2
Impressum
Cover: Ölbild "Bildnis junger Mann Ingres" von Jean-Auguste-Dominique (1780-1867)
Covergestaltung: nexx verlag gmbh, 2015
ISBN/EAN: 9783958705395
Rechtschreibung und Schreibweise des Originaltextes wurden behutsam angepasst.
www.nexx-verlag.de
Sebastian Gilbert
In dem Augenblick, wo Gilbert erschien, machten die Enthusiasten den Vorschlag, die Gefangenen im Triumph umherzutragen, welcher Vorschlag einstimmig angenommen wurde.
Gilbert hätte sehr gewünscht, dieser Huldigung zu entgehen, aber es war nicht möglich; er, Billot und Pitou waren bereits erkannt.
Das Geschrei: Nach dem Stadthaus! nach dem Stadthaus! erscholl abermals, und Gilbert sah sich auf die Schultern von zwanzig Personen zugleich emporgehoben.
Vergebens wollte der Doktor widerstehen, vergebens teilten Billot und Pitou ihre kräftigsten Faustschläge an ihre Waffenbrüder aus: die Freude und die Begeisterung hatten die Haut des Volkes abgehärtet. Faustschläge, Schläge mit Piken-Schäften, mit Flintenkolben kamen den Siegern wie Liebkosungen vor und verdoppelten nur ihre Berauschung.
Gilbert war also genötigt, sich auf den Schild erheben zu lassen.
Der Schild war ein Tisch, in dessen Mitte man eine Lanze aufgepflanzt hatte, die dem Triumphator als Stützpunkt dienen sollte.
So beherrschte der Doktor Gilbert diesen Ozean von Köpfen, der von der Bastille nach der Arcade Saint-Jean seine Wogen schlug, ein Meer voller Stürme, dessen Wellen mitten unter Piken, Bajonetten und Waffen von allen Arten, von allen Formen und Epochen die Gefangenen im Triumph davontrugen.
Doch zu gleicher Zeit wälzte der erschreckliche, unwiderstehliche Ozean eine andere Gruppe fort, die so fest zusammengedrängt war, dass sie eine Insel zu sein schien. Diese Gruppe führte de Launay als Gefangenen weg. In ihrem Umkreis machten sich nicht minder geräuschvolle, nicht minder enthusiastische Schreie hörbar, doch es waren keine Siegesrufe, sondern Todesdrohungen.
Von dem erhabenen Punkt aus, wo er sich befand, verlor Gilbert nicht den kleinsten Umstand von dem furchtbaren Schauspiel.
Unter all den Gefangenen, denen man die Freiheit wiedergegeben, war nur Gilbert im vollen Besitz seiner Fähigkeiten. Die fünf Tage Gefangenschaft bildeten nur einen dunkeln Punkt in seinem Leben. Sein Auge hatte nicht Zeit gehabt, in der Finsternis der Bastille zu erlöschen oder schwach zu werden.
Seit seinem Abgang aus der Bastille war der Marsch des Gouverneurs der Anfang seiner Hinrichtung.
Elie, der das Leben von Herrn de Launay unter seine Verantwortlichkeit genommen hatte, ging an der Spitze, beschützt durch seine Uniform und die Bewunderung des Volks, das ihn zuerst hatte ins Feuer gehen sehen. Er hielt in der Hand, an der Spitze seines Degens, das Billet, das Herr de Launay durch eine der Schießscharten der Bastille dem Volke hatte zukommen lassen. Nach ihm kam der Aufseher der königlichen Steuern, die Schlüssel der Festung in der Hand haltend; dann Maillard mit der Fahne; dann ein junger Mann, der das Reglement der Bastille, von seinem Bajonett durchlöchert, zeigte, ein verhasstes Reskript, kraft dessen so viele Tränen geflossen waren.
Endlich kam der Gouverneur, beschützt durch Hullin und zwei bis drei andere, die aber unter der Masse von drohenden Fäusten, unter den geschwungenen Säbeln und den bebenden Lanzen verschwanden.
Neben dieser Gruppe schleppte man den Major von Losme. Der Major von Losme war ein guter, braver, vortrefflicher Mann. Viele Unglückliche hatten ihm, seitdem er in der Bastille war, eine Linderung zu verdanken gehabt. Doch das Volk wusste das nicht, das Volk hatte ihn mit den Waffen in der Hand gefangen genommen. Das Volk hielt ihn nach seiner glänzenden Uniform für den Gouverneur, während der Gouverneur in seinem grauen Rock, ohne irgendeine Stickerei, ohne das Ordensband des heiligen Ludwig, das er mit eigener Hand abgerissen, sich in einen gewissen beschützenden Zweifel flüchtete.
So war das Schauspiel, das der sichere Blick von Gilbert beherrschte, dieser immer beobachtende und ruhige Blick des Mannes, der sich selbst unter Gefahren, die ihn persönlich bedrohten, seine mutige Fassung bewahrte.
Als Hullin aus der Bastille trat, rief er seine sichersten und ergebensten Freunde, die mutigsten, an diesem Tag volkstümlichen Soldaten zu sich; vier bis fünf antworteten auf seinen Ruf und suchten seine edelmütige Absicht durch Beschirmung des Gouverneurs zu unterstützen. Es waren drei Männer, deren Andenken die unparteiische Geschichte geheiligt hat; sie hießen: Arnet, Chollat und Lepine. Diese Männer suchten also das Leben eines Mannes zu verteidigen, dessen Tod hunderttausend Stimmen forderten.
Um sie gruppierten sich einige Grenadiere von den französischen Garden, deren Uniform, seit drei Tagen populärer geworden, ein Gegenstand der Verehrung für das Volk war.
Herr de Launay, entging den Streichen, solange die Arme seiner edelmütigen Verteidiger die Streiche parieren konnten; aber den Schmähreden und Drohungen vermochte er nicht zu entgehen.
An der Ecke der Rue de Jouy war von den fünf Grenadieren der französischen Garden, die sich dem Zug beim Abgang aus der Bastille angeschlossen hatten, nicht einer mehr übrig. Sie waren unterwegs einer nach dem andern durch die Begeisterung der Menge und vielleicht auch durch die Berechnung der Mörder entführt worden, und Gilbert hatte sie, einen nach dem andern, verschwinden sehen, wie die Kügelchen eines Rosenkranzes, den man abkörnt.
Von da an sah er voraus, der Sieg würde sich trüben durch Blut. Er wollte sich deswegen von dem Tische losreißen, der ihm als Schild diente, doch es hielten ihn eiserne Arme darauf fest. In seiner Ohnmacht forderte er Billot und Pitou zur Verteidigung des Gouverneurs auf; beide gehorchten seinem Befehle und strengten alle ihre Kräfte an, um diese Menschenwogen zu durchschneiden und bis zu ihm zu gelangen.
Die Gruppe der Verteidiger bedurfte in der Tat der Unterstützung. Chollat, der seit dem vorhergehenden Tag nichts gegessen, war aus Erschöpfung ohnmächtig geworden; nur mit großer Mühe hatte man ihn aufgehoben und es verhindert, dass die Menge nicht mit Füßen auf ihn trat. Durch diesen Vorfall entstand eine Bresche an der Mauer, ein Durchbruch am Damm.
Rasch stürzte ein Mann durch diese Bresche, schwang seine Flinte verkehrt und führte mit dem Kolben einen furchtbaren Schlag nach dem Kopf des Gouverneurs.
Lepine sah die Keule sich senken, er hatte Zeit, sich mit ausgestreckten Armen zwischen dem Gouverneur und sie zu werfen, und erhielt auf seine eigene Stirn den Schlag, der für den Gouverneur bestimmt war.
Durch den Streich betäubt, durch das Blut geblendet, fuhr er schwankend mit den Händen nach seinem Gesicht, und als er sehen konnte, war er schon zwanzig Schritte vom Gouverneur entfernt. In diesem Augenblick kam Billot, Pitou im Schlepptau nachziehend, in die Nähe des Gouverneurs.
Billot glaubte bemerkt zu haben, das verräterische Zeichen, an dem man de Launay hauptsächlich erkannte, sei, dass der Gouverneur allein barhäuptig war.
Billot nahm daher seinen Hut, streckte den Arm aus und setzte ihn dem Gouverneur auf den Kopf.
De Launay wandte sich um und erkannte Billot. Ich danke, sagte er, doch was Sie auch machen mögen, Sie werden mich nicht retten.
Lassen Sie uns nur das Stadthaus erreichen, und ich stehe für alles, versetzte Hullin.
Ja, erwiderte de Launay, doch werden wir es erreichen?
Mit Gottes Hilfe werden wir es wenigstens versuchen, erwiderte Hullin.
Man konnte es in der Tat hoffen, denn man fing an auf den Platz vor dem Stadthaus auszumünden; doch dieser Platz war überströmt von Menschen mit nackten Armen, die Säbel und Piken schwangen. Das in den Straßen umherlaufende Gerücht hatte ihnen verkündigt, man bringe den Gouverneur und den Major der Bastille, und sie warteten wie eine Meute, die man lange, die Nase im Wind, die Zähne fletschend, zurückgehalten hat.
Sobald sie den Zug erscheinen sahen, stürzten sie auf ihn los.
Hullin bemerkte, dass hier die äußerste Gefahr war, der letzte Kampf stattfinden sollte. Konnte er es dahin bringen, dass de Launay die Stufen der Freitreppe hinaufzusteigen vermochte, konnte er ihn bis zu den inneren Stiegen fortreißen, so war der Gouverneur gerettet.
Herbei, Elie; herbei, Maillard; herbei, Ihr Männer von Herz! rief er, es handelt sich um die Ehre von uns allen.
Elie und Maillard hörten den Ruf; sie machten einen Seitensprung mitten unter das Volk, doch das Volk unterstützte sie nur zu gut: es öffnete sich vor ihnen und schloss sich hinter ihnen.
Elie und Maillard fanden sich von der Hauptgruppe getrennt, die sie nicht mehr erreichen konnten.
Die Menge sah, was sie gewonnen hatte, und machte eine wütende Anstrengung. Wie eine Riesenschlange rollte sie ihre Ringe um die Gruppe. Billot wurde aufgehoben, fortgeschleppt; Pitou, der sich in allem Billot anschloss, überließ sich demselben Wirbel; Hullin stolperte auf den ersten Stufen des Stadthauses und fiel. Einmal erhob er sich wieder, doch nur, um beinahe in demselben Augenblick abermals zu fallen, und diesmal folgte ihm de Launay in seinem Sturze.
Der Gouverneur blieb, wie er war; bis zum letzten Augenblick gab er keine Klage von sich, bat er nicht um Gnade; er schrie nur mit scharfer Stimme:
Ihr Tiger, die ihr seid, lasst mich wenigstens nicht verschmachten.
Nie wurde ein Befehl mit größerer Pünktlichkeit vollzogen, als diese Bitte; im einem Nu neigten sich um den gefallenen de Launay die Köpfe drohend, erhoben sich die Arme bewaffnet. Man sah einen Augenblick nur noch krampfhaft zusammengezogene Hände, niedertauchende Eisen; dann kam ein Kopf, vom Rumpf gelöst, zum Vorschein und wurde am Ende einer Pike von Blut triefend emporgehoben; er bewahrte noch sein bleiches, verächtliches Lächeln.
Das war der erste.
Gilbert hatte auch diese ganze Szene mit angesehen, und auch diesmal hatte er herabspringen wollen, um dem Unglücklichen beizustehen; doch er war von zweihundert Armen zurückgehalten worden. Er wandte sich ab und seufzte.
Der Kopf mit den offenen Augen erhob sich gerade, als wollte er ihn mit einem letzten Blick begrüßen, dem Fenster gegenüber, wo Flesselles stand, umgeben und beschützt von den Wählern.
Es wäre schwierig gewesen, zu sagen, wer bleicher ausgesehen, der Lebendige oder der Tote.
Plötzlich erhob sich ein ungeheurer Tumult bei der Stelle, wo der Leichnam von de Launay lag. Man hatte ihn durchsucht und in seiner Westentasche das vom Stadtvogt an ihn gerichtete Billet, das er Losme gezeigt, vorgefunden.
Dieses Billet war, wie man sich erinnert, in folgenden Wortlauten abgefasst:
Halten Sie fest! ich belustige die Pariser mit Kokarden und Versprechungen. Am Ende des Tages wird Ihnen Herr von Bezenval Verstärkung schicken.
Von Flesselles.
Ein grässlicher Fluch stieg von dem Pflaster der Straße zum Fenster des Stadthauses auf, wo sich Flesselles befand.
Ohne die Ursache davon zu erraten, begriff er doch die Drohung und warf sich rückwärts.
Doch er war bereits gesehen worden, man wusste, dass er anwesend sei; man stürzte nach den Treppen, und zwar diesmal mit einer so allgemeinen Bewegung, dass die Männer, die Gilbert trugen, diesen verließen, um der unter dem Sturmwind des Zornes steigenden Flut zu folgen.
Gilbert wollte auch in das Stadthaus hinein, doch nicht um zu drohen, sondern um Flesselles zu beschützen. Er hatte schon die ersten drei bis vier Stufen der Freitreppe überschritten, als er sich heftig nach rückwärts gezogen fühlte; er wandte sich um, in der Absicht, sich von diesem neuen Zwang loszumachen; aber diesmal erkannte er Billot und Pitou.
Oh! rief Gilbert, der von dem hohen Punkte aus, auf dem er stand, den ganzen Platz überschaute, was geht denn dort vor?
Und er bezeichnete mit der Hand die Rue de la Tixeranderie.
Kommen Sie, Doktor, kommen Sie, sagten gleichzeitig Billot und Pitou.
Oh! die Mörder! rief der Doktor, die Mörder! ...
In diesem Augenblick fiel der Major von Losme von einem Axthieb getroffen; das Volk vermengte in seinem Zorn den selbstsüchtigen, barbarischen Gouverneur, der der Verfolger der unglücklichen Gefangenen gewesen war, und den edelmütigen Mann, der sie beständig unterstützt hatte.
Oh! ja, ja, sagte Gilbert, gehen wir, denn ich fange an mich zu schämen, dass ich von solchen Menschen befreit worden bin.
Doktor, sprach Billot, seien Sie unbesorgt, nicht diejenigen, welche dort gekämpft haben, schlachten hier.
Doch in demselben Augenblick, wo der Doktor die Stufen hinabstieg, die er eben hinaufgestiegen war, um Flesselles zu Hilfe zu eilen, wurde die Woge, die sie bis zum Stocken unter dem Gewölbe zusammengedrängt hatte, von diesem wieder ausgespien. Unter dem großen Menschenstrom sträubte sich ein Mann, den man fortriss.
Nach dem Palais Royal! nach dem Palais Royal! schrie die Menge.
Ja, meine Freunde, ja, meine guten Freunde, nach dem Palais Royal! wiederholte dieser Mann.
Und er rollte gegen den Fluss, als ob die menschliche Überschwemmung ihn nicht nach dem Palais Royal führen, sondern in die Seine hätte fortziehen wollen.
Oh! rief Gilbert, hier ist abermals einer, den sie erwürgen wollen! Versuchen wir es, wenigstens ihn zu retten.
Doch kaum waren diese Worte gesprochen, als man einen Pistolenschuss vernahm, und Flesselles im Rauche verschwand.
Gilbert bedeckte in einer Bewegung erhabenen Zornes seine Augen mit seinen beiden Händen; er verfluchte dieses Volk, das während es so groß war, nicht die Stärke, rein zu bleiben, besaß und seinen Sieg durch einen dreifachen Mord befleckte.
Denn, als er seine Hände wieder von seinen Augen entfernte, sah er drei Köpfe an der Spitze von drei Piken.
Der erste war der Kopf von Flesselles, der zweite der von Losme, der dritte der von de Launay.
Der eine erhob sich auf den Stufen des Stadthauses, der andere in der Mitte der Rue de la Tixanderie, der dritte auf dem Quai Pelletier.
Durch ihre Stellung bildeten sie ein Dreieck.
Oh! Balsamo! Balsamo! murmelte der Doktor mit einem Seufzer, symbolisiert man mit einem solchen Dreieck die Freiheit?
Und Billot und Pitou nach sich ziehend, entfloh er durch die Rue de la Vannerie.
An der Ecke der Rue Blanche-Mibray traf der Doktor einen Fiaker; er winkte ihm, zu halten, und stieg ein.
Billot und Pitou nahmen bei ihm Platz.
Nach dem College Louis-le-Grand, sagte Gilbert. Und er warf sich in den Hintergrund des Wagens und versank in eine tiefe Träumerei, in der ihn Billot und Pitou nicht störten.
Man fuhr über den Pont-au-Change, schlug den Weg durch die Rue de la Cite und die Rue Saint-Jacques ein und gelangte zum College Louis-le-Grand.
Ganz Paris schüttelte ein Schauer. Die Kunde hatte sich nach allen Seiten verbreitet, die Gerüchte von den Ermordungen auf der Greve vermischten sich mit den glorreichen Erzählungen von der Einnahme der Bastille; man sah die verschiedenen Eindrücke, welche die Geister ergriffen, sich wiederspiegeln auf den Gesichtern ... Blitze der Seele, die sich nach außen verrieten.
Gilbert hatte den Kopf nicht an den Wagenschlag gehalten, kein Wort hatte er gesprochen. An den Huldigungen des Volks findet sich immer auch eine lächerliche Seite, und Gilbert sah seinen Triumph von dieser Seite an. Dann kam es ihm dennoch vor – wie sehr er sich auch angestrengt hatte, das Blutvergießen zu verhindern – als ob einige Tropfen von dem vergossenen Blut auf ihn zurückspritzten.
Der Doktor stieg vor der Tür des Colleges aus, und hieß Billot ihm folgen. Pitou blieb bescheiden im Fiaker.
Sebastian war noch im Krankenzimmer; bei der Meldung der Ankunft des Doktors Gilbert führte ihn der Vorsteher persönlich ein.
Billot, der, so wenig er auch Beobachter war, den Charakter des Vaters und des Sohnes kannte, betrachtete aufmerksam die Szene, die unter seinen Augen vorging.
So sehr der Knabe in der Verzweiflung sich schwach und reizbar gezeigt hatte, ebenso ruhig und zurückhaltend zeigte er sich in der Freude. Als er seinen Vater sah, erbleichte er, und es versagte ihm die Sprache. Ein leiser Schauer lief über seine Lippen.
Dann warf er sich Gilbert mit einem einzigen Freudenschrei um den Hals und hielt ihn schweigend in seinen Armen.
Der Doktor erwiderte mit demselben Schweigen dieses stille Umfangen. Nur schaute er seinen Sohn, nachdem er ihn umarmt hatte, lange an, mit einem mehr traurigen als freudigen Lächeln.
Ein geschickterer Beobachter als Billot würde sich gesagt haben, es walte ein Unglück oder ein Verbrechen zwischen diesem Knaben und diesem Mann.
Der Knabe war weniger zurückhaltend gegen Billot. Sobald er etwas andres sehen konnte, als seinen Vater, der seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch genommen hatte, lief er auf den guten Pächter zu, umschlang dessen Hals mit seinen Armen und sagte: Sie sind ein braver Mann, Herr Billot, Sie haben mir Wort gehalten, und ich danke Ihnen.
Ho! Ho! Herr Sebastian, rief Billot, das ist nicht ohne Mühe abgegangen; Ihr Vater war hübsch eingesperrt, und man musste nicht wenig Schaden anrichten, ehe man ihn herausbringen konnte.
Sebastian, fragte der Doktor mit einer gewissen Besorgnis, bist du gesund?
Ja, mein Vater, antwortete der junge Mann, obgleich Sie mich im Krankenzimmer finden.
Gilbert lächelte und sagte: Ich weiß, warum du hier bist.
Der Knabe lächelte ebenfalls.
Fehlt es dir hier an nichts? fuhr der Doktor fort.
An nichts, durch Ihre Fürsorge.
Mein lieber Freund, ich will dir also immer dieselbe, dieselbe und einzige Ermahnung geben: arbeite!
Ja, mein Vater.
Ich weiß, dass dieses Wort für dich kein leerer Schall ist; wenn ich das glaubte, so würde ich es dir nicht mehr sagen.
Mein Vater, es ist nicht an mir, Ihnen hierauf zu antworten, erwiderte Sebastian. Es ist an Herrn Berardier, unserem vortrefflichen Vorsteher.
Der Doktor wandte sich gegen Herrn Berardier um, und dieser bedeutete ihm, er habe ein paar Worte mit ihm zu sprechen.
Warte Sebastian, sagte der Doktor.
Und er ging auf den Vorsteher zu.
Mein Herr, fragte Sebastian teilnehmend den Pächter, sollte Pitou ein Unglück widerfahren sein? Der arme Junge ist nicht bei Ihnen.
Er ist vor der Tür in einem Fiaker.
Mein Vater, sagte Sebastian, wollen Sie erlauben, dass Herr Billot Pitou hierher bringt? es würde mich sehr freuen, ihn zu sehen.
Gilbert nickte mit dem Kopf; Billot ging hinaus.
Was haben Sie mir zu sagen? fragte Gilbert den Abbé Berardier.
»Ich wollte Ihnen sagen, mein Herr, dass es nicht die Arbeit ist, was Sie diesem Knaben empfehlen müssten, sondern vielmehr die Zerstreuung.
Wieso, Herr Abbé?«
Ja, er ist ein vortrefflicher junger Mensch, denn jeder hier liebt ihn wie einen Sohn oder einen Bruder, doch wenn man nicht darauf Acht gibt, so wird ihn etwas töten.
Was denn? rief Gilbert.
Die Arbeit, zu der Sie ihn ermahnen. Würden Sie ihn an seinem Pulte sehen, die Arme gekreuzt, die Nase im Wörterbuch, das Auge starr ...«
Arbeitend oder träumend? fragte Gilbert.
Arbeitend: den guten Ausdruck, die antike Wendung, die griechische oder lateinische Form ganze Stunden lang suchend; und sehen Sie, gerade in diesem Augenblick ...«
Der junge Mensch, obgleich sein Vater sich kaum seit fünf Minuten von ihm entfernt, obgleich Billot kaum die Tür hinter sich zugemacht hatte, war er in eine Art von Träumerei versunken, die der Ekstase glich.
Ist er oft so? fragte Gilbert mit Besorgnis.
Mein Herr, ich könnte beinahe sagen, das sei sein gewöhnlicher Zustand. Sehen Sie, wie er sucht.
Sie haben Recht, Herr Abbé, und wenn Sie ihn so suchen sehen, müssten Sie ihn zerstreuen.
Das wäre schade, denn es gehen aus seiner Arbeit Kompositionen hervor, die unsrer Anstalt die größte Ehre machen werden. Ich prophezeie, dass dieser Knabe in drei Jahren alle Preise beim Konkurs davon trägt.
Geben Sie wohl acht, sagte der Doktor, diese Art von Vertiefung des Geistes, in die Sie Sebastian versunken sehen, ist eher ein Beweis von Schwäche, als von Stärke, ein Symptom von Krankheit, als von Gesundheit. Sie hatten Recht, Herr Abbé, man darf dem Knaben die Arbeit nicht zu sehr empfehlen, oder man muss wenigstens die Arbeit von der Träumerei zu unterscheiden wissen.
Mein Herr, ich versichere Ihnen, dass er arbeitet, und zum Beweise dient, dass seine Aufgabe immer früher als die der andern gemacht ist. Sehen Sie seine Lippen sich bewegen? Er wiederholt seine Lektionen.
Wohl denn! wenn er seine Lektionen so wiederholt, Herr Berardier, zerstreuen Sie ihn; er wird darum sie nicht schlechter wissen und sich dabei besser befinden.
Ah! sprach der gute Abbé, Sie müssen sich darauf verstehen, Sie, den die Herren von Condorcet und Cabanis für einen der gelehrtesten Männer erklärt haben, die wir gegenwärtig besitzen.
Nur, sagte der Doktor, nur gehen Sie mit Vorsicht zu Werke, so oft Sie genötigt sind, ihn solchen Träumereien zu entziehen, um ihn stufenweise zu dieser Welt, die er verlassen hat, zurückzuführen.
Der Abbé schaute den Doktor ganz erstaunt an. Es fehlte wenig, dass er ihn für einen Narren gehalten hätte.
Herr Abbé, sprach der Doktor, Sie sollen sogleich den Beweis von dem, was ich Ihnen sage, gewahr werden.
Billot und Pitou kehrten in diesem Augenblick zurück. Mit drei Sprüngen war Pitou bei Sebastian.
Du hast nach mir verlangt, Sebastian? sagte Pitou, während er den Knaben beim Arm fasste. Du bist sehr artig, ich danke dir. Und er näherte seinen großen Kopf der blassen Stirn des Knaben.
Schauen Sie, sprach Gilbert, den Arm des Abbes ergreifend.
Plötzlich durch die herzliche Berührung von Pitou aus seiner Träumerei aufgeweckt, wankte Sebastian in der Tat, sein Angesicht wurde noch blässer, sein Kopf neigte sich, als ob sein Hals nicht mehr die Kraft gehabt hätte, ihn zu tragen. Ein schmerzlicher Seufzer drang aus seiner Brust hervor, dann färbte eine lebhafte Röte seine Wangen.
Er schüttelte den Kopf und lächelte.
Ah! Du bist es, Pitou, sagte er. Ja, es ist wahr, ich habe nach dir verlangt.
Und er schaute ihn an und rief: Du hast dich also geschlagen?
Ja, und als ein braver Junge, sprach Billot.
Warum haben Sie mich nicht mitgenommen? versetzte der Knabe mit einem Ton des Vorwurfs; ich hätte mich auch geschlagen, und würde wenigstens etwas für meinen Vater getan haben.
Sebastian, sprach Gilbert, indem er sich seinem Sohne näherte und seinen Kopf an sein Herz drückte, du kannst noch bei weitem mehr für deinen Vater tun als dich für ihn schlagen; du kannst seine Ratschläge anhören, sie befolgen, und ein ausgezeichneter, berühmter Mann werden.
Nicht wahr, wie Sie? sagte der Knabe mit Stolz. Oh! das ist es auch, wonach ich trachte.
Sebastian, sprach der Doktor, willst du, nachdem du Billot und Pitou umarmt und diesen unsern guten Freunden gedankt hast, mit mir im Garten einen Augenblick plaudern?
Das wird mich glücklich machen, mein Vater. Zwei- oder dreimal in meinem Leben konnte ich ganz allein mit Ihnen sein, und diese Augenblicke sind noch immer mit all ihren einzelnen Umständen meinem Gedächtnis gegenwärtig.
Herr Abbé, Sie erlauben? fragte Gilbert.
Gewiss.
Billot, Pitou, es ist vielleicht für euch Bedürfnis, etwas zu euch zu nehmen.
Bei meiner Treue, ja, antwortete Billot, ich habe seit dem Morgen nichts gegessen, und Pitou ist, denke ich, so nüchtern als ich.
Verzeihen Sie, entgegnete Pitou, ich habe so etwas wie einen Laib Brot und ein paar Würste kurz vorher, ehe ich Sie aus dem Wasser gezogen, verzehrt; doch das Bad macht Hunger.
Nun, so kommen Sie in den Speisesaal, sagte der Abbé Berardier, man soll Ihnen Mittagsbrot vorsetzen.
Ho! ho! rief Pitou.
Sie fürchten die Kost der Anstalt? versetzte der Abbé. Beruhigen Sie sich, man wird Sie als Eingeladenen behandeln. Übrigens scheint mir, fuhr der Abbé fort, es ist bei Ihnen nicht nur der Magen im Verfall, mein lieber Herr Pitou.
Pitou warf einen Blick voll Scham auf sich selbst.
Und wenn man Ihnen zugleich mit dem Mittagsbrot Hosen anböte ...
Ich würde sie in der Tat annehmen, Herr Abbé! antwortete Pitou.
Kommen Sie also, die Hosen und das Mittagsbrot sind zu Ihren Diensten.
Und er führte Billot und Pitou auf der einen Seite weg, während, ihnen mit der Hand winkend, Gilbert und Sebastian sich auf der andern entfernten.
Beide durchschritten den für die Erholungen bestimmten Hof und erreichten ein den Lehrern vorbehaltenes Gärtchen, einen frischen, schattigen Winkel, in dem der ehrwürdige Abbé Berardier seinen Tacitus und seinen Juvenal zu lesen pflegte.
Gilbert setzte sich auf eine von Reben beschattete Bank, zog Sebastian zu sich, strich mit der Hand seine langen Haare, die auf seine Stirn herabfielen, auseinander und sprach:
Nun, mein Kind, nun sind wir wieder vereinigt.
Sebastian schlug die Augen zum Himmel auf.
Durch ein Wunder Gottes, ja, mein Vater.
Gilbert lächelte.
Wenn es ein Wunder gibt, sagte Gilbert, so hat es das brave Volk von Paris verrichtet.
Mein Vater, entgegnete der Knabe, trennen Sie nicht Gott von dem, was vorgefallen ist, denn ich, als ich Sie sah, dankte instinktartig Gott.
Und Billot?
Billot kam nach Gott.
Gilbert dachte nach.
Du hast recht, mein Kind, sprach er. Gott ist im Grunde von allen Dingen. Doch kommen wir auf dich zurück und lass uns ein wenig miteinander reden, ehe wir uns wieder trennen.
Werden wir uns abermals trennen, mein Vater?
Nicht für lange Zeit, denke ich. Doch es ist ein Kistchen, das wertvolle Papiere enthält, zu gleicher Zeit, als man mich in die Bastille einsperrte, verschwunden. Ich muss wissen, wer mich hat einsperren lassen, wer das Kistchen gestohlen.
Es ist gut, mein Vater, ich werde warten. Sie wiederzusehen, bis Ihre Nachforschungen beendigt sind, sagte der Knabe.
Und er seufzte.
Warum bist du traurig, Sebastian? fragte der Doktor.
Ich weiß es nicht; mir scheint, das Leben ist nicht für mich gemacht, wie für die andern Kinder: Alle haben Zerstreuungen, Vergnügen; ich, ich habe keine.
Du hast keine Zerstreuungen, kein Vergnügen?
Mein Vater, ich will damit sagen, ich finde keine Unterhaltung bei den Spielen meines Alters.
Nimm dich in Acht, Sebastian; ich würde es bedauern, wenn du einen solchen Charakter hättest. Sebastian, die Geister, die eine glorreiche Zukunft versprechen, sind wie die guten Früchte während ihres Wachstums: sie haben ihre Bitterkeit, ihre Säure, ihre Herbe, ehe sie den Gaumen durch ihre wohlschmeckende Reife erquicken. Glaube mir, mein Kind, es ist gut, jung gewesen zu sein.
Wenn ich es nicht bin, so ist es nicht meine Schuld, antwortete der junge Mensch mit einem schwermütigen Lächeln.
Gilbert drückte fortwährend die Hände seines Sohnes in den seinigen, heftete seine Augen auf die von Sebastian und sprach: Dein Alter, mein Sohn, ist das der Saat; nichts darf noch von dem, was das Studium in dich gelegt hat, außen zum Vorschein kommen. Mit vierzehn Jahren, Sebastian, ist der Ernst Hochmut oder Krankheit. Ich habe dich gefragt, ob deine Gesundheit gut sei; du hast mir geantwortet: ja. Ich will dich nun fragen, ob du hochmütig seist; suche mir mit nein zu antworten.
Mein Vater, erwiderte der Knabe, beruhigen Sie sich; was mich traurig macht, ist weder Krankheit, noch Hochmut; nein, es ist ein Kummer.
Ein Kummer, armes Kind! Mein Gott! welchen Kummer kannst du in deinem Alter haben? Sprich, sprich!
Nein, mein Vater, nein, später. Sie sagten, Sie haben Eile, Sie können mir nur eine Viertelstunde schenken. Sprechen wir von etwas anderem, als von meinen Tollheiten.
Nein, Sebastian, ich würde dich unruhig verlassen. Sage mir, woher dieser Kummer rührt.
Wahrhaftig, ich wage es nicht, mein Vater.
Was befürchtest du?
Ich befürchte, in Ihren Augen für einen Geisterseher zu gelten, oder mit Ihnen von Dingen zu reden, die Sie betrüben würden.
Du betrübst mich noch viel mehr, wenn du dein Geheimnis bewahrst, liebes Kind.
Sie wissen wohl, dass ich vor Ihnen kein Geheimnis habe.
So sprich.
In der Tat, ich wage es nicht.
Sebastian, du, der du ein Mann zu sein dir einbildest?
Gerade deshalb.
Auf, fasse Mut!
Wohlan denn, mein Vater, es ist ein Traum!
Ein Traum, der dich erschreckt?
Ja und nein; denn wenn ich in diesen Traum mich versenke, bin ich nicht erschrocken, sondern wie in eine andere Welt versetzt. Schon als ein kleines Kind hatte ich solche Visionen. Sie wissen, zwei- oder dreimal habe ich mich in den großen Wäldern verirrt, die das Dorf umgeben, wo ich aufgezogen wurde.
Ja, man hat es mir gesagt.
Wohl! ich folgte etwas wie einem Gespenst.
Du sagst? ... fragte Gilbert, indem er seinen Sohn mit einem Erstaunen anschaute, das dem Schrecken glich.
Hören Sie, mein Vater, was geschah: Ich spielte wie die andern Kinder im Dorf, und solange ich im Dorf war, solange andre Kinder mit mir oder bei mir waren, sah ich nichts; wenn ich mich aber von ihnen trennte, wenn ich die letzten Gärten überschritt, so fühlte ich in meiner Nähe etwas wie das Rauschen eines Kleides; ich streckte die Arme aus, um es zu fassen, und ich umfing nur die Luft. Doch wie sich dieses Rauschen mehr entfernte, wurde das Gespenst sichtbar. Anfangs war es ein Dunst, durchsichtig wie eine Wolke, dann verdichtete sich der Dunst und nahm eine menschliche Form an. Diese Form war die einer Frau, die mehr glitt, als ging, und umso sichtbarer wurde, je mehr sie sich in die dunkelsten Stellen des Waldes vertiefte.
Dann zog eine unbekannte, fremde, unwiderstehliche Gewalt mich fort auf den Spuren von den Schritten dieser Frau. Ich verfolgte sie mit ausgestreckten Armen, stumm wie sie; denn oft habe ich es versucht, sie anzurufen, und nie konnte meine Stimme einen Ton bilden. Und ich verfolgte sie so, ohne dass sie anhielt, ohne dass ich sie zu erreichen vermochte, bis mir das Wunder, das mir ihre Gegenwart verkündigt hatte, ihren Abgang bezeichnete. Diese Frau verschwand allmählich; das Leibliche wurde Dunst, der Dunst verflüchtigte sich, und alles war vorbei. Und ich fiel, erschöpft von der Anstrengung, an der Stelle nieder, wo sie verschwunden war. Hier fand mich Pitou zuweilen an demselben Tag, zuweilen erst am andern.
Gilbert schaute den Knaben unablässig mit einer wachsenden Unruhe an. Seine Finger hatten sich auf den Puls von Sebastian gelegt.
Dieser begriff das Gefühl, das den Doktor bewegte und sprach: Oh! Seien Sie unbesorgt, mein Vater, ich weiß, dass nichts Wirkliches an dem allen ist; ich weiß, dass es eine Vision ist, und nicht mehr.
Und diese Frau, fragte der Doktor, welches Aussehen hatte sie?
Oh! ein majestätisches gleich einer Königin.
Und ihr Gesicht, hast du es bisweilen gesehen, mein Kind?
Ja.
Seit wann? fragte der Doktor bebend.
Erst seitdem ich hier bin, antwortete der junge Mann.
Aber in Paris hast du ja den Wald von Villers-Cotterets nicht, wo die Bäume ein düsteres, geheimnisvolles grünes Gewölbe bilden? In Paris hast du nicht die Stille, die Einsamkeit, dieses Element der Gespenster?
Doch, mein Vater, ich habe dies alles hier.
Wie, hier? Ist dieser Garten nicht den Lehrern vorbehalten?
Allerdings, mein Vater. Doch zwei- oder dreimal kam es mir vor, als sähe ich diese Frau in den Garten gleiten. Jedes Mal wollte ich ihr folgen, immer hielt mich die geschlossene Tür zurück. Als mich dann eines Tages der Abbé Berardier, der mit meiner Komposition sehr zufrieden war, fragte, was ich wünsche, bat ich ihn, zuweilen im Garten mit ihm spazieren gehen zu dürfen. Er erlaubte es mir. Ich benützte diese Erlaubnis, und hier, hier, mein Vater, ist die Vision wieder erschienen.
Gilbert schauerte. Eine seltsame Sinnestäuschung, sagte er, jedoch möglich bei einer nervösen Natur, wie die deinige; und du hast ihr Gesicht gesehen?
Ja, mein Vater.
Du erinnerst dich desselben?
Der Knabe lächelte.
Hast du es je versucht, dich ihr zu nähern?
Ja.
Ihr die Hand zu reichen?
Dann verschwand sie.
Und wer ist diese Frau deiner Ansicht nach, Sebastian?
Mir scheint, es ist meine Mutter.
Deine Mutter! rief Gilbert erbleichend.
Und er drückte seine Hand auf sein Herz, als wollte er das Blut einer schmerzlichen Wunde stillen.
Das ist ein Traum, und ich bin beinahe so verrückt als du, sprach er.
Der Knabe schwieg und schaute mit nachdenkendem Auge seinen Vater an.
Nun? fragte dieser.
Nun! es kann möglicherweise ein Wahn sein. Doch die Wirklichkeit meines Traumes existiert, denn während der letzten Pfingsten führte man uns im Wald von Satory bei Versailles spazieren, und dort, während ich seitwärts träumte ...
Ist dir dieselbe Vision erschienen?
Ja; doch diesmal in einem mit vier prächtigen Pferden bespannten Wagen ... doch diesmal sehr reell, sehr lebend. Ich wäre beinahe in Ohnmacht gefallen.
Und welcher Eindruck ist dir von dieser neuen Erscheinung geblieben?
Dass es nicht meine Mutter war, die ich im Traum erscheinen sah, denn diese Frau war dieselbe wie die meiner Erscheinung; aber meine Mutter ist tot.
Gilbert stand auf und fuhr mit seiner Hand über seine Stirn. Eine seltsame Blendung hatte sich seiner bemächtigt.
Der Knabe bemerkte seine Unruhe und erschrak über seine Blässe.
Ah! sagte er, sehen Sie, dass ich Unrecht gehabt habe, Ihnen alle diese Torheiten zu erzählen.
Nein, mein Kind, nein; im Gegenteil, sprich mir oft hiervon, sprich davon, so oft du mich siehst, und wir werden dich zu heilen suchen.
Sebastian schüttelte den Kopf. Mich heilen ... und warum? sagte er. Ich habe mich an diesen Traum gewöhnt; er ist ein Teil meines Lebens geworden; ich liebe die Vision, obgleich sie mich flieht, obgleich es mir manchmal vorkommt, als stieße sie mich zurück. Heilen Sie mich nicht, mein Vater. Sie können abermals mich verlassen, abermals reisen, nach Amerika zurückkehren. Habe ich diese Vision, so bin ich doch nicht so allein.
Wohl denn, murmelte der Doktor.
Und er drückte Sebastian an seine Brust und sprach:
Auf Wiedersehen, mein Kind; ich hoffe, dass wir uns nicht verlassen werden; denn wenn ich reise, nun! so werde ich es diesmal so einrichten, dass du mit mir kommst.
War meine Mutter schön? fragte der Knabe.
Oh! ja, sehr schön, antwortete der Doktor mit erstickter Stimme.
Und sie liebte Sie ebenso sehr, als ich Sie liebe?
Sebastian! Sebastian! sprich nimmer von deiner Mutter, rief der Doktor.
Und er drückte seine Lippen zum letzten Mal auf die Stirn des Knaben und eilte dann aus dem Garten weg.
Statt ihm zu folgen, sank der Knabe düster und niedergeschlagen auf seine Bank zurück.
Im Hof fand Gilbert Billot und Pitou wieder, die sich vollkommen gestärkt hatten und dem Abbé Berardier die einzelnen Umstände von der Einnahme der Bastille erzählten.
Nachdem er dem Vorsteher aufs Neue Sorgfalt in der Behandlung von Sebastian empfohlen, stieg er mit seinen zwei Gefährten wieder in den Fiaker.
Frau von Staël
Als Gilbert im Fiaker seinen Platz neben Billot und Pitou gegenüber wieder eingenommen hatte, war er bleich, und ein Schweißtropfen perlte an der Wurzel von jedem seiner Haare.
Doch es lag nicht im Charakter dieses Mannes, unter der Macht irgendeiner Gemütsbewegung gebeugt zu bleiben. Er warf sich in die Ecke des Wagens zurück, drückte seine beiden Hände an seine Stirn, als hätte er die Gedanken darin zusammenpressen wollen, ließ, nachdem er einen Augenblick unbeweglich gewesen, die Hände wieder fallen und zeigte, statt eines verstörten Gesichtes, eine vollkommen ruhige Physiognomie.
Sie sagten also, sprach er dann, Sie sagten, mein lieber Herr Billot, der König habe dem Herrn Baron von Necker seinen Abschied gegeben?
Ja, Herr Doktor.
Und die Unruhen in Paris rühren von dieser Ungnade her?
Sie fügten bei, Herr von Necker habe sogleich Paris verlassen?
Er erhielt sein Entlassungsdekret, als er eben zu Mittag speiste; eine Stunde nachher war er unterwegs nach Brüssel.
Wo er sein soll ... Hörten Sie nicht sagen, er habe unterwegs angehalten?
Doch, in Saint-Ouen, um von seiner Tochter, Frau von Staël, Abschied zu nehmen.
Ist Frau von Staël mit ihm abgereist?
Wie ich sagen hörte, ist er mit seiner Frau allein abgereist.
Kutscher, rief Gilbert, halten Sie bei dem ersten besten Schneider an.
Wollen Sie die Kleider wechseln? fragte Billot.
Jawohl. Dieser Rock hat sich ein wenig zu stark an den Mauern der Bastille abgerieben, und in solchem Anzug macht man keinen Besuch bei der Tochter eines in Ungnade gefallenen Ministers. Suchen Sie in Ihren Taschen und sehen Sie, ob Sie nicht ein paar Louis d'or darin finden.
Ho! ho! sagte der Pächter, es scheint, Sie haben Ihre Börse in der Bastille gelassen.
So verlangt es die Vorschrift des Gefängnisses, erwiderte Gilbert lächelnd; jeder Gegenstand von Wert wird in der Kanzlei niedergelegt.
Und bleibt dort, sprach der Pächter.
Und er öffnete seine große Hand, die etwa zwanzig Louis d'or enthielt, und setzte hinzu: Nehmen Sie, Doktor.
Gilbert nahm zehn Louis d'or. Einige Minuten nachher hielt der Fiaker vor dem Laden eines Trödlers an. Das war damals noch der Gebrauch. Gilbert vertauschte seinen alten gegen einen neuen schwarzen Rock, wie ihn die Herren vom dritten Stand in der Nationalversammlung trugen,
Ein Friseur in seiner Bude, ein Savoyard auf seinem Stühlchen vollendeten die Toilette des Doktors.
Der Kutscher führte Gilbert über die äußeren Boulevards nach Saint-Ouen, und er stieg vor dem Haus des Herrn von Necker in dem Augenblick ab, als es sieben Uhr auf der Dagoberts-Kathedrale schlug.
Um dieses Haus, wo es kurz zuvor noch von eifrigen Besuchen wimmelte, herrschte eine tiefe Stille, die nur die Ankunft des Fiakers von Gilbert unterbrach; und dennoch war es nicht jene Melancholie der verlassenen Schlösser, jene grämliche Traurigkeit der von der Ungnade getroffenen Häuser.
Die geschlossenen Gitter, die verödeten Blumenbeete verkündigten wohl den Abgang der Gebieter; doch keine Spur von Schmerz oder allzu großer Eile.
Überdies hatte ein ganzer Teil des Schlosses, der östliche Flügel, die Sommerläden offen behalten, und als Gilbert sich nach dieser Seite wandte, kam ein Lakai in der Livree des Herrn von Necker dem Besuch entgegen.
Durch das Gitter entspann sich nun folgendes Gespräch: Mein Freund, befindet sich Herr von Necker nicht mehr im Schloss?
Nein, der Herr Baron ist mit der Frau Baronin vergangenen Sonnabend nach Brüssel abgereist.
Aber Frau von Staël?
Madame ist hier geblieben. Doch ich weiß nicht, ob Madame empfangen kann; es ist die Zeit ihrer Promenade.
Ich bitte, erkundigen Sie sich, wo sie ist, und melden Sie ihr den Doktor Gilbert.
Ich will mich erkundigen, ob Madame in ihren Zimmern ist. Ohne Zweifel wird sie den Herrn empfangen. Geht sie aber spazieren, so habe ich den Befehl, sie nicht in ihrer Promenade zu stören.
Der Lakai öffnete das Gitter; Gilbert trat ein.
Während der Lakai das Gitter wieder schloss, warf er einen forschenden Blick auf den Wagen, der den Doktor gebracht hatte, und auf die seltsamen Gestalten seiner zwei Reisegefährten.
Dann entfernte er sich, den Kopf schüttelnd wie ein Mensch, bei dem der Verstand nicht ausreicht; der aber jeden andern Verstand herauszufordern scheint, da klar zu sehen, wo der seinige in der Finsternis geblieben ist.
Gilbert blieb zurück und wartete allein.
Nach fünf Minuten kam der Lakai zurück.
Die Frau Baronin geht spazieren, sagte er.
Und er verbeugte sich, um Gilbert den Abschied zu geben.
Der Doktor aber hielt sich nicht für geschlagen und erwiderte:





























