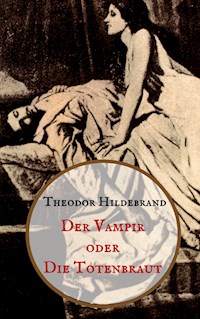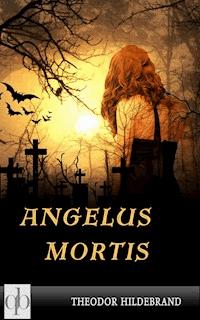
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Quality Books Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
* Ein schauriger Vampirroman der Schwarzen Romantik In einer romantisch schönen Gegend, zwei Postkutschenstunden von Prag entfernt, erhebt sich ein uraltes Schloss in den Tiefen des Böhmerwaldes, das sich die Familie Lobenthal als neues Heim erwählt hat. Schon naht wieder ein Winter, der die alten Bäume mit seinem eisigen Odem bald in tiefen Schnee hüllen wird. Wie erstaunt da die Nachricht, dass eine geheimnisvolle junge Dame in ein einsames Haus im Wald gezogen sein soll. Die Dorfbewohner erzählen sich, dass sie schön sei, aber auch, dass sie etwas Fremdes, Unbeschreibbares an sich habe. Frau Lobenthal, oben im Schloss, schöpft die Hoffnung, die neue Nachbarin als angenehme Gesellschafterin für sich zu gewinnen, denn die Tage sind einsam geworden und das düstere alte Gemäuer beginnt sie zu ängstigen, nun, da ihr Mann in Familienangelegenheiten verreist ist … * Entdecken Sie einen der ältesten Vampirklassiker der Literaturgeschichte Erstmals 1828 unter dem Titel "Der Vampyr, oder: Die Todtenbraut" erschienen, wurde dieser frühe, vom Staub der Jahrhunderte begrabene Vampirroman von Quality Books aufwendig modernisiert, um heutige Leser zu fesseln. Mit psychologischer Tiefe erzählt er von Schuld, verhängnisvoller Leidenschaft und einem verzweifelten Kampf zwischen verzehrender Liebe und blutiger Rache – ein Genuss für Liebhaber von E. T. A. Hoffmanns "Der Sandmann", Ann Radcliffes "Die Geheimnisse von Udolpho" und John Polidoris "Der Vampyr". * Ein verborgenes Meisterwerk erwacht Theodor Hildebrand, ein vergessener Schöpfer düsterer Erzählungen, wob mit "Angelus Mortis" ein Leichentuch aus Verlockung und Verdammnis. Quality Books lässt diesen Roman aus dem frühen 19. Jahrhundert in sprachlich überarbeiteter Fassung neu erstrahlen.. Kannst du dem Fluch der Lodoiska widerstehen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 273
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ANGELUS MORTIS
Modernisierte Neufassung
eines Romans
von
Theodor Hildebrand
Quality Books
2021
* * * *
Quality Books
Klassiker in neuem Glanz
Textgrundlage:
Der Vampyr, oder: Die Todtenbraut
Theodor Hildebrand
Erdruck: Leipzig, 1828, bei Christian Ernst Kollmann
Neufassung: Marcus Galle
Umschlaggestaltung: Maisa Ahmad-Galle
© 2018 by Quality Books, Hameln
2., veränderte Auflage: September 2021
ISBN 978-3-946469-17-9
E-Mail: [email protected]
Für die vollständige Anschrift klicken Sie bitte auf den nachfolgenden Link:
Anschrift
Dieses E-Book, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung des Herausgebers nicht vervielfältigt, wiederverkauft oder weitergegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
Titel
Impressum
Angelus Mortis
[Ein Vampirroman der Schwarzen Romantik]
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Fünfzehntes Kapitel
Sechzehntes Kapitel
Siebzehntes Kapitel
Achtzehntes Kapitel
Neunzehntes Kapitel
Zwanzigstes Kapitel
Einundzwanzigstes Kapitel
Zweiundzwanzigstes Kapitel
Dreiundzwanzigstes Kapitel
Vierundzwanzigstes Kapitel
In eigener Sache
Impressum (Anschrift)
ANGELUS MORTIS
- Ein Vampirroman der Schwarzen Romantik -
Erstes Kapitel
Ein unglückliches, aber unverdientes Schicksal zwang den russischen Oberst Alfred Lobenthal im Jahr 1818, seinen Abschied vom Militär zu nehmen. Er begab sich nach Berlin, seinem Geburtsort, wo er auch gerne bis zu seinem Lebensende geblieben wäre, wenn sein verhängnisvolles Schicksal nicht etwas anderes für ihn bestimmt hätte. Nach einem kaum halbjährigen Aufenthalt in dieser prächtigen Königsstadt trat Alfred eines Morgens tief bekümmert in das Zimmer seiner Gemahlin und kündigte ihr an, dass eine dringende Notwendigkeit ihn zwinge, Berlin zu verlassen und der Familie ein neues Heim, weit entfernt von der Stadt, zu suchen, wo sie in Ruhe und Frieden leben könnten.
Helene, die Gemahlin des Obersts, erschrak zwar über diese Neuigkeit, nahm sie aber doch mit einer gewissen Gelassenheit hin. Sie liebte ihren Gatten zärtlich und wurde ebenso von ihm wiedergeliebt; den übrigen Teil ihres Glücks machten ihre Kinder aus, und wo sie sich auch befinden mochte, war sie zufrieden, wenn sie nur von ihren Lieben nicht getrennt war. In den Augenblicken der Muße, die ihr die Pflichten als Hausfrau und Mutter übrig ließen, kam Langeweile erst gar nicht auf, weil ihre Leidenschaften, die Musik und die Malerei, diesem Feind der Ruhe keinerlei Raum gaben. Daher war sie auch keineswegs betrübt, als sie von ihrem Gatten die unerwartete Neuigkeit erfuhr, und fragte ihn auch kaum nach dem Grund für seinen so plötzlichen Entschluss. Sie wünschte nur zu wissen, ob Alfred sich vielleicht wieder einmal durch politische Äußerungen in Gefahr gebracht habe. Nachdem er sie hierüber beruhigt hatte und sie wissen ließ, dass der Bankrott eines bedeutenden Handelshauses ihn um einen großen Teil seines Vermögens gebracht habe, weshalb er es für nötig erachte, einige Jahre sehr zurückgezogen zu leben, umarmte sie ihren Gatten voller Zärtlichkeit und versicherte ihm, dass sie ohne Bedauern den Trubel der Hauptstadt gegen ein Leben in der Provinz tauschen werde.
Der Oberst betrieb seine Abreise mit der größten Eile. Er wollte nicht einmal den Verkauf seines prächtigen Mobiliars abwarten, sondern bat stattdessen einen Freund, diese Angelegenheit für ihn zu übernehmen; und schon am folgenden Tag, nachdem er den Entschluss seiner Frau mitgeteilt hatte, reiste er mit ihr und seinen Kindern, nur von einem einzigen Bedienten begleitet, ab, ohne von seinen Bekannten und Verwandten Abschied genommen zu haben.
Sobald Alfred das Stadttor hinter sich gelassen hatte, schien er wie von einer großen Last befreit. Seine Blicke, die unruhig umhergeirrt waren, solange er noch in der Stadt weilte, nahmen plötzlich einen entspannten Ausdruck an und er schien zusehends freier atmen zu können. Er drückte seiner Frau lebhaft die Hand und voller Erleichterung rief er ihr zu: »Endlich haben wir die Stadt im Rücken! Du glaubst gar nicht, wie verhasst sie mir geworden ist. Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis der Wagen endlich zum Tor hinausfuhr!«
»Wie kann es nur möglich sein, lieber Alfred«, erwiderte seine Frau, »dass du plötzlich so schlecht von deiner Vaterstadt sprichst? Hat Berlin denn auf einmal allen Reiz für dich verloren; du warst doch sonst immer so begeistert von ihr? Hat sich die Stadt wirklich so zum Schlechten verändert oder missfällt sie dir nur, weil sich unsere Lage geändert hat?«
»Ich muss gestehen«, antwortete der Oberst, »dass ich alles, was mich sonst so sehr für diese Stadt eingenommen hat, jetzt kaum mehr sehen mag. Ich fühle, dass es mir unerträglich wäre, auch nur noch einen Tag länger in Berlin zu bleiben.«
»Dann kannst du doch jetzt froh sein, dass wir die verhasste Stadt schon im Rücken haben. Ich wünsche dir jedenfalls von Herzen, dass du in einer anderen deine Ruhe wiederfinden wirst und alle unangenehmen Erinnerungen vergessen kannst!«
»Von welcher Stadt sprichst du denn, mein Herz?«
»Nun, von derjenigen, in der wir zukünftig wohnen werden. Wir befinden uns auf der Straße nach Potsdam, daher frage ich mich, ob du wohl nach Dresden oder nach Leipzig fahren möchtest. Oder hast du vielleicht eine noch weiter entfernte Stadt im Sinn?«
»Ach, liebe Helene«, sagte der Oberst verlegen, »es fällt mir schwer, dich ganz mit dem Opfer bekannt zu machen, das du mir bringen sollst. Denkst du, ich verlasse Berlin, um in einer anderen Stadt zu wohnen? Gewiss nicht, denn in meiner Lage sehne ich mich nur nach Einsamkeit! Liebe Helene, ich hoffe, du wirst dich nicht über meinen grausamen Entschluss beklagen. Ich will nämlich eine abgelegene, ländliche Unterkunft suchen, wo nichts …«
Eine plötzliche Röte überzog bei diesen Worten die schönen männlichen Züge des Obersts; er hielt mitten im Satz inne und sah Helene mit einem unbeschreiblichen Blick an, in dem die schmerzhaftesten Empfindungen nicht zu verkennen waren.
Helene wäre hierüber vielleicht beunruhigt gewesen, wenn sie nicht geglaubt hätte, die Ursache für den Schmerz ihres Gatten zu kennen. Denn sie wusste ja, wie sehr ihm der Verlust des Geldes, vor allem ihret- und der Kinder wegen, zu Herzen ging; und sie wusste, wie sehr er sie liebte. Deshalb fürchtete sie, dass es ihm Kummer bereiten musste, sie mitten aus den Vergnügungen der großen Welt herauszureißen und ihr die Einsamkeit des Landlebens zuzumuten. Ohne daher weiter über Alfreds Verhalten nachzudenken, hielt sie sich bloß an den äußeren Schein und sagte, ihrem Gatten die Hand drückend:
»Beruhige dich, lieber Alfred; es ist mir egal, welchen Winkel der Erde ich bewohne, wenn ich nur bei dir und meinen Kindern bin. Meine Pinsel und Farben sind hier in diesem Kästchen und meine Harfe wird mir nachgesandt: Was könnte mir da noch zu meinem Glück fehlen?«
»Wirklich, teure Helene, du fürchtest dich nicht vor dem einsamen Landleben?«
»Das wäre nur dann der Fall, wenn ich von den drei mir teuren Wesen getrennt wäre; doch sind wir zusammen, ist mein Glück stets vollkommen.«
»Du weißt gar nicht, von welcher Sorge du mich damit befreist; denn ich glaube dir, dass du es ernst meinst! Um es frei herauszusagen, ich ertrage in meinem jetzigen Zustand wirklich nur die Einsamkeit und Zurückgezogenheit und sehne mich weg von allem Trubel des Lebens. Daher will ich versuchen, einen Zufluchtsort zu finden, der nicht so nahe bei der Stadt liegt, dass man uns belästigen wird, der aber auch nicht so weit entfernt ist, dass wir auf alle Annehmlichkeiten der Städte verzichten müssen; wobei ich insbesondere an die Hilfe der Arzneikunst denke, falls Wilhelm und Julie (die Namen ihrer beiden Kinder) einmal krank sein sollten.«
»Und wo, Alfred, denkst du, diesen Zufluchtsort zu finden?«
»In Böhmen, nicht weit von Prag.«
»Es scheint mir aber, dass du bei allen deinen früheren Reisen noch nie in dieser Gegend gewesen bist. Kennst du denn jemanden in Böhmen und weißt du bereits, wo wir dort leben werden?«
»Nein, durchaus nicht; ich habe mir Böhmen ja deshalb ausgesucht, weil ich dort völlig unbekannt bin; alles Weitere überlasse ich erst mal dem Zufall. Ich hoffe, dass meine Spur auf diese Weise völlig verloren gehen wird und ich somit keinen Belästigungen ausgesetzt sein werde … denn der Anblick von Menschen ist mir verhasst geworden. Ach, könnte ich doch nur die Vergangenheit aus meinem Gedächtnis streichen! Teure Helene, wie sehr wünschte ich, nur für dich gelebt zu haben!«
Diese zärtlichen Worte, die Helene ihrer Natur nach nur angenehm sein konnten, brachten in ihrem Herzen jedoch eine genau entgegengesetzte Empfindung hervor. Der Ton, mit dem ihr Gemahl sie ausgesprochen hatte, schien einen bitteren Vorwurf gegen ihn selbst anzudeuten, und seine Physiognomie sagte dabei mehr aus als seine Worte. Helene liebte ihren Mann noch wie in den ersten Tagen ihrer Ehe; bis jetzt hatte sich in ihrem Herzen noch nie eine eifersüchtige Empfindung geregt, weil Alfreds Verhalten sie überzeugte, dass sie allein in seinen Gedanken herrschte; aber diese Ruhe konnte von einem Augenblick zum anderen getrübt werden. Helene hatte bis jetzt noch nie ernstlich darüber nachgedacht, welches Leben ihr Mann wohl vor der Bekanntschaft mit ihr geführt haben könnte; sie ging zwar davon aus, dass ein junger, hübscher Offizier sicherlich eine Menge verliebter Abenteuer gehabt haben musste; aber sie glaubte, dass Alfred nicht genügend Zeit gehabt hatte, sich Gefühlen hinzugeben, die erst dann gefährlich werden, wenn sie lange dauern.
Was das anging, machte sich Helene also keine Sorgen; allerdings stieg jetzt der unglückliche Gedanke in ihr auf, dass vielleicht eine ältere Liebesintrige etwas mit der plötzlichen Abreise, die einer übereilten Flucht glich, zu tun haben könnte.
Was immer auch Helene in dieser Hinsicht gedacht haben mochte, so hütete sie sich doch, diese Gedanken auszusprechen; sie versuchte vielmehr, sie zu unterdrücken, indem sie ein gleichgültiges Gespräch anfing. Hierbei kamen ihr die Fragen ihrer Kinder zu Hilfe, und Alfred, der sich über deren unschuldiges Geschwätz freute, versuchte, ihre Neugierde zu befriedigen. Der Oberst bemerkte indessen, dass die Miene seiner Gemahlin ernster und nachdenklicher geworden war; doch da er diesen Anschein von Kummer nur ihrer Abreise von Berlin zuschrieb, gab er sich alle Mühe, sie durch seine Zärtlichkeit wieder aufzuheitern, was ihm auch so gut gelang, dass Helene, von seiner Liebe zu ihr gerührt, all ihre leeren Mutmaßungen beiseite warf und sich ganz dem Glück überließ, mit ihrem Gatten und ihren Kindern leben zu können.
Zweites Kapitel
Kaum war die Familie in Prag angekommen, verlor der Oberst keine Zeit, die einsame Bleibe zu suchen, nach der er sich von ganzem Herzen sehnte. Er wandte sich hierzu an einen Kommissionär, um zu erfahren, ob es abseits aller großen Straßen, aber doch nicht zu weit von der Stadt entfernt, eine ländliche Immobilie gab, die zur Vermietung oder zum Verkauf stand; und er hatte Glück, denn der Zufall entsprach hierbei völlig seinen Wünschen. Der Eigentümer des Schlosses R…, das in einer romantisch schönen und fruchtbaren Gegend, ungefähr zwei Stunden von Prag entfernt, lag, hatte schon seit längerer Zeit vergebens Liebhaber des Landlebens gesucht, aber bis jetzt noch keinen Mieter für das uralte Gebäude, welches er selber nicht bewohnte, finden können. Daher ging er auch gleich auf die Bedingungen des Obersts ein, nachdem dieser das Schloss, gleich nach Kenntnis dessen Vermietung, einer gründlichen Besichtigung unterzogen hatte. Entzückt von dessen Lage, die genau seinen Wünschen entsprach, setzte Alfred sogleich einen Mietvertrag in gehöriger Form auf und begab sich mit seiner Familie zu seinem neuen Zuhause. Die nötigen Möbel, einfach, aber bequem, nicht prächtig, aber geschmackvoll, hatte er in der Stadt gekauft und ließ sie unter Aufsicht eines alten Unteroffiziers von seinem Regiment nachkommen. Dieser Mann namens Werner, ebenfalls ein Deutscher, ein tapferer Soldat, war in Russland schon vor längerer Zeit mit einer kleinen Pension verabschiedet worden. Da Lobenthal ihm einst in einer Schlacht das Leben gerettet hatte, empfand Werner eine starke Verbundenheit zu seinem Oberst, die letztlich dazu führte, dass er in dessen Dienste trat, wobei er jedoch weniger die Rolle eines Bedienten als vielmehr die eines treuen und völlig ergebenen Freundes einnahm. Eine Köchin und ein Hausmädchen, beide in Prag in Dienst genommen, machten das Hauswesen des Obersts bereits komplett; denn Helene und ihr Gemahl hatten bewusst auf allen Luxus verzichtet, weil er schlicht seine Bedeutung für sie verloren hatte.
Die ersten Tage nach ihrer Ankunft im Schloss R… verflossen unter Beschäftigungen, die mit der Veränderung des Wohnsitzes gewöhnlich verbunden sind. Die Arbeiter hierfür waren in jener Gegend jedoch entweder selten zu haben oder sie waren ungeschickt, wodurch die ganze innere Einrichtung und Renovierung des Schlosses auf des Obersts und Werners Schultern ruhte. Sie leimten die Tapeten an, hängten die Spiegel auf, stellten die Möbel an ihren Platz, schlugen die Betten auf usw., und ihre Hände, nur gewohnt, Waffen zu führen, wussten sich äußerst geschickt der Werkzeuge friedlicher Arbeiter zu bedienen.
Auch Helene war ihrerseits nicht müßig; die Wäsche, die Küche und die Speisekammer gaben ihr vollauf zu tun; sie vernachlässigte nichts, und während die beiden Gatten so miteinander arbeiteten, verschönerten sie ihre Zeit durch die Bekundungen ihrer zärtlichen Gefühle und die Glückseligkeit eines vollkommenen gegenseitigen Vertrauens. Doch mitten unter diesen leichten Arbeiten verdunkelte oft eine plötzliche Erinnerung die heitere Stirn des Obersts; ein unwillkürliches Erbeben, das er sogleich wieder zu unterdrücken versuchte, bewies, dass ihn ein geheimer Kummer bedrücken musste, und mehr als einmal drehte Helene schnell ihr Gesicht zur Seite, um ihren Gatten durch ihre besorgten Züge nicht noch zusätzlich zu belasten.
Diese Phase währte jedoch nicht lange, und immer öfter sah man ihn bald von einer heiteren Unbeschwertheit durchdrungen; die Gegenwart seiner Kinder bereitete ihm Vergnügen und sehr häufig nahm er an ihren unschuldigen Spielen teil; bald beschäftigte er sich mit seiner Flöte, bald durchstrich er, von einem Jagdhund begleitet, die zahlreichen umliegenden Täler und Berge. Hier aber, von dickem Gebüsch umgeben, setzte er sich oft am Fuß einer Eiche nieder und überließ sich seinen Träumereien, die ihn meist mehrere Stunden lang in ihrem Bann hielten. Für gewöhnlich weckten ihn erst die einbrechende Abenddämmerung oder einige vorübergehende Landleute wieder aus diesem fast bewusstlosen Zustand; er schlug sich dann heftig vor die Stirn und eilte schnellen Schrittes zum Schloss zurück.
Hätte Helene nur Geschmack für die Vergnügungen der großen Welt gehabt, würde sie sich an ihrem jetzigen Aufenthaltsort äußerst unglücklich gefühlt haben. An Gesellschaft war hier kaum zu denken; die in der Nähe wohnenden Herrschaften kamen nur im Sommer aufs Land, und sechs Monate lang im Jahr würde es niemand von ihnen gewagt haben, sich zwischen die Berge und Felsen zu begeben, die im Winter fast gänzlich unzugänglich waren. Wir haben aber schon gesagt, dass Helene in sich selbst vortreffliche Hilfsmittel zum Zeitvertreib fand. Wenn das Hauswesen ihre Tätigkeit nicht in Anspruch nahm, vergnügte sie sich durch Musik, Malerei und das Lesen der besten Werke unserer schönen Literatur, oder sie fand hinreichenden Genuss in der Gesellschaft ihres Mannes und ihrer Kinder.
Ein ganzes Jahr verging, ohne dass irgendeine außerordentliche Begebenheit eine Abwechslung in das stille und einförmige Leben der Familie Lobenthal gebracht hätte. Je mehr Zeit verfloss, desto mehr erlangte der Oberst seine Ruhe wieder, und keine unangenehme Erinnerung schien ihn mehr zu belasten. Helene, die ihren Gatten sehr genau beobachtete, freute sich heimlich darüber. Nur selten verließ Alfred jetzt noch das Schloss; er ging nicht mehr so häufig wie am Anfang auf die Jagd, sondern war fast immer bei seiner Frau und seinen Kindern, mit deren Erziehung er sich beschäftigte. Zum Zeitvertreib ließ er sich auch die Verschönerung des Schlossgartens angelegen sein, den er mit mehreren seltenen und schönen Blumen bereichert hatte.
Auch der Winter war an diesem einsamen und abgelegenen Ort für Alfred und Helene nicht ohne Reiz, denn sie verstanden es, sich selbst genug zu sein. Wenn der häufig fallende Regen die Wege in der Umgegend so verdorben hatte, dass es völlig unmöglich war, spazieren zu gehen, diente der weite Saal des Schlosses als gymnastischer Tummelplatz, an dem Vater und Kinder sich für die körperliche Ausbildung der Letzteren heilsamen Leibesübungen überließen. Ohne Unterlass hallte dann von den langen und hohen leeren Wänden ein lautes und herzliches Gelächter wieder. Den Stunden des Vergnügens folgte ein lehrreicher Unterricht; die Abende verflossen unter angenehmen Erzählungen, mit denen Helene ihre beiden kleinen aufmerksamen Zuhörer in Staunen versetzte, und voller Entzücken betrachtete dann Alfred dieses Gemälde der häuslichen Glückseligkeit.
Man schenkte weder den Stürmen und dem Schnee noch dem Regen, der gegen die Fenster prasselte, Beachtung, und nach und nach verschwand jede Erinnerung an eine bittere Vergangenheit.
Auch der nächste Frühling verfloss in dieser angenehmen Ruhe. Um die Mitte des Monats Juli erhielt der Oberst jedoch einen Brief, der ihn mit neuem Kummer erfüllte. Er hatte eine Schwester, die in Stettin an einen königlichen Beamten verheiratet war. Gegenseitiges Unrecht unter den beiden Gatten, die beide noch jung und vielleicht Sklaven ihrer Leidenschaften waren, hatte schon mehrere unangenehme Auftritte zwischen ihnen herbeigeführt, die sich noch täglich vervielfältigten. Ein gemeinsamer Freund dieser beiden Unglücklichen, der einen öffentlichen Ausbruch ihrer Uneinigkeiten befürchtete, hielt es für seine Pflicht, den Oberst von dem, was vorging, zu benachrichtigen. Er drängte ihn, keine Zeit zu verlieren und unverzüglich nach Stettin zu reisen, weil der Oberst, wie er glaubte, der Einzige war, dem eine dauerhafte Aussöhnung der beiden Gatten gelingen konnte.
Alfred Lobenthal kam diese dringende Aufforderung äußerst ungelegen. Es schien ihm zu hart, sich aus dem Schoß seiner glücklichen Familie zu entfernen, um wieder in die Welt zurückzukehren, deren verhasstem Trubel er nun schon entgangen war. Er fühlte zwar, wie nützlich seiner Schwester sein guter Rat sein konnte, um sie vor dem Abgrund des Unglücks zu bewahren, dem sie unbedachtsam entgegenzueilen schien, und sein Herz machte ihm auch Vorwürfe wegen der Gleichgültigkeit, die er ihr gegenüber an den Tag legte, obwohl er eigentlich die Rolle eines Vaters für sie zu übernehmen hatte; doch auf der anderen Seite sollte er sich auf unbestimmte Zeit von seiner zärtlichen Gattin und seinen Kindern trennen, und dieses Opfer war ihm zu groß. Er wusste lange nicht, was er tun sollte; ehe er jedoch einen Entschluss fasste, versuchte er, durch schriftliche Ermahnungen auf seine Schwester einzuwirken. Solche Vorstellungen, die an die Vernunft der Betreffenden appellierten, konnten aber da kein Gehör finden, wo heftige Leidenschaften laut ihre Stimmen erhoben; die beiden Gatten klagten einander gegenseitig in den Antworten an, die sie ihm auf seine Briefe zukommen ließen, und dachten nicht daran, sich wieder zu versöhnen. Endlich gelangte ihre Uneinigkeit an einen solchen Punkt, dass Alfreds Schwester keinen Anstand nahm, das Haus ihres Mannes zu verlassen und sich auf das Landgut einer ihrer Freundinnen zurückzuziehen.
Drittes Kapitel
Als der Oberst Nachricht davon erhielt, dass seine Schwester das eheliche Haus verlassen hatte, zögerte er nicht länger; er machte sich Vorwürfe, nicht schon früher abgereist zu sein, und gab sich selbst einen Teil der Schuld an dem Fehler, den seine Schwester begangen hatte. Jetzt musste so schnell wie möglich Hilfe geleistet werden, und nachdem er Helene um Rat gefragt hatte, die völlig seiner Meinung war, begab er sich nach Prag, von wo er mit Extrapost weiter nach Stettin eilte. Er reiste ganz allein und ließ zum Schutz für seine Frau und Kinder den rechtschaffenen und furchtlosen Werner zurück, den er in allem, was das Interesse seiner Familie betraf, als sein zweites Selbst betrachten konnte. Helene musste ihren ganzen Mut zusammennehmen, um beim Abschied von ihrem Gatten die Fassung zu bewahren, zumal es die erste Trennung von ihm war. Doch es gelang ihr, den Schmerz in sich zu verschließen und nur so viel davon zu zeigen, wie sie zurückzuhalten nicht imstande war.
»Ach, Geliebter!«, rief sie unter einem Strom von Tränen. »Kehre bald wieder zu mir zurück! Erst jetzt wird mir dieser Ort hier wirklich wie eine Einöde vorkommen; ich werde mich völlig alleine fühlen, sobald du nicht mehr bei mir bist.«
Alfred versuchte, der zärtlichen Helene einigen Trost zu spenden. Schon befand man sich im Monat September und er versprach ihr, spätestens im Dezember zurückzukehren; hinzusetzend, dass sie auf seine Liebe vertrauen solle, durch die er selbst nichts sehnlicher wünsche, als noch weit früher in ihre Arme zurückzukehren, wenn es nur irgend möglich sei. Aber wie vergeblich sind alle Trostbekundungen in dem Augenblick der Trennung! Man fühlt nichts als das gegenwärtige Übel, welches einen niederdrückt. Die Zukunft ist in solcher Stimmung belanglos, die Hoffnung verliert all ihren Zauber und man kennt nur die Qual der Gegenwart.
In den ersten Tagen nach Alfreds Abreise war Helene wie in einem Zustand der Bewusstlosigkeit. Ihr Geist, von vielen ängstlichen Gedanken angegriffen, wurde für eine abergläubische Furcht empfänglich, und nur mit einem geheimen Schauder ging sie des Abends die Treppe hinauf und durch den großen Saal. Die Einbildungskraft, die stets bereit ist, alles herbeizuziehen, was uns zu ängstigen vermag, nahm an Lebhaftigkeit noch stetig zu, was zur Folge hatte, dass bald schon die geringste Kleinigkeit genügte, um sie in Furcht zu versetzen. Oft blieb sie plötzlich zitternd stehen, weil sie glaubte, ein sonderbares Geräusch gehört zu haben, oder sie machte ihre Augen zu, aus Scheu, irgendeine fürchterliche Erscheinung zu erblicken. Die Gesellschaft ihrer Kinder reichte an den Abenden, die schon lang zu werden begannen, nicht mehr aus, um sie zu beruhigen; sie rief nach dem treuen Werner und nach Lisette, der Köchin, einem guten, aber höchst abergläubischen, furchtsamen Mädchen, und behielt beide stundenlang unter dem Vorwand bei sich, ihnen Befehle für den folgenden Tag geben zu wollen oder sich Rechenschaft darüber geben zu lassen, was sie den Tag über getan hatten.
Es mag auf dem Land auch noch so einsam sein, die Häuser mögen auch noch so weit voneinander entfernt liegen, so führt dies alles doch nicht dazu, die Neugierde der Landbevölkerung zu vermindern. Für diesen Menschenschlag ist schon das gewöhnlichste Ereignis etwas Besonderes. Sie geben auf die geringste Kleinigkeit acht und alles wird den Nachbarn getreulich weitererzählt. So war es auch bei der Ankunft der Familie Lobenthal im Schloss R… Was für übertriebene Dinge erzählte man sich von ihr, was für lächerliche Märchen wurden auf ihre Kosten verbreitet! Aber die Zeit verfloss und ein und derselbe Gesprächsstoff kann nicht ewig zur Unterhaltung dienen; daher schien die Familie Lobenthal, nachdem fünfzehn Monate vergangen waren, bei den Einheimischen völlig als eingebürgert und dazugehörig zu gelten, und man trat sogar mit der Dienerschaft in freundschaftliche Verhältnisse, sodass es nun häufiger vorkam, dass die Männer im Stall mit Werner und die Frauen in der Küche mit Lisette Unterhaltungen anknüpften und ihnen erzählten, was sie sonntags vor der Kirchtür Neues gehört hatten.
Lisette und Werner erzählten, sofern Gelegenheit dazu war, ihrer Herrin gerne wieder, was sie gehört hatten, und Helene errötete innerlich über das seltsame Vergnügen, das sie dabei genoss, ihnen zuzuhören; denn Zerstreuung war ihr während der Abwesenheit ihres Mannes sehr nötig, und ganz gleich, welchen Gegenstand man vor ihr zur Sprache brachte: sie zog das albernste Geschwätz immer noch der Einsamkeit vor.
Schon war der Oberst seit mehr als einer Woche nicht mehr im Schloss, als Lisette eines Abends mit so wichtiger Miene ins Zimmer trat, dass Helene nicht daran zweifeln konnte, gleich eine außerordentliche Neuigkeit mitgeteilt zu bekommen. Sie irrte sich nicht; sobald das gute Mädchen sich bei der Lampe niedergesetzt hatte, die ihr zu ihrer Abendarbeit leuchtete, fing sie zu erzählen an:
»Von nun an, Frau Oberstin, werden wir nicht mehr so ganz allein in dieser Gegend sein; das Land hier wird immer mehr bevölkert, die Anzahl der Fremden vermehrt sich; und wenn das so weiter geht, wird man bald, wie man im Dorf sagt, montags einen Markt auf unserm Schlossplatz abhalten können.«
»Ja, mein Gott«, antwortete Helene erstaunt, »wer sind denn die zahlreichen Leute, die sich in der Gemeinde angesiedelt haben?«
»Um die Wahrheit zu sagen, Frau Oberstin, sind es noch nicht wirklich viele, aber das wird noch kommen. Fürs Erste ist es nur ihre Familie und dann eine Dame, deren Geschichte und Herkunft man noch nicht kennt, und die das kleine Haus dort unten im Tal, mitten im Wald, gekauft hat.«
»Da hat sie sich aber eine sehr einsame Wohnung gewählt, und entweder muss sie viel Mut besitzen oder ein großes Gefolge bei sich haben, wenn sie ohne Furcht in diesem Haus bleiben kann.«
»Dieser Meinung ist auch das ganze Dorf, und dennoch ist sie ganz allein; denn ihr alter Bedienter kann hier gar nicht mitgezählt werden, weil er so abgelebt, so bleich und hinfällig aussieht, dass er weniger einem lebendigen Menschen als eher einem Bewohner der anderen Welt gleicht. Was die Dame betrifft, so sagt man, dass sie schön sei, obgleich ihre Miene etwas ganz Außerordentliches haben soll. Ich kann übrigens nichts Näheres darüber sagen, weil ich sie noch nicht gesehen habe; doch ich müsste schon sehr krank sein, sollte ich am nächsten Sonntag in der Kirche fehlen. Die Dame wird doch ohne Zweifel dort sein, und dann will ich sie genau betrachten, damit ich ihnen einen gründlichen Bericht abstatten kann, falls es ihnen selbst nicht möglich sein sollte, sie mit eigenen Augen zu sehen.«
»Ich bezweifle nicht, Lisette, dass du sie dir genau ansehen wirst; aber was erzählt man sich denn im Dorf von ihr? Weiß man, aus welchem Grund sie sich gerade jetzt, wo es schon auf den Winter zugeht, eine so wenig angenehme Wohnung genommen hat? Ist sie aus Prag? Ist sie Witwe oder unverheiratet?«
»Man hat all diese Fragen schon ihrem Bedienten gestellt, ohne auch nur die kleinste Antwort darauf zu bekommen; denn dieser Bediente soll ein mürrischer und äußerst grober Mensch sein. Seine Antworten sind: ja, nein, vielleicht: das geht euch nichts an; was er kauft, bezahlt er, ohne dabei irgendetwas zu sagen, und wenn er fertig ist, entfernt er sich auch sogleich wieder. So viel scheint jedoch schon sicher zu sein, dass diese Leute keine Deutschen sind; denn sie haben eine ganz seltsame Aussprache und bedienen sich untereinander fremder, unverständlicher Worte.«
»Ist diese Dame denn schon länger hier?«, fragte Helene, in der bereits die Hoffnung keimte, dass ihr die Fremde eine Gesellschafterin sein könnte, mit der zugleich einige Abwechslung in ihr einfaches, gleichförmiges Leben käme.
»Sie ist an demselben Tag hier angekommen, an dem der Herr Oberst abreiste. Anfangs stieg sie bei dem Schäfer Paul ab und fragte ihn, ob nicht in der Nähe irgendein Haus zu mieten oder zu kaufen sei. Paul erwiderte, dass die Gebrüder Gierschmann das kleine Haus im Wald verkaufen wollten; sie ließ sie sogleich herbeiholen, handelte mit ihnen den Preis aus und schlief schon in derselben Nacht in ihrem neuen Zuhause. Paul und die beiden Gierschmanns haben aus diesem Verkauf anfangs ein Geheimnis gemacht, wahrscheinlich, weil sie der armen Dame eine übermäßig hohe Summe für das Haus abgenommen haben. Aber am Ende kommt doch alles heraus: Die Geschichte wurde bekannt, und ich bin nicht die Letzte, die sie erfahren hat. Vor einer Stunde habe ich sie von der Frau des Nachtwächters gehört, und ich würde gegen meine Pflicht gehandelt haben, wenn ich ihnen nicht sogleich alles erzählt hätte.«
Helene dankte Lisette durch eine Verneigung des Kopfes für ihren guten Willen und nahm sich vor, so bald wie möglich Bekanntschaft mit der fremden Dame zu machen.
Während dieses langen Gesprächs schwieg Werner, der ebenfalls zugegen war, und schüttelte nur von Zeit zu Zeit den Kopf. Diese Bewegung und sein Stillschweigen fielen der Oberstin auf und daher fragte sie ihn, ob er Misstrauen gegen die unbekannte Dame hege.
»Nun ja«, erwiderte Werner, »ich sehe nicht gerade etwas Gutes darin, das sie in dieser Gegend erschienen ist. Eine junge Frau, die auch hübsch sein soll, wie man sagt, kommt mit einem einzigen Bedienten hierher, um sich in ein abgelegenes Haus einzuschließen: Sollte das nicht zu denken geben? Hat sie einen Mann? Wo ist ihre Familie? Könnte sie vielleicht eine Abenteurerin sein? Ich habe ehemals genug von diesen geheimnisvollen Prinzessinnen bei unseren Offizieren gesehen, die anfangs alle Blicke scheuten und sich unnahbar verhielten, bis sie irgendeinen Fang gemacht hatten. Dann erschienen sie am helllichten Tage und zeigten ihre Reize, ihre Pracht und ihr schlechtes Benehmen; hatten sie nun die Frucht gänzlich ausgesogen, verschwanden sie plötzlich wie die Irrwische, die wir oft dort unten auf dem Morast erblicken.«
»Ich kann mir vorstellen«, antwortete Helene, »dass man solche unglücklichen Geschöpfe in einer großen Stadt antrifft, die, um einen desto besseren Handel mit ihren Reizen zu machen, die Neugierde durch das Dunkel anzufachen versuchen, mit dem sie sich umhüllen; aber hier in R…, mein guter Werner, was sollte eine solche Person hier suchen? Wo ist hier der reiche Junggeselle, den sie verführen könnte? Ich kenne in der ganzen Gegend nur Familien, die in der vollkommensten Eintracht leben und zudem in Kürze das Land bis zum künftigen Sommer verlassen werden. Kann es nicht vielmehr sein, dass diese Dame Schicksalsschläge erlitten hat? Oder schämt sie sich vielleicht, in der Welt auf einem niedrigeren Fuße zu leben, als ihr früher ihrem Rang nach zukam? Und wird wohl eine heutige Sirene mitten im Wald, fern von jeder Straße ihren Aufenthalt wählen? Wird sie sich nicht vielmehr den Orten nähern, die häufig von Reisenden besucht werden? Nein, mein lieber Werner, dein Verdacht ist ungerecht; man sollte von seinem Nächsten nichts Übles denken, solange keine triftigen Gründe dazu vorhanden sind.«
Werner erwiderte nichts, aber er schien keineswegs überzeugt zu sein. Ihm diente seine Erfahrung als Richtschnur, wonach er alles beurteilen zu können glaubte, was ihm begegnete.
Der folgende Tag war außerordentlich schön. Gegen Abend gingen die Kinder unter Werners Aufsicht spazieren, und der Zufall führte sie zum nahe gelegenen Wald, während Helene selbst sich nicht so weit vom Schloss entfernte, sondern nur bis zum Dorf hinunterging, wo sie mit den Landbewohnern, denen sie begegnete, von der nahe bevorstehenden Ernte plauderte. Alle erzählten ihr aber von der fremden Dame; ihre Ankunft hatte die allgemeine Neugier gereizt und man beobachtete daher jeden ihrer Schritte. Man wusste, dass sie gegen Abend ihre Wohnung verließ, um in der Umgegend spazieren zu gehen; solange aber die Sonne noch am Himmel stand, zeigte sie sich nur höchst selten. Den ganzen Tag brachte sie in einem Zimmer ihres oberen Stockwerks zu, wo niemand sie zu sehen bekam. Ihr alter Bedienter verrichtete sämtliche Geschäfte des Hauswesens, aber er sah stets so mürrisch aus, dass man keine Lust verspürte, eine Unterhaltung mit ihm anzuknüpfen, wenn er dann und wann ins Dorf kam, um etwas einzukaufen.
Je mehr Helene über die Unbekannte hörte, desto fester nahm sie sich vor, sie kennenzulernen; denn trotz all ihrer vortrefflichen Eigenschaften war die Frau Oberstin doch immer noch eine Tochter unserer gemeinsamen Stammmutter Eva. Allerdings wusste sie ihren geheimen Wunsch unter einer scheinbar großen Gleichgültigkeit zu verbergen, und als es finster zu werden begann, kehrte sie zum Schloss zurück.
Sobald ihre Kinder sie erblickten, liefen sie ihr voller Freude entgegen. »Ach, Mutter, liebe Mutter!«, riefen beide zugleich. »Wir haben die schöne unbekannte Dame gesehen und mit ihr gesprochen. Sie hat uns diese schönen Blumenkränze geschenkt. Ach, wie gut und wie hübsch sie ist!«
Dieses unverhoffte Zusammentreffen und die Worte ihrer Kinder reizten Helenes Neugierde noch mehr. »Still, liebe Kinder«, sagte sie, »sprecht nicht beide zugleich; eines von euch soll mir erzählen, was vorgefallen ist, und das andere kann dann nachholen, was das erste vielleicht vergessen hat.«
Dieser Vorschlag war zwar ganz angemessen, aber nicht frei von Schwierigkeiten, was seine Ausführung anging. Julie, ein höchst lebhaftes, niedliches Mädchen, schien nicht geneigt, ihrem Bruder das Wort zu überlassen, der seinerseits wieder das Recht des Älteren in Anspruch nahm, um der Erzähler des kleinen Abenteuers zu sein. Hieraus entstand ein ernsthafter Streit. Helene versuchte anfangs vergebens den Weg der Güte: Sie drang nicht durch, weil Julie sprechen und Wilhelm nicht schweigen wollte. Die Mutter sah sich endlich genötigt, ihre ganze Autorität zu gebrauchen, und ein bestimmter Befehl legte dem kleinen Mädchen Stillschweigen auf. Julie nahm nun eine schmollende Miene an und setzte sich in einen Winkel des Zimmers, wo sie ihr niedliches Gesichtchen in den Händen verbarg und dabei versicherte, dass ihr Bruder falsch erzähle, dass sie aber gewiss den Mund nicht öffnen werde, um ihn zu berichtigen.
Wilhelm, stolz auf die Auszeichnung, die ihm seine Mutter zuteilwerden ließ, stellte sich lächelnd vor sie hin und fing nun seine Erzählung an: »Ich hatte Lust, liebe Mutter, in das Tal hinabzugehen, um einige von den schönen Blumen, die dort so reichlich auf der Wiese wachsen, zu pflücken. Ich bat daher unseren Werner, uns dorthin zu führen, und er willigte ein; wir waren aber kaum einige Augenblicke da, so lief auch schon Julie, die niemals ruhig bleiben kann, mit allen Kräften auf den Wald zu.«
»Das ist nicht wahr!«, rief Julie, voll Ärger über die Beschuldigung ihres Bruders. »Ich verfolgte einen schönen, bunten Schmetterling und du tatest dasselbe. — Siehst du wohl, liebe Mutter, dass du von Wilhelm nichts Ordentliches erfahren wirst? Daher will ich dir lieber erzählen, was geschehen ist, denn mit mir hat ja die Dame zuerst gesprochen.«
»Ich habe dir befohlen zu schweigen«, antwortete die Mutter sanft, aber ernsthaft; »und ich will, dass du mir gehorchst. Dass ich also meinen Befehl nicht zum dritten Mal wiederholen muss!«