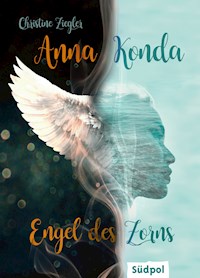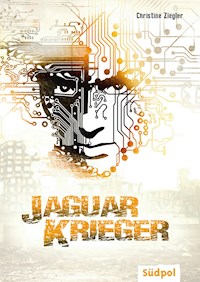15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Südpol Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Anna Konda
- Sprache: Deutsch
Das mitreißende Finale der großen Lovestory Halbengel Anna sehnt sich nach Leo, Luzifers Gehilfe, der von seinem Chef in den hintersten Winkel der Hölle strafversetzt wurde. Ein Leben ohne ihn ist für sie keine Option und so verfolgt sie nur noch ein Ziel: einen Weg in die Hölle zu finden, um Leo zu befreien. Doch dann kommt eine neue Nonne ins Kloster: Felicitas, eine junge Schwarze, deren engelsgleichem Charme die alten Nonnen sämtlichst erliegen. Und obwohl Anna Felicitas' wahre Natur erkennt, versinkt sie immer tiefer in ihrer Sehnsucht, sodass sie fast zu spät erkennt, in welcher Gefahr sich die Nonnen befinden und welchem Kampf sie sich wirklich stellen muss … Romantisch, spannend und humorvoll – der dritte Teil der fesselnden Trilogie Engel der Finsternis ist der dritte Teil der fesselnden Romantasy-Trilogie "Anna Konda" von Christine Ziegler. Liebe, Spannung & Übernatürliches - eine romantische Geschichte im Spannungsfeld zwischen christlicher Mythologie und Realität, zwischen Engel und Teufel. Für Fans von Marah Woolf, Ava Reed und Kerstin Gier.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Originalcopyright © 2022 Südpol Verlag, Grevenbroich
Autoin: Christine Ziegler
Umschlaggestaltung: Corinna Böckmann
E-Book Umsetzung: Leon H. Böckmann, Bergheim
ISBN: 978-3-96594-164-9
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung,
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
Mehr vom Südpol Verlag auf:
www.suedpol-verlag.de
Immer noch für Anna
Licht vertreibt die Finsternis und Finsternis verschlingt das Licht. Dazwischen liegt die Dämmerung mit ihren Grautönen, Hoffnungen und Ängsten.
Ein Lichtwesen verließ den Himmel, klopfte an die Klosterpforte und jagte die Schatten aus dunklen Ecken und unsicheren Herzen. Doch die Helligkeit war schonungslos.
Furcht gibt es in der Liebe nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die Furcht.
(Der erste Brief des Johannes, Kapitel 4, Vers 18)
Tagebucheintrag von Anna Konda am Freitag, 17. Dezember
Liebe lässt keine Halbherzigkeit zu. Sie fordert und riskiert alles. Daher wähle ich den unmöglichen Weg und rede mir ein, dass Grenzen nur im Kopf existieren.
Morgen weiß ich, ob mein Plan funktioniert, ob ich mein Leben aufs Spiel setze oder die Ordnung der Welt gefährde.
Wer auch immer diese Zeilen liest, drücke mir die Daumen. Bitte!
Sonntag, 10. Oktober
Flohmärkte gehörten seit Wochen zu meinem festen Trainingsplan. Es gab keinen besseren Platz, um Energien nachzuspüren, die an Gegenständen hafteten. Inzwischen erkannte und blockierte ich sie innerhalb von Sekundenbruchteilen. Es war nur eine Frage der Übung und ich war sehr diszipliniert.
Leos Warnung, mich von altem Krempel, wie er es nannte, fernzuhalten, klang zwar in mir nach, aber ich ließ mich dadurch weder von meinem Berufswunsch noch von meiner Lebensplanung abhalten.
Flucht wird nie deine Antwort sein, hatte mir Herr Li, mein Kampfkunsttrainer, kurz vor seinem Verschwinden mit auf den Weg gegeben. Und er hatte recht, Aufgeben kam für mich nicht infrage.
Behutsam griff ich nach einem pausbackigen Schutzengel, der ein Mädchen an der Hand führte. Zu seinen Füßen schlängelte sich eine giftgrüne Schlange. Ich lauschte, ob die Geschichte der bemalten Porzellanfigur in mir einen Widerhall fände. Aber es blieb still. Ich stellte das kitschige Ding zurück. Meine Finger tasteten weiter, strichen über ein altes, aber kaum benutztes Gebetbuch, eine Thermoskanne, eine Zitronenpresse, verharrten bei einer Marienstatue und kehrten zu dem Engelchen zurück. Die Dinge auf dem Campingtisch waren verstaubt, aber energetisch sauber.
»Der Engel kostet fünf Euro«, informierte mich der Verkäufer. »Billiger kriegst du den nicht. Bei mir wird nicht gehandelt. Der hat einen super Job gemacht und meine Mutter ihr ganzes Leben lang begleitet. Bis sie dann mit 101 friedlich eingeschlafen ist.«
Ich musterte die Engelsfigur. Der rechte Flügel war abgebrochen. Das Mädchen blickte trotzdem bewundernd zu seinem halbbeflügelten Beschützer auf und übersah dabei die Schlange. Beim nächsten Schritt würde es auf den Kopf des Reptils treten. Die Nonnen hätten den beschädigten Engel sofort in eine ihrer Gruseldeko-Installationen eingebaut. Wenigstens früher. Bevor Felicitas am 6. Januar an die Klosterpforte geklopft hatte. Inzwischen war sie die neue Postulantin* und hatte die fromme Deko mitleidlos beseitigt. Sie war jung und dynamisch und sorgte im Kloster für Ordnung. Seitdem waren die Gänge geputzt, entrümpelt und mit Notbeleuchtungen ausgestattet. Wie war es nur möglich, dass ich das Klosterleben vermisste und gleichzeitig froh war, nicht mehr dort zu sein?
»Vier Euro. Das ist mein letztes Wort.«
Ich betrachtete die Bruchstelle, wo der Flügel fehlte. Offensichtlich war der Engel einmal abgestürzt.
»Wo kriegt man sonst für dieses Geld einen fast ganzen Engel? Die sind ja normalerweise unbezahlbar und machen sich rar.«
Ich nickte zustimmend. Die Engel hatten sich, seit sie mich im Kloster abgelegt hatten, wirklich rargemacht. Nur einmal war einer ungebeten zu Besuch gekommen und hatte versucht, mich zu töten. Aber danach hatten es die Himmelsboten noch nicht einmal nötig gefunden, sich zu entschuldigen oder nach dem Rechten zu schauen. Erst nachdem Luzifer beinahe mit meiner Hilfe in den Himmel gestürmt wäre, sahen sie sich zum Handeln gezwungen und schickten eine Aufpasserin. Und das nur drei Wochen nach dem missglückten Einsatz des Himmelsschlüssels, eine für die Lichtwesen vermutlich rasend schnelle Reaktionszeit. Felicitas hatte dann alles überstrahlt. Auch mich. Sie war eben ein ganzer Engel.
»Drei Euro!«, brummte der Mann. »Der ist doch wirklich hübsch.«
Ich konnte mich nur zu gut an die seligen Gesichter der Nonnen erinnern, als Felicitas flügellos, aber engelsgleich durch die Pforte ins Kloster schwebte. Sogar meine Mutter war von ihr hin und weg. Und wieder spürte ich einen Stich. Ich war tatsächlich eifersüchtig, weil Felicitas mir meinen Platz im Herz der Schwestern weggenommen hatte. Außer bei Clara.
»Zwei Euro!«
Zwischen Felicitas und mir war es einfach. Es war Abneigung auf den ersten Blick. Wir konnten uns nicht ausstehen.
Der Mann griff nach dem Engel. »Jetzt reichts.«
»Ich nehm ihn.«
Der Mann grinste, riss eine Seite aus einer Illustrierten mit Promis und wickelte die Porzellanfigur darin ein. »Du bist vielleicht eine harte Verhandlerin. Sieht man dir gar nicht an. Beinahe hätte ich dir das Engelchen geschenkt. Das ist mir wirklich noch nie passiert.«
Ich lächelte. Wenigstens hier funktionierte meine Engelsnatur. Nachdem ich gezahlt hatte, steckte ich die Figur in meinen Stoffbeutel und schlenderte zum nächsten Stand. Die Herbstsonne übergoss die Welt mit goldenem Licht und gab den angerosteten und ausrangierten Dingen ein Stück ihres alten Glanzes zurück.
»Anna! Aaanaaaa!«, tönte Muriels Stimme wie ein Posaunenruf am Jüngsten Tag über das Flohmarktgelände. Besucher und Händler drehten sich fragend um. Seit Muriel beschlossen hatte, Schauspielerin zu werden, nahm sie Stunden in Stimmbildung und trainierte überaus fleißig. Das mit der Lautstärke klappte inzwischen super.
Zwei Reihen weiter entdeckte ich meine Freundin in einer bestickten Bluse und einer Jeans mit Schlag. Sie posierte vor einem Standspiegel und drehte sich um sich selbst.
»Stammt aus meiner Hippiezeit«, erklärte die Verkäuferin lächelnd. »Wie schlank ich damals gewesen bin.« Die Frau war inzwischen gemütlich rund und bestimmt über 70. Eine Lesebrille baumelte an einem Kettchen um ihren Hals und ihre kurzen Haare waren silbergrau. Mit verklärtem Blick betrachtete sie Muriel, der die Sachen wie angegossen passten, und summte leise vor sich hin.
»Don‘t you want somebody to love«, sang Muriel den Text zur Melodie. Daraufhin schmetterten beide den Song. Maximal schief, aber äußerst textsicher.
Ich setzte eine Sonnenbrille mit grünen Gläsern auf, schüttelte meine Haare und blickte in den Spiegel.
Plötzlich wurde der Gesang lauter. Die Luft war schlagartig kühl und der Boden matschig. Menschen klatschten und jubelten. Mein eigenes Bild verschwamm und stattdessen tauchte ein lachender junger Mann auf. Seine schwarzen Locken wurden von einem Stirnband zusammengehalten. Er kam auf mich zu und in seinen Augen sah ich nicht weniger als bedingungslose Liebe.
Schnell setzte ich die Brille ab. »Sie waren in Woodstock? Auf dem Festival?«, fragte ich atemlos.
Die Frau nickte und schloss kurz die Augen. Wie ich tauchte auch sie tief in die Vergangenheit ein. Nur waren es bei ihr ihre eigenen Erinnerungen. »Ja, ich habe Jefferson Airplane live gesehen, Janis Joplin, Santana und The Who. Dort habe ich auch meinen Mann Andi kennengelernt.« Sie fasste an ihre Halskette, wo zwei Eheringe nebeneinander hingen. Selbst ihre Trauer war voll Liebe. Andi lebte nicht mehr und war doch noch immer bei seiner Frau. Wie tröstlich.
»Wahnsinn«, flüsterte Muriel und machte einen Großeinkauf. Die Sonnenbrille setzte sie sofort auf. Dann hakte sie sich bei mir unter. »Und du hast wirklich den Spirit von Woodstock gefühlt? Make love, not war und so?«
Ich nickte.
Muriel schüttelte den Kopf. »Du bist meine beste und unheimlichste Freundin. Aber wahrscheinlich hat dich nur unser engelsgleicher Gesang in die Vergangenheit getragen.«
»Möglich«, erwiderte ich grinsend.
Wir bummelten weiter und ich übte an den Ständen, den Fluss der alten Energien zu stoppen. Das Woodstock-Erlebnis faszinierte mich, gleichzeitig ärgerte ich mich aber, dass ich die Kontrolle über die anhaftende Erinnerung verloren hatte. Seit ich im Juli, kurz nach meinem 18. Geburtstag, aus dem Kloster ausgezogen war, war mir das nicht mehr passiert. Aber Andi hatte mich aus dem Gleichgewicht gebracht. Bevor ich seine Gefühle blockieren konnte, hatten sie mein Herz erreicht. Allerdings gab es dafür eine einfache Erklärung. Andis Frau war ein lebender Verstärker. Vielleicht hatte ich auch nur ihre Erinnerung gesehen. Es musste daher nicht gleich als Trainingsrückschlag gewertet werden. Ich hatte mich im Griff. Die Woodstock-Brille war eine Ausnahme gewesen. Genau wie das intensive Gefühl. Wahre Liebe war selten und nicht jeder hatte das Glück, sie zu erleben. Ich wusste jedoch, wie sie sich anfühlte. Sie brannte höllisch heiß in mir.
Muriel und ich arbeiteten uns Seite an Seite durch einen Bücherstand. Sie schmökerte in Bestsellern und Kochbüchern. Ich wühlte mich durch die Theologie-Kiste.
Meine Freundin warf mir einen Seitenblick zu und grinste. »Mal wieder Himmel und Hölle?«
»Interessiert mich eben.«
Muriel zog ein Buch aus meiner Kiste. »Wie wärs mit einer Kinderbibel?« Sie blätterte darin. »Aber wahrscheinlich kennst du sowieso alle Geschichten in- und auswendig. Wobei die mit dem Wal und diesem Jonas ist schon sehr cool und superschön gezeichnet.«
Ich überflog das Inhaltsverzeichnis eines Lehrbuches über christliche Theologie. Aber dort wurden weder Engel noch Teufel erwähnt.
Muriel hielt mir Das große Handbuch der Dämonen unter die Nase. »Oder lieber etwas düsterer? Seit du aus dem Kloster raus bist, hat es dir ja eher die Hölle angetan.«
Tatsächlich las ich alles, was ich zu diesem Thema finden konnte. Ich nahm Muriel das Buch aus der Hand und schlug es bei dem Kapitel über magische Schriften auf, die von der Clavicula Salomonis, dem Grimorium Verum bis zu neueren Texten von H. P. Lovecraft und Aleister Crowley reichten. In den sogenannten Grimoires gab es Zaubersprüche, Namenslisten von Dämonen und Engeln mit ihren zugehörigen Siegeln, Rezepte für Zaubertränke, Anleitungen für Talismane oder astrologische Tabellen. Die Menschen hatten im Lauf der Jahrhunderte viel gesammelt und sich noch mehr ausgedacht. Bei einer besonders grausigen Teufelsdarstellung bekreuzigte ich mich unwillkürlich.
Muriel schüttelte den Kopf. »Mach dich endlich locker, Anna. Du steckst schon lange nicht mehr in deiner Klosterblase, sondern in unserem ganz normalen, wunderbaren Leben und das ist bestimmt nicht sündig oder höllisch oder sonst was.« Sie hob die neu erworbene Woodstock-Sonnenbrille an und musterte mich. »Oder fürchtest du dich immer noch vor dem Bösen, Anna?«
»Ich kann mich wehren«, erwiderte ich schlicht und klappte das Buch zu.
»Das glaub ich dir aufs Wort«, lachte Muriel. »Tim kann gar nicht fassen, wie gut du in diesem japanischen Schwertkampf bist, obwohl ihr doch erst vor ein paar Wochen damit angefangen habt. Ihn hat das schon immer interessiert und er weiß alles darüber. Und du gehst da einfach hin und kannst es.«
»Es heißt Kendo und ich lerne es erst. Vielleicht etwas schneller als andere. Aber durch Herrn Lis Training habe ich einfach einen Vorsprung.«
»Sei nicht so bescheiden, sondern sag einfach, dass du eine verdammt gute Kämpferin bist.« Sie wandte sich an den Verkäufer. »Neben meiner Freundin hier würden sogar die Avengers blass aussehen.«
Der Mann nickte höflich. Er hielt uns vermutlich für mittelmäßig irre.
»Hör auf damit, Muriel.«
»Nur wenn du heute mit mir tanzen gehst. Ich hab von einem total angesagten Club gehört und ich zieh die Flowerpower-Sachen an und du regelst mit deinem Charme die Sache mit dem Türsteher.«
»Immer gerne«, ging ich auf ihren Vorschlag ein. Auch wenn das bedeutete, dass ich am nächsten Morgen völlig übermüdet bei meiner Praktikumsstelle im Museum auftauchen würde. Aber je später ich ins Bett fallen würde, desto weniger Zeit hätte ich, mich nach Leo zu sehnen. So mein Plan, der leider nie funktionierte. Ich vermisste ihn immer. Bei jedem Atemzug, jedem Wimpernschlag, jedem Krähenschrei. In der Nacht flüsterte ich seinen Namen in die Dunkelheit. Am Tag beobachtete ich die Schatten und hoffte, er würde sich plötzlich daraus lösen. Aber er blieb verschwunden. Ich spürte ihn nicht mehr. Luzifer bestrafte Leo, weil er sich mit mir gegen seinen Chef verbündet hatte. Das hatte er jedoch nur getan, um mein Leben zu retten. Und jetzt durfte er die Erdoberfläche nicht mehr betreten. Und ich musste ohne ihn leben.
»Paleo oder vegan? Italienisch oder marokkanisch?«, unterbrach Muriel meine Gedanken.
Hilflos zuckte ich mit den Schultern.
»Dann nehm ich alle vier und das hier noch dazu.« Muriel legte ein blutrotes Buch auf den Stapel. »Für die Bildung.«
»Ist ein echter Klassiker«, bestätigte der Händler. »Wenn man Vampire mag, muss man Bram Stokers Dracula gelesen haben.«
Meine Freundin liebte Vampirromane. Ihre Augen blitzten. »Vielleicht lebt der Graf ja immer noch in seinem alten Schloss.«
Oder wurde von Leo in der Hölle bewacht. Muriels Fantasie blühte auf. »Wir könnten Jonathan Harkers Spuren folgen und dieses Buch als Reiseführer verwenden. Die ersten Seiten überspringen wir und starten nicht in London, sondern in München. Wir nehmen Tims Auto. Das wird der Roadtrip unseres Lebens!«
»Es ist nur eine Geschichte.«
»In jeder Geschichte steckt ein Funken Wahrheit«, verteidigte sie ihren Plan und hatte damit vielleicht sogar recht. Leo hatte mich nicht nur vor alten Energien, sondern auch vor Vampiren gewarnt. Er konnte sie nicht ausstehen.
»Auf dem Rückweg besuchen wir dann deine Verwandten. Da warst du schließlich noch nie.«
»Meine Eltern kommen aus Tschechien. Jonathan Harker traf Graf Dracula in Siebenbürgen, das liegt in Rumänien.«
Muriel zahlte. »Was du alles weißt. Muss an deiner okkulten Lektüre liegen.«
Ich kaufte das Dämonenbuch und steckte es zu meinem Schutzengelchen in die Tasche. Vielleicht würde ich darin einen Hinweis auf Leos echten Namen finden und könnte ihn rufen. Aber bestimmt würde Luzifer den Kontakt verhindern. Auch wenn ich Leos Namen wüsste, hätte ich damit sicher nicht mehr Macht über ihn als der Fürst der Hölle selbst. Trotzdem war es einen Versuch wert. Beschäftigung statt Verzweiflung! Das war meine Devise.
Zurück in unserer Wohnung vertiefte ich mich in das Buch. Muriel übte mit Tim einen Monolog für das Vorsprechen an der Schauspielschule. Gerade war sie in die Rolle von Shakespeares Julia geschlüpft. Ich hörte der unglücklich Liebenden zu und starrte aus dem Fenster in den wolkenlosen Himmel. Noch eine Woche. Dann würde ich mit dem Studium beginnen, von dem Leo mir vehement abgeraten hatte. Aber er konnte nicht ahnen, wie hart ich in den vergangenen Monaten an meinen mentalen und körperlichen Fähigkeiten gearbeitet hatte. Meine Abwehr wurde besser, Tag für Tag. Aber leider kam ich Leo damit nicht näher. Keinen Schritt. Wie Julia sich nach Romeo sehnte, sehnte ich mich nach Leo und wie sie wusste ich von der Unmöglichkeit einer Beziehung. Aber anders als Julia würde ich eine Lösung finden. Seit Shakespeare das Stück aufgeschrieben hatte, waren immerhin über 400 Jahre vergangen und die alten Grenzen hatten keinen Bestand mehr. Ich würde lieben, wen ich wollte. Davon würde mich selbst Luzifer nicht abhalten. Ich war jedoch völlig planlos, wie mir das gelingen sollte. Im Moment konnte ich nichts ausrichten. Daher würde ich jetzt erst einmal tanzen gehen.
Sonntag, 17. Oktober
Während ich über das Wasser des Olympiasees blickte, telefonierte ich wie jeden Sonntag mit meiner Mutter. Tim und Muriel hatten mir das Smartphone zum Geburtstag geschenkt und ich liebte dieses Gerät. Inzwischen fragte ich mich, wie ich so lange ohne ausgekommen war. Musik hören, Fotos machen, Informationen suchen oder wie jetzt während meiner Laufrunde zu telefonieren. Meine Mutter schwärmte gerade von Felicitas’ ghanaischen Kochkünsten. Ich dehnte meine Oberschenkelmuskulatur.
»Ich wünsche dir für morgen viel Glück. Du machst das schon mit dem Studium.«
»Danke.« Wie so oft fehlten mir bei meiner Mutter die Worte.
»Clara steht neben mir. Ich geb dich weiter.«
Es raschelte und wieder war meine Mutter am Telefon. »Übrigens habe ich Felicitas ein paar Anziehsachen von dir gegeben. Ich hoffe, du bist damit einverstanden. Aber die Ärmste kommt aus einem wärmeren Land. Sie ist die kalten Nächte hier nicht gewohnt.«
Und es würde noch viel kälter werden, dachte ich. Sie musste sich auf einen langen eisigen Winter einstellen, auch wenn das Kloster jetzt eine neue Heizung hatte. Ich konnte mir zwar nicht vorstellen, dass es im Himmel viel wärmer wäre, aber wahrscheinlich war Gestaltlosigkeit nicht temperatursensibel.
»Passt«, antwortete ich.
Felicitas hatte behauptet, in Afrika aufgewachsen zu sein. Ihre Mutter stamme aus Ghana und ihr Vater sei ein deutscher Arzt, der dort in einem Missionskrankenhaus arbeitete. Leider waren beide bei einem Unfall ums Leben gekommen. Genau diese Art von Geschichte schlug bei den Nonnen ein. Felicitas war anschließend zu einer Tante nach Deutschland geschickt worden und hatte eine Ausbildung zur Krankenpflegerin gemacht. Plötzlich hat dann Gott nach ihr gerufen und sie spürte, dass sie ins Kloster gehen musste. Oder so ähnlich. Ich hatte bei dem Märchen nicht genau zugehört, weil ich wusste, woher Felicitas wirklich stammte.
Es raschelte wieder.
»Kommst du nächsten Sonntag?«, fragte Schwester Clara.
Ich hatte die Einladung zur Einkleidung von Felicitas per Post bekommen und bisher nicht darauf reagiert.
»Ich weiß noch nicht«, wich ich aus.
»Es wäre schön, wenn du an Felicitas’ großem Tag dabei wärst. Sie wird sich freuen, wenn du kommst.«
Da war ich mir ganz und gar nicht sicher.
»Ich verstehe nicht, warum ihr es alle so eilig habt mit dem Noviziat. Sie lebt erst seit Januar bei euch.«
»Das hat Mutter Hildegard so entschieden. Felicitas ist es ernst und sie hat um Aufnahme in unsere Gemeinschaft gebeten. Wie du weißt, tun das nicht mehr viele junge Frauen.«
Sie hatte recht. Die Schwestern brauchten Nachwuchs und ein Engel war für das Kloster ein Glücksfall. Felicitas würde das Höllentor zuverlässig geschlossen halten und die Schwestern wären dadurch geschützt. Sie garantierte Sicherheit, wo ich Gefahr gebracht hatte. Ich sollte mich darüber freuen und nicht in meiner egoistischen Eifersüchtelei stecken bleiben. Objektiv betrachtet war es gut, dass sie da war.
»Ich freue mich für euch, wirklich, und werde kommen.«
Ein Entenpaar paddelte vorbei. Ich konnte Claras Lächeln fühlen.
»Jetzt erst einmal einen guten Start und Gottes Segen. Mögen seine Engel dich immer begleiten.«
»Amen«, flüsterte ich und beobachtete, wie die Sonne unterging und die Dämmerung als Vorbote der Nacht heranschlich.
Langsam trabte ich am Seeufer entlang. Die Wasserfläche atmete kühle feuchte Luft aus, die sich als feiner Nebel auf meine Haut legte. Es roch faulig, als würde am Ufer etwas verrotten. Mein Instinkt meldete Gefahr und ich wunderte mich, wie tief der Schock durch den Dämon im Badesee immer noch saß. Im Sommer war ich oft schwimmen gegangen und es war völlig unbeschwert gewesen. Daher dachte ich, ich hätte das Erlebnis verarbeitet. Aber wie bei einer Allergie reagierte mein mentales Immunsystem beim kleinsten Reiz über. Ich zwang mich, ruhig weiterzulaufen und kämpfte gegen meinen immer stärker werdenden Fluchtimpuls an.
Renn weg, schrie mein Innerstes. Ich lockerte meine Schultern und erhöhte das Tempo. Meine Panik nahm zu. Jeder Schritt kostete mich Überwindung. Ich keuchte.
Ein entgegenkommender Jogger musterte mich besorgt. »Alles in Ordnung? Schalt lieber einen Gang runter.«
Ich versuchte ein Lächeln. Mein Pulli klebte mir am Körper und mein Atem ging stoßweise. Erschöpft blieb ich stehen und stützte mich mit den Händen auf den Knien ab. Vielleicht hatte ich zu viel verdrängt und nichts verarbeitet. In den letzten Monaten hatte ich versucht, ein ganz normales Leben zu führen. Es wäre mir fast gelungen, wäre da nicht die unstillbare Sehnsucht nach Leo gewesen.
Die Pause brachte keine Erholung. Meine Pulsfrequenz stieg weiter und meine Pulsuhr meldete einen Alarm. Ich hatte über posttraumatische Belastungsstörungen gelesen. Reichte das modrige Wasser tatsächlich schon, um meine Erinnerungen zu triggern? Saß der Schock über das Erlebte derart tief und wurzelte in meinem Unterbewusstsein?
Zwei Männer im Anzug kamen mir entgegen. Wahrscheinlich würden auch sie mir ungefragte Trainingsratschläge geben.
Der Ältere lüpfte grüßend seinen Hut. »Sport ist Mord. Ich versteh nicht, warum die Menschen das erfunden haben. Aber scheinbar reicht ihnen ihre normale Arbeit nicht mehr. Früher waren sie mit dem puren Überleben beschäftigt und hatten für derart Absonderlichkeiten gar keine Zeit.« Er grinste mich an.
Mein Mund war plötzlich staubtrocken.
»Entspannen Sie sich doch. Sie sind ja ganz verkrampft.« Er machte einen Schritt auf mich zu und schnupperte. »Und Sie schwitzen. Passen Sie nur auf, sonst holen Sie sich noch den Tod.« Seine Augenfarbe wechselte von Grau zu feurigem Orange. Die Pupille war nicht rund, sondern schlitzförmig, wie bei Katzen oder Schlangen. Ich starrte ihm direkt in die Augen und folgte dem Sog, der von ihnen ausging. Luzifer blinzelte nicht.
»Hallo Anna«, ging sein Begleiter dazwischen. Damit war der Bann gebrochen und ich konnte meinen Blick abwenden.
»Hallo Kiki«, antwortete ich.
»Soso. Mein Mitarbeiter wird namentlich begrüßt und für mich gibt es nicht einmal ein Guten Tag oder noch lieber ein Grüß Gott, wir sind schließlich mitten in Bayern. Oder vielleicht ein stimmungsvolles Fahr-zur-Hölle oder Geh-zum-Teufel. Haben dir die Schwestern keinen Respekt vor dem Alter beigebracht? Alt genug wären sie eigentlich. Aber die haben ja scheinbar schon auf Erden das ewige Leben.«
Ich kämpfte gegen einen Schwächeanfall. Meine Beine zitterten und ich musste alle Kraft aufbringen, nicht vor Luzifer auf die Knie zu sinken.
»Wenn du sie mal wieder besuchst, erzählst du ihnen mal von der Kampagne Pinkstinks. Diese Wandfarbe ist doch alles andere als modern und zeitgemäß. Rosa ist nämlich ganz böööse.« Er dehnte das Wort.
Ich starrte den Boden und Luzifers Schlangenlederschuhe an und konzentrierte mich auf meine mentale Abwehr. Das war Schwerstarbeit. Beim letzten Zusammentreffen hatte der Fürst der Hölle getobt, weil die Nonnen die Klosterkirche rosa gestrichen hatten und nicht lindgrün, wie er vorgeschlagen hatte. Der Gedanke tat mir gut und heiterte mich sogar auf.
»Wobei der Ort seit dem plötzlichen Zuzug vergiftet ist. Dir gefällt es dort mit der Lichtverschmutzung auch nicht mehr, oder?« Er machte einen Schritt auf mich zu.
Unwillkürlich hob ich meinen Blick. Kikaru schüttelte leicht den Kopf. Aber es war zu spät. Luzifers Augen hielten mich fest.
»Was hältst du davon, wie Kikaru zu meinem Team zu wechseln? Deines hat dich ziemlich schnell aufgegeben. Ich bin da wesentlich anhänglicher. Glaub mir. Mit meinem Stellenangebot könntest du dir auch dieses staubtrockene und völlig nutzlose Studium sparen. In diesem Punkt hatte Leo, wie du ihn nennst, recht. Es ist nichts für dich. Pure Zeitverschwendung.« Er lachte schallend. Seine Stimme hallte im Park wider. Hunde begannen zu heulen und auf dem See flogen die Enten auf. Offensichtlich war er über meine Zukunftspläne bestens informiert. Es wunderte mich nicht, dass er mich überwachen ließ.
»Mein Mitarbeiter wird dich beraten und dir jede Frage beantworten. Wende dich vertrauensvoll und jederzeit an ihn. Ich muss jetzt leider los. Ein langweiliges Gespräch mit einem alten, aufgeblasenen Sack wartet auf mich. Aber was sein muss, muss sein. Und du bist zwar unterhaltsam, aber leider nicht sehr gesprächig. Aber das kann ja noch werden. Du scheinst ausreichend Potenzial zu haben. Meine Personalentwicklung ist übrigens ausgezeichnet und du hättest in meinem Umfeld ungeahnte Karrierechancen, Anna Konda.« Wie immer bereitete es ihm teuflische Freude, meinen Namen auszusprechen. »Und was deinen Leo angeht – solltest du ihn jemals finden, lasse ich ihn mit dir gehen. Dafür müsstest du dich jedoch in die Abgründe der Hölle bequemen. Wünsche den jungen Leuten noch einen erquicklichen Abend.« Wieder lüpfte er seinen Hut, drehte sich um und spazierte entspannt den Hügel hinauf. Dabei schwang er gut gelaunt seinen schwarzen Stock, der mit einem Silberknauf in Form eines Widderschädels verziert war.
»Du darfst ihm nicht direkt in die Augen blicken«, warnte Kiki mich. »Das kannst du nicht kontrollieren.«
Was spielten die beiden? Good Cop, bad Cop? Gehörte es zum Konzept, dass Luzifer mich bedrohte und Kikaru Vertrauen aufbauen sollte?
»Was macht ihr hier?«, fragte ich so gelassen wie möglich.
Kikaru musterte mich. Anders als bisher trug er kein Schwert bei sich. Sein grauer Anzug war elegant, aber unauffällig. Nur seine schwarzen Haare hatte er wie ein Samurai zu einem kleinen Bun am Hinterkopf gebunden.
»Wir haben eine Aktionärsversammlung in der Olympiahalle besucht. Wo trifft man sonst so viele Menschen, die vor Gier und Geld kurz vorm Platzen sind? Für Luzifer ist es das reinste Wellnessparadies. Jetzt hat er noch ein Gespräch mit einem der Vorstände und es wird dabei um nicht viel weniger als dessen Seele gehen.«
Die Seele irgendeines Vorstandsmitglieds kümmerte mich gerade herzlich wenig. »Wie geht es Leo?«, stellte ich die einzige Frage, die mich interessierte.
»Du musst ihn vergessen.«
»Niemals«, flüsterte ich.
Kikaru zog seine dunklen Augenbrauen hoch. Sein strenger Blick erinnerte mich an Herrn Li. Er war zwar größer als mein alter Kampfkunstlehrer, aber in Mimik und Bewegungsmuster glich er ihm. Vater und Sohn eben.
»Du bist tatsächlich stur. Komm, lass uns ein Stück gehen. Sonst erkältest du dich wirklich noch.«
Seite an Seite schlenderten wir am Ufer entlang.
»Wie geht es deinem Vater?«, fragte ich die zweitwichtigste Frage.
»Auch ihn musst du vergessen«, antwortete er. »Du brauchst Ablenkung, einen harmlosen Zeitvertreib. Dann wird das Leben leichter. Menschenherzen und -gehirne sind vergesslich. Glaub mir.«
Ich wurde wütend und blieb stehen. »So wird das nichts mit unserem Personalgespräch! Du sollst mir den Höllendienst schmackhaft machen, da wären ein paar Antworten auf meine Fragen gar nicht schlecht. Dieses Gerede, was ich alles vergessen soll, ist auf jeden Fall völlig daneben. Luzifer hat mir Informationen in Aussicht gestellt. Wenn du keine lieferst, beschwer ich mich! An höchster ...«, ich zögerte, »oder tiefster Stelle. Verstehst du?«
Kikaru war sprachlos. Plötzlich verzog sich sein ausdrucksloses Gesicht zu einem kleinen Grinsen. Er schlenderte weiter. »Du solltest vor meinem Chef mehr Respekt haben. Noch besser wäre Angst. Vorhin hatte ich das Gefühl, das wäre so. Aber Panik verfliegt bei dir schnell und hinterlässt kaum Spuren.«
»Und?«, blaffte ich ihn an.
Er zuckte mit den Schultern. »Spiel nicht mit dem Feuer, Anna. Das ist nicht dein Weg.«
»Woher kennst du meinen Weg.«
Er schwieg.
Ich spürte seine Aura. »Bereust du deine Entscheidung?«
»Das geht dich nichts an.« Damit drehte er sich um und verschwand. Anders als Luzifer spazierte er nicht davon, sondern löste sich standesgemäß in Rauch auf.
»Eingebildetes Pack«, schimpfte ich vor mich hin. »Wichtigtuer, Besserwisser, Angeber.« Mir fiel nichts mehr ein. Inzwischen fror ich erbärmlich. Ich rieb meine eiskalten Hände gegeneinander, blies warmen Atem in meine Handflächen und hüpfte auf der Stelle. Nichts half. Meine Zähne schlugen klappernd aufeinander.
Ich lief zur U-Bahn-Station und fuhr heim. Dort verschwand ich sofort im Badezimmer und stellte mich lange unter die heiße Dusche. Wie sollte ich Leo jemals erreichen? Musste ich mich dafür tatsächlich auf Luzifers Seite schlagen? Wie weit war ich bereit für meine Liebe zu gehen? Ich drängte meine aufkeimende Verzweiflung zurück. Ich würde einen anderen Weg finden. Immer noch zitternd zog ich mich an und ging zu Muriel und Tim, die ich in der Küche lachen hörte.
Dort lag das aufgeschlagene Paleo-Kochbuch und versprach Steinzeitkost. Die beiden standen am Herd. Diese alltägliche Situation tat mir gut und beruhigte mich.
»Es gibt eine Curry-Kokos-Bowl. So gut wie keine Kohlenhydrate«, informierte mich Muriel.
Irritiert betrachtete ich den Reistopf.
»Das ist geraspelter und in Kokosnussmilch gedämpfter Blumenkohl«, erklärte Tim.
Während ich den Tisch deckte, fragte ich, ob sie mich am Sonntag zur Feier ins Kloster begleiten wollten.
»Bin dabei. Klingt cool«, antwortete Muriel. Auch Tim nickte zustimmend.
»Weißt du, wie Felicitas dann heißen wird?«
Ich schüttelte den Kopf. »Der Name wird erst bei der Feier verraten.«
»Wahnsinn! Stell dir mal vor, du heißt vorher Erika oder Sabine und dann plötzlich Schwester Bonaventura oder Schwester Adelaidis oder Schwester Assumpta?«
Diese Schwestern gab es im Kloster tatsächlich.
»Früher wurde der Name vergeben, heute darf man ihn sich selbst aussuchen, hat mir Clara erklärt.« Ich hatte auch noch nie erlebt, dass eine Schwester in die Gemeinschaft aufgenommen wurde.
Muriel füllte den Blumenkohlreis schweigend in drei Schalen. Ich konnte ihr ansehen, wie es in ihrem Hirn arbeitete und sie sich Namensvorschläge ausdachte. »Schwester Thaddäa oder Fructuosa. Noch besser Schwester Deotilla.«
Tim platzierte in der Mitte der Schale ein Häufchen Blattspinat. »Wie kommst du nur auf so was?«, wunderte er sich.
»Ich sollte Felicitas beraten«, beschloss Muriel. »So eine Entscheidung will gut überlegt sein. Ein Hauch Exotik ist gut, nur nicht zu viel.« Sie streute großzügig eine gemörserte, intensiv duftende Gewürzmischung über das Essen und legte ein Stück frittiertes Hühnerfleisch dazu.
»Ich glaube nicht, dass sie deinen Rat will«, bremste ich den Enthusiasmus meiner Freundin.
Muriel grinste mich an und stellte die Schalen auf den Tisch. »Du magst sie nicht.«
»Kein bisschen«, erwiderte ich und schenkte allen Wasser ein.
Muriel trank einen Schluck und betrachtete mich. »Irgendwie seid ihr euch sogar ähnlich. Aber sie ist noch perfekter als du.«
»Von perfekt gibt es keine Steigerung«, warf Tim ein.
Muriel wiegte den Kopf. »Doch, offensichtlich schon. Aber die macht diese Felicitas nicht sympathischer, sondern einfach nur besserwisserisch und langweilig.«
Montag, 18. Oktober
Am nächsten Tag begann mein Studentinnenleben. Muriel drückte mir nach dem Frühstück eine kleine Schultüte in die Hand. »Lass dich bloß nicht einschüchtern. Es ist nämlich ganz einfach: Wissen heißt wissen, wo es geschrieben steht und das findest du bestimmt schnell heraus.«
Ich war sprachlos. Muriel lachte. »Dieser Spruch ist leider weder von mir noch von Herrn Li. Sondern von Albert Einstein. Der sagt auch so Sachen wie Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.«
Unter diesem Gesichtspunkt verfügte Muriel über unendliche Weisheit.
Mit klopfendem Herzen lief ich kurz darauf durch die langen Gänge des Universitätsgebäudes und suchte nach dem richtigen Hörsaal. Die kleine Schultüte hatte ich in meine Tasche gesteckt, Muriel hatte darauf bestanden, dass ich sie mitnahm. Die Raumnummerierung war verwirrend, lange Gänge war ich jedoch aus dem Kloster gewohnt und mit ein paar kleineren Umwegen kam ich pünktlich ans Ziel. Die Einführungsveranstaltungen waren mit viel Organisation und Begrüßungen überfrachtet, aber ich lernte meine Kommilitonen kennen. Wir waren ein kleiner Jahrgang, sieben Männer und sieben Frauen, und ich fühlte mich in dieser überschaubaren Gruppe auf Anhieb wohl. Ich war die Jüngste. Einige hatten schon längere Berufserfahrung oder eine abgeschlossene handwerkliche Ausbildung. Ich konnte bisher nur ein paar Wochen Praktikum vorweisen.
Am Nachmittag berichtete ich Muriel alles haarklein. Sie stand mal wieder in der Küche. Kochen war neben der Schauspielerei ihre neue Leidenschaft.
»Ist ziemlich viel Theorie, Mathematik, Physik und Chemie.«
Muriel verdrehte die Augen und tauchte Apfelringe und Bananenstücke erst in Teig und ließ sie dann in heißes Fett gleiten.
»Am meisten freue ich mich auf die praktischen Sachen. Wir fotografieren und beschreiben echte Objekte, haben Kurse direkt im Museum, arbeiten im Labor und bestimmen Fasern und Farbstoffe.«
»Klingt wirklich atemberaubend spannend.« Muriel wendete einen Apfelring.
»Und du? Wie war dein Tag?«
Muriel lächelte. »Wunderbar! Ich habe Pflaumenmus eingekocht und nebenbei die Rolle von Julia gelernt. Wobei ich mir die ganze Zeit denke, das mit Romeo hätte so nicht passieren müssen. Ein paar dämliche Missverständnisse und dann sind beide tot. Das ist so was von unnötig. Liebe hat einfach immer recht. Sie ist doch das Einzige, was wirklich zählt. Wen interessiert da schon die Abstammung oder Familientraditionen?«
Ich nickte. »Aber manche Grenzen sind unüberwindbar.«
Muriel schüttelte energisch den Kopf. »Dann sind diese Grenzen falsch. So einfach ist das.«
Wenn es nur wirklich so einfach wäre, dachte ich.
Dienstag, 19. Oktober
Am nächsten Vormittag sollten wir in einem Seminar Gegenstände beschreiben und wenn möglich alten Fotos und somit ihren früheren Besitzern zuordnen. Vor dieser Aufgabe hatte ich Angst. Andererseits war es genau das, was ich machen wollte. Dingen ihre Geschichte zurückgeben und so das Schicksal der Menschen wieder sichtbar machen. Ich wusste, dass die Sachen aus dem Konzentrationslager in Auschwitz stammten. Vorsichtig öffnete ich einen der Kartons und holte einen roten Kinderpullover heraus, der in weißes Seidenpapier gewickelt war. Ich versuchte unbeteiligt zu bleiben, aber gegenüber diesem Grauen gab und gibt es kein Entrinnen. Es fuhr mir durch Herz und Knochen.
Fest drückte ich den handgestrickten Kinderpulli an mich. Die rote Wolle war vom Waschen verfilzt und riss mich in die Vergangenheit.
Beim Aussteigen aus dem Wagon schlingen sich dünne Kinderarme um den Hals der Mutter. Das Kind wimmert. Zwischen den Maschen des Pullovers wuchert tote Dunkelheit. Es gibt keinen Trost. Nur Verzweiflung und Schmerz. Die Luft zum Atmen fehlt. Sprachloses Entsetzen erfüllt die Stille.
Ich falle. Bodenlos tief.
»Wir bringen sie in mein Büro«, hörte ich aus der Ferne. Jemand hob mich hoch und trug mich weg.
»Sie bekommt keine Luft.«
»Öffnen Sie das Fenster.«
Auch jetzt noch drückte schwarzer Schmerz meinen Brustkorb zusammen. Mit Mühe saugte ich Sauerstoff in meine Lungen. Jemand tätschelte meine Wange.
»Anna? Hörst du mich?«
Ich öffnete die Augen. Mein Kommilitone Leander kniete neben mir.
Frau Professor Weißling legte ihr Telefon zurück auf den Schreibtisch und seufzte erleichtert. »Das wird schon wieder. Wenn es Ihnen nichts ausmacht«, Leander stimmte zu, bevor die Professorin den Satz zu Ende gesprochen hatte, »kümmern Sie sich um Frau Konda und ich fahre mit dem Seminar fort. Gute Besserung«, wünschte sie mir und schob sich an mir vorbei. Ich lag zwischen Schreibtisch und Bürotür auf dem Boden. Immer noch fiel mir das Atmen schwer.
»Der Pullover?« Meine Stimme klang fremd. Ich tastete nach dem rauen Stoff und sah wieder die Augen der Mutter, die ihr Kind an sich drückte.
»Dem ist nichts passiert. Als du ohnmächtig wurdest, hast du ihn losgelassen. Er liegt bei den anderen Kleidungsstücken.«
Die vom Leben übrig geblieben sind, dachte ich. Und die Menschen? Was war mit ihnen passiert? Hatte der Wind die Asche ihrer Körper verstreut, nachdem sie vergast und verbrannt worden waren?
»Ist dir das schon mal passiert? Brauchst du einen Arzt?« Leander reichte mir ein Glas Leitungswasser.
Ich nippte an der klaren Flüssigkeit. »Nein. Geht schon wieder. Keine Ahnung, was los war«, log ich und schloss die Augen. Unsägliches Leid war innerhalb von Sekunden in meine Seele gekrochen. Etwas Ähnliches war mir tatsächlich schon einmal passiert, als Graf Steinwart mir vor gut einem Jahr seine Waffensammlung gezeigt und ein Richtschwert in die Hand gedrückt hatte. Ich hatte das Blut der Hingerichteten geschmeckt und ihre Schreie gehört. Aber das Grauen, das der Kinderpullover an mich weitergegeben hatte, war unvorstellbar, namenlos. Ich setzte mich auf und achtete auf meine Atemzüge. In Gedanken zählte ich mit. Bis vier einatmen, kurze Pause, bis acht ausatmen. Leander kniete neben mir und beobachtete mich.
»Ich komm schon klar, danke. Ich hab einfach das Frühstück vergessen. Mein Blutzucker ist im Keller. Am besten gehe ich heim und esse was.«
»Ich begleite dich.« Leander streckte mir seine kräftige Hand entgegen, doch ich rappelte mich alleine hoch. Jede gutgemeinte Berührung schien mir wie Verrat.
»Es ist nicht weit. Ich wohne nur fünf Minuten von hier.« Ich wollte die Fürsorge loswerden.
»Dann bin ich zur nächsten Vorlesung zurück. Du musst dir keine Sorgen machen, dass ich etwas verpasse. Das Kinderzeug finde ich eh nicht besonders spannend.«
Meine Fingernägel bohrten sich in meine Handflächen. Kinderzeug von Kindern, die nicht erwachsen wurden. Ich starrte aus dem Fenster auf die viel befahrene Straße, die am Lehrstuhlgebäude vorbeiführte. Kinder, die gequält und ermordet worden waren.
»Vielleicht verträgst du das Mottengift nicht, mit dem die Kleidungsstücke behandelt worden sind. Die haben da bestimmt DDT oder Schlimmeres verwendet.«
Der Würgereiz kam plötzlich. Ich schmeckte Tod, Rauch und Chemikalien auf der Zunge und übergab mich. Die Reste meines Frühstücks, das ich nicht vergessen hatte, landeten auf dem grauen Laminat. Kraftlos ließ ich mich in den Schreibtischstuhl von Professor Weißling sinken.
»Keine Sorge. Ich mach das weg.« Leander verließ den Raum und kam kurz danach mit Papierhandtüchern und einer Mülltüte zurück. Ich beobachtete ihn beim Saubermachen, ohne ihm meine Hilfe anzubieten.
Leander putzte entschlossen. Trotz seiner stattlichen Größe und seiner schnellen Bewegungen wirkte er behäbig. Er trug ein weit geschnittenes weißes Leinenhemd und eine braune Lederhose, die entlang der Beine geschnürt war. Sowohl seine Kleidung als auch sein sorgfältig gestutzter Knebelbart hätten einem Mann der Gotik gut gestanden. Passierte das, wenn man sich zu viel mit Vergangenem beschäftigte? Verwischten sich dann die Grenzen zur Gegenwart und Vergangenes drängte in unser Leben? Leander stammte aus einer Regensburger Restauratorendynastie und fast seine ganze Familie kämpfte gegen Zerfall und Vergessen. Das hatte er mir gestern erzählt.
»Hohe Insektizidbelastungen sind in Museen ein großes Problem. Mein Bruder beschäftigt sich damit. Er hat eine eigene Firma, die unterschiedliche Methoden zur Dekontaminierung anbietet«, beschwerte er die laute Stille mit leeren Worten.
Der graue Fußboden war wieder sauber.
»Komm jetzt.«
Folgsam stand ich auf. Leander hatte meine Jacke und Tasche aus dem Seminarraum geholt. Mir fehlte die Kraft, mich durchzusetzen. Daher lief ich neben Leander her, der weiterhin auf mich einredete, weg von den Kinderkleidern aus Auschwitz. Ich schämte mich für meine Reaktion auf die flüchtige Wahrnehmung, die nur wenige Augenblicke gedauert hatte. Es war nichts im Vergleich zu dem Grauen, das diese Menschen erlitten hatten.
Vor der weiß lackierten Haustür nahm Leander mir den Schlüssel aus der zitternden Hand und sperrte auf. Dabei erzählte er mir, dass er in einem Studentenwohnheim am Olympiapark wohnte. »Die Mieten in München sind reiner Wucher.«
Ich nickte und hatte keine Ahnung. Die Wohnungssuche war für mich problemlos gewesen. Muriel, die entgegen ihrer eigenen Prognose das Abitur bestanden hatte, war mit ihrem Freund Tim zusammengezogen und ich hatte ein Zimmer neben der trauten Zweisamkeit bezogen. Die Miete hatten Tims Eltern, die Eigentümer der Wohnung, mit meiner Mutter geklärt. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich kostenlos dort wohnte. Die Fabigs waren eine großherzige Familie.
»Schönes Haus.« Anerkennend strichen Leanders Finger über die Jugendstilfliesen, die das Treppenhaus zierten. »Wie bist du in dieser Lage zu einem Zimmer gekommen? Hast du dem Teufel deine Seele verkauft?«
Meine Hand suchte am Geländer Halt. »Ich hab sie ihm geschenkt«, flüsterte ich und griff ins Leere. Dann umhüllte mich erneut dunkle Stille.
»Sie ist heute zum zweiten Mal ohnmächtig geworden. Einmal in der Uni und dann hier im Treppenhaus.« Leander klang ehrlich besorgt.
»Nur gut, dass du bei ihr warst und sie aufgefangen hast. Was da alles hätte passieren können. Ich darf mir das gar nicht vorstellen. Sie hätte sich den Kopf anschlagen können und wäre für die nächsten dreißig Jahre ins Koma gefallen oder sie hätte ihre Erinnerung verloren und mich nicht wiedererkannt. Dann hätten wir uns ganz neu kennenlernen müssen. Aber ich hätte ihr alles erzählt.«
Wie könnte ich jemals meine beste Freundin Muriel vergessen? An ihrer Seite musste man sich nicht einmal vor einer Amnesie fürchten. Dank ihrer ausgefeilten Schnellsprechtechnik würde sie den Großteil mein bisheriges Leben innerhalb weniger Stunden wiedergeben. Was für meine Kindheit und Jugend auch nicht sonderlich schwer wäre, weil mein Alltag maximal vorhersehbar gewesen war. Bis zu meiner Begegnung mit Leo. Seitdem war alles anders. 15 Monate war es her, dass er mir als Abgesandter der Hölle unter einer Linde begegnet war. Wegen mir war Leo von seinem Chef Luzifer in die Hölle verbannt worden und durfte Zeit meines Lebens die Erde nicht mehr betreten.
Ob ich ihn jemals vergessen konnte? Mit oder ohne Amnesie? Ich bezweifelte es. Er hatte sich in meine DNA eingebrannt. Er war ein schwarzer Fleck, ein Brandzeichen auf meiner hellen Halbengelseele.
Muriel war Leo nur ein einziges Mal begegnet und hatte mich über Wochen wegen ihm gelöchert. Inzwischen war sie jedoch viel zu sehr mit ihrem eigenen Leben beschäftigt. Ich sprach seinen Namen nie aus, verbat mir sogar an ihn zu denken. Was nicht funktionierte. Nicht einmal für eine Stunde.
»Wirklich sonderbar. Normalerweise ist Anna körperlich total robust. Die haut so schnell nichts um«, wunderte sich Muriel und deckte mich zu. »Die ist so sportlich, die würde jeden Ironman blass aussehen lassen und Kampfsport kann sie. Irgendwas Asiatisches und Bogenschießen, auch wenn sie das hier in München gar nicht mehr macht. Dafür geht sie jetzt mit Tim, das ist mein Freund, zum Kendo. Da ist sie auch schon viel besser als er. Aber das ist kein Wunder. Daheim hatte sie sogar einen privaten Trainer, Herr Li hieß der, der war zwar auch der Koch, aber der konnte ganz tolle Sachen. Durch die Luft hüpfen, mit Stöcken kämpfen und kunstvoll schreiben, so mit Pinsel und Tusche. Konnte natürlich keiner lesen. Aber die Nonnen waren begeistert. Hat Anna dir schon erzählt, dass sie in einem Kloster aufgewachsen ist?« Wie immer wartete Muriel nicht auf die Antwort ihres Gesprächspartners, sondern fuhr unbeeindruckt fort.
Ich stellte mich schlafend und konnte nicht sehen, ob Leander wenigstens den Kopf geschüttelt hatte.
»Ihre Eltern, ihr Vater ist leider schon seit Jahren tot, waren dort Hausmeister. Die alten Nonnen hatten immer panische Angst, dass der kleinen Anna was passieren könnte. Es ist ein mittleres Wunder, dass sie überhaupt zum Studium weggehen durfte. Ich dachte immer, die wollen, dass sie im Kloster bleibt und den ganzen Tag betet. Aber jetzt passen eben Tim und ich auf sie auf und die Fabigs, das sind Tims Eltern. Besonders Selene, Tims Mutter, ruft oft an und fragt nach ihr. Über Anna scheint sie sich mehr Gedanken zu machen als um ihren eigenen Sohn.«
Davon wusste ich noch gar nichts.
»Ich versteh diese übertriebene Fürsorge nicht. Ihr ist noch nie was passiert. Aber stell dir vor, ich bin letztes Jahr von einem Pfeil getroffen worden. Ich wäre beinahe gestorben. Sogar der Priester war schon da. Wegen der letzten Ölung und so. Aber dann haben die Schwestern ganz viel gebetet und alle waren bei mir. Meine Mama, Tim und Elias. Und dann ging es mir wieder besser. Anna hat mir am Krankenbett Berufsvorschläge gemacht und bei Zauberin bin ich dann aufgewacht. Aber eigentlich weiß ich noch immer nicht, was ich mal machen will. Zurzeit denke ich, Schauspielerin wäre gut oder Köchin. Hast du übrigens Hunger? Ich habe gerade orientalische Energiekugeln gemacht. Schau nicht so entsetzt, ist was Anständiges. Mit Nüssen und Datteln, völlig vegan. Das wird Anna auch guttun, wenn sie aufwacht.«
Vorsichtig öffnete ich die Augen. Ich lag auf meinem Bett. Muriel saß neben mir. Leander stand zu meinen Füßen.
»Wie gehts dir?«, fragte Muriel und strich über meinen Handrücken.
»Besser«, versuchte ich ein Lächeln. »Keine Sorge, ich brauch nur etwas Ruhe. Wahrscheinlich habe ich mich gestern beim Training überanstrengt.«
Meine Freundin nickte verständnisvoll, sprang auf und griff mit theatralischer Geste nach Leanders Arm. »Ich sags ja immer. Sport ist Mord.« Bei dem Satz, den Luzifer ebenfalls verwendet hatte, zuckte ich unwillkürlich zusammen. »Auf den Schreck, mach ich uns einen Kaffee«, entschied Muriel und zog Leander mit sich. Widerstand war zwecklos.
»Anna hat einen roten Kinderpulli in die Hand genommen und plötzlich ist ihr die Farbe aus dem Gesicht gewichen. Sie hat gewimmert, als hätte sie Schmerzen. Dann fiel sie einfach um«, hörte ich Leanders leiser werdende Stimme.
Ich stöhnte auf. Leo hatte mich in seinem Abschiedsbrief eindringlich gewarnt. Such dir einen ungefährlichen Beruf! Hörst du! Restaurierung ist das Allerletzte. Lass die Finger von dem alten Krempel. Hatte er mal wieder recht behalten?
Aber während des Praktikums war doch alles normal verlaufen. Mein Flohmarkttraining hatte sich ausgezahlt. Ich nahm nur die materielle Ebene der Gegenstände wahr und hatte keine Flashbacks oder Energiemuster gespürt. Woodstock war eine Ausnahme gewesen. Es ist gut, flüsterte ich meinem aufgeregten Herz zu. Das Schicksal der Menschen, die in Auschwitz ermordet worden waren, wühlt jede Seele auf und die Erinnerung daran muss lebendig bleiben.
Meine Berufswahl war richtig. Wenn niemand mehr erzählen kann, Menschen tot sind, sind Dinge die letzten Zeugnisse. Flüchtiges Festhalten, den Fluss der Zeit sichtbar machen, Dinge und Geschichten vor dem Vergessen bewahren, das wollte ich schon, seit ich ein Kind war.
Ich tastete nach Leos Brief. Er steckte zwischen Matratze und Bettgestell. Ich konnte den Wortlaut auswendig und trotzdem faltete ich ihn jetzt auseinander und strich mit den Fingerkuppen über die Buchstaben.
Wende dich dem Leben zu. Wenigstens diesen Rat von Leo versuchte ich umzusetzen. Seit Weihnachten beschäftigte ich mich ununterbrochen damit und minimierte so die Zeit zum Nachdenken. Mein verzweifelter Fleiß hatte mir eine ausgezeichnete Abiturnote beschert. Selbst meine Lehrer waren über meinen schulischen Endspurt erstaunt. Anschließend hatte ich mit Muriel und Tim die Wohnung renoviert, ein Museumspraktikum absolviert und mich ins Münchner Nachtleben gestürzt. Jetzt widmete ich meine ganze Energie dem Studium und was darüber hinaus noch übrig war, verbrauchte ich beim Sport. Ich rannte, bis meine Muskeln brannten, durch den Englischen Garten, trainierte Kendo oder ging bis in die Morgenstunden tanzen. Am besten waren die Tage, an denen ich abends am Küchentisch vor Erschöpfung einschlief. Dann war meine Sehnsucht betäubt. Trotzdem trug ich den Anhänger, den er mir geschenkt hatte, Tag und Nacht um den Hals. Innere Einsamkeit war mein ständiger Begleiter geworden, aber ich ignorierte sie, so gut ich konnte. Jammern half nicht. Ich würde jetzt in die Küche gehen und mit Muriel und Leander einen Kaffee trinken. Aber mir fehlte die Kraft zum Aufstehen. Ich starrte die Wand an und wickelte mich erneut in meine Bettdecke. Warm wurde mir davon nicht.
»Bis morgen«, rief Leander im Flur. »Wir treffen uns um 10 Uhr vor der Alten Pinakothek. Erhol dich.«
Tim klopfte und öffnete meine Zimmertür einen Spalt. »Kommst du zum Abendessen?«
Ich warf einen kurzen Blick auf mein Handy und realisierte, dass ich sieben Stunden wie bewusstlos geschlafen hatte. Langsam stand ich auf und kämpfte gegen eine aufsteigende Übelkeit an.
Muriel schob sich an Tim vorbei. »Du musst was essen. Sonst kippst du gleich wieder um«, entschied sie mit hochgezogenen Augenbrauen und klang dabei fast wie meine Mutter oder eine der Klosterschwestern, die Essen für ein universelles Heilmittel hielten.
Tatsächlich ging es mir nach dem scharfen Kürbis-Spinat-Curry besser. Tim hingegen wischte sich mit einem Stück Küchenrolle den Schweiß von der Stirn. »Sehr lecker, aber höllisch scharf. Damit hatte ich gar nicht gerechnet.«
Ob Leo wohl gerne scharf aß, fragte ich mich. Irgendwie passte das zu einem Teufel. Bei dem Gedanken lächelte ich still vor mich hin.
»Netter Typ, der Leander«, stellte Muriel fest und brachte das Dessert. »Meine Energiekugeln haben ihm gut geschmeckt. Er war ziemlich besorgt um dich.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Das passiert mir öfter. Ich zieh das scheinbar an«, erwiderte ich und biss in eine der Kugeln. Sie war in geröstetem Sesam gewälzt und schmeckte köstlich.
Wobei es nicht mehr ganz stimmte. Früher waren die Nonnen rund um die Uhr um mich besorgt gewesen. Bis Felicitas kam. Schon nach einer Woche akzeptierte die Gemeinschaft sie einstimmig als Aspirantin, acht Wochen später als Postulantin und so hatte sich Felicitas in Rekordgeschwindigkeit im Kloster eingenistet. Alles an ihr war sanft, ihre braunen Augen, ihre Stimme, ihre Gesichtszüge. Ich konnte sie nicht ausstehen. Natürlich brauchten die Nonnen Nachwuchs. Seit Jahren hatte sich keine Frau mehr für den Klostereintritt interessiert. Ich konnte die Begeisterung der Schwestern bis zu einem bestimmten Grad verstehen. Mein Auszug kurz nach meinem 18. Geburtstag war dank Felicitas‘ erfüllender Anwesenheit schnell und unproblematisch verlaufen. Mein Zimmer in München war möbliert. Meine Mutter wollte, dass ich mein Kinderzimmer für Besuche behielt und alles unverändert ließ. Meine Sachen hatten locker in einen Umzugskarton und zwei Reisetaschen gepasst und somit in Tims Auto. Jeden Sonntag telefonierte ich fünf bis zehn Minuten mit meiner Mutter. Nur meine Lieblingsschwester Clara meldete sich öfter. Zusammen mit ihr hatte meine Mutter mich dreimal in München besucht. Auf Klosterausflüge und die Begegnung mit der wunderbaren Felicitas hatte ich überhaupt keine Lust und mich schon öfter gefragt, ob ich eifersüchtig war. Ja, das war ich und zwar mit Haut und Haaren.
»Ich hatte nicht das Gefühl, dass Leander unter einem Helfer-Syndrom leidet«, grinste Muriel Tim an. Er schwieg taktvoll.