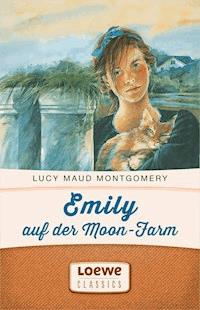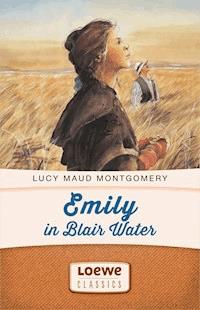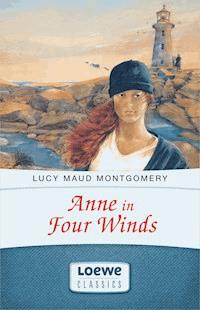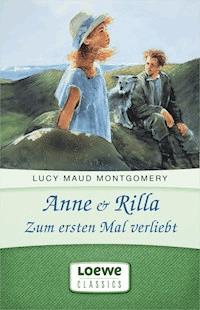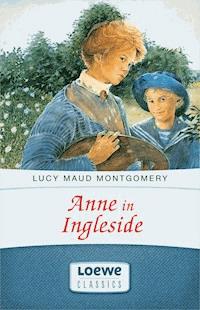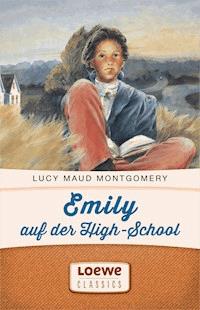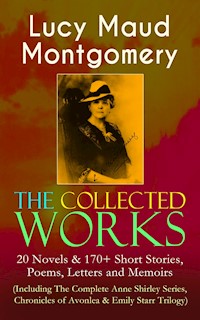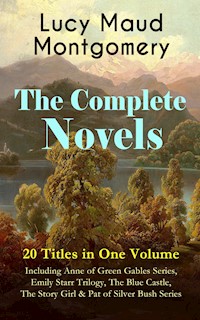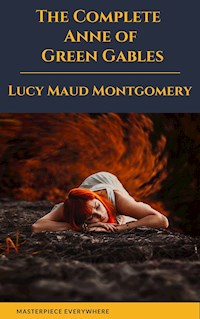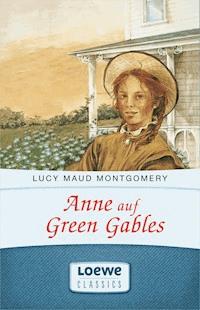
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Anne Shirley Romane
- Sprache: Deutsch
Der Jugendbuch-Klassiker auch endlich als eBook! Die turbulente Geschichte um das liebenswerte Waisenkind Anne, das auf der Farm Green Gables aufwächst, hat schon ganze Generationen begeistert! In der Fortsetzung sorgt Anne als Sechzehnjährige im Städtchen Avonlea für Aufregung – nostalgische Unterhaltung für Jung und Alt. Annes zeitlose Geschichten sind jetzt auch in der Netflix-Serie Anne with an E zu sehen. Was sollen die Cuthberts nur mit der quirligen Anne anstellen? Der lebenslustige Rotschopf stellt ihr sonst so beschauliches Leben ordentlich auf den Kopf. Dank ihres hitzigen Temperaments stolpert Anne von einer Katastrophe in die nächste! Aber zum Glück schafft sie es, auch die unmöglichsten Situationen irgendwie zu meistern. Enthält die Bände "Anne auf Green Gables" und "Anne in Avonlea".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 797
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gute Sterne leuchteten dir bei deiner Geburt,
Anne auf Green Gables
MrsRachel Lynde erfährt eine Neuigkeit
Mrs Rachel Lyndes Haus stand dort, wo die von Erlen und Fuchsien gesäumte Hauptstraße von Avonlea durch eine kleine Senke führte. Quer durch diese Talmulde lief ein Bach. Seine Quelle lag weit entfernt in den Wäldern der alten Cuthbert-Farm und es hieß, dort sei er noch ein ziemlich wilder, verzweigter Fluss mit geheimnisvollen Seen und Wasserfällen. Hier vor Lynde’s Hollow war er jedoch schon ganz zahm, denn selbst ein Bach konnte nicht einfach so an MrsRachel Lyndes Haustür vorbeifließen, ohne den gebührenden Anstand zu wahren. MrsRachels scharfen Augen entging nämlich nichts, was dort vorbeikam – bei Bächen und Kindern angefangen. Und sollte sie irgendetwas Merkwürdiges oder Störendes bemerken, würde sie weder ruhen noch rasten, bis sie die Ursache beseitigt hatte.
Nun gibt es ja eine Menge Leute – in Avonlea ebenso wie anderswo –, die für die Angelegenheiten ihrer Nachbarn mehr Interesse aufbringen als für ihre eigenen. MrsRachel dagegen besaß die außergewöhnliche Fähigkeit, ihr eigenes Leben und das ihrer Mitmenschen gleichermaßen gut im Griff zu haben. Sie war eine ausgezeichnete Hausfrau; alle anfallenden Arbeiten erledigte sie immer vorbildlich. Außerdem stand sie dem wöchentlichen Nähkreis vor, half in der Sonntagsschule aus und galt als wichtigste Stütze des kirchlichen Hilfswerks und des Fördervereins der Auslandsmission. Doch trotz all dieser Pflichten fand MrsRachel immer noch genug Zeit, stundenlang an ihrem Küchenfenster zu sitzen und Baumwolldecken zu stricken – sechzehn an der Zahl hatte sie schon fertiggestellt, wie die anderen Hausfrauen in Avonlea mit ehrfürchtiger Stimme zu berichten wussten. Während sie dort saß, hielt sie ein wachsames Auge auf die Hauptstraße, die hinunter in die Senke führte und sich dann den steilen rötlichen Hügel hinaufschlängelte. Da Avonlea auf einer kleinen dreieckigen Halbinsel lag, die in den St.-Lorenz-Golf hinausragte, musste jeder, der in den Ort fuhr oder ihn verlassen wollte, diese Straße benutzen und sich dem Scharfblick von MrsRachel aussetzen.
Eines Nachmittags saß sie wie gewohnt an ihrem Platz. Es war Anfang Juni, das warme Sonnenlicht fiel hell durch die Fensterscheiben. Der Obstgarten am Hang unterhalb des Hauses stand in voller Blüte und ein Heer von Bienen summte über der weiß-rosa Pracht. Thomas Lynde, ein sanftmütiger kleiner Mann, den die Leute in Avonlea nur »den Mann von Rachel Lynde« nannten, säte gerade Spätrüben auf dem hügeligen Feld hinter der Scheune. Auf seinem Feld drüben bei Green Gables hätte Matthew Cuthbert heute eigentlich das Gleiche tun müssen. MrsRachel war sich da ganz sicher, denn sie hatte am Abend vorher gehört, wie er drüben in Carmody in William J.Blairs Laden Peter Morrison erzählte, er wolle sich am nächsten Nachmittag an die Rübensaat machen. Natürlich hatte Peter ihn erst danach fragen müssen: Matthew Cuthbert war ja in seinem ganzen Leben noch nie freiwillig mit irgendetwas herausgerückt.
Nichtsdestotrotz fuhr Matthew Cuthbert um halb drei Uhr nachmittags in aller Seelenruhe durch die Talmulde den Hügel hinauf! Und nicht nur das: Er trug einen weißen Kragen und seinen Sonntagsanzug – ein eindeutiger Beweis dafür, dass er Avonlea verlassen wollte. Außerdem hatte er die braune Stute vor den Wagen gespannt, also hatte er eine längere Fahrt vor sich. Aber wohin wollte er? Und wozu?
Bei jedem anderen Einwohner von Avonlea hätte MrsRachel durch geschicktes Kombinieren bald eine einigermaßen plausible Antwort auf beide Fragen gefunden. Aber Matthew verließ den Ort so selten, dass schon etwas sehr Dringendes und Ungewöhnliches dahinterstecken musste. Er war der schüchternste Mensch, den man sich vorstellen konnte und er hasste es, sich unter fremden Leuten zu bewegen, wo er vielleicht sogar etwas sagen musste. Matthew Cuthbert mit weißem Kragen auf seinem Einspänner – das war schon ein äußerst seltener Anblick! Sosehr sie auch nachdachte – MrsRachel konnte sich keinen Reim darauf machen und ihr Nachmittagsvergnügen war ihr nun gründlich verdorben.
»Ich werde nach dem Tee nach Green Gables hinübergehen und Marilla fragen, was da los ist«, nahm sich die wackere Frau schließlich vor. »Er fährt ja sonst um diese Jahreszeit nicht in die Stadt und ich wüsste nicht, wann er jemals Besuche gemacht hätte. Hm … Wäre ihm der Rübensamen ausgegangen, dann würde er doch nicht in vollstem Sonntagsstaat losfahren, um neuen zu holen, und für den Doktor fuhr er wiederum nicht schnell genug. Irgendetwas muss passiert sein – jawohl! Und ich habe keine Minute Ruhe, bevor ich nicht weiß, was dieser Mann im Schilde führt.«
So verließ MrsRachel nach dem Tee das Haus. Sie hatte es nicht weit, denn das große, von weiten Obstgärten umgebene Haus der Geschwister Cuthbert lag nur eine knappe Viertelmeile von Lynde’s Hollow entfernt. Ein von wilden Rosen umsäumter Hohlweg führte dorthin. Green Gables lag ein gutes Stück abseits der Hauptstraße, an die sich die anderen Häuser Avonleas reihten. Matthews Vater, der nicht weniger scheu gewesen war als sein Sohn, hatte diesen abgelegenen Ort gewählt, als er das Haus erbaute.
»Kein Wunder, dass Marilla und Matthew so eigen sind. Hier sind sie ja von jeder Menschenseele abgeschnitten. Na ja, wer weiß, ob sie wirklich anders wären, wenn sie mehr Gesellschaft hätten. Mir ist es ja lieber, andere Leute um mich zu haben, aber vielleicht sind sie auch ganz zufrieden und haben sich an die Einsamkeit gewöhnt. Man kann sich bekanntlich an alles gewöhnen – selbst an eine Schlinge um den Hals, wie die Iren sagen.«
Mit diesen Worten verließ MrsRachel den Hohlweg und betrat den Hof von Green Gables. Von den majestätischen Weiden auf der einen bis zu den schlanken Pappeln auf der anderen Seite herrschte hier musterhafte Ordnung. Kein Unkrautpflänzchen, kein noch so kleines Strohhälmchen oder Steinchen war zu sehen. Das wäre MrsRachels scharfen Augen natürlich nicht entgangen; sie hatte sogar den Verdacht, dass Marilla Cuthbert diesen Hof genauso oft fegte wie ihre Wohnstube. Hier hätte man wirklich vom Boden essen können.
MrsRachel klopfte an die Küchentür und trat auf Marillas Ruf hin ein. Die Küche war ein sehr freundlicher Raum – oder sie hätte es zumindest sein können, wenn sie nicht so fürchterlich sauber gewesen wäre. Warmes Sonnenlicht strömte durch das Westfenster, während das Ostfenster von wildem Wein beschattet wurde, der an der Hauswand emporkletterte. Hier im Schatten saß Marilla am liebsten – das heißt, wenn sie sich überhaupt einmal einen Moment lang Ruhe gönnte und sich hinsetzte. Gegen den Sonnenschein hegte sie nämlich ein gewisses Misstrauen; die Sonnenstrahlen kamen ihr so leichtfertig und munter vor, während man die Welt doch gar nicht ernst genug nehmen konnte. Und so saß sie auch jetzt wieder im Schatten und strickte. Hinter ihr war der Abendbrottisch gedeckt.
Noch bevor sie die Tür hinter sich schloss, hatte MrsRachel mit ihren scharfen Augen bereits alle Einzelheiten erfasst. Marilla hatte drei Teller aufgedeckt – also würde Matthew einen Gast mit nach Hause bringen; doch sie hatte das Alltagsgeschirr genommen und ganz gewöhnliches Apfelkompott und nur eine Sorte Kuchen bereitgestellt – folglich konnte es sich um keinen hochgestellten Besuch handeln. Wie sollte man sich dann aber Matthews weißen Kragen und den Einspänner erklären? Diese rätselhaften Vorgänge auf Green Gables machten MrsRachel ganz wirr im Kopf.
»Guten Abend, Rachel«, begrüßte Marilla sie lebhaft. »Ein schöner Abend, nicht wahr? Willst du dich nicht setzen? Wie geht es deiner Familie?«
Zwischen Marilla Cuthbert und MrsRachel bestand seit Langem eine Art Freundschaft, obwohl – oder vielleicht sogar weil – sie so verschieden waren.
Marilla war eine große hagere Frau mit einer eckigen Figur; ihre Haare hatten bereits einige graue Strähnen und waren immer zu einem Dutt gebunden, den sie mit zwei Drahtnadeln feststeckte. Sie machte einen strengen und etwas engstirnigen Eindruck, doch manchmal ließen ihre Gesichtszüge auch einen gewissen Sinn für Humor ahnen, der nur keine Gelegenheit bekommen hatte, sich zu entfalten.
»Uns geht’s gut«, sagte MrsRachel, »aber ich hatte schon befürchtet, bei euch sei etwas nicht in Ordnung. Ich habe nämlich Matthew vorhin bei uns vorbeifahren sehen. Will er gar den Doktor holen?«
Ein kleines Lächeln umspielte Marillas Lippen. Sie hatte schon mit MrsRachels Besuch gerechnet. Dass Matthew aus unerklärlichen Gründen weggefahren war, hatte ja unweigerlich die Neugierde ihrer Nachbarin anstacheln müssen.
»Nein, nein, mir geht’s gut, obwohl ich gestern wieder fürchterliche Kopfschmerzen hatte«, antwortete sie. »Matthew ist zum Bahnhof nach Bright River hinübergefahren. Wir bekommen einen kleinen Jungen aus dem Waisenhaus von Nova Scotia.* [*kanadische Provinz am Atlantik.] Er kommt mit dem Nachmittagszug.«
Hätte Marilla gesagt, Matthew wäre nach Bright River gefahren, um dort ein australisches Känguru abzuholen – MrsRachel hätte nicht überraschter sein können. Volle fünf Sekunden lang verschlug es ihr glatt die Sprache. Es war zwar kaum zu glauben, dass Marilla sie auf den Arm nehmen wollte, aber diesmal lag der Verdacht doch sehr nahe.
»Das ist doch nicht dein Ernst, Marilla?«, rief MrsRachel, als sie ihre Stimme wiedergefunden hatte.
»Doch, natürlich«, sagte Marilla so selbstverständlich, als ob es zu den üblichen Frühlingsarbeiten auf jeder normalen Farm in Avonlea gehörte, einen Waisenjungen aus Nova Scotia von der Bahn abzuholen.
MrsRachel war entsetzt. »Wie um alles in der Welt seid ihr denn nur auf diese Idee gekommen?«, fragte sie missbilligend. Man hatte sie nicht mal um Rat gefragt und das allein war Grund genug, der Sache mit Ablehnung zu begegnen.
»Nun, wir hatten es uns schon eine ganze Weile überlegt, eigentlich schon den ganzen Winter über«, erwiderte Marilla. »MrsAlexander Spencer war kurz vor Weihnachten hier und erzählte uns, sie wolle im Frühling ein kleines Mädchen aus dem Waisenhaus in Hopetown adoptieren. Seitdem ist uns die Sache nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Wir haben uns aber für einen Jungen entschieden. Matthew ist schließlich auch nicht mehr der Jüngste. Er wird schon sechzig und ist nicht mehr so schnell auf den Beinen. Sein Herz macht ihm ziemlich zu schaffen. Und du weißt ja, wie schwer es ist, heutzutage einen guten Arbeiter zu finden – abgesehen von diesen halbwüchsigen Franzosen. Die sind zu haben, aber sobald man sie eingewiesen und angelernt hat, verschwinden sie in die Staaten, um in den neuen Konservenfabriken das große Geld zu verdienen. Na ja, und da haben wir letzte Woche gehört, dass MrsSpencer nach Hopetown fahren wolle, um ihr kleines Mädchen zu holen. Wir haben ihr durch Robert Spencers Familie in Carmody ausrichten lassen, sie solle uns doch bitte einen tüchtigen, anständigen jungen Burschen von zehn oder elf Jahren mitbringen. Dieses Alter erschien uns am besten. Dann ist er alt genug, um gleich von Anfang an auf der Farm mit anzupacken, aber noch jung genug, um noch allerhand lernen zu können und sich einzufügen. Wir wollen ihm ein gutes Zuhause geben und ihn auch zur Schule schicken. Ja, und heute brachte uns der Postbote ein Telegramm von MrsAlexander Spencer. Sie wollte heute mit dem Nachmittagszug in Bright River sein und den Jungen dort absetzen. Sie selbst fährt gleich weiter nach White Sands.«
MrsRachel hielt sich selbst viel darauf zugute, dass sie immer ganz offen sagte, was sie dachte. Und dieser Gewohnheit folgte sie auch jetzt, nachdem sie die erstaunliche Neuigkeit erst mal verdaut hatte.
»Nun, Marilla, ich will dir meine ehrliche Meinung sagen. Ihr seid dabei, einen großen Fehler zu begehen – jawohl! Wer weiß, was ihr euch damit einhandelt. Ein fremdes Kind ins Haus zu nehmen, von dem ihr überhaupt nicht wisst, welche Anlagen es mitbringt und was für Eltern es hat! Erst letzte Woche habe ich in der Zeitung von einem Ehepaar gelesen, das einen Waisenjungen adoptiert hat, und er hat ihnen nachts das Haus angesteckt – und zwar mit voller Absicht, Marilla, sodass sie fast in ihren Betten verbrannt sind. Und ich habe noch von einem anderen Fall gehört, wo ein Junge aus dem Waisenhaus immer die Eier ausgelutscht hat. Es war ihm einfach nicht abzugewöhnen. Wenn du mich um Rat gefragt hättest – was du ja leider nicht getan hast, Marilla –, dann hätte ich euch gesagt: Lasst um Himmels willen die Finger davon – jawohl!«
Doch all diese Hiobsbotschaften konnten Marilla nicht aus der Fassung bringen. Sie strickte seelenruhig weiter.
»Da ist schon was dran an dem, was du sagst. Ich hatte zuerst ja auch meine Bedenken. Aber Matthew hatte es sich nun einmal in den Kopf gesetzt und da habe ich nachgegeben. Es kommt so selten vor, dass Matthew wirklich mal sein Herz an etwas hängt. Und was das Risiko angeht, so ist eigentlich alles riskant, was man auf dieser Welt tut. Eigene Kinder zu kriegen, ist auch nicht so sicher; die können genauso missraten. Außerdem ist Nova Scotia nicht so weit von unserer Insel entfernt. Der Junge kommt ja nicht aus England oder aus den Staaten, folglich kann er auch nicht so viel anders sein als wir.«
»Nun, hoffen wir das Beste«, sagte MrsRachel in einem Tonfall, der ihre Zweifel deutlich hören ließ. »Sag aber bloß nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, wenn er vielleicht Green Gables ansteckt oder Strychnin in den Brunnen schüttet. Erst kürzlich ist mir ein Fall zu Ohren gekommen, wo ein Waisenkind drüben in New Brunswick auf diese Weise eine ganze Familie ausgelöscht hat. Allerdings handelte es sich dabei um ein Mädchen.«
»Na ja, von einem Mädchen ist ja auch nicht die Rede«, gab Marilla zurück, als wäre das Vergiften von Brunnen eine typisch weibliche Angewohnheit. »Ich würde nicht im Traum daran denken, ein Mädchen aufzuziehen. Ich frage mich sowieso schon, wie MrsAlexander Spencer auf diese Idee gekommen ist. Aber sie würde ja nicht mal davor zurückschrecken, ein ganzes Waisenhaus zu adoptieren, wenn sie es sich einmal in den Kopf gesetzt hätte.«
MrsRachel wäre zu gerne dageblieben, bis Matthew mit dem kleinen Waisenjungen zurückkehrte. Doch da es bis dahin noch mindestens zwei Stunden dauern würde, entschied sie sich lieber dafür, zu den Bells hinüberzugehen und ihnen brühwarm von dieser Neuigkeit zu berichten. Das würde die Sensation sein! Und MrsRachel liebte es nun mal, Sensationen zu verbreiten.
Marilla war erleichtert, als MrsRachel aufstand; in ihrer Gegenwart fühlte sie all ihre Zweifel und Bedenken wachsen.
»Das hat gerade noch gefehlt!«, rief MrsRachel aus, als sie wieder allein auf dem Hohlweg war. »Das Ganze kommt mir immer noch wie ein Traum vor. Mir tut vor allem das kleine Wesen leid. Matthew und Marilla haben doch überhaupt keine Ahnung von Kindererziehung! Ein Kind auf Green Gables, das ist eine geradezu gespenstische Vorstellung. Es hat dort niemals Kinder gegeben. Matthew und Marilla waren ja schon groß, als das Haus gebaut wurde – falls die beiden überhaupt jemals kleine Kinder gewesen sind, was man manchmal bezweifeln möchte. Um nichts in der Welt möchte ich in der Haut dieses Waisenknaben stecken!«
Das alles erzählte Mrs
Matthew Cuthbert erlebt eine Überraschung
Matthew Cuthbert fuhr mit seinem Einspänner durch lichte Tannenwälder und grüne Täler, vorbei an Gehöften und blühenden Obstgärten. Bis Bright River waren ungefähr acht Meilen zurückzulegen und Matthew genoss die Fahrt auf seine Art sehr. Nur wenn ihm Frauen entgegenkamen, war ihm das äußerst unangenehm. Er musste sie ja mindestens mit einem Kopfnicken bedenken, denn auf Prince Edward Island war es üblich, jeden zu grüßen, den man auf der Straße traf – ob man ihn nun kannte oder nicht.
Matthew fürchtete sich vor Frauen. Er hatte das unangenehme Gefühl, dass diese rätselhaften Geschöpfe sich heimlich über ihn lustig machten – womit er nicht unbedingt unrecht hatte. Seine Bewegungen waren linkisch und mit seinen langen grauen Haaren, den krummen Schultern und dem Schnurrbart, den er schon seit seinem zwanzigsten Lebensjahr trug, gab er ein ziemlich sonderbares Bild ab. Eigentlich hatte er mit zwanzig schon so ausgesehen wie jetzt mit sechzig – abgesehen von den grauen Haaren natürlich.
Als Matthew auf dem Bahnhof von Bright River ankam, war von einem Zug weit und breit nichts zu sehen. Der lange Bahnsteig war menschenleer; das einzige lebende Geschöpf war ein Mädchen, das ganz am anderen Ende auf einem großen Kieshaufen saß. Matthew, der vage wahrgenommen hatte, dass es sich um ein weibliches Wesen handelte, schlich sich so schnell wie möglich an ihm vorbei, ohne es auch nur anzusehen. Hätte er genauer hingeschaut, wäre ihm der Ausdruck von Spannung und Hoffnung auf dem blassen Gesicht sicherlich nicht entgangen. Das Mädchen saß da und wartete auf irgendetwas. Und da es im Moment auch keine andere Möglichkeit hatte, sich zu beschäftigen, gab es sich eben voll und ganz dem Warten hin.
»Wird der Nachmittagszug pünktlich sein?«, erkundigte sich Matthew bei dem Stationsvorsteher, der gerade sein Büro abschloss und nach Hause gehen wollte.
»Der ist schon seit einer halben Stunde durch«, erwiderte der Mann schroff. »Aber es ist jemand ausgestiegen, der zu Ihnen gehört, ein kleines Mädchen. Es sitzt da draußen auf dem Kies. MrsSpencer hat es abgesetzt und meinte, es sei ein Waisenkind, das Sie und Ihre Schwester aufnehmen wollen.«
»Aber … ich erwarte kein Mädchen«, antwortete Matthew verblüfft, »ich bin gekommen, um einen kleinen Jungen abzuholen.«
»Tut mir leid, mehr Waisenkinder habe ich nicht zu bieten.«
»Das verstehe ich nicht«, wunderte sich Matthew weiter und wünschte, Marilla wäre hier, um die Situation in die Hand zu nehmen.
»Nun, am besten fragen Sie das Mädchen einmal selbst«, riet ihm der Stationsvorsteher ungerührt. »Die Kleine ist nämlich nicht auf den Mund gefallen. Vielleicht sind den Leuten im Waisenhaus die Jungen gerade ausgegangen.«
Damit ging der Mann heim zum Kaffeetrinken und ließ den unglücklichen Matthew stehen, der sich nun einer Aufgabe gegenübergestellt sah, die ihm schwerer schien, als in einen Löwenkäfig zu steigen: Er musste auf ein Mädchen zugehen – noch dazu auf ein wildfremdes – und es fragen, warum es denn kein Junge sei. Seufzend wandte er sich um und schlurfte über den langen Bahnsteig auf das Kind zu, das ihn die ganze Zeit über nicht aus den Augen gelassen hatte.
Es war etwa elf Jahre alt und trug ein sehr kurzes, sehr hässliches Kleid aus gelbgrauem Flanell und dazu einen verblichenen braunen Matrosenhut, unter dem zwei dicke rote Zöpfe herausschauten. Das schmale, blasse Gesicht dieses Mädchens, vor dem Matthew Cuthbert eine solche Heidenangst hatte, war mit Sommersprossen geradezu übersät.
Dass die großen graugrünen Augen vor Munterkeit und Lebenslust nur so sprühten und dass der Mund weiche, ausdrucksvolle Lippen besaß, entging Matthew zunächst.
Aber immerhin wurde ihm die Qual erspart, das Gespräch eröffnen zu müssen. Denn sobald die Kleine erkannt hatte, dass er auf sie zuging, stand sie auf, umfasste mit einer Hand den Griff einer schäbigen alten Reisetasche und streckte ihm die andere Hand entgegen.
»Sie müssen MrMatthew Cuthbert sein«, sagte sie mit klarer, heller Stimme. »Ich bin so froh, dass Sie gekommen sind. Ich hatte nämlich schon ein bisschen Angst, dass Sie nicht mehr kommen würden. Da habe ich mir überlegt, dass ich dann auf dem Kirschbaum dort unten die Nacht verbringen würde. Ich hätte überhaupt keine Angst gehabt. Es muss wundervoll sein, im silbernen Mondschein auf einem blühenden Kirschbaum zu schlafen, finden Sie nicht auch? Man könnte sich vorstellen, man wäre in einer großen Marmorhalle. Und ich war mir ganz sicher: Wenn Sie heute Abend nicht gekommen wären, dann hätten Sie mich spätestens morgen früh abgeholt.«
Matthew drückte verlegen die schmale kleine Hand des Mädchens und fasste dabei einen inneren Entschluss: Er würde diesem Kind mit den leuchtenden Augen nichts von dem Missverständnis erzählen. Das sollte Marilla übernehmen. In Bright River konnte er die Kleine ja sowieso nicht zurücklassen, also konnten alle Fragen und Erklärungen genauso gut verschoben werden, bis er wieder sicher und geborgen auf Green Gables war.
»Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe«, sagte er schüchtern. »Komm, das Pferd steht drüben im Hof. Gib mir deine Tasche.«
»Oh, die trage ich lieber selber«, antwortete das Kind fröhlich. »Ich habe alles darin, was ich auf dieser Welt besitze, aber schwer ist sie trotzdem nicht. Und wenn man sie nicht richtig anfasst, geht der Handgriff ab. Es ist eine uralte Reisetasche, wissen Sie. Ach, ich bin so froh, dass Sie gekommen sind, auch wenn es sicherlich ganz schön gewesen wäre, in einem blühenden Kirschbaum zu übernachten. Wir haben noch ein gutes Stück Weg vor uns, nicht wahr? Acht Meilen, sagte MrsSpencer. Ich freue mich schon, ich reise nämlich für mein Leben gerne. Und es kommt mir fast wie ein Wunder vor, dass ich bei Ihnen leben und ganz zu Ihnen gehören darf. Ich habe noch nie irgendwo dazugehört – jedenfalls nicht richtig. Aber im Waisenhaus war es bisher am schlimmsten. Ich war zwar nur vier Monate dort, aber das war schon lange genug. Ich nehme an, Sie waren noch nie in einem Waisenhaus, deshalb können Sie sich auch nicht vorstellen, wie das ist. Es ist schlimmer als alles, was Sie sich vorstellen können. Dabei waren die Leute dort gut zu uns. Aber es gibt so wenig Raum für Fantasie – abgesehen vielleicht von den anderen Waisenkindern. Ja, man konnte sich vorstellen, dass das Mädchen neben einem in Wirklichkeit die Tochter eines echten Grafen ist, die als Säugling von einer grausamen Amme entführt wurde, die dann starb, bevor sie ein Geständnis ablegen konnte. Nachts bin ich oft wach geblieben und habe mir lauter solche Sachen ausgedacht, weil ich tagsüber dazu keine Zeit hatte. Vielleicht bin ich deshalb so dünn – ich bin furchtbar dünn, nicht wahr? Ich habe kein Gramm Fett auf den Knochen. Aber ich stelle mir oft vor, ich wäre hübsch und rund und hätte Grübchen in den Ellenbogen.«
Damit fand der Redefluss von Matthews Reisegefährtin zunächst einmal ein Ende. Die Kleine war etwas außer Atem geraten und außerdem hatten sie inzwischen die Kutsche erreicht. Jetzt kam kein Ton mehr über ihre Lippen, bis sie Bright River verlassen hatten und einen steilen Berg hinunterfuhren. Links und rechts vom Weg standen blühende Kirschbäume und schlanke Birken, deren Äste sich direkt über ihren Köpfen wiegten.
Das Kind streckte die Hand aus und brach sich einen Zweig mit weißen Blüten ab.
»Ist er nicht wunderschön? Woran hat Sie der weiße Baum erinnert, der sich da eben so weit über die Straße lehnte?«
»Hm … ich weiß nicht«, sagte Matthew.
»Na, an eine Braut natürlich – eine Braut in Weiß mit einem durchsichtigen Schleier. Ich habe zwar noch nie eine Braut gesehen, aber ich kann sie mir gut vorstellen. Allerdings glaube ich nicht, dass ich jemals selbst eine Braut sein werde. Ich bin so hässlich, mich will bestimmt niemand heiraten – höchstens irgendein Missionar vielleicht. Wer als Missionar in der Fremde lebt, ist vielleicht nicht so wählerisch, oder? Aber ich hoffe doch, dass ich eines Tages wenigstens ein hübsches Kleid bekommen werde. Das ist mein höchster Wunsch auf Erden. Ich hab mich heute Morgen nämlich fürchterlich geschämt, weil ich dieses schreckliche alte Flanellkleid tragen musste. Alle Waisenkinder tragen diese Dinger, wissen Sie. Ein Kaufmann in Hopetown hat dem Heim letzten Winter dreihundert Meter Flanellstoff geschenkt. Einige Leute sagen, das hätte er nur getan, weil er den Stoff nicht verkaufen konnte, aber ich glaube, er hat es bestimmt gut gemeint, finden Sie nicht auch? Als ich in den Zug stieg, hatte ich das Gefühl, dass alle Leute mich anstarrten und Mitleid mit mir hatten. Aber ich habe mir einfach vorgestellt, ich trüge ein wunderbares Kleid aus reiner blauer Seide – wenn man sich schon etwas vorstellt, dann soll es sich ja auch lohnen – und einen großen Hut mit Blumen und Federn und eine funkelnde goldene Armbanduhr und weiße Lederhandschuhe und passende Stiefel. Da hab ich mich schon gleich viel besser gefühlt und konnte die Reise nach Leibeskräften genießen. Ach, die Überfahrt zur Insel war einfach himmlisch! Auf dem Schiff gab es so viel zu sehen und ich wollte nichts verpassen. Wer weiß, ob ich in meinem Leben noch einmal die Gelegenheit haben werde, mit einem Schiff zu reisen … Oh, sehen Sie, da drüben stehen noch mehr blühende Kirschbäume! Ich habe noch nie so ein Blütenmeer gesehen. Die Insel ist wirklich wunderschön. Ich bin so glücklich, dass ich hier leben darf. Ich habe schon oft sagen hören, Prince Edward Island sei das schönste Fleckchen Erde auf der ganzen Welt, und da habe ich gleich davon geträumt, dass ich dort einmal leben werde. Aber ich hätte nie gedacht, dass dieser Traum einmal Wirklichkeit werden sollte. Es ist schön, wenn Träume plötzlich wahr werden, finden Sie nicht? – Diese roten Wege sehen so lustig aus. Als wir mit dem Zug aus Charlottetown herausfuhren und die roten Wege an unserem Fenster vorbeiflogen, da habe ich MrsSpencer gefragt, weshalb sie so rot sind, und die meinte dann, sie wisse es nicht und ich solle um Himmels willen aufhören, ihr so viele Fragen zu stellen. Mindestens tausend Stück hätte ich ihr schon gestellt. Wahrscheinlich hatte sie recht. Aber wie soll man Dinge herausfinden, wenn man keine Fragen stellt? – Wieso sind die Wege eigentlich rot, MrCuthbert?«
»Ich weiß nicht«, antwortete Matthew.
»Dann muss ich das noch herausfinden. Ist es nicht eine herrliche Vorstellung, dass es noch so viele Dinge zu erforschen gibt? Ich bin so froh, dass ich auf der Welt bin. Die Welt ist so interessant! Und wenn wir schon alles wüssten, wäre sie nur halb so schön, nicht wahr? Man hätte überhaupt keinen Raum für Fantasie, oder? Aber ich rede wohl mal wieder zu viel. Das habe ich schon oft zu hören bekommen. Soll ich lieber den Mund halten? Wenn es sein muss, kann ich still sein, obwohl es mir, ehrlich gesagt, ziemlich schwerfällt.«
Zu seinem eigenen Erstaunen fühlte Matthew sich wohl. Wie viele stille Menschen war er gern mit Leuten zusammen, die von sich aus den größten Teil der Unterhaltung bestritten und von ihrem Gegenüber nicht allzu viel erwarteten. Aber er hätte es sich nicht träumen lassen, dass er die Gesellschaft eines kleinen Mädchens so genießen könnte. Frauen waren ja schon schlimm genug, doch kleine Mädchen waren noch viel schrecklicher. Er konnte es nicht ausstehen, wie sie an ihm vorbeihuschten und ihm verschreckte Seitenblicke zuwarfen, so als müssten sie befürchten, dass er sie bei lebendigem Leibe fressen würde. Wohlerzogene kleine Mädchen in Avonlea waren eben so. Aber diese sommersprossige kleine Hexe war ganz anders und obgleich er bei seiner eher langsamen Denkweise einige Mühe hatte, mit dem Tempo ihrer Gedankensprünge mitzuhalten, merkte er ziemlich schnell, dass ihm das Geplauder der Kleinen eigentlich gut gefiel.
Also sagte er, scheu wie immer: »Nein, nein, rede nur so viel, wie du willst. Mir macht das nichts aus.«
»Oh, ich bin ja so froh! Ich weiß jetzt schon: Wir zwei werden uns gut verstehen. Es ist eine große Erleichterung, wenn man reden kann, wann immer man Lust dazu hat, und sich nicht immer sagen lassen muss, dass Kinder nur sprechen sollen, wenn sie etwas gefragt werden. Das habe ich bestimmt schon zehntausendmal gehört. Und oft lachen die Leute mich aus, weil ich angeblich so große, geschwollene Worte benutze. Aber wenn man große Gedanken hat, muss man doch auch große Worte dafür haben, oder was meinen Sie?«
»Hm, tja … das klingt einleuchtend«, sagte Matthew.
»MrsSpencer hat mir erzählt, dass Ihre Farm ›Green Gables‹ heißt. Ich habe sie über alles ausgefragt. Und als sie mir sagte, dass sie ganz von Bäumen umstanden sei, war ich glücklicher denn je. Ich liebe Bäume! Beim Waisenhaus gab es überhaupt keine, nur so ein paar mickrige kleine Stämmchen an der Straße. Sie hatten einen weißen Zaun um sich und sahen selbst wie Waisenkinder aus. Immer wenn ich sie ansah, kamen mir fast die Tränen. Dann versuchte ich, sie zu trösten: ›Ach, ihr armen kleinen Bäumchen! Wenn ihr doch nur in einem großen Wald inmitten lauter anderer Bäume stehen könntet! Dann würden grünes Moos und Glockenblumen um eure Wurzeln wachsen, in euren Zweigen würden Vögel zwitschern und vielleicht würde sogar ein Bach in eurer Nähe rieseln. In einer solchen Umgebung könntet dann auch ihr fröhlich wachsen, nicht wahr? Hier aber müsst ihr für immer und ewig klein und mickrig bleiben. Ich weiß genau, wie euch zumute ist.‹ Als ich sie heute Morgen zurücklassen musste, war ich richtig traurig. Man fühlt sich den Dingen mit der Zeit so verbunden, nicht wahr? Gibt es einen Bach in der Nähe von Green Gables? Ich habe vergessen, MrsSpencer danach zu fragen.«
»Ja, es gibt einen, gleich hinter dem Haus.«
»Himmlisch! Ich habe immer davon geträumt, in der Nähe eines Baches zu wohnen. Aber ich habe nie gedacht, dass es einmal Wirklichkeit werden könnte. Nicht alle Träume werden wahr, so ist es doch, MrCuthbert? Wäre es nicht wunderbar, wenn sie immer wahr würden? Aber heute bin ich auch so schon fast glücklich. So richtig glücklich kann ich nie sein, weil … meine Haare … wie würden Sie diese Farbe nennen?«
Bei diesen Worten hielt die Kleine einen ihrer langen, glänzenden Zöpfe hoch. Matthew war in der Beurteilung weiblicher Locken nicht gerade erfahren, aber in diesem Fall gab es keinerlei Zweifel.
»Rot, oder?«
Mit einem tiefen Seufzer, der allen Kummer ihres jungen Lebens verriet, ließ das Mädchen den Zopf wieder fallen.
»Ja, meine Haare sind rot«, sagte es verdrossen. »Jetzt verstehen Sie, warum ich nie vollkommen glücklich sein kann. Kein Mensch mit roten Haaren könnte das. Alles andere macht mir nicht so viel aus: die Sommersprossen, die grünen Augen, meine hagere Figur. Ich kann mir ja immer vorstellen, ich hätte einen lilienweißen Teint und große veilchenblaue Augen. Sogar Grübchen in den Ellenbogen kann ich mir vorstellen. Nur meine roten Haare, die kann ich nicht wegträumen, sosehr ich es auch versuche. Ich kann mir tausendmal einreden: ›Meine Haare sind schwarz, rabenschwarz‹ – ich weiß trotzdem, dass sie rot sind und darüber komme ich nicht hinweg. In einem Roman habe ich einmal etwas über ein wunderschönes Mädchen gelesen. Natürlich hatte es keine roten Haare – im Gegenteil, ›goldene Locken umrahmten seine Alabasterstirn‹. Was ist eine Alabasterstirn? Ich konnte es nie herausfinden. Können Sie es mir sagen?«
»Hm, nein … leider nicht«, bedauerte Matthew, dem langsam schon schwindelig wurde. So hatte er sich als Kind gefühlt, wenn er mit einem Karussell gefahren war.
»Es muss auf jeden Fall etwas Wunderbares sein, denn sie war von überirdischer Schönheit. Haben Sie sich schon einmal vorgestellt, wie es wäre, von überirdischer Schönheit zu sein?«
»Nein, noch nie«, gestand Matthew aufrichtig.
»Ich habe es mir schon oft vorgestellt. Was möchten Sie lieber sein: von überirdischer Schönheit, klug und weise oder engelsgleich gut?«
»Nun ja … ich weiß nicht genau.«
»Ich weiß es auch nicht. Ich kann mich nie entscheiden. Aber das macht ja nichts, ich werde sowieso keins davon sein. MrsSpencer sagt … Oh, MrCuthbert, MrCuthbert!«
Das war es natürlich nicht, was MrsSpencer sagte. Aber der Kleinen hatte es die Sprache verschlagen. Der Wagen war nach einer scharfen Kurve in die »Avenue« eingebogen. So nannten die Leute in Newbridge die eine halbe Meile lange, von ausladenden, alten Apfelbäumen überdachte Allee, die ein schrulliger alter Farmer vor langer Zeit angelegt hatte. Über ihren Köpfen wölbte sich ein dichter Baldachin aus schneeweißen duftenden Blüten und unterhalb der Äste erschien die rote untergehende Sonne wie ein farbiges rundes Fenster hinter dem Hochaltar einer riesigen Kathedrale.
Das Mädchen war völlig überwältigt und blieb auch dann noch stumm, als sie das kleine Dorf Newbridge schon längst hinter sich gelassen hatten.
»Du bist wahrscheinlich müde und hungrig«, brach Matthew endlich das Schweigen. »Aber es ist nicht mehr weit, nur noch eine Meile.«
Mit einem tiefen Seufzer erwachte die Kleine aus ihren Tagträumen. »Oh, MrCuthbert«, flüsterte sie, »was war das für eine weiße Pracht, durch die wir da gefahren sind?«
»Hm, du meinst wohl die ›Avenue‹«, antwortete Matthew nach kurzem Nachdenken. »Hübsch, nicht?«
»Hübsch? Das ist nicht das richtige Wort. Und ›schön‹ ist es auch nicht. Beide reichen nicht aus, um es zu beschreiben. Es war wundervoll! Das ist das erste Mal, dass ich etwas gesehen habe, das in meinen Träumen nicht schöner sein könnte. Das hat richtig wehgetan, hier«, – sie zeigte auf ihre Brust –, »aber es war ein höchst angenehmer Schmerz. Haben Sie schon einmal einen solchen Schmerz verspürt, MrCuthbert?«
»Nein, nicht dass ich wüsste.«
»Man sollte so einen wundervollen Ort nicht einfach ›Avenue‹ nennen, das ist viel zu nichtssagend. Ich werde ihn … Moment mal … ja, ich werde ihn die ›Weiße-Blütentraum-Allee‹ nennen. Ist das nicht ein wunderbarer Name? – Müssen wir wirklich nur noch eine Meile fahren, bis wir zu Hause sind? Ich bin froh und traurig zugleich. Die Fahrt ist so interessant, von mir aus könnte es immer so weitergehen. Aber ich freue mich auch, nach Hause zu kommen. Solange ich denken kann, habe ich noch nie ein Zuhause gehabt. Oh, ist das schön!«
Sie waren gerade auf dem Kamm eines kleinen Hügels angelangt. Unter ihnen lag ein kleiner See, der fast wie ein Fluss aussah, so lang und gewunden zog er sich durch die Wiesen. In der Mitte wurde er von einer Brücke überspannt und zur Küste hin von einer Kette bernsteinfarbener Sandhügel eingerahmt. Große Tannen und Ahornbäume spiegelten sich in seinem Wasser, von den Sümpfen am anderen Ende des Sees war der quakende Gesang der Frösche zu hören. Ein kleines graues Haus ragte aus den Zweigen eines blühenden Obstgartens. Obgleich es noch nicht ganz dunkel war, schien Licht durch eines der Fenster.
»Das ist Barrys Weiher«, erklärte Matthew.
»Schon wieder so ein Name, der mir nicht gefällt. Ich werde ihn … ›See der glitzernden Wasser‹ nennen. Ja, das ist der richtige Name für ihn! Das kann ich nämlich an dem Schauer erkennen: Immer wenn ein Name genau passt, rieselt mir ein kleiner Schauer den Rücken hinunter. Haben Sie auch schon mal so etwas gespürt?«
Matthew verfiel ins Grübeln. »Ja … doch. Ich kriege immer kalte Rückenschauer, wenn ich die hässlichen weißen Larven im Gurkenbeet sehe. Die kann ich einfach nicht ausstehen.«
»Oh, das kann aber nicht die gleiche Art von Schauer sein. Oder finden Sie, dass man Raupen im Gurkenbeet mit dem ›See der glitzernden Wasser‹ vergleichen kann? Weshalb nennen ihn die Leute eigentlich ›Barrys Weiher‹?«
»Wahrscheinlich, weil MrBarry dort drüben am See wohnt. Orchard Slope heißt seine Farm. Wenn die großen Bäume dahinter nicht wären, könnte man von hier aus schon Green Gables sehen. Wir müssen nur über die Brücke fahren, es ist noch ungefähr eine halbe Meile.«
»Hat MrBarry kleine Töchter? Ich meine, nicht richtig klein … eher so in meinem Alter?«
»Ja, er hat ein elfjähriges Mädchen. Diana heißt es.«
»Oh! Was für ein wunderschöner Name!«
»Na ja, ich weiß nicht so recht. Er klingt so heidnisch. Jane oder Mary, das sind gute, vernünftige Namen. Aber als Diana geboren wurde, unterrichtete an der Schule gerade eine Lehrerin, die so hieß, und nach der haben sie die Kleine benannt.«
»Ach, ich wünschte, es hätte so eine Lehrerin gegeben, als ich geboren wurde. Da ist die Brücke ja schon. Ich mache lieber die Augen zu. Ich habe nämlich immer Angst, wenn ich über eine Brücke fahre. Sie könnte ja gerade dann zusammenstürzen, wenn ich genau in der Mitte bin. Also schaue ich lieber nicht hin. Aber wenn wir in der Mitte sind, muss ich die Augen doch wieder aufmachen, denn wenn die Brücke tatsächlich zusammenstürzt, dann will ich auch sehen, wie sie zusammenstürzt. Das ist bestimmt interessant und ich möchte es nicht verpassen.«
Als sie heil und sicher auf der anderen Seite des Sees angelangt waren, sagte Matthew: »So, jetzt sind wir fast zu Hause, das ist Green Gables, dort …«
»Sagen Sie es mir nicht!«, fiel ihm das Mädchen ins Wort. »Ich will raten. Bestimmt werde ich es erkennen.«
Gespannt sah Anne sich um. Die Sonne war schon untergegangen, doch in dem milden Dämmerlicht war die Landschaft noch klar zu erkennen. Im Westen zeichnete sich ein dunkler Kirchturm gegen den Himmel ab. Darunter lag ein kleines Tal, in das sich die Häuser von Avonlea schmiegten. Langsam ließ das Mädchen den Blick von einem Gehöft zum anderen wandern, bis er zuletzt ganz links auf einem Haus ruhen blieb, das fernab von der Straße zwischen blühenden Obstbäumen und lichten Wäldern lag. Über ihm schien – wie ein Zeichen der Verheißung – ein heller, kristallklarer Stern.
»Das ist es, nicht wahr?«, sagte sie und zeigte die Richtung an. Matthew ließ erfreut die Zügel auf den Rücken der Stute klatschen. »Du hast es erraten! Aber wahrscheinlich hat MrsSpencer dir alles beschrieben, sodass du es leicht erkennen konntest.«
»Nein, das hat sie nicht, wirklich nicht! Nach dem, was sie mir erzählt hat, hätte es auch jedes der anderen Häuser sein können. Ich hatte keine Ahnung, wie es aussieht. Aber sobald ich es gesehen habe, fühlte ich: Das ist mein Zuhause. Ach, ich komme mir vor wie im Traum. Mein Arm ist bestimmt schon ganz blau und grün, weil ich mich heute dauernd kneifen musste. Immer wenn mir auf einmal ganz schlecht wurde und ich dachte: Das ist alles nur ein Traum – da habe ich mich schnell gezwickt, um zu sehen, ob ich auch wirklich wach bin. Aber es ist wahr. Ich habe ein Zuhause gefunden.«
Mit einem zufriedenen Seufzer verfiel das Mädchen in tiefes Schweigen. Matthew dagegen wurde es immer mulmiger zumute. Er war heilfroh, dass es Marillas Aufgabe sein würde, diesem heimatlosen Kind klarzumachen, dass es sein lang ersehntes Zuhause hier nicht finden würde.
Je näher sie Green Gables kamen, desto mehr schreckte Matthew vor dem Augenblick der Wahrheit zurück. Es erschien ihm nicht recht.
Er dachte dabei nicht an Marilla oder an all die Probleme, die ihnen durch dieses Missverständnis entstehen würden, sondern nur an die Enttäuschung des Kindes. Er hatte das hoffnungsvolle Leuchten in den Augen der Kleinen gesehen und bei dem Gedanken, es zum Erlöschen bringen zu müssen, fühlte er sich wie der Komplize bei einem Mord. Ganz ähnlich ging es ihm, wenn er ein Lamm oder ein Kalb oder irgendein anderes unschuldiges kleines Geschöpf töten musste.
Als sie in die Einfahrt einbogen, lag der Hof schon im Dunkeln, die Zweige der schlanken Pappeln raschelten im Wind.
»Hören Sie, wie die Bäume im Schlaf reden?«, flüsterte das Mädchen, als es vom Wagen herunterstieg. »Was für schöne Träume sie haben müssen!«
Dann folgte es Matthew ins Haus – die alte Reisetasche mit allem, was es auf dieser Welt besaß, fest in der Hand.
Marilla Cuthbert versteht die Welt nicht mehr
Mit raschen Schritten kam ihnen Marilla durch den Hausflur entgegen. Doch als ihr Blick auf die kleine Gestalt mit den langen roten Zöpfen fiel, blieb sie wie angewurzelt stehen.
»Matthew Cuthbert, wer ist das?«, wollte sie wissen. »Und wo ist der Junge?«
»Da war kein Junge«, sagte Matthew kläglich. »Nur sie.« Dabei zeigte er auf die Kleine. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er sie noch nicht einmal nach ihrem Namen gefragt hatte.
»Kein Junge!? Aber es muss doch ein Junge da gewesen sein«, empörte sich Marilla. »Wir haben MrsSpencer doch ausrichten lassen, dass sie uns einen Jungen mitbringen soll.«
»Ja, aber sie hat das Mädchen mitgebracht, der Stationsvorsteher hat es mir bestätigt. Und da musste ich sie wohl mit nach Hause nehmen. Ich konnte sie ja nicht einfach da sitzen lassen, wer auch immer das verbockt hat.«
»Na, das ist mir ja eine schöne Geschichte!«, rief Marilla aus.
Während dieses Gespräches waren die großen Augen des Kindes ratlos von einem zum anderen gewandert. Es dauerte eine Weile, bis es die ganze Tragweite der Situation begriff. Plötzlich ließ es die alte Reisetasche fallen und rang verzweifelt die Hände.
»Sie wollen mich nicht!«, jammerte es. »Sie wollen mich nicht haben, weil ich kein Junge bin! Ich hätte es doch ahnen müssen. Mich hat noch nie jemand gewollt. Es war einfach zu schön, um wahr zu sein. Ach, was soll ich jetzt nur tun?«
Dicke Tränen kullerten über seine Wangen. Es setzte sich auf einen Stuhl, schlug beide Hände vors Gesicht und fing bitterlich zu schluchzen an. Marilla und Matthew wechselten hilflose Blicke, keiner von ihnen wusste, was er tun sollte.
»Na, na!«, sagte Marilla endlich. »Es gibt keinen Grund, so zu weinen.«
»Und ob es einen Grund gibt!« Das Kind hob sein tränenüberströmtes Gesicht. »Sie würden schließlich auch weinen, wenn Sie ein Waisenkind wären und dächten, Sie hätten ein Zuhause gefunden, und dann stellt sich plötzlich heraus, dass man Sie nicht behalten will, bloß weil Sie kein Junge sind. Das ist die größte Tragödie, die mir in meinem Leben je widerfahren ist!«
Bei diesen Worten stahl sich unwillkürlich ein kleines Lächeln auf Marillas Gesicht. »Komm, hör jetzt auf zu weinen. Wir werden dich ja nicht gleich heute Abend vor die Tür setzen. Du wirst so lange bei uns bleiben, bis sich die ganze Sache aufgeklärt hat. Wie heißt du eigentlich?«
Die Kleine zögerte einen Moment. »Können Sie mich bitte Cordelia nennen?«, fragte sie dann.
»Dich Cordelia nennen? Ist das denn dein Name?«
»Nein, eigentlich nicht. Aber ich würde so gerne Cordelia heißen. Das klingt so elegant!«
»Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Wenn du nicht Cordelia heißt, wie heißt du dann?«
»Anne Shirley«, antwortete das Mädchen widerwillig, »aber, bitte, nennen Sie mich doch Cordelia. Es kann Ihnen doch ganz egal sein, wie Sie mich nennen, wenn ich sowieso nur kurze Zeit hierbleiben soll, oder? Und ›Anne‹ klingt so furchtbar unromantisch.«
»Schluss mit dem Unsinn!«, erwiderte Marilla ungerührt. »Anne ist ein guter, vernünftiger Name, für den du dich überhaupt nicht zu schämen brauchst.«
»Ich schäme mich ja auch gar nicht«, erklärte Anne, »Cordelia finde ich bloß viel schöner. Aber wenn Sie mich schon Anne nennen wollen, dann bitte am Schluss mit einem e.«
»Was macht das für einen Unterschied, ob mit oder ohne e?«, wunderte sich Marilla und wieder spielte ein ungewohnt mildes Lächeln um ihre Lippen.
»Das ist ein Riesenunterschied! Es sieht tausendmal besser aus. Sehen Sie den Namen denn nicht in Gedanken vor sich auf dem Papier? Ich schon. A-n-n sieht einfach furchtbar aus, aber A-n-n-e, das wirkt richtig nobel. Also, wenn Sie mich mit einem e am Ende nennen wollen, kann ich mich dazu entschließen, auf Cordelia zu verzichten.«
»Also, gut, Anne mit einem e am Ende: Kannst du uns verraten, wie es zu diesem Missverständnis gekommen ist? Wir haben MrsSpencer ausrichten lassen, sie soll uns einen Jungen mitbringen. Gab es denn keine Jungen im Waisenhaus?«
»Oh, doch, es gab dort jede Menge Jungen. Aber MrsSpencer sagte ausdrücklich, dass Sie sich für ein Mädchen von ungefähr elf Jahren entschieden hätten. Und die Schwester meinte, ich käme dafür infrage. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich gefreut habe! Ich konnte die ganze letzte Nacht vor lauter Freude gar nicht schlafen. Aber …«, sie drehte sich vorwurfsvoll zu Matthew um, »warum haben Sie mir denn nicht gleich am Bahnhof gesagt, dass Sie mich hier nicht haben wollen? Jetzt, wo ich die ›Weiße-Blütentraum-Allee‹ und den ›See der glitzernden Wasser‹ gesehen habe, ist es nur noch schlimmer.«
»Was um alles in der Welt meint sie damit?«, wandte Marilla sich ratlos an Matthew.
»Ach, nichts. Wir haben uns auf der Fahrt eben ein bisschen unterhalten«, antwortete Matthew ausweichend. »Ich bringe jetzt am besten erst einmal die Stute in den Stall, Marilla. Wenn ich zurückkomme, können wir essen.«
»Hat MrsSpencer außer dir noch jemand mitgebracht?«, erkundigte sich Marilla, als Matthew hinausgegangen war.
»Ja, sie selbst will Lily Jones aufnehmen. Lily ist erst fünf Jahre alt und wunderschön. Sie hat nussbraunes Haar. Wenn ich wunderschön wäre und nussbraunes Haar hätte, würden Sie mich dann behalten?«
»Nein. Wir brauchen einen Jungen, der Matthew bei der Arbeit auf der Farm zur Hand gehen kann. Mit einem Mädchen können wir gar nichts anfangen. Aber jetzt nimm deinen Hut ab und leg ihn zu deiner Tasche in den Flur.«
Widerspruchslos folgte Anne. Als Matthew zurückkam, setzten sie sich. Doch Anne konnte nichts essen; vergebens knabberte sie an ihrem Butterbrot und kostete lustlos von dem Apfelkompott in der kleinen Glasschüssel neben ihrem Teller: Es wollte einfach nicht weniger werden.
»Du isst ja gar nichts«, sagte Marilla streng.
Anne seufzte. »Ich kann nicht essen, ich bin mit der Welt zerfallen! Könnten Sie etwa essen, wenn Sie mit der Welt zerfallen wären?«
»Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich war noch nie mit der Welt zerfallen«, antwortete Marilla.
»Wirklich noch nie? Und haben Sie sich auch noch nie vorgestellt, Sie wären es?«
»Nein, auch noch nicht.«
»Dann können Sie auch nicht verstehen, wie das ist. Es ist ein ziemlich unangenehmes Gefühl, das kann ich Ihnen versichern.
Man hat einen riesigen Kloß im Hals und kann einfach nichts herunterschlucken – selbst wenn es ein Karamellbonbon wäre. Vor zwei Jahren habe ich einmal einen Karamellbonbon bekommen, der hat einfach köstlich geschmeckt. Seitdem habe ich oft von Karamellbonbons geträumt, aber ich bin immer ausgerechnet dann aufgewacht, als ich sie gerade in den Mund stecken wollte. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, wenn ich so wenig esse. Es schmeckt alles sehr, sehr gut; ich kann bloß nicht.«
»Wahrscheinlich ist sie müde«, sagte Matthew, der seit seiner Rückkehr vom Stall keinen Ton von sich gegeben hatte. »Am besten bringst du sie ins Bett, Marilla.«
Für den Jungen, den sie eigentlich erwartet hatten, war die Couch in der kleinen Kammer neben der Küche gerichtet; für ein Mädchen aber schien Marilla diese Unterkunft doch nicht recht passend zu sein. Das Gästezimmer war für dieses heimatlose Geschöpf allerdings auch nicht das Richtige – blieb also nur noch das unbenutzte Zimmer im Ostgiebel. Marilla zündete eine Kerze an und ging voraus. Hut und Reisetasche fest in der Hand, folgte ihr Anne die Stufen hinauf.
Oben stellte Marilla die Kerze auf einen kleinen dreieckigen Tisch und schlug die Bettdecke zurück.
»Ich nehme an, du hast ein Nachthemd dabei?«, fragte sie.
Anne nickte. »Ja, ich habe zwei. Die Schwester im Waisenhaus hat sie für mich genäht. Sie sind bloß fürchterlich kurz. In einem Waisenhaus ist der Stoff immer knapp – jedenfalls in einem so armen Waisenhaus wie unserem. Ich hasse kurze Nachthemden. Aber schließlich kann man in ihnen genauso gut träumen wie in langen.«
»Also, zieh dich schnell aus und geh ins Bett. Ich komme in ein paar Minuten zurück, um die Kerze zu holen, damit du nicht noch das Haus in Brand setzt.«
Als Marilla gegangen war, sah sich Anne traurig um. Die weiß gekalkten Wände sahen schrecklich nackt und kalt aus. In der einen Ecke des Zimmers stand das altmodische Bett mit vier langen dunklen Pfosten, in der anderen Ecke war der Tisch mit einem Stuhl, darüber hing ein kleiner rechteckiger Spiegel. In der Mitte zwischen Tisch und Bett befand sich das Fenster, gegenüber der schlichte Waschtisch. Der ganze Raum war von einer solchen Kälte und Strenge, dass Anne bis ins Mark erschauerte. Hastig warf sie ihre Kleider ab, streifte sich das kurze Nachthemd über und sprang mit einem Satz in das große Bett, wo sie ihr Gesicht im Kopfkissen vergrub und die Bettdecke fest über sich zog. Als Marilla später heraufkam, um die Kerze zu holen, deuteten nur die unordentlich über den Fußboden verstreuten Kleidungsstücke und das zerwühlte Bett darauf hin, dass überhaupt jemand im Zimmer war.
Langsam hob Marilla Annes Kleider auf, legte sie ordentlich auf dem Stuhl zusammen und ging dann mit der Kerze in der Hand auf das Bett zu.
»Gute Nacht«, sagte sie etwas verlegen, aber keineswegs unfreundlich.
Plötzlich erschien Annes blasses Gesicht mit den großen Augen über der weißen Bettdecke. »Wie können Sie von einer ›guten‹ Nacht sprechen, wo Sie doch genau wissen, dass es die schlimmste Nacht meines Lebens sein wird?«, fragte sie vorwurfsvoll.
Dann tauchte sie wieder in die Versenkung unter.
Kopfschüttelnd ging Marilla in die Küche zurück und machte sich daran, das Geschirr vom Abendessen zu spülen. Matthew rauchte Pfeife, was bei ihm immer ein sicheres Zeichen für innere Unruhe war. Mit Rücksicht auf Marilla, die das Rauchen für eine schlechte, ungesunde Angewohnheit hielt, rauchte er äußerst selten. Aber manchmal war die Pfeife für ihn einfach unentbehrlich. Marilla wusste das und übersah es dann geflissentlich.
»Das ist ja eine schöne Bescherung!«, sagte sie zornig. »Das hat man nun davon, wenn man andere um etwas bittet, anstatt die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Gleich morgen früh werde ich zu MrsSpencer hinüberfahren und die Sache klären. Das Kind muss wieder zurück ins Waisenhaus.«
»Ja, wahrscheinlich hast du recht«, gab Matthew zögernd zurück.
»Wahrscheinlich? Was soll das heißen?«
»Hm … sie ist ein liebes Ding, Marilla. Eigentlich ein Jammer, sie zurückzuschicken. Sie würde so gern bleiben.«
»Matthew Cuthbert, du willst doch nicht etwa sagen, wir sollten sie behalten?«
Marilla verstand die Welt nicht mehr. Sie hätte nicht überraschter sein können, wenn Matthew ihr plötzlich mitgeteilt hätte, er würde am liebsten den ganzen Tag auf dem Kopf stehen.
»Hm, nein … ich glaube nicht … das heißt«, stammelte Matthew, der sich immer unwohl fühlte, wenn er eine genaue Aussage machen sollte. »Ich meine, niemand kann von uns verlangen, dass wir sie hier bei uns aufnehmen.«
»Allerdings. Sie ist nicht die Richtige für uns.«
»Aber vielleicht sind wir die Richtigen für sie«, wandte Matthew ein.
»Matthew Cuthbert, ich glaube langsam, dieses Kind hat dich behext! Ich seh’s dir doch an der Nasenspitze an, dass du sie hierbehalten willst.«
»Hm, tja … sie ist ein so interessantes kleines Ding«, fuhr Matthew fort. »Du hättest hören sollen, was sie mir alles auf der Fahrt vom Bahnhof erzählt hat.«
»Oh, reden kann sie, das ist mal sicher. Aber ob ausgerechnet das zu ihren Gunsten spricht? Ich mag Kinder nicht, die pausenlos vor sich hin plappern. Ich möchte kein Mädchen – und selbst wenn ich eines wollte, dann wäre dieser redselige Rotschopf auch nicht gerade mein Typ. Nein, nein, wir müssen sie auf schnellstem Wege dahin zurückbringen, wo sie hergekommen ist.«
»Ich könnte einen jungen Franzosen einstellen, der mir bei der Arbeit hilft«, schlug Matthew vor. »Und sie könnte dir ein bisschen Gesellschaft leisten.«
»Ich brauche keine Gesellschaft«, erwiderte Marilla schroff. »Und ich habe nicht vor, sie bei uns aufzunehmen.«
»Wir machen natürlich alles so, wie du es sagst, Marilla«, schloss Matthew, stand auf und legte seine Pfeife beiseite. »Ich gehe ins Bett.«
Damit verließ er die Küche und auch Marilla legte sich mit düsterer Miene schlafen, nachdem sie das Geschirr gespült und abgetrocknet hatte. Oben im Ostgiebel von Green Gables lag ein einsames, heimatloses Kind und weinte sich in den Schlaf.
Der erste Morgen auf Green Gables
Es war schon heller Tag, als Anne erwachte, sich im Bett aufsetzte und verwirrt auf das Fenster starrte, durch das eine Flut warmen Sonnenlichts hereinströmte.
Im ersten Moment konnte sie sich nicht entsinnen, wo sie eigentlich war. Doch dann fiel ihr mit einem Mal alles wieder ein: Sie war auf Green Gables, aber man wollte sie nicht hierbehalten, weil sie ein Mädchen war!
Doch es war ein herrlicher Morgen und vor ihrem Zimmer stand ein Kirschbaum in voller Blüte. Mit einem Satz sprang sie aus dem Bett, öffnete weit das Fenster und sah staunend hinaus in den sonnigen Junimorgen.
Der riesige Kirschbaum vor ihrem Fenster stand so nahe am Haus, dass seine Äste die Wände berührten; und er war so voller Blüten, dass man kaum ein einziges grünes Blatt sehen konnte. Auf beiden Seiten des Hauses lagen große Obstgärten mit Apfel- und Kirschbäumen. Sie sahen aus wie ein einziges Blütenmeer. Das Gras unter den Bäumen war von gelbem Löwenzahn übersät. Etwas weiter unten im Garten blühte der Flieder und der Morgenwind wehte seinen süßlichen Duft herüber.
Auf der anderen Seite des Gartens erstreckte sich eine saftige Kleewiese bis zu dem von weißen Birken umsäumten Bachlauf. Jenseits des Baches erhob sich ein kleiner Hügel mit Fichten und Tannen, durch deren Zweige sie den grauen Giebel des kleinen Hauses sehen konnte, das am anderen Ufer des ›Sees der glitzernden Wasser‹ stand. Etwas weiter links konnte man hinter den großen Scheunen und den grünen, leicht abfallenden Feldern das Meer erkennen.
Anne sog jede Einzelheit gierig ein. Völlig versunken in die Schönheit dieser Landschaft kniete sie am Fenster, als ihr plötzlich jemand eine Hand auf die Schulter legte. Es war Marilla, die unbemerkt ins Zimmer getreten war.
»Es wird Zeit, dass du dich anziehst«, sagte sie unwirsch.
Marilla wusste nicht recht, wie sie mit dem Kind reden sollte, und dieses Unvermögen ließ sie barsch und unfreundlich erscheinen, auch wenn sie es nicht so meinte.
Anne stand auf und seufzte tief. »Oh, ist es nicht wunderbar?«, fragte sie und deutete mit der Hand hinaus.
»Ein stattlicher Baum«, bestätigte Marilla, »und er blüht reichlich. Bloß die Früchte sind nichts Besonderes – klein und voller Würmer.«
»Oh, ich meine nicht nur den Baum. Natürlich ist er schön, himmlisch schön – er blüht, als ginge es um sein Leben. Ich meine alles hier: den Garten und die Obstplantage und den Bach und die Bäume – die ganze, große, liebe Welt. An einem solchen Morgen muss man die Welt einfach lieben, geht es Ihnen nicht auch so? Und ich kann den Bach bis hier oben plätschern hören. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wie lustig Bäche sind? Sie kichern die ganze Zeit vor sich hin. Selbst im Winter kann man sie unter dem Eis hören. Ich bin so froh, dass es hier einen Bach gibt! Ich werde mich immer gerne daran erinnern, auch wenn ich Green Gables niemals wiedersehe. Heute Morgen bin ich nicht mehr mit der Welt zerfallen. Ist es nicht herrlich, dass es jeden Tag einen Morgen gibt? Traurig bin ich allerdings immer noch. Ich habe mir gerade vorgestellt, Sie wollten mich vielleicht doch behalten, und ich könnte bis in alle Ewigkeit hierbleiben. Das Schlimme daran ist nur, dass man früher oder später doch in die Wirklichkeit zurückmuss, und das tut dann sehr weh.«
»Du solltest dich lieber anziehen und nach unten kommen, anstatt dich hier oben zu verträumen«, sagte Marilla, als sie endlich auch einmal zu Wort kam. »Das Frühstück ist schon fertig. Wasch dein Gesicht und kämm dir die Haare. Lass das Fenster offen und schlag die Bettdecke über das Fußende – und beeil dich!«
Anne konnte sich offensichtlich beeilen, wenn es darauf ankam, denn in zehn Minuten stand sie unten in der Küche.
»Ich habe einen Bärenhunger«, verkündete sie, als sie sich auf den Platz setzte, den Marilla für sie gedeckt hatte. »Ach, ich bin ja so froh, dass heute die Sonne scheint! Aber regnerische Morgen mag ich auch. Man weiß noch nicht, was den ganzen Tag über passieren wird, da hat man jede Menge Raum für Fantasie. Aber ich bin trotzdem froh, dass es nicht regnet. Wenn die Sonne scheint, ist es viel einfacher, fröhlich zu sein und den Aufgaben des Lebens standzuhalten. Es mag ja ganz schön sein, über das Leid anderer zu lesen und sich vorzustellen, wie man selbst alle Prüfungen heldenhaft bestehen würde, aber wenn sie sich einem dann plötzlich wirklich stellen, dann ist es nicht mehr so schön, nicht wahr?«
»Halt um Himmels willen jetzt mal deinen Mund«, fuhr Marilla sie an. »Für ein kleines Mädchen redest du entschieden zu viel.«
Daraufhin schwieg die Kleine so gehorsam und beharrlich, dass es Marilla nur noch nervöser machte. Gedankenverloren kaute Anne auf ihrem Brot herum, während ihre Augen mit leerem Blick aus dem Fenster starrten. Offenbar schwebte sie im Geiste in irgendwelchen unerreichbaren Welten, während ihr Körper leblos neben Marilla am Tisch saß.
»Warum wollte Matthew sie bloß hierbehalten?«, fragte sich Marilla. Sie spürte, dass er noch derselben Meinung war wie am Abend zuvor – und dass er auch bei dieser Meinung bleiben würde. So war Matthew nun einmal. Er setzte sich etwas in den Kopf und verfolgte die Sache dann mit stummer Beharrlichkeit, was zehnmal stärker und wirksamer war, als wenn er seine Meinung in lange Reden kleiden würde.
Als das Frühstück vorüber war, erwachte Anne aus ihren Tagträumen und fragte, ob sie das Geschirr spülen dürfe.
»Kannst du das denn auch?«, fragte Marilla misstrauisch.
»Fast so gut wie auf kleine Kinder aufpassen. Darin habe ich am meisten Erfahrung. Wie schade, dass Sie keine Kinder haben, um die ich mich kümmern könnte.«
»Ich glaube nicht, dass ich hier noch mehr Kinder haben wollte, als im Moment schon hier sind. Eins wirft schon genug Probleme auf. Ich habe keine Ahnung, was wir mit dir machen sollen. Matthew ist schon ein seltsamer Mensch.«
»Ich finde ihn wunderbar«, erwiderte Anne. »Er hat so viel Mitgefühl! Es macht ihm gar nichts aus, dass ich so viel rede – es scheint ihm sogar zu gefallen. Matthew ist eine verwandte Seele – das wusste ich vom ersten Augenblick an.«
»Ihr seid beide ein bisschen verschroben, wenn du das mit deiner Seelenverwandtschaft meinst«, entgegnete Marilla seufzend. »Ja, du kannst das Geschirr spülen. Nimm reichlich heißes Wasser und trockne hinterher ordentlich ab. Ich habe genug zu tun heute Morgen. Am Nachmittag muss ich ja nach White Sands hinüberfahren, um mit MrsSpencer zu reden. Du kommst am besten mit, dann können wir gleich sehen, wie es weitergeht. Wenn du mit dem Geschirr fertig bist, gehst du nach oben und machst dein Bett.«
Anne erledigte den Abwasch recht geschickt, wie Marilla, die die ganze Zeit über ein scharfes Auge auf sie hielt, bald bemerkte.
Später machte sie ihr Bett, wobei sie allerdings weniger erfolgreich war, denn mit dicken Federbetten hatte sie bisher noch nie zu tun gehabt. Doch nach einigen Mühen war auch das geschafft und Marilla, die Anne loswerden wollte, sagte, sie solle nach draußen gehen und bis zum Mittagessen im Garten spielen.
»Aber … ich möchte, glaube ich, lieber nicht hinausgehen«, erklärte Anne im Tonfall eines Märtyrers, der allen irdischen Freuden entsagt hat. »Wenn ich sowieso nicht hierbleiben darf, möchte ich Green Gables nicht zu sehr ins Herz schließen. Und wenn ich erst einmal draußen bin und alle Bäume und Blumen im Garten und den kleinen Bach besucht habe … Schöne Dinge muss man ja einfach lieb gewinnen. Deshalb war ich auch so froh, als ich gehört habe, dass ich hier leben sollte. Ich dachte, dann würde es so viele Dinge geben, die ich lieb haben könnte, und nichts könnte mich mehr davon abhalten. Doch dieser Traum ist nun vorüber. Ich ergebe mich in mein Schicksal. Es ist besser, wenn ich nicht hinausgehe, sonst ergebe ich mich ihm am Ende dann doch nicht. Wie heißt eigentlich die Blume auf dem Fenstersims, Miss Cuthbert?«
»Das ist eine Geranie.«
»Nein, diese Art von Namen meine ich nicht. Ich meine den Namen, den Sie ihr gegeben haben. Oder haben Sie ihr noch gar keinen gegeben? Darf ich es dann tun? Ich könnte sie … mal sehen … ja, ich könnte sie ›Bonny‹ nennen, solange ich hier bin. Darf ich? Ach, bitte!«
»Von mir aus. Aber was um alles in der Welt soll das für einen Sinn haben, einer Geranie einen Namen zu geben?«
»Oh, ich finde es schön, wenn alle Dinge einen eigenen Namen haben, auch wenn es nur Geranien sind. Vielleicht ist die Geranie außerdem schrecklich gekränkt, wenn man sie einfach ›Geranie‹ nennt und sonst nichts. Ihnen würde es doch auch nicht gefallen, wenn man sie nur ›Frau‹ nennen würde, oder? Ja, ich werde sie ›Bonny‹ nennen. Für den Kirschbaum vor meinem Fenster habe ich auch schon einen passenden Namen gefunden: ›Schneekönigin‹. Natürlich kann er nicht das ganze Jahr über weiße Blüten tragen, aber man kann es sich ja immer vorstellen, nicht wahr?«
»So etwas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt«, murmelte Marilla vor sich hin, als sie sich in den Keller zurückzog, um Kartoffeln zu holen. »Irgendwie ist sie tatsächlich interessant, da hat Matthew schon recht. Langsam bin ich selbst gespannt, was sie wohl als Nächstes sagen wird. Wenn es so weitergeht, wird sie mich auch noch verhexen. Matthew hat sie ja schon voll in ihren Bann gezogen. Dieser Blick, den er mir beim Hinausgehen heute Morgen zugeworfen hat! Ich wünschte, er wäre wie andere Männer und würde die Sache ausführlich mit mir besprechen, dann könnte ich ihn mit Worten wieder zur Vernunft bringen. Aber was soll man mit einem Mann machen, der einem nur Blicke zuwirft?«
Als Marilla vom Keller zurückkehrte, war Anne schon wieder in ihre Träume versunken. Den Kopf in die Hände gestützt, die Augen auf den Horizont geheftet, saß sie am Fenster. Erst als Marilla sie zum Mittagessen rief, wachte sie wieder auf.
»Kann ich heute Nachmittag die Stute und den Einspänner haben, Matthew?«, fragte Marilla, als sie zu dritt am Tisch saßen.