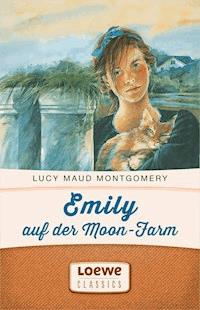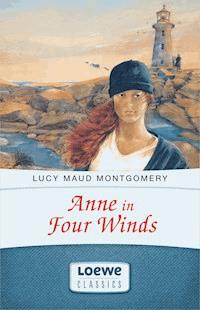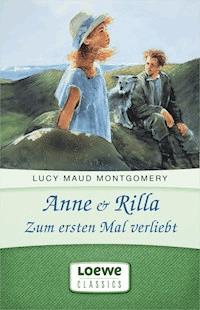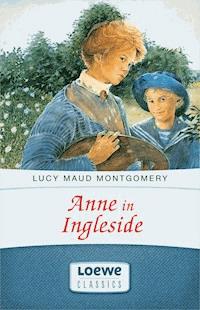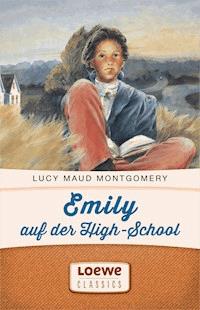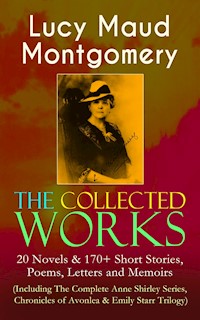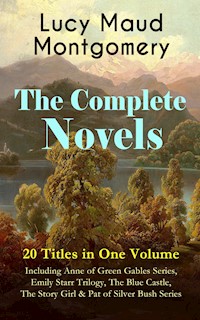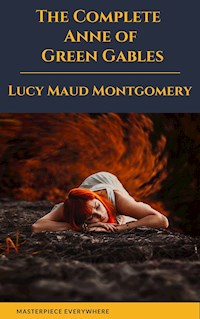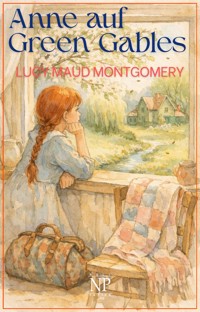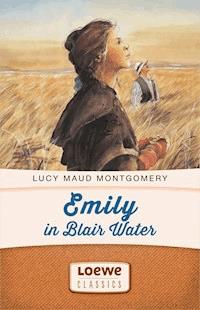
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Emily
- Sprache: Deutsch
Nachdem Emily ein Angebot, nach New York zu gehen, abgelehnt hat, bleibt sie als Einzige der vier Freunde in Blair Water zurück. Teddy und Ilse studieren in Montreal, und Perry will Anwalt werden. Emilys großes Ziel ist es nach wie vor, eine berühmte Schriftstellerin zu sein. Emily erreicht zwar dieses Ziel, aber sie muss erkennen, dass es auch für sie Dinge gibt, die ihr wichtiger sind. Zum Beispiel ihre Freunde und ihre lange uneingestandene Liebe zu Teddy. Die Klassiker-Reihe von Lucy Maud Montgomery als eBook! Nach "Anne auf Green Gables" erzählte die weltweit bekannte Autorin die Geschichte vom Waisenkind Emily und ihrem Traum, eine große Schriftstellerin zu werden. Nostalgie-Spaß für Jugendliche und Erwachsene!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Stella Campbell Keller
vom Stamme Josephs
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titel
1. Kapitel – „Nie wieder heißes…
2. Kapitel – New Moon, 18.…
3. Kapitel – Anfangs nahm niemand…
4. Kapitel – Das Jahr nach…
5. Kapitel – Es gab nur…
6. Kapitel – Teddy Kent und…
7. Kapitel – Von Oktober bis…
8. Kapitel – Die Murraysippe glaubte…
9. Kapitel – In einem Punkt…
10. Kapitel – Es war November,…
11. Kapitel – Als Teddys Brief…
12. Kapitel – 4. Mai 19…
13. Kapitel – Emily saß gerade…
14. Kapitel – „Morgenstund’ hat Gold…
15. Kapitel – Emily kehrte gerade…
16. Kapitel – Es gibt zwei…
17. Kapitel – Der Sommer nach…
18. Kapitel – Ende Oktober machte…
19. Kapitel – 1. Oktober 19…
20. Kapitel – An ihrem vierundzwanzigsten…
21. Kapitel – Im Juli kamen…
22. Kapitel – Das Leben ging…
23. Kapitel – Es war Januar,…
24. Kapitel – Im Mai kam…
25. Kapitel – Nur noch zwei…
26. Kapitel – Ilse machte nicht…
27. Kapitel – Es war an…
Nachwort
Weitere Titel von Lucy Maud Montgomery
Weitere Infos
Impressum
Erstes Kapitel
„Nie wieder heißes Wasser mit Milch und Zucker!“ hatte Emily Byrd Starr in ihr Tagebuch geschrieben, als sie von der High School in Shrewsbury nach New Moon zurückgekehrt war. Jetzt würde das Leben erst richtig anfangen!
Es war wie ein Symbol. Wenn Elizabeth Murray Emily nämlich erlaubte, von nun an echten Tee zu trinken, dann bedeutete das nichts anderes als die stillschweigende Anerkennung ihres Erwachsenseins. In den Augen anderer war Emily schon längst erwachsen, besonders für ihren Cousin Andrew Murray und ihren Freund Perry Miller, deren Heiratsanträge Emily abgewiesen hatte. Als Tante Elizabeth davon erfahren hatte, war ihr mit einem Mal klargeworden, daß sie Emily nicht länger zwingen konnte, „Kindertee“ zu trinken. Trotzdem machte sich Emily keine Hoffnungen, daß Tante Elizabeth so weit gehen würde, ihr jemals Seidenstrümpfe zu erlauben. Ein Seidenpetticoat mochte ja noch angehen; den sah man immerhin nicht, auch wenn es unter dem Rock verführerisch raschelte. Aber Seidenstrümpfe – nein, wie unmoralisch!
So kam es, daß Emily – ein Mädchen, das „schreibt“, wie die Leute untereinander tuschelten – von Tante Elizabeth und Tante Ruth als ihresgleichen auf New Moon akzeptiert wurde. Nichts hatte sich auf New Moon verändert, seit Emily vor sieben Jahren hierhergekommen war. Die Schnitzerei des Serviertisches warf immer noch denselben komischen Schatten auf genau dieselbe Stelle an der Wand, wo er ihr gleich am ersten Tag aufgefallen war. New Moon war ein altes Haus, das viel erlebt hatte und nun sehr ruhig und weise und ein wenig geheimnisvoll wirkte. Vielleicht auch ein wenig streng, aber doch sehr freundlich. Manche Leute aus Blair Water und aus Shrewsbury fanden, daß New Moon doch ein langweiliger Ort sei für ein junges Mädchen. Was konnte es hier schon anfangen? Wie konnte Emily nur so dumm sein und Miss Royals Angebot, in New York bei einer Zeitschrift anzufangen, ablehnen? Wie konnte sie sich nur so eine Chance entgehen lassen! Emily aber hatte eine ziemlich genaue Vorstellung von dem, was sie tun wollte, und sie war ganz und gar nicht der Meinung, daß es ihr auf New Moon langweilig werden würde oder daß sie sich gar durch ihre Entscheidung, dort zu bleiben, den Weg nach oben verbaut hätte.
Emily war die geborene Geschichtenerzählerin. In früheren Zeiten hätte sie wohl mit ihrem Stamm im Kreis am Feuer gesessen und ihren Zuhörern spannende Geschichten erzählt. Aber da sie nun einmal viel später geboren worden war, mußte sie sich andere Methoden einfallen lassen, damit die Menschen auf das aufmerksam wurden, was sie zu sagen hatte.
Doch die Zutaten, die man braucht, um eine Geschichte zu erfinden, sind immer und überall die gleichen geblieben: Geburten, Todesfälle, Hochzeiten, Skandale – das ist es, was die Menschen überall auf der Welt am meisten interessiert.
Voller Optimismus machte sich Emily also daran, ihren Traum von Ruhm und Reichtum zu verwirklichen. Aber es war nicht nur das. Schreiben war für Emily Byrd Starr mehr als etwas, womit man Geld verdienen und Lorbeeren ernten kann. Schreiben war etwas, was sie tun mußte. Wenn ihr etwas in den Sinn kam – eine Idee, egal ob erfreulich oder unerfreulich –, dann quälte sie sich damit so lange herum, bis es von der Seele geschrieben war. Sie hatte ein Gespür für Humor und Ernst. Die komischen und die tragischen Seiten des Lebens fesselten sie so sehr, daß sie ihren Empfindungen unbedingt mittels ihrer Feder Ausdruck verschaffen mußte. Die Welt war voller verlorener, aber unsterblicher Träume. Nur ein dünner Vorhang trennte sie von der Wirklichkeit. Sie wollten entdeckt und gedeutet werden und riefen nach ihr, mit einer Stimme, der sie einfach gehorchen mußte.
Emily war voller jugendlicher Lebensfreude. Das Leben war verlockend und winkte sie immer und immer weiter. Emily wußte, daß ihr ein harter Kampf bevorstand. Sie wußte, daß sie die Nachbarn von Blair Water immer wieder vor den Kopf stoßen würde, wenn sie für einen von ihnen zum Beispiel einen Nachruf schreiben sollte oder wenn sie beim Schreiben ein ungewöhnliches Wort gebrauchte. Immer muß sie so großspurig daherreden, würde es dann wieder heißen. Sie wußte, daß es weiterhin Absagen hageln würde. Sie wußte, daß es Tage geben würde, an denen sie sich verzweifelt einredete, sie sei absolut unfähig zu schreiben. Tage, an denen sie die Absagen mit ihren abgedroschenen Phrasen einfach nicht mehr sehen konnte und vor Wut am liebsten die Wohnzimmeruhr mit ihrem höhnischen, erbarmungslosen Ticktack aus dem Fenster schleudern würde. Tage, an denen alles schiefging und sie mit nichts zufrieden war. Tage, an denen sie an ihrer Überzeugung zweifeln würde, daß in der Poesie genausoviel Wahrheit lag wie in der Wirklichkeit. Tage, an denen das beiläufige Wort, nach dem sie so begierig lauschte, wie ein spöttisches Echo an ihr Ohr drang, ohne je wirklich erreichbar zu sein.
Sie wußte, daß Tante Elizabeth ihre Schreibsucht zwar duldete, sie aber keineswegs billigte. Doch Emily hatte immerhin in den zwei Jahren, während sie die High School in Shrewsbury besuchte, mit ihren Gedichten und Geschichten Geld verdient. Tante Elizabeth hatte es kaum fassen können – daher also wohl ihre Nachsicht. Trotzdem gehörte es sich nicht für eine Murray! Niemand in der Familie hatte je geschrieben! Außerdem hatte die ehrenwerte Elizabeth Murray immer das ungute Gefühl, als würde sie dabei von irgend etwas ausgeschlossen. Ja, sie nahm es Emily in der Tat übel, daß sie außer auf New Moon und in Blair Water auch noch in einer anderen Welt lebte, in einem funkelnden, unermeßlichen Königreich, in das sie jederzeit eintreten und wohin ihr keine Tante der Welt folgen konnte. Hätte Emily nicht so oft den Eindruck erweckt, als sähe sie etwas Wunderschönes und Geheimnisvolles vor Augen, wer weiß, vielleicht hätte Tante Elizabeth dann etwas mehr Verständnis für sie aufbringen können. Aber niemand läßt sich gern aussperren, schon gar nicht die selbstgefälligen Murrays von New Moon.
Diejenigen Leser, die Emily schon in den Jahren auf New Moon und in Shrewsbury begleitet haben, wissen wohl, wie sie ausgesehen hat. Für diejenigen, die Emily noch nicht kennengelernt haben, möchte ich sie beschreiben, wie sie im blühenden Alter von siebzehn Jahren aussah, während sie an einem goldenen Herbsttag durch den alten Garten von New Moon spazierte. Dieser Garten war eine Stätte des Friedens. Ein bezaubernder Garten mit den prächtigsten Farben und wunderschönen geheimnisvollen Schatten. Er war erfüllt vom Duft der Fichten und Rosen; Bienen summten, der Wind sang sein Klagelied, das Meer rauschte in der Ferne, und im Norden hörte man immer das leise Seufzen der Tannen in Lofty John Sullivans Busch. Emily liebte jede Blume, jeden Schatten und jede Stimme in diesem Garten und jeden dieser schönen alten Bäume. Ganz besonders die wilden Kirschbäume hinten in der Ecke, die drei Pyramidenpappeln, die sie „die drei Prinzessinnen“ nannte, den wilden, mädchenhaften Pflaumenbaum am Bach, die große Fichte in der Mitte des Gartens, einen Silberahorn und eine Pinie weiter draußen, eine Zitterpappel in einer anderen Ecke, die immer mit dem Wind flirtete, und die weißen Birken in Lofty Johns Busch, die würdevoll in einer Reihe standen.
Emily war glücklich, an einem Ort zu wohnen, wo es so viele Bäume gab, uralte Bäume, gepflanzt und gepflegt von Händen, die längst tot waren, untrennbar verknüpft mit den Freuden und Leiden der Menschen, die sich in ihrem Schatten aufgehalten hatten.
Emily war ein schlankes junges Mädchen. Ihr Haar schimmerte wie schwarze Seide. Ihre Augen waren grau, und die Schatten unter ihren Augen waren besonders dunkel und reizvoll, wenn sie zu verbotener Stunde noch wach war, um eine Geschichte zu Ende zu schreiben oder den Grundriß für eine neue Handlung auszuarbeiten. Sie hatte einen scharlachroten Mund mit den typischen Murray-Fältchen in den Mundwinkeln; und sie hatte spitze, koboldhafte Ohren. Vielleicht waren die Mundfältchen und die spitzen Ohren schuld daran, daß manche Leute fanden, sie hätte etwas von einer Katze. Ihr Kinn und ihr Nacken waren fein geformt; und sie hatte ein ganz verblüffendes Lächeln, das langsam immer breiter wurde, bis es in einem Strahlen endete.
Ihre Knöchel gefielen ganz besonders der klatschsüchtigen alten Tante Nancy Priest, die sie überall anpries. Ihre Wangen waren rosig, nur manchmal verfärbten sie sich plötzlich tiefrot. Es brauchte nicht viel, um Emily zum Erröten zu bringen. Es genügte schon der Wind draußen auf dem Meer, das leuchtende Blau des Himmels, eine feuerrote Mohnblume, weiße Segel, die im strahlenden Morgenlicht den Hafen verließen, das Meer im silbernen Schein des Mondes, eine leuchtend blaue Akelei im alten Obstgarten. Oder ein ganz bestimmtes Pfeifen aus Lofty Johns Busch.
Und sonst – war Emily eigentlich hübsch? Ich kann es nicht sagen. Emily wurde jedenfalls nie erwähnt, wenn von den Schönheiten von Blair Water die Rede war. Doch wer je ihr Gesicht gesehen hatte, der vergaß es nie wieder. Es kam nie vor, daß jemand, dem Emily zum zweiten Mal begegnete, in Verlegenheit kam und sagte: „Hm, irgendwie kommen Sie mir bekannt vor, aber …“
Unter Emilys Vorfahren hatte es viele reizende Frauen gegeben. Alle hatten ihr etwas von ihrer Persönlichkeit mitgegeben. Sie war wie ein sprudelnder Wasserfall. Ein Gedanke konnte sie bewegen wie heftiger Wind, ein Gefühl sie überwältigen wie ein Sturm. Sie gehörte zu jenen temperamentvollen Menschen, von denen man sich, auch wenn sie gestorben sind, nicht vorstellen kann, daß sie wirklich tot sind. Sie sprühte vor Leidenschaft – ganz im Gegensatz zu ihrer praktisch und vernünftig denkenden Sippschaft. Viele Menschen mochten sie, aber viele mochten sie auch nicht. Auf jeden Fall kam es nie vor, daß sie jemandem einfach gleichgültig war.
Als Emily noch klein war und mit ihrem Vater in dem kleinen alten Haus in Maywood lebte, wo er später starb, da war sie einmal hinausgezogen, um das Ende des Regenbogens zu suchen. Sie lief weit hinaus über Felder und Hügel, voll Hoffnung und Erwartung. Doch während sie noch lief, wurde der wundervolle Bogen schwächer und immer schwächer – und schließlich war er fort. Emily war ganz allein in einem unbekannten Tal. Für einen Augenblick fingen ihre Lippen an zu zittern. Tränen traten ihr in die Augen. Doch dann hob sie den Kopf und lächelte tapfer zum Himmel hinauf.
„Es wird wieder einen Regenbogen geben“, sagte sie. Das Leben auf New Moon war nicht mehr wie früher. Emily mußte sich erst noch daran gewöhnen. Sie mußte wohl damit rechnen, daß sie sich manchmal einsam fühlen würde. Ilse Burnely, ihre übermütige, seit sieben Jahren treue Freundin, war auf die Schule für Literatur und Ausdruck nach Montreal gegangen. Unter Tränen hatten die beiden Mädchen voneinander Abschied genommen und sich geschworen, sich nie wieder an der gleichen Stelle zu treffen. Machen wir uns doch nichts vor: Wenn sich Freunde nach einer Zeit der Trennung wiedertreffen, dann ist da immer ein Gefühl der Fremdheit – mal schwächer, mal stärker. Keiner findet den anderen völlig unverändert. Das ist natürlich und unvermeidbar. Der Mensch entwickelt sich ständig weiter, er bleibt nie an einer Stelle stehen. Aber was nützt uns das Philosophieren, wer kann schon das Gefühl der Verwirrung und Enttäuschung unterdrücken, wenn er feststellen muß, daß der Freund nicht mehr derselbe ist und nie wieder derselbe sein kann wie früher – auch wenn er sich zum Guten hin verändert hat?
Emily spürte das ganz deutlich, im Gegensatz zu Ilse. Sie fühlte, daß es Abschied nehmen hieß von der Ilse aus ihren Kindertagen auf New Moon und ihren Studienjahren in Shrewsbury. Auch Perry Miller, früher „Knecht“ auf New Moon, dann erfolgreicher Absolvent der High School, hoffnungsfroher, aber abgewiesener Verehrer von Emily und Zielscheibe von Ilses Wutausbrüchen – war gegangen. Er studierte Rechtswissenschaften in einem Anwaltsbüro in Charlottetown und hatte schon verschiedene vielversprechende Ziele im Auge.
Das Ende des Regenbogens – ein ersponnener Topf voller Gold, nein, das war nichts für Perry. Er wußte genau, was er wollte, und er richtete sich danach. Langsam glaubten die Leute auch, daß er es schaffen würde. Schließlich war doch der Abstand zwischen einem juristischen Angestellten in Mr. Abels Büro und dem Obersten Gerichtshof von Kanada auch nicht größer als der Abstand zwischen demselben Angestellten und dem barfüßigen Straßenjungen aus Stovepipe Town unten am Hafen.
Teddy Kent von Tansy Patch war schon eher einer, der dem Regenbogen nachlief. Aber auch er ging fort, auf die Kunstakademie nach Montreal. Er wußte, wie verlockend, aber auch wie hoffnungslos und schmerzlich es war, wenn man auf die Suche nach dem Regenbogen ging.
„Auch wenn wir den Regenbogen nie finden werden – das Suchen hat doch auch seinen Reiz. Mehr vielleicht, als wenn wir ihn finden“, sagte Teddy zu Emily, als sie kurz vor Teddys Abreise im Dämmerlicht durch den Garten von New Moon schlenderten.
„Aber wir werden ihn finden“, sagte Emily und richtete den Blick auf einen Stern, der über den „drei Prinzessinnen“ funkelte. Die Art, wie Teddy „wir“ gesagt hatte, machte Emily ganz selig. Emily war immer ehrlich zu sich selbst, sie brauchte sich da gar nichts vorzumachen: Teddy Kent bedeutete ihr mehr als sonst irgend jemand auf der Welt. Aber sie – wieviel bedeutete sie ihm eigentlich? Wenig? Viel? Oder etwa gar nichts?
Emily hatte absichtlich an diesem Abend keinen Hut aufgesetzt, sondern ihr Haar mit vielen kleinen, gelben Chrysanthemen geschmückt, die sie sternförmig angeordnet hatte. Lange hatte sie darüber nachgedacht, was für ein Kleid sie tragen sollte, bis sie sich für das Seidenkleid mit den gelben Schlüsselblumen entschieden hatte. Sie fand, daß sie darin sehr nett aussah. Aber was bedeutete das schon, wenn Teddy gar keine Notiz davon nahm? Er sah sie immer gleich an, dachte sie gekränkt. Dean Priest wäre da ganz anders, der hätte ihr ein Kompliment gemacht.
„Ich weiß nicht“, sagte Teddy. Mißmutig sah er dabei Emilys grauem Kater Daffy nach, der wie ein Tiger durchs Dickicht schlich. „Ich weiß nicht. Jetzt, wo ich kurz vor der Abreise stehe, habe ich so ein flaues Gefühl. Vielleicht ist die ganze Mühe umsonst. Das bißchen Zeichentalent – was nützt das schon? Vor allem, wenn man nachts um drei wach liegt und darüber nachdenkt?“
„Das Gefühl kenne ich nur zu gut“, sagte Emily. „Gestern abend habe ich stundenlang über eine Geschichte nachgegrübelt, bis ich in meiner Verzweiflung zu der Einsicht kam, daß ich nie schreiben kann, daß ich es gar nicht erst zu versuchen brauche – daß ich nichts zustande bringe, was wirklich von Bedeutung ist. Mit dieser Erkenntnis ging ich zu Bett und weinte, bis mein Kissen ganz naß war. Um drei Uhr wachte ich auf und konnte noch nicht mal mehr weinen. Es kam mir plötzlich so sinnlos vor zu weinen. So sinnlos wie lachen oder ehrgeizig sein. Ich hatte überhaupt keinen Mut mehr. Dann stand ich im Morgengrauen auf und fing mit einer neuen Geschichte an. Man darf sich einfach nicht unterkriegen lassen von dem Gefühl, das einen nachts um drei überkommt.“
„Aber leider ist es in jeder Nacht drei Uhr“, sagte Teddy. „Um diese Zeit steht für mich immer fest, daß man das, was man am meisten will, garantiert nicht bekommt. Dabei gibt es zwei Dinge, die ich mir sehnlichst wünsche. Das eine ist natürlich, ein großer Künstler zu werden. Ich habe mich nie für einen Feigling gehalten, Emily, aber jetzt habe ich Angst. Wenn ich es nicht schaffe! Alle werden mich auslachen. Mutter wird sagen, siehst du, ich habe es gleich gewußt. Sie läßt mich nur sehr ungern gehen, mußt du wissen. Wenn ich mir vorstelle, daß ich versage! Es wäre wirklich besser, ich würde nicht gehen.“
„Nein, du mußt gehen!“ ereiferte sich Emily. Gleichzeitig fragte sie sich, was wohl das zweite sein mochte, das Teddy sich so sehnlich wünschte. „Du darfst keine Angst haben“, sagte sie. „In der Nacht, als Vater starb, sagte er zu mir, daß ich vor nichts Angst zu haben brauche. Und hat Emerson nicht mal gesagt: ‚Tu immer das, wovor du Angst hast‘?“
„Wahrscheinlich hat Emerson das gesagt, nachdem er schon alles hinter sich hatte, was ihm je Angst gemacht hat. Hinterher kann man leicht reden.“
„Du weißt, ich glaube an dich“, sagte Emily leise.
„Ja, das weiß ich. Du und Mr. Carpenter. Ihr seid die einzigen, die wirklich an mich glauben. Sogar Ilse ist der Meinung, daß Perry es viel eher zu etwas bringt als ich.“
„Dafür bist du auf dem Weg zum Gold des Regenbogens.“
„Aber wenn ich es nicht finde und dich enttäusche – das wäre das Schlimmste überhaupt.“
„Aber du wirst es finden. Siehst du den Stern dort oben über den ‚drei Prinzessinnen‘, Teddy? Das ist die Wega aus dem Sternbild der Leier. Sie ist mein Lieblingsstern. Weißt du noch, wie wir früher abends im Obstgarten saßen, du und Ilse und ich, während Cousin Jimmy die Kartoffeln für die Schweine kochte? Du hast uns dann immer so wunderschöne Geschichten über diesen Stern erzählt – und über dein früheres Leben, bevor du auf diese Welt kamst.“
„Ja, wir waren richtig unbekümmerte Grünschnäbel damals“, sagte Teddy wie ein von Sorgen niedergedrückter Mann, der sich wehmütig an seine sorglose Jugendzeit zurückerinnert.
„Ich möchte, daß du mir etwas versprichst“, sagte Emily. „Immer, wenn du diesen Stern siehst, dann denke daran, daß ich an dich glaube – ganz fest.“
„Und versprichst du mir, daß du immer an mich denkst, wenn du diesen Stern siehst?“ fragte Teddy. „Oder besser: Wir wollen einander versprechen, daß wir immer an den anderen denken, wenn wir diesen Stern sehen. Überall und solange wir leben.“
„Ich verspreche es“, sagte Emily. Wie sie Teddy liebte, wenn er sie so anschaute!
Was für ein romantisches Versprechen! Aber was bedeutete es eigentlich? Emily wußte es nicht. Sie wußte nur, daß Teddy fortgehen würde, daß das Leben ihr plötzlich leer und kalt vorkam – daß der Wind in den Bäumen von Lofty Johns Busch so traurig klang – daß der Sommer vorbei und der Herbst gekommen war. Und daß der Topf voller Gold am Ende des Regenbogens irgendwo in weiter Ferne lag.
Warum bloß hatte sie diesen Stern erwähnt? Warum bloß kam man bei Tannenduft und Abendrot auf so dumme Gedanken?
Zweites Kapitel
New Moon, 18. November 19..
Heute kam die Dezemberausgabe der Zeitschrift Marchwood mit meinem Gedicht Flüchtiges Gold. Ich schreibe das deshalb in mein Tagebuch, weil sie meinem Gedicht eine ganze Seite gewidmet und es noch dazu illustriert haben – noch nie ist eins meiner Gedichte so zu Ehren gekommen. Dabei ist es wahrscheinlich ziemlich kitschig – Mr. Carpenter hat nur die Nase gerümpft, als er es las, und sich geweigert, überhaupt etwas dazu zu sagen. Mr. Carpenter würde nie auf die Idee kommen, irgendeinen Trost auszusprechen, wenn ihm etwas nicht gefällt; aber wenn er gar nichts sagt, das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Wenn die Leser allerdings nicht so genau auf den Inhalt achten, dann kommt das Gedicht vielleicht doch an, so vornehm, wie es aussieht.
Was für ein Segen, daß dem Herausgeber die Idee mit den Illustrationen gekommen ist! Er hat mein angeknackstes Selbstvertrauen wieder aufgerichtet!
Allerdings war ich mit den Bildern nicht so ganz einverstanden. Der Künstler hat das, was ich aussagen wollte, überhaupt nicht begriffen. Teddy hätte das bestimmt besser gemacht.
Teddy macht große Fortschritte auf der Kunstakademie. Und die Wega leuchtet jeden Abend. Ich wüßte zu gern, ob er wirklich jedesmal an mich denkt, wenn er sie sieht. Womöglich sieht er sie überhaupt nicht. Vielleicht fällt sie gar nicht auf in Montreal mit seinen vielen Lichtern. Er scheint Ilse ziemlich oft zu sehen. Sie sind bestimmt heilfroh, sich zu kennen, in einer so großen Stadt voller fremder Leute.
26. November 19..
Heute war ein wunderschöner Novembertag – sommermild und herbstlich-süß. Ich bin zum Friedhof unten am See gegangen und habe dort eine ganze Weile gelesen. Tante Elizabeth versteht nicht, wie man sich an so einem schauerlichen Ort niederlassen kann, und sie hat zu Tante Laura gesagt, ich hätte womöglich eine krankhafte Ader. Aber ich wüßte nicht, was daran krankhaft sein soll. Es ist schön dort, und der Wind trägt immer so würzige und süße Düfte über den See herüber. Es ist ruhig und friedlich dort, umgeben von den alten Gräbern – lauter grüne Hügelchen, die mit rauhreifbedecktem Farn besprenkelt sind. Männer und Frauen liegen dort, die im selben Haus gewohnt haben wie ich. Männer und Frauen, die gesiegt haben – Männer und Frauen, die besiegt worden sind – und jetzt sind Sieg und Niederlage eins. Auf dem Friedhof kann ich nie himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt sein. Es ist dort alles nicht mehr so wichtig. Ich mag die uralten roten Sandsteinplatten, besonders die auf Mary Murrays Grab mit der Inschrift „Hier bleibe ich“ – welche ihr Mann aus Rache eingravieren ließ. Sein Grab liegt direkt neben ihrem, und ich bin sicher, sie haben einander längst verziehen. Vielleicht kommen sie ja manchmal bei Mondschein hervor, schauen sich die Inschrift an und lachen darüber. Man kann die Schrift kaum noch lesen, weil der Stein mit lauter winzigen Flechten bewachsen ist. Cousin Jimmy hat es aufgegeben, sie wegzukratzen. Eines Tages wird der alte Stein so zugewachsen sein, daß es aussieht, als wäre er voller grüner, roter und silberner Flecken.
20. Dezember 19..
Heute ist etwas Erfreuliches passiert. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Madison’s hat meine Geschichte Die Anklageangenommen!!! Es ist nämlich sehr schwierig, bei dieser Zeitschrift unterzukommen – daher die drei Ausrufezeichen. Das weiß ich nur zu gut. So oft schon habe ich es versucht, und der Dank für meine Mühe war immer und immer wieder das Übliche von wegen „wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen“ – Und jetzt hat es endlich doch geklappt! Bei Madison’s angenommen zu werden ist ein sicheres Zeichen dafür, daß der Weg zum Gipfel erreichbar ist. Der Herausgeber hat sogar netterweise gesagt, es sei eine bezaubernde Geschichte.
Er hat mir einen Scheck über fünfzig Dollar geschickt. Bald werde ich Tante Ruth und Onkel Wallace das Geld zurückzahlen können, das sie für mich in Shrewsbury ausgegeben haben. Tante Elizabeth hat den Scheck mal wieder argwöhnisch beäugt, sich aber – zum erstenmal – die Frage verkniffen, ob die Bank mir das Geld wirklich in bar auszahlt. Tante Lauras schöne blaue Augen strahlten vor Stolz. Strahlende Augen gefallen mir – besonders wenn sie wegen meines Erfolgs so strahlen.
Cousin Jimmy findet, daß Madison’s mindestens soviel taugt wie alle Yankee-Zeitschriften zusammen.
Ob Dean Priest meine Geschichte wohl gefällt? Und wenn, ob er es mir dann auch sagt? Er sagt nie ein Wort der Anerkennung über das, was ich in letzter Zeit schreibe. Am liebsten würde ich ihn dazu zwingen. Seine Kritik wäre mir am wichtigsten, abgesehen von dem, was Mr. Carpenter sagt.
Etwas ist merkwürdig an Dean. Irgendwie scheint er immer jünger zu werden. Noch vor ein paar Jahren fand ich ihn ziemlich alt. Jetzt kommt er mir vor wie ein Mann in mittleren Jahren. Wenn das so weitergeht, ist er bald wieder ein junger Mann. Wahrscheinlich liegt das daran, daß mein Verstand ein bißchen heranreift und ich ihn langsam einhole. Tante Elizabeth lehnt meine Freundschaft mit ihm immer noch genauso ab wie früher. Sie hat gegen jeden Priest eine abgrundtiefe Abneigung. Aber ich wüßte nicht, was ich ohne Deans Freundschaft tun sollte. Sie ist wie das Salz des Lebens.
15. Januar 19..
Heute war es stürmisch. Die Nacht zuvor konnte ich nicht schlafen, weil ich vier Absagen bekommen hatte. Es kam, wie Miss Royal es vorhergesagt hatte: Ich ärgerte mich auf einmal furchtbar, daß ich nicht doch mit ihr nach New York gegangen bin. Daß Babys immer weinen, wenn sie nachts aufwachen, verstehe ich nur zu gut. Mir ist oft genug auch danach zumute. Alles lastet dann so schwer auf meiner Seele. Ich war jedenfalls den ganzen Vormittag niedergeschlagen und schlecht gelaunt und konnte es kaum erwarten, bis die Post kam; das schien mir die letzte Rettung zu sein. Ich bin immer so gespannt auf die Post. Was würde wohl diesmal dabeisein? Ein Brief von Teddy (Teddy schreibt so fröhliche Briefe!)? Ein netter dünner Umschlag mit einem Scheck drin? Oder ein dicker, der noch mehr deprimierende Absagen verhieß? Vielleicht auch einer von Ilses schwungvoll dahingekritzelten Briefen? Aber nichts davon! Nur ein wütender Brief von Beulah Grand, einer entfernten Kusine aus Derry Pond, die sich aufregt, weil sie sich einbildet, sie käme in meiner Geschichte Ein Dummkopf kommt selten allein vor. Die Geschichte ist vor kurzem in einer weitverbreiteten kanadischen Landwirtschaftszeitung abgedruckt worden. Sie macht mir die schlimmsten Vorwürfe – ob ich denn nicht wenigstens eine alte Freundin, die es immer gut gemeint hat, verschonen könne. Sie sei es nicht gewohnt, in den Zeitungen lächerlich gemacht zu werden. Sie habe keine Lust, für meine Späße in der öffentlichen Presse herzuhalten. Dabei sind ihre Äußerungen auch nicht gerade taktvoll; einiges von dem, was sie schreibt, hat mich verletzt, anderes macht mich richtig wütend. Nicht im Traum habe ich an Kusine Beulah gedacht, als ich die Geschichte schrieb! Der Charakter der Tante Kate ist frei erfunden. Und selbst wenn ich während des Schreibens an Kusine Beulah gedacht hätte – mit Sicherheit hätte ich sie nicht in die Geschichte mit hineingenommen, so dumm und uninteressant, wie sie ist. Sie hat nicht die geringste Ähnlichkeit mit Tante Kate, die eine lebhafte, humorvolle alte Dame ist.
Nicht genug damit, daß Kusine Beulah sich an mich wandte, nein, sie schrieb auch noch an Tante Elizabeth, mit dem Erfolg, daß es einen Familienkrach gab. Tante Elizabeth glaubt mir nicht, daß ich unschuldig bin – sie behauptet, Tante Kate sei das genaue Abbild von Kusine Beulah, und sie möchte mich doch höflich bitten – wenn ich das schon höre! – meine Verwandten in Zukunft aus dem Spiel zu lassen.
„Das gehört sich einfach nicht für eine Murray“, sagte Tante Elizabeth erhobenen Hauptes, „aus den Eigenheiten von Freunden Kapital zu schlagen.“
Wieder etwas, was Miss Royal vorhergesehen hatte! Sollte sie womöglich in allem Recht behalten? Wenn das so wäre, dann …
Cousin Jimmy, der die Geschichte ganz lustig fand, schoß aber dann den Vogel ab:
„Laß doch die alte Beulah, Pussy“, flüsterte er mir zu. „Das war gut so, du hast es ihr mit deiner Tante Kate ganz schön gezeigt. Ich hab’ sie sofort wiedererkannt, noch bevor ich die Seite zu Ende gelesen hatte. An ihrer Nase habe ich sie erkannt.“ Das also war es! Dummerweise hatte ich Tante Kate mit einer langen Hängenase versehen! In der Tat, es läßt sich nicht leugnen: Kusine Beulah hat eine lange Hängenase! Wenn das kein Markenzeichen ist! Da konnte ich jetzt noch so steif und fest behaupten, ich hätte mit Kusine Beulah nichts im Sinn gehabt – niemand wollte mir glauben. Cousin Jimmy nickte nur und kicherte.
Aber das Allerschlimmste ist: Wenn Tante Kate wirklich wie Kusine Beulah Grant ist, dann habe ich ganz und gar versagt!
Immerhin geht es mir jetzt schon viel besser als vorhin, als ich mit meiner Tagebucheintragung anfing. Jetzt bin ich nicht mehr ganz so wütend und enttäuscht. Das ist wohl der größte Vorteil, wenn man Tagebuch schreibt.
3. Februar 19..
Heute war ein großer Tag! Ich bekam drei Zusagen! Und ein Herausgeber hat mich sogar gebeten, ihm ein paar Geschichten zuzuschicken. Eigentlich kann ich es überhaupt nicht leiden, wenn ich dazu aufgefordert werde, eine Geschichte zu schicken. Das ist viel schlimmer, als wenn man von sich aus eine schickt. Wenn die Geschichte nämlich dann zurückkommt, dann ist das viel demütigender, als wenn man sie an irgendeinen namenlosen Herausgeber geschickt hat, der irgendwo tausend Meilen weit weg hinter dem Schreibtisch sitzt.
Außerdem habe ich festgestellt, daß ich keine Geschichten auf Bestellung schreiben kann. Das ist wirklich grausam. Ich habe es kürzlich versucht. Der Herausgeber der Zeitschrift Junge Leute hatte mich gebeten, anhand bestimmter Richtlinien eine Geschichte zu schreiben. Das tat ich auch. Er schickte sie zurück, wies mich auf diesen und jenen Fehler hin und bat mich, die Geschichte neu zu schreiben. Ich versuchte es. Ich schrieb und verbesserte, ich strich weg und fügte hinzu, so lange, bis meine Geschichte nur noch ein zusammengestückeltes Etwas war. Schließlich ging ich zum Küchenherd, hob eine der Herdplatten hoch und ließ meine erste Geschichte und alle nachfolgenden Variationen hineinplumpsen.
Seitdem habe ich mir geschworen, nur noch das zu schreiben, was ich will!
16. Februar 19..
Meine Geschichte Ein folgenreicher Witz erschien heute in der Zeitschrift Das Heim. Leider wurde ich nur auf dem Einband erwähnt, zusammen mit ‚anderen‘. Zum Ausgleich wurde ich in der Zeitschrift Junge Dame als ‚eine der bekannten und beliebten Mitwirkenden fürs kommende Jahr‘ namentlich erwähnt. Cousin Jimmy las das Vorwort des Herausgebers bestimmt ein halbes dutzendmal, und ich hörte, wie er immer wieder vor sich hinmurmelte: bekannt und beliebt. Dann ging er in den Laden an der Ecke und kaufte mir ein neues Jimmy-Buch. Immer, wenn ich wieder einen neuen Meilenstein auf dem Weg zum Gipfel hinter mich gebracht habe, belohnt mich Cousin Jimmy mit einem neuen Jimmy-Buch. Ich kaufe mir nie eines selbst, denn damit würde ich ihn nur kränken. Er blickt immer voller Ehrfurcht auf den Stapel Jimmy-Bücher, die auf meinem Schreibtisch liegen, festen Glaubens, daß sich in dem Durcheinander hochwertige Literatur verbirgt.
Ich gebe Dean meine Geschichten zum Lesen. Ich kann einfach nicht anders, obwohl er sie mir immer wieder kommentarlos zurückbringt, oder, was noch schlimmer ist, mit irgendeinem Trostspruch. Es ist schon wie eine fixe Idee von mir geworden, daß ich Dean unbedingt dazu bringen will zuzugeben, daß wenigstens etwas von dem, was ich schreibe, etwas taugt. Das wäre ein Siegesgefühl! Aber solange er das nicht tut, ist alles nur Staub und Asche.
2. April 19..
Neuerdings kommt ein gewisser junger Mann aus Shrewsbury gelegentlich zu Besuch – nicht gerade zur Begeisterung derer von New Moon. Und genausowenig zu E. B. Starrs Begeisterung. Tante Elizabeth war ziemlich grimmig, weil ich mit ihm ein Konzert besucht habe. Als ich spätabends nach Hause kam, lauerte sie mir auch schon auf.
„Ich bin nicht durchgebrannt, wie du siehst, Tante Elizabeth“, sagte ich zu ihr. „Und ich verspreche dir, daß es dazu auch nicht kommen wird. Wenn ich nämlich jemanden unbedingt heiraten will, dann sage ich dir das schon rechtzeitig, mach dir da mal keine Sorgen.“
Ich weiß nicht, ob Tante Elizabeth daraufhin mit ruhigerem Gewissen zu Bett ging oder nicht. Wenn meine Mutter durchgebrannt ist – Gott sei Dank! –, dann steht für Tante Elizabeth gleich fest, daß sich das vererbt!
15. April 19..
Heute abend bin ich den Hügel hinaufspaziert und bei Mondschein um das enttäuschte Haus herumgeschlichen. Das enttäuschte Haus ist vor siebenunddreißig Jahren für eine junge Braut erbaut worden, die dann doch nie dort eingezogen ist. Es ist auch nur zum Teil fertig. Da steht es nun, mit Brettern vernagelt und mit gebrochenem Herzen. Ich habe jedesmal solches Mitleid mit ihm. Mit seinen blinden Augen, durch die niemals ein Lichtstrahl gedrungen ist – bis auf einen Feuerschein vor langer Zeit einmal. Dabei hätte es so ein nettes kleines Haus werden können, so wie es sich an den Wald anschmiegt. Ein warmes, freundliches Haus. Und ein gutmütiges kleines Haus. Nicht so eines wie das, das Tom Semple gerade neu gebaut hat. Das ist ein übellauniges Haus. Zänkisch, mit kleinen Augen und scharfen Ellbogen. Komisch, daß ein Haus, das noch nie bewohnt gewesen ist, schon so einen Charakter haben kann. Als Teddy und ich noch Kinder waren, da haben wir einmal ein Brett vom Fenster weggestemmt, sind hineingeklettert und haben im Kamin Feuer gemacht. Dann haben wir uns davorgesetzt und Zukunftspläne geschmiedet. Wir stellten uns vor, einmal zusammen in diesem Haus zu wohnen. Bestimmt hat Teddy diese kindischen Ideen längst vergessen. Er schreibt mir oft, lange, lustige, Teddy-typische Briefe. Und er erzählt mir jede Kleinigkeit über das, was er erlebt. Aber in letzter Zeit kommen mir seine Briefe ziemlich unpersönlich vor. Solche Briefe hätte er genausogut an Ilse schreiben können.
Armes kleines enttäuschtes Haus. Ich fürchte, du wirst immer enttäuscht bleiben.
l.Mai 19..
Endlich wieder Frühling! Junge Pappeln mit zartgoldenen Blättern. Das Meer, das sich hinter den silbernen und lila Sanddünen kräuselt.
Der Winter ist unglaublich schnell vergangen, und das trotz der schrecklichen Nächte, in denen ich um drei Uhr wach wurde, und trotz des traurigen Dämmerlichts. Dean kommt bald aus Florida zurück. Aber weder Teddy noch Ilse kommen diesen Sommer nach Hause. Das hat mir nächtelang keine Ruhe gelassen. Ilse will an die Küste fahren, um eine Tante zu besuchen. Irgendeine Schwester ihrer Mutter, die sich nie zuvor um Ilse gekümmert hat. Und Teddy hat die Chance bekommen, für eine New Yorker Firma eine Serie über die berittene Polizei im Nordwesten zu illustrieren, und muß dafür in den Ferien hoch in den Norden fahren, um Skizzen zu machen. Das ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit für ihn, und ich wäre auch kein bißchen traurig, wenn er wenigstens auch ein bißchen traurig darüber wäre, daß er nicht nach Blair Water kommen kann. Aber den Eindruck habe ich nicht.
Wahrscheinlich gehört für ihn Blair Water und alles, was damit zusammenhängt, längst der Vergangenheit an.
Jetzt erst wird mir klar, wie sehr ich mich darauf verlassen hatte, daß Ilse und Teddy im Sommer kommen, und wie sehr mir diese Hoffnung über einige trübe Zeiten im Winter hinweggeholfen hat. Wenn ich mir vorstelle, daß ich diesen Sommer nicht ein einziges Mal Teddys Pfeifen aus Lofty Johns Busch hören soll, daß ich ihm noch nicht einmal zufällig an einem unserer geheimen Lieblingsplätze begegnen werde, daß sich, wenn ich irgendwo unter Menschen bin, nicht ein einziges Mal unsere Blicke treffen werden, deren Bedeutung nur wir beide kennen, dann kommt mir das Leben plötzlich so farblos vor wie ein grauer, zerfetzter Lumpen.
Gestern habe ich Mrs. Kent im Postamt getroffen, und sie blieb sogar stehen, was selten genug vorkommt. Sie haßt mich wie eh und je.
„Ich nehme an, du weißt, daß Teddy diesen Sommer nicht kommt?“ fragte sie.
„Ja“, sagte ich knapp.
Als sie sich umdrehte, bemerkte ich in ihren Augen so einen komischen triumphierenden Blick, der mir richtig weh tat – und den ich gut verstand. Sie leidet zwar darunter, daß Teddy nicht zu ihr kommt, aber um so mehr freut sie sich, daß er nicht zu mir kommt. Das zeigt doch, daß er nichts für mich übrig hat, da ist sie sich ganz sicher.
Wahrscheinlich hat sie recht. Aber man kann doch im Frühling nicht nur Trübsal blasen!
Andrew hat sich verlobt! Tante Addie ist voll und ganz mit dem Mädchen einverstanden. „Eine Bessere als die hätte ich auch nicht für Andrew finden können’, sagte sie heute zu Tante Elizabeth. Zu Tante Elizabeth und gegen mich. Tante Elizabeth sagte mit kühler Miene, daß sie sich freue. Tante Laura fing an zu schluchzen – sie schluchzt immer, wenn irgend jemand geboren wird oder stirbt oder heiratet oder sich verlobt oder kommt oder geht oder zum erstenmal wählen geht. Sie war wohl schon ein wenig enttäuscht. Wo Andrew doch so eine sichere Partie für mich gewesen wäre! Stimmt, ein Wirbelwind ist Andrew sicher nicht.
Drittes Kapitel
Anfangs nahm niemand Mr. Carpenters Krankheit besonders ernst. Er hatte in den Jahren zuvor schon häufiger Rheumaanfälle bekommen, die ihn für ein paar Tage ans Bett fesselten. Doch danach hatte er es immer wieder geschafft, zur Arbeit zu humpeln, mißmutiger und angriffslustiger denn je. Mr. Carpenter fand, daß die Schüler von Blair Water längst nicht mehr das waren, was sie früher einmal gewesen seien. Heutzutage hätte er es nur noch mit einer gefühllosen, nichtsnutzigen Rasselbande zu tun.
„Es hat überhaupt keinen Sinn, diesen Hohlköpfen etwas eintrichtern zu wollen. Ich bin es leid“, knurrte er.
Teddy und Ilse und Perry und Emily waren ja nicht mehr da. Diese vier hatten wenigstens noch Leben in den Schulalltag gebracht. Vielleicht war Mr. Carpenter nicht nur das Unterrichten leid, sondern alles. Er war noch nicht einmal so alt an Jahren, aber er hatte den größten Teil seiner Energie in seiner wilden Jugendzeit aufgebraucht. Diese kleine, ängstliche, unscheinbare Frau, mit der er verheiratet gewesen war, war im letzten Herbst gestorben, einfach so. Sie schien Mr. Carpenter nie besonders viel bedeutet zu haben, doch nach ihrem Tod ging es zusehends mit ihm bergab.
Die Schulkinder hatten Angst vor seinen bissigen Bemerkungen und noch mehr vor seinen Zornesausbrüchen, die immer häufiger wurden. Die Schulleitung sprach bereits von einem neuen Lehrer, wenn das Schuljahr zu Ende sein würde.
Mr. Carpenters Krankheit begann wie üblich mit einem Rheumaanfall. Dann kamen Herzbeschwerden dazu. Dr. Burnley, der ihn aufsuchte, obwohl er sich hartnäckig dagegen wehrte, einen Arzt kommen zu lassen, machte ein ernstes Gesicht und sprach von mangelndem Lebenswillen. Tante Louisa Drummond aus Derry Pond kam, um ihn zu pflegen. Mr. Carpenter fügte sich mit einer Resignation, die nur ein schlechtes Omen sein konnte, als ob nichts mehr wichtig sei.
„Macht, was ihr wollt. Soll sie herumwerkeln, wenn es euer Gewissen erleichtert. Mir ist es egal, was sie treibt, Hauptsache, sie läßt mich in Ruhe. Sie soll nur ja nicht auf die Idee kommen und mich füttern oder verhätscheln oder neue Laken aufziehen. Ihr Haar gefällt mir überhaupt nicht. Viel zu glatt und ölig. Sagt ihr, sie soll was dagegen tun. Und wieso sieht ihre Nase so aus, als hätte sie ständig Schnupfen?“
Emily lief jeden Abend hinüber und setzte sich eine Weile zu ihm. Sie war der einzige Mensch, den der alte Mann überhaupt noch sehen wollte. Er sprach nicht viel, aber alle paar Minuten öffnete er die Augen und warf ihr ein verschmitztes, verständnisvolles Lächeln zu, als ob sie zusammen über einen guten Witz lachen mußten, den außer ihnen niemand verstand. Tante Louisa wußte nicht, was sie von diesem Gegrinse halten sollte, und ärgerte sich darüber. Sie war zwar eine gutmütige, mütterliche Person, aber dieses kumpelhafte Schmunzeln ihres Patienten auf dem Sterbebett machte sie doch ziemlich ratlos. Sie fand, er solle sich lieber darüber Gedanken machen, was nach seinem Tod mit seiner Seele passieren würde. Schließlich ging er nicht zur Kirche, oder? Er ließ ja noch nicht einmal den Pfarrer herein. Dafür freute er sich jedesmal, wenn Emily Starr kam.
Tante Louisa allerdings traute dieser Emily Starr nicht so recht über den Weg. War es nicht so, daß sie schrieb? Und hatte sie nicht die Kusine ihrer Mutter zweiten Grades bis ins Detail in eine ihrer Geschichten hineingenommen? Wahrscheinlich nahm sie sich jetzt diesen Heiden auf seinem Sterbebett vor. Das würde doch auch ihr übergroßes Interesse an ihm erklären. Tante Louisa musterte dieses teuflische junge Ding eingehend. Hoffentlich kam Emily nicht auf die Idee, auch sie noch in eine Geschichte hineinzustecken.
Daß es Mr. Carpenters Sterbebett war, davon wollte Emily zunächst nichts wissen. So krank konnte er doch nicht sein! Er hatte keine Schmerzen, er klagte nicht. Sobald es draußen wärmer wurde, würde es ihm wieder bessergehen. Immer und immer wieder redete sie sich das ein, um nur ja daran zu glauben. Sie wollte sich einfach ein Leben in Blair Water ohne Mr. Carpenter nicht vorstellen.
Eines Abends im Mai schien es Mr. Carpenter tatsächlich besserzugehen. Seine Augen glühten so feurig, und seine Stimme dröhnte so laut wie früher. Er neckte die arme Tante Louisa, die zwar seine Späße nicht verstand, aber sie geduldig ertrug. Kranke mußte man schließlich bei Laune halten. Er erzählte Emily eine lustige Geschichte, und sie kamen aus dem Lachen gar nicht mehr heraus. Tante Louisa schüttelte nur den Kopf. Die arme Frau, es gab sicher Dinge, die sie nicht wußte. Aber etwas wußte sie aus ihrer Erfahrung als bescheidene Krankenpflegerin: Dieses plötzliche Wiederaufleben bedeutete nichts Gutes. Emily dagegen wußte das nicht. Glücklich darüber, daß sich Mr. Carpenters Zustand so gebessert hatte, ging sie nach Hause. Bald würde er wieder gesund sein und in die Schule zurückkehren, seine Schüler wieder anbrüllen, geistesabwesend und in einem alten Schmöker lesend die Straße entlangwandern und sich mit seinem scharfzüngigen Humor über ihre Manuskripte auslassen. Emily fiel ein Stein vom Herzen. So einen Freund wie Mr. Carpenter durfte sie einfach nicht verlieren!
Um zwei Uhr nachts wurde Emily von Tante Elizabeth geweckt. Mr. Carpenter wollte sie sehen und hatte nach ihr geschickt.
„Geht es ihm wieder schlechter?“ fragte Emily, während sie aus dem Bett schlüpfte.
„Er stirbt“, sagte Tante Elizabeth knapp. „Dr. Burnley sagt, er wird wohl den Morgen nicht mehr erleben.“
Emily machte ein so bestürztes Gesicht, das Tante Elizabeth rührte.
„Ist es nicht besser so für ihn, Emily?“ sagte sie mit ungewohnt sanfter Stimme. „Er ist alt und müde. Seine Frau ist gestorben, und unterrichten soll er auch nicht länger. Er würde dann doch nur einsam sein. Der Tod ist sein bester Freund.“
„Und ich?“ fragte Emily und schluckte.
Sie machte sich im Dunkeln auf den Weg zu Mr. Carpenters Haus. Tante Louisa weinte, aber Emily konnte nicht weinen. Mr. Carpenter öffnete die Augen und lächelte sie an, mit seinem vertrauten verschmitzten Lächeln.
„Keine Tränen“, murmelte er. „Ich dulde keine Tränen an meinem Sterbebett. Sag dieser Louisa Drummond, sie soll sich in die Küche verziehen zum Weinen. Ich weiß nicht, was sie hier eigentlich noch will. Es gibt nichts, was sie noch für mich tun könnte.“
„Kann ich denn noch etwas tun?“ fragte Emily.
„Bleib einfach hier sitzen, damit ich dich bis zum Schluß sehen kann. Niemand geht gern allein. Der Gedanke, allein zu sterben, war mir immer schon zuwider. Wie viele Weiber sitzen denn da draußen in der Küche und warten, bis ich tot bin?“
„Nur Tante Louisa und Tante Elizabeth“, sagte Emily und konnte ein Schmunzeln nicht unterdrücken.
„Ich kann nicht viel reden. Ich hab’ mein ganzes Leben lang geredet. Ich kann nicht mehr. Hab’ keine Puste mehr. Aber was ich noch sagen wollte – schön, daß du da bist.“
Mr. Carpenter schloß die Augen und sagte nichts mehr. Emily saß ganz still da. Ihr Kopf hob sich schattenartig vom schwachen Dämmerlicht ab, das durchs Fenster hereindrang. Der Wind spielte mit ihrem Haar. Der Duft der Lilien vor dem Haus strömte durchs offene Fenster herein, ein geheimnisvoller Duft, süßer als Musik, wie all die Wohlgerüche vergangener, unbeschreiblich schöner Jahre zusammen. In der Ferne zeichneten sich zwei schlanke dunkle Tannen, die genau gleich groß waren, gegen den silbrigen Nebel der Morgendämmerung ab. Genau zwischen ihnen schimmerte schwach die Sichel des Mondes. Ihr Anblick tröstete Emily und schenkte ihr neue Kraft nach der Anspannung dieser ungewohnten Nachtwache. Was immer auch geschah, etwas so Schönes wie dies würde nie vergehen.
Ab und zu kam Tante Louisa herein, um nach dem alten Mann zu sehen. Mr. Carpenter schien sie gar nicht zu bemerken, doch jedesmal, wenn sie wieder draußen war, öffnete er die Augen und zwinkerte Emily zu.
Emily zwinkerte zurück, fast zu ihrem eigenen Entsetzen. Denn wenn man eine echte Murray war wie sie, dann gehörte es sich einfach nicht, sich auf dem Sterbebett zuzuzwinkern. Nicht auszudenken, was Tante Elizabeth dazu sagen würde!
„Netter kleiner Zeitvertreib“, murmelte er. „Bin froh, daß du da bist.“
Um drei Uhr wurde er plötzlich unruhig. Tante Louisa kam herein.
„Bevor die Flut nicht zurückgegangen ist, kann er nicht sterben, mußt du wissen“, flüsterte sie Emily zu.
„Verzieh dich! Du mit deinem abergläubischen Geschwätz“, rief Mr. Carpenter scharf. „Ich sterbe dann, wenn es soweit ist, das hat mit der Flut überhaupt nichts zu tun.“
Tante Louisa war entsetzt. Sie entschuldigte sich bei Emily für sein vermeintliches Gefasel und schlüpfte hinaus.