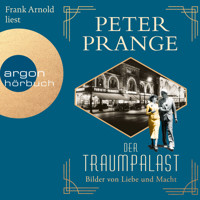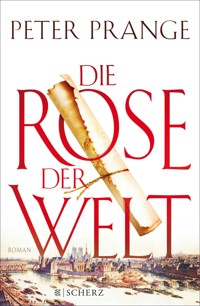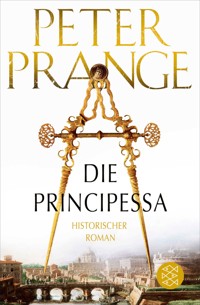4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wir alle streben nach Glück, nach Liebe, nach Karriere. Aber wie sehr wir auch streben: Das Glück ist nicht von Dauer, die Liebe erkaltet, die Karriereleiter bricht. Fragt sich nur: Muss das so sein? Viele Wege führen zum Misserfolg – doch zum Glück gibt es ein paar Ausnahmen von der Regel. Peter Prange zeigt sie auf. Ein ungewöhnlich kluges, erstaunlich witziges Buch über den ganz persönlichen Erfolg: Wie er sich zuverlässig verhindern lässt, und wie man ihn trotzdem erreicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Peter Prange
Anstelle eines Erfolgsratgebers
Sieben Wege zum Misserfolg – und eine Ausnahme von der Regel
Ratgeber
Für Coco
»Kunst ist, wenn mans nicht kann, denn wenn mans kann, ists keine Kunst.« Johann Nestroy
Versuch und Irrtum – und noch ein Versuch
Anstelle eines Vorworts
In der Regel sind die Autoren von Ratgebern unendlich viel klüger als ihre Leser. Nicht so bei diesem Buch. Sein Autor gibt hier und heute in aller Öffentlichkeit zu: Dümmer als er hätte sich kaum jemand anstellen können.
Zum Beweis ein paar Worte zur Vorgeschichte. Dieses Buch ist im Jahr 2000 schon einmal erschienen, und zwar unter dem Titel Sieben Wege zum Misserfolg – und eine Ausnahme von der Regel. Um es gleich vorweg zu sagen: Damit hatte ich mich mit traumwandlerischer Sicherheit für einen der besagten sieben Wege entschieden.
Was hatte ich für wunderbare Erwartungen bei der Lancierung dieses kleinen Ratgebers! Das wird ein Hit, Bestsellerautoren wie Dale Carnegie & Co. werden sich die Augen reiben! Besonders stolz war ich auf den Titel – obwohl mein Verleger da so seine Zweifel hatte. Doch ich ließ mich nicht beirren. Wie wunderbar, hielt ich seinen kleinmütigen Einwänden entgegen, würde mein Titel sich von all den ebenso reißerischen wie unhaltbaren Parolen der Konkurrenten unterscheiden, die mit dem Versprechen »Tue A, B und C, und du wirst reich, berühmt und glücklich« für sich warben. Die Leser würden glücklich sein und meine Originalität mit millionenfachen Käufen belohnen.
Und dann war der große Tag da – das Buch erschien. Ich hatte eigentlich gedacht, dass an diesem Morgen in Deutschland die Glocken läuten, die Rathäuser ihre Flaggen hissen würden. Doch nichts dergleichen geschah. Im Gegenteil. Der Verkauf blieb deutlich hinter den Erwartungen zurück. Kaum ein Mensch schien sich für mein Buch zu interessieren. Gerade mal zehntausend Exemplare wurden verkauft, in drei verschiedenen Ausgaben.
Heute kann ich durchaus verstehen, was damals geschah – beziehungsweise nicht geschah. Es war genau das passiert, was mein Verleger befürchtet hatte. Mein grandioser Titel hatte sich als sicheres Bollwerk gegen mögliche Leser erwiesen. Kein Wunder: Wer will sich schon darin belehren lassen, wie er zum Misserfolg gelangt? Und dafür auch noch Geld bezahlen? Nein danke!
Umso erstaunlicher allerdings waren die Reaktionen der Menschen, die trotzdem zu dem Buch gegriffen hatten. Selten habe ich von einem so kleinen Publikum eine so große Resonanz erfahren. Diese Leser haben sich offenbar auf den Untertitel der damaligen Ausgabe konzentriert und wollten mehr wissen über die »eine Ausnahme von der Regel«. In diesem Untertitel hatte ich unter Aufbietung meiner ganzen Tarn- und Täuschungskunst das eigentliche Versprechen des Buches versteckt. Wie man nämlich gegen alle äußeren und inneren Widerstände möglicherweise doch zu der Art von Erfolg gelangt, um die es mir beim Schreiben des Buches ging: ins Reine mit sich selbst zu gelangen, um die Dinge im Leben zu tun, auf die es einem selber wirklich und entscheidend ankommt.
Bei denen, die das Rätsel des Titels lösten und das Buch lasen, hat es eine erstaunliche Wirkung gezeigt. Drei von vielen Beispielen: Da hat ein Mann mir ganz aufgeregt berichtet, dass die Lektüre meines Ratgebers zur Scheidung seiner Ehe geführt habe – »Aber dafür wollte ich mich doch nur bedanken!« erwiderte er auf meine bestürzte Reaktion. Eine junge Frau, die an sich selbst verzagt war, konnte angesichts der Dämlichkeiten, die der Autor aus seinem eigenen Leben berichtet (und davon gab und gibt es in dem Buch jede Menge) endlich wieder einmal lachen. Und eine Psychologin (ausgerechnet!) schrieb mir sogar, dass mein Ratgeber ihr den Mut und letzten Anstoß gegeben habe, eine eigene Praxis zu eröffnen.
Am größten aber war vielleicht die Wirkung, die dieses Buch in meinem eigenen Leben ausgelöst hat. Schon beim Schreiben wurde mir, obwohl ich mich nach Kräften dagegen sträubte, eines zunehmend klar: Ich predigte Wein – und trank selber Wasser. Soll heißen: Ich forderte meine Leser auf, ihre Träume zu wagen, weil das Leben einfach zu kurz und zu schade sei, um es immer nur mit sauren Pflichten zu verbringen, doch ich selber hatte nicht die Courage, nach meinen eigenen Maximen zu leben.
Dabei hatte ich ja einen Traum, der schon lange in mir schwelte. Ich wollte einen Roman schreiben, der die Geschichte des geteilten und wiedervereinigten Deutschlands am Beispiel einer Familie erzählte. Seit dem Mauerfall hatte ich diese Idee, immer wieder meldete sie sich bei mir zu Wort und wollte geschrieben sein, doch ich versuchte, sie zu ignorieren und zu verdrängen. Wahrscheinlich, weil ich damals als Unternehmensberater viel zu viel Geld auf viel zu einfache (und darum letztlich unbefriedigende) Weise verdiente. Doch als ich mit meinem Ratgeber fertig war, konnte ich mich meiner eigenen Weisheit nicht länger verschließen: Ich nahm eine Auszeit, mit allen Risiken, von meinem Geldberuf und schrieb den Roman.
Und siehe da: Der Roman Das Bernstein-Amulett kam nicht nur früher als die Sieben Wege zum Misserfolg heraus – er war auch das weitaus erfolgreichere Buch. Inzwischen ist er in einem Dutzend Ausgaben erschienen, mit einer internationalen Auflage von über einer Million Exemplaren, und wurde sogar für die ARD als Zweiteiler verfilmt. Mit dem Ergebnis, dass ich meinen alten Beruf an den Nagel hängen konnte, um mich fortan ganz der Schriftstellerei zu widmen, dem Beruf also, von dem ich seit meiner Kindheit schon träumte.
Wie auch immer man die Resultate im Einzelnen bewerten mag, eines zeigen die Beispiele immerhin: Die Sieben Wege zum Misserfolg haben am Ende doch noch Wirkung gezeigt – und offensichtlich hatte nicht nur ich davon profitiert. Aber wenn selbst mir, dem hoffnungslosesten aller Fälle, es mit dieser Therapie gelang, meine sehnlichsten Träume zu verwirklichen, warum dann nicht auch anderen – zum Beispiel Ihnen, lieber Leser? Als mein neunmalkluger Verleger vorschlug, dem Buch eine zweite Chance zu geben und es unter anderem Titel neu herauszubringen, habe ich daher gerne zugestimmt. In der Hoffnung, dass es den neuen Leserinnen und Lesern vielleicht ähnlich auf die Sprünge hilft wie mir selbst vor Jahren als Autor.
Bei der Lektüre wünsche ich Ihnen viel Spaß. Und vor allem viel Erfolg beim Selber-Leben!
Tübingen, im Mai 2012
Peter Prange
Kapitel 1:Wo, bitte, gehts zum Erfolg?
Irgendetwas kann da nicht stimmen. Eigentlich müsste die Welt von erfolgreichen Menschen nur so wimmeln. Denn seit es Erfolg gibt, gibt es auch Ratgeber, wie man zum Erfolg gelangt. Hundertprozentig, todsicher.
Doch schon der Griff an die eigene Nase beweist, dass die Sache nicht so ohne weiteres klappt. Trotz aller Vorbilder und Patentrezepte ist Erfolg eher die Ausnahme als die Regel. Wo also liegt der Haken?
Franklin, das Vorbild
Als ich fünfzehn Jahre alt war, schien alles noch ganz einfach. Ich wollte bloß ein erfolgreicher Mensch werden. Mehr Wünsche hatte ich nicht. Die Frage war nur, wie. Zum Glück hatte ich einen sehr engagierten Englischlehrer, den ich um Rat fragen konnte. Der drückte mir ein altes Buch in die Hand: die Lebenserinnerungen Benjamin Franklins, von 1791. Mit glühenden Wangen las ich die Geschichte dieses erstaunlichen Mannes. Wie er vom Sohn eines armen Seifensieders zum Erfinder, Unternehmer und Staatsmann aufstieg. Wie er den Blitzableiter erfand, Zeitschriften und Verlage gründete, Bücher zu den verschiedensten Themen verfasste, die erste moderne Leihbücherei einrichtete und am Ende seines Lebens sogar an der Gründung der Vereinigten Staaten mitwirkte: der erste amerikanische Selfmademan, der Prototyp des Erfolgsmenschen schlechthin, dessen Konterfei noch heute auf jeder Hundertdollarnote prangt!
Das Buch war eine Schatzgrube. Denn Franklin beschrieb darin nicht nur seine einmalige Karriere, sondern verriet auch die Erfolgsformel, der er seinen Aufstieg verdankte: »Early to bed and early arise, makes a man healthy, wealthy and wise!« (Früh zu Bett und früh ans Werk, so erwirbst du Gesundheit, Weisheit und Geld.) Jeden Morgen stand er um Punkt fünf Uhr auf, wusch sich und frühstückte, plante den Ablauf des kommenden Tages, las und studierte bis acht, arbeitete sodann bis zwölf, aß zu Mittag und prüfte die Bücher, arbeitete wiederum von zwei bis um sechs, aß dann zu Abend, musizierte anschließend oder zerstreute sich im Gespräch, um den Tag stets mit der Frage zu beschließen, welche positive Tat er seit dem Aufstehen vollbracht hatte, bevor er um zehn – erschöpft, aber glücklich – in die Kissen sank.
Auf diese Weise verbrachte Franklin sein Leben – tagaus, tagein. Um sich selbst systematisch zu kontrollieren, legte er eine Tafel an, in der er waagrecht die Wochentage und senkrecht all jene Tugenden verzeichnete, die seiner Auffassung nach jeden Menschen zum Erfolg führen müssen: dreizehn an der Zahl.
Fasziniert betrachtete ich die Seite, wohl über eine Stunde lang. Was ich mit eigenen Augen sah, war die Gesetzestafel des Erfolgs. Diese Tugenden hatten Franklin reich und berühmt gemacht. Warum nicht auch mich?
Leben nach Plan
Über Nacht verwandelte ich mich in einen anderen Menschen. Ich malte Franklins Tugendtafel ab, um künftig über mein Leben Buch zu führen, fest entschlossen, jeden Verstoß gegen eine der vorgezeichneten Tugenden mit einem dicken schwarzen Fleck unter dem entsprechenden Tag zu ahnden. Doch Wunder über Wunder: Meine Tafel blieb makellos rein. Mit dem ersten Klingelzeichen betrat ich morgens die Schule, ich war ein Muster an Ordnung, reinigte fünfmal am Tag meine Fingernägel, sprach nur, wenn ich gefragt wurde, und dann ausschließlich die reine Wahrheit, entwickelte einen fanatischen Gerechtigkeitssinn und war ansonsten die Demut in Person. Selbst in puncto Keuschheit hatte ich mir nichts vorzuwerfen, ganz in Franklins Sinn: »Übe geschlechtlichen Umgang selten, nur um der Gesundheit oder Nachkommenschaft willen und niemals bis zur Stumpfheit oder Schwäche.« Geschlagene sechs Monate hielt ich durch. Das Resultat war vernichtend. Von dem erhofften Erfolg keine Spur! Meine Mitschüler rückten zusehends von mir ab, der Trainer der Fußballmannschaft vergaß mich plötzlich bei der Mannschaftsaufstellung und in der Tanzschule bekam ich eine Partnerin verpasst, die ein Meter neunzig groß war – ich war damals ein Meter fünfundsechzig.
Am Abend des Abschlussballs erklärte ich mein Franklin-Projekt für gescheitert.
Irrungen und Wirrungen
Neuen Mut fasste ich, als mein Deutschlehrer, ein langhaariger Referendar und Intimfeind meines Englischlehrers, voller Begeisterung von einem Essay des berühmten Arztes und Dichters Gottfried Benn erzählte. Genie und Wahnsinn war der viel versprechende Titel dieses alternativen Leitfadens. Noch am selben Tag besorgte ich ihn mir in der Schülerbücherei. Mir gingen die Augen über. Folgendes hatte Benn über das Wesen des Erfolgs herausgefunden: »Das Produktive, wo immer man es berührt, eine Masse, durchsetzt von Stigmatisierungen, Rausch, Halbschlaf, Paroxysmen; ein Hin und Her von Triebvarianten, Anomalien, Fetischismen …« Das also war die Wahrheit! Franklin war ein Irrtum, ein papierener Lesebuchheld. Die wirklichen Genies pfiffen auf seine Tugenden; stattdessen machten sie den Tag zur Nacht, fraßen, soffen und hurten. Das waren Vorbilder, denen nachzueifern lohnte! Ein weiterer radikaler Persönlichkeitswechsel erschien mir unausweichlich. Ich ließ mir die Haare bis auf die Schultern wachsen, stellte jede Form von Schularbeit ein, knutschte wildfremde Mädchen auf offener Straße ab und ernährte mich vorwiegend von Haschisch und Marihuana.
Die positiven Ergebnisse meiner Neuorientierung ließen nicht lange auf sich warten. Meine Mitschüler wählten mich zum Klassensprecher, Tante Lieselotte hörte auf, mich bei der Begrüßung zu küssen, und im benachbarten Mädchengymnasium hatte ich einen Ruf wie Donnerhall.
Doch es gab auch Schattenseiten: Beim Fußball reichte meine Kondition für maximal fünf Minuten, sodass der Trainer mich aus der Mannschaft warf; und am Ende des Schuljahres war ich nicht nur sitzengeblieben, sondern erhielt für meine genialen Bemühungen auch noch die Androhung eines Verweises.
Erste Erkenntnis
Ratlos stand ich da. Ob ich es so oder anders anfing, ob mit Franklin oder mit Benn: Das Ergebnis war in beiden Fällen deprimierend, mein Erfolg ferner denn je.
Ein Licht ging mir auf, als ich meine Mentoren während eines Klassenausflugs gemeinsam zur Rede stellte. Voller Empörung warf ich ihnen vor, dass sie mit ihren Ratschlägen mein Leben ruinierten. Mit noch größerer Empörung wiesen die zwei meine Vorwürfe zurück.
»Warst du etwa kein erfolgreicher Schüler, solange du dich an Franklins Tugenden gehalten hast?«, fragte mein Englischlehrer. »Ja, aber bei meinen Freunden war ich der letzte A…« Bevor ich ausreden konnte, fiel auch schon mein Deutschlehrer über mich her: »Und wem, glaubst du, hast du deinen Erfolg bei den Mädchen zu verdanken?«
»Na gut, aber dafür bin ich jetzt in der Schule unter aller S.«
»Ja, was willst du denn eigentlich?«, fragten mich plötzlich beide wie aus einem Munde.
Die Frage traf mich wie ein Eimer kaltes Wasser. Und während ich vergeblich nach Worten suchte, waren meine beiden Lehrer ein einziges Mal in ihrem Leben einer Meinung: »Du weißt ja gar nicht, was du willst!«
Damit trafen sie den Nagel auf den Kopf. Doch der Schock war ein heilsamer. Denn in diesem Augenblick begriff ich, warum ich bislang in die Irre gegangen war. Weil mir die einfachste und wichtigste Voraussetzung für jeden Erfolg fehlte: die klare Vorstellung, was Erfolg für mich persönlich bedeutete.
Mein Vater und Mr. Vanderbilt
Der Erfolg hat ein Janusgesicht. Einerseits ist er immer wieder derselbe, andererseits ist er immer wieder verschieden: Alle Menschen wollen Erfolg, doch für jeden Menschen bedeutet Erfolg etwas anderes. Weshalb Erfolg im wahrsten Sinn des Wortes Ansichtssache ist.
Das Schicksal zweier mehr oder weniger erfolgreicher Männer veranschaulicht diesen Sachverhalt. Der eine davon hieß Ernst Prange (kein Wunder, er wurde später mein Vater) und lag im Winter 1944 eine endlos lange Nacht unter Trommelfeuer in einem Schützengraben, irgendwo in Rumänien. Und während ihm die Granaten um die Ohren pfiffen, schickte er ein Stoßgebet zum Himmel: »Lieber Gott, wenn ich je aus dieser Scheiße heil herauskomme, lass mich bitte ein verdammter Spießer werden.«
Der liebe Gott meinte es gut mit ihm. Zwar stellte er das Trommelfeuer erst am nächsten Morgen ein, doch ließ er meinen Vater am Leben. Und warf ihm auch keine größeren Steine in den Weg, als er sich nach dem Krieg daranmachte, seine Wunschvorstellung in die Tat umzusetzen: Mein Vater übernahm das elterliche Bettengeschäft, heiratete eine Frau, zeugte zwei Kinder – meine Schwester und mich – und ging in seiner Freizeit reiten. Und da er allen privaten und beruflichen Verlockungen nach mehr Abenteuer und Größe mannhaft widerstand, führte er ziemlich genau das Leben, nach dem er sich im Schützengraben gesehnt hatte.
Ganz anders die Geschichte des Reeders und Eisenbahnpioniers Cornelius Vanderbilt. So berühmt sein Name heute ist, so ehrgeizig waren vor hundertfünfzig Jahren seine Pläne. Fünfhundert Millionen Dollar, dies sein erklärtes Lebensziel, wollte er bis zu seinem Tod angehäuft haben. Doch als es ans Sterben ging, verzeichneten seine diversen Konten »nur« siebzig Millionen.
»Ich sage Ihnen im Ernst«, schrieb ihm darum der große Romancier Mark Twain, »dass ich wohl nicht vierundzwanzig Stunden mit dem entsetzlichen Gedanken leben könnte, dass mir vierhundertdreißig Millionen Dollar fehlen.« Wer also war unter dem Strich erfolgreicher – der berühmte Mr. Vanderbilt oder mein unbekannter Vater? Ich würde sagen: mein Vater. Er hat in seinem Leben geschafft, was er wollte; Mr. Vanderbilt nicht.
Das Geheimnis des Erfolgs
Wenn zwei das Gleiche suchen, ist es noch lange nicht dasselbe. Doch die Tatsache, dass alle Menschen dem Erfolg von Natur aus nachrennen, verleitet uns allzu oft zu der Annahme, dass wir alle die gleichen Ziele verfolgen. In Wirklichkeit aber legt jeder selbst die Messlatte auf, der eine bewusst, der andere unbewusst. Das weiß schon der platteste Volksmund: »Dem einen sin Uhl, dem andern sin Nachtigall!«
Erfolg kennt keine allgemein gültigen Regeln und schon gar keine Patentrezepte. Auch wenn Mr. Vanderbilt zu seiner Zeit der reichste Mann der Welt war: Da er sein Ziel verfehlt hat, blieb ihm der wirkliche Erfolg versagt. Denn Erfolg pfeift auf verbindliche Standardwerte und Normvorstellungen. Erfolg ist weder Geld noch Sex, weder Ruhm noch Macht – ja nicht einmal das dickste Auto in der Nachbarschaft. Alles das kann Erfolg natürlich sein, muss es aber nicht. Erfolg ist etwas viel Einfacheres und eben deshalb etwas viel Anspruchsvolleres: Erfolg ist, wenn ich erreiche, was ich mir vorgenommen habe. Weshalb sich das Geheimnis des Erfolgs in einem simplen Satz zusammenfassen lässt: Tausend Wege führen nach Rom, doch nur ein Weg führt zum Erfolg – der eigene!
»Hand aufs Herz!« – Übung 1
»Der Erfolg«, hat der Schweizer Autor Max Frisch einmal gesagt, »verändert den Menschen nicht. Er entlarvt ihn.« Warum das so ist? Ganz einfach: Erfolg habe ich dann, wenn ich erreiche, was ich mit Leib und Seele begehre. Darum Hand aufs Herz: Was bedeutet Erfolg für Sie? Ganz subjektiv, nach Ihrem persönlichen Empfinden? Bitte nehmen Sie ein Blatt Papier und notieren Sie darauf die zehn wichtigsten Begriffe, die Ihrer Meinung nach wirklichen Erfolg ausmachen.
Kapitel 2:Darf ich wollen, was ich will?
In einem Sketch von Karl Valentin besucht ein Ehepaar das Münchner Oktoberfest. Im Biergarten erzählt die Frau einem Tischnachbarn vom Hippodrom, voller Empörung über die leicht geschürzten Reiterinnen, die sie dort erblicken musste: »De Weibsbilder sitzen ja halbert nackert auf de Gäul droben, i bin ganz rot wordn, mein Mann hat auch nicht hinschaun mögn.«
Worauf dieser präzisiert: »Mögen hätt’ ich schon wollen, aber dürfen hab’ ich mich nicht getraut.«
Der Kampf um das Schnitzel
Bei jedem Scherz ist etwas Ernst. Die ernste Frage hinter dem Valentin-Sketch lautet: Darf ich wollen, was ich will? An dieser Frage scheiden sich die Geister – und die Erfolgreichen von den Erfolglosen. Denn sie geht noch tiefer als die Frage nach der individuellen Vorstellung vom Erfolg, den äußeren Gütern, an denen ich meinen persönlichen Erfolg messe. Sie betrifft vielmehr meine innere Einstellung, mit der ich dem Erfolg begegne. Bin ich überhaupt zum Erfolg bereit? Glaube ich überhaupt, Anforderungen an mein Leben stellen zu dürfen? Solche und ähnliche Fragen auch nur zu äußern, geschweigedenn zu bejahen, ist in den Augen vieler Menschen eine schamlose Anmaßung. Zum Beispiel in den Augen meiner Verwandten. Denn in unserer Familie kommt es nicht darauf an, was man selbst will, sondern darauf, was der jeweils andere gerne möchte.
Ich erinnere mich noch genau: Wenn bei uns das Mittagessen verteilt wurde, entspann sich stets ein merkwürdiges Ritual. Wie beim Potlatsch der Maori, bei dem die Häuptlinge sich gegenseitig mit Geschenken so lange überschütten, bis einer (der Verlierer) nichts mehr zu verschenken hat, drängte bei uns einer dem andern eben jene Leckerbissen auf, die er selbst mit Heißhunger begehrte.
Im geschlossenen System der Familie funktionierte diese Geheimsprache wunderbar. Ohne dass die Regeln je erklärt wurden, verstand jeder am Tisch genau, was ein vermeintliches Angebot in Wirklichkeit bedeutete. Die Botschaft: »Nimm doch dieses herrliche Bratenstück, das lacht dich doch an!«, hieß im Klartext: »Lass ja die Finger davon oder ich bin stocksauer!«
Schwierigkeiten gab es allerdings, wenn eine fremde Person zu Gast war. Das bekam meine heutige Frau bei ihrem ersten Besuch an unserer Tafel zu spüren. Auf der Fleischplatte waren noch zwei Schnitzel, ein kleines und ein großes. Welches sie denn gerne hätte, fragte meine Schwester, um ihre potentielle Schwägerin auf die Probe zu stellen. Unbekümmert zeigte meine Zukünftige auf das große. Meine Schwester gab ihr das Schnitzel, doch mit deutlichen Anzeichen von Verärgerung. Meine Zukünftige spürte, dass sie irgendetwas falsch gemacht hatte – wenn sie nur gewusst hätte, was! »Welches Schnitzel«, fragte sie darum meine Schwester, »hättest du denn an meiner Stelle genommen?«
»Natürlich das kleine«, antwortete meine Schwester wahrheitsgemäß.
»Aber dann«, schloss meine Zukünftige voller Verwunderung, »hast du doch genau das bekommen, was du willst!«
Der klammheimliche Wunsch
Ich glaube nicht, dass meine Familie zivilisierter oder höflicher war als die Familie meiner Frau. Vielmehr glaube ich, dass wir in unserer Familie ein gehöriges Problem hatten: nämlich klipp und klar zu sagen, was wir gerne hätten. Statt seinen Willen zu artikulieren, hoffte jeder von uns darauf, dass der jeweils andere ihn zu seinem Glück nötigte. Dieser klammheimliche Wunsch steuerte unser Verhalten, in großen und in kleinen Dingen – doch nicht unbedingt zu unserem Besten. Abgesehen davon, dass unsere Familienstrategie außerhalb des Familienkreises nur selten zum gewünschten Ergebnis führte – welche Bank zum Beispiel nötigt ihren Kunden von sich aus einen zinsfreien Kredit auf? –, sorgte sie auch familienintern oft genug für Konfusion und Chaos.
Wenn jeder stets für den anderen denkt, keiner aber für sich selbst, weiß schließlich niemand mehr, wo ihm der Kopf steht. Wenn dann auch noch – was bei uns natürlich andauernd geschah – ein kontroverses Thema seitens des Familienvorstands mit der Formel »Dann tut doch, was ihr wollt« beendet wurde, war die Ratlosigkeit perfekt. Weil eben dazu niemand von uns imstande war.
Fahrt ins Blaue
Erfolg ist, wenn man erreicht, was man will. Doch wie kann man etwas erreichen, wenn man sich nicht klarmacht, was man will? Kein vernünftiger Mensch würde sich, außer vielleicht am Sonntagnachmittag, ins Auto setzen und einfach drauflosfahren, ohne vorher zu klären, wohin die Reise geht. Weil jedermann weiß, dass er sich dann früher oder später hoffnungslos verfahren würde.
Im Leben aber tun wir oft nichts anderes. Wir fahren los, ohne ein Ziel, geben plötzlich wie verrückt Gas, weil wir denken, wir kommen nicht an, geraten in Sackgassen, die wir für Abkürzungen halten, und wundern uns dann, wenn wir am Ende irgendwo ohne Sprit liegen bleiben – meistens noch dazu an einem Ort, wohin wir niemals »freiwillig« gefahren wären, hätte man uns vorher nur gefragt.
Große Preisfrage: Warum stellen wir uns so dämlich an?
»Hand aufs Herz!« – Übung 2
»Kinder, die was wollen«, so eine Redensart, »kriegen was auf die Bollen!« Was meinen Sie? Dürfen Sie wollen, was Sie wollen?
Bitte notieren Sie auf einem Blatt Papier nebeneinander jeweils zehn Argumente dafür und dagegen. Linke Seite: Warum Sie nicht wollen dürfen, was Sie wollen. Rechte Seite: Warum Sie wollen dürfen, was Sie wollen. Vergleichen Sie anschließend Ihre Argumente und entscheiden Sie selbst: Dürfen Sie wollen, was Sie wollen? Wenn ja – herzlichen Glückwunsch! Wenn nein – stellen Sie sich bitte den nettesten und sympathischsten Menschen vor, den Sie kennen. Und fragen Sie sich: Darf dieser nette und sympathische Mensch wollen, was er will? Wenn die Antwort für diesen Menschen »Ja« lautet, warum dann nicht auch für Sie?
Kapitel 3:Des Menschen Wille oder sein kompliziertes Himmelreich
In meiner Heimatstadt gab es einen Briefträger namens Rudi Lebsanft, der als großer Philosoph galt. Die unscheinbarsten Dinge am Wegesrand konnten ihn zu den tiefsinnigsten Betrachtungen herausfordern. Zum Beispiel ein Ameisenhaufen. »Die Viecher haben es gut«, sagte er einmal beim Anblick der wuselnden Insekten. »Sobald sie aus dem Ei geschlüpft sind, wissen sie, was sie zu tun haben.« Was daran so beneidenswert sei, fragte ich ihn. »Dass sie sich nie entscheiden müssen«, erwiderte er und holte einen Flachmann aus seiner Tasche. »Weil, Entscheiden ist das Schwierigste überhaupt. Wenn ein Mensch immer entscheiden muss, was er tun soll, immer und überall – ich glaube, er bringt sich um oder er wird zum Säufer.« Sprach es und nahm einen Schluck aus der Flasche.
Verfluchte Freiheit
Der Briefträger-Philosoph aus meinem Geburtsort stand mit seiner Ansicht nicht allein. Sein französischer Kollege Jean-Paul Sartre kam zu ganz ähnlichen Erkenntnissen – nur dass der sie nicht im Vorübergehen produzierte, sondern auf vielen tausend Seiten. »Der Mensch ist zur Freiheit verdammt.« Diese These hat Sartre unsterblich gemacht. Ob auch glücklich, sei dahingestellt.
Warum ist der Mensch zur Freiheit verdammt? Weil er – im Unterschied zu Ameisen – nicht durch Instinkte gebunden ist, die sein Handeln nach einem vorgegebenen Muster leiten. Er entwickelt sich nach keinem Schema F, sondern ist das, wozu er sich entscheidet. Denn was immer er tut – er kann und muss sich entscheiden. Alles ist seine Wahl, ob er will oder nicht. Selbst wenn er sich entscheidet, sich nicht zu entscheiden, ist diese Entscheidung doch seine Entscheidung. Diese Freiheit ist ja an sich etwas Herrliches – wenn es bloß nicht so schwer fiele, Gebrauch von ihr zu machen. Das war schon der Auslöser für den berühmtesten Seufzer der Weltliteratur: »Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust …«
Peter & Paul / I
Nennen wir die zwei Seelen, was meine Brust betrifft, der Einfachheit halber Peter und Paul. Kaum wache ich am Morgen auf, geraten die beiden aneinander. Manchmal glaube ich, sie streiten sogar, wenn ich schlafe. Denn sobald sich ein Wunsch in mir regt, melden sie sich zu Wort.
Peter flüstert mir zu: »Tus lieber nicht. Was bildest du dir ein? Du bist nicht auf der Welt, um glücklich zu sein. Denk an die Folgen! Tu nur, was die anderen von dir erwarten, dann bist du auf der sicheren Seite.«
Ganz anders Paul. »Na los«, flüstert er, »probiers mal aus. Warum nicht? Tu einfach, was du für richtig hältst! Bist du etwa kein erwachsener Mensch? Der Einzige, der dir Vorschriften machen kann, bist du selbst. Worauf wartest du? Das Leben ist zu kurz, um zu versauern.«
Wenn zwei sich streiten, leidet der Dritte. Und während Peter und Paul mich immer heftiger bestürmen, frage ich mich verzweifelt: Auf wen von beiden soll ich hören?
Das Oberammergau-Dilemma
Wer frei ist, hat die Qual der Wahl. Warum aber wird die Wahl zur Qual? Weil jede Entscheidung den Ausschluss von unzähligen Alternativen bedeutet: ein Ja zu einer Möglichkeit, ein Nein zu Abermillionen anderer Möglichkeiten. Wenn ich zum Beispiel in Oberammergau Urlaub mache, kann ich nicht gleichzeitig woanders Urlaub machen. Also will die Sache gut überlegt sein. Denn falls ich mich für Oberammergau entscheide, verzichte ich mit dieser Entscheidung automatisch auf Paris und auf London, auf Berlin und auf Tokio, auf Buxtehude und auf Pusemuckel.
Ist Oberammergau einen solchen Verzicht wirklich wert? Diese Frage macht mich natürlich verrückt. Vielleicht ist der Ort ja gar nicht so schön, wie mir die Verkäuferin im Reisebüro weismachen wollte, vielleicht öden die blöden Passionsspiele mich nur an. Vielleicht hat auch mein Vetter Klaus Recht, wenn er behauptet, Urlaub in Deutschland könne man sowieso vergessen. Außerdem wollte ich schon immer mal nach Wien, die Hofreitschule besichtigen. Und der Robinson Club auf Fuerteventura ist ja angeblich ein ganz heißer Tipp. Und irgendwann im Leben sollte man auch mal New York gesehen haben.
Die Konsequenz des Briefträgers
Das ist das Dilemma der Freiheit: Ich kann von ihr konkreten Gebrauch nur machen, indem ich sie einschränke, durch die Festlegung auf eine bestimmte Option. Und mit jeder Entscheidung, die ich treffe, riskiere ich, mich genau für das Falsche und gegen das Richtige zu entscheiden. Dabei macht mir nicht die Beschränktheit, sondern gerade die Vielfalt der Möglichkeiten das Leben schwer.
Davon kann Briefträger Lebsanft ein Lied singen. Um vom Alkohol loszukommen, suchte er einen Arzt auf. Der verschrieb ihm eine dreimonatige Kur auf dem Bauernhof. Dort sollte er Kartoffeln sortieren: die kleinen für die Schweine, die mittleren für die Saat, die großen für den Verkauf. Doch schon am Abend des ersten Tages griff er zur Flasche, mit seinen Nerven total am Ende. Der Grund für seinen Rückfall? – Natürlich die vielen Entscheidungen!
Das ist nun schon über zwanzig Jahre her. Seitdem ist Rudi Lebsanft fest entschlossen, sich umzubringen. Wenn er bloß wüsste, wie er sich das Leben nehmen soll: mit einer Pistole oder doch lieber mit einem Strick?