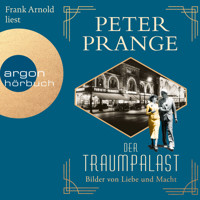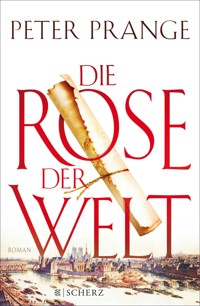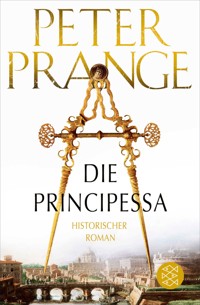9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Kind, das den Papstthron besteigt – der große historische Roman von Bestseller-Autor Peter Prange. Er ist noch ein Kind, gerade erst zwölf Jahre alt, aber er besteigt den mächtigsten Thron des Abendlandes. Im Jahr 1032 wird Benedikt IX. in Rom auf den Stuhl Petri erhoben. Er ist der jüngste Papst aller Zeiten. Aber er zahlt einen hohen Preis dafür. Denn er muss verzichten: auf die Liebe zu der Frau, der sein ganzes Leben gilt. In Rom regt sich bald Widerstand gegen seine strenge Herrschaft. So schwer die Bürde des Amtes auf ihm lastet, ist er doch bereit, alles zu tun, um sich auf dem Papstthron zu halten. Und er muss sich fragen, welche Hoffnung auf Erlösung ihm bleibt. »In der Tradition anspruchsvoller Unterhaltungsliteratur.« SWR 2
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 791
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Peter Prange
Der Kinderpapst
Historischer Roman
Über dieses Buch
Dies ist die Geschichte des wohl rätselhaftesten Papstes in zweitausend Jahren Kirchengeschichte. Sein Name: Benedikt IX. Sein Drama: Als Kind auf den Stuhl Petri erhoben, bleibt ihm die Liebe versagt, der sein ganzes Leben gilt. Die Bürde, Stellvertreter Christi zu sein, lastet schwer auf ihm. Dreimal wird er in Rom vom Papstthron verjagt. Um die Herrschaft wieder an sich zu reißen, ist er bereit, das Leben anderer rücksichtslos zu opfern. Doch so entsetzlich seine Taten scheinen, sind sie in Wahrheit ein einziger Ruf nach Gott, Ausdruck seiner verzweifelten Hoffnung, dass der Schöpfer aus dem Dunkel seines Schweigens trete. Dabei steht Gott dem Verzweifelten zeit seines Lebens vor Augen, in Gestalt der Liebe – in Gestalt jener Frau, nach der sein Herz sich von allem Anfang an verzehrt …
Weitere Titel von Peter Prange:
›Der Traumpalast – Im Bann der Bilder‹, ›Unsere wunderbaren Jahre‹, ›Eine Familie in Deutschland. Zeit zu hoffen, Zeit zu leben‹, ›Eine Familie in Deutschland. Am Ende die Hoffnung‹, ›Das Bernstein-Amulett‹, ›Himmelsdiebe‹, ›Die Rebellin‹, ›Die Rose der Welt‹, ›Ich, Maximilian, Kaiser der Welt‹, ›Die Philosophin‹, ›Die Principessa‹, ›Die Gärten der Frauen‹, ›Die Götter der Dona Gracia‹, ›Werte: Von Plato bis Pop – alles, was uns verbindet‹
Die Website des Autors: www.peterprange.de
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Bestsellerautor Peter Prange ist der große Erzähler der Geschichte. Als Autor aus Leidenschaft gelingt es ihm, die eigene Begeisterung für seine Themen auf Leser und Zuhörer zu übertragen. Die Gesamtauflage seiner Werke beträgt weit über drei Millionen. Seine historischen Romane wie ›Ich, Maximilian, Kaiser der Welt‹ wurden ebenso erfolgreich verfilmt wie die Deutschland-Romane ›Das Bernstein-Amulett‹ und ›Unsere wunderbaren Jahre‹. Mit ›Der Traumpalast‹ liegt der vierte große Deutschland-Roman vor. Der Autor lebt mit seiner Frau in Tübingen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Neuausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2009 by Peter Prange
vertreten durch AVA international GmbH
Autoren- und Verlagsagentur, München.
Die Originalausgabe erschien 2012 im Droemer Verlag
© 2022 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: www.buerosued.de unter Verwendung von Motiven von akg-images und mauritius images
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491223-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
{Motto]
Prolog Congregatio
Erstes Buch Vom Himmel
Erstes Kapitel: 1021–33 Gotteszeichen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Zweites Kapitel: 1036–37 Wunderglaube
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
Drittes Kapitel: 1037 Ohnmacht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Zweites Buch Durch die Welt
Viertes Kapitel: 1037–39 Ermächtigung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Fünftes Kapitel: 1044 Superbia
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Sechstes Kapitel: 1045 Krieg
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
Siebtes Kapitel: 1045–46 Wiedergeburt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
Drittes Buch Zur Hölle
Achtes Kapitel: 1046 Schisma
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Neuntes Kapitel: 1047–48 Aberratio
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
Zehntes Kapitel: 1048–49 Strafgericht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Epilog Beneficatio
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Dichtung und Wahrheit
Danke
Für Roman Hocke,
der als Kind tatsächlich Papst werden wollte – und es irgendwie auch geworden ist.
»Deus caritas est.«
Papst Benedikt XVI.
PrologCongregatio
1981
Mit geschlossenem Mund gähnend, schielte ich auf meine Armbanduhr, in der Hoffnung, dass die Zeit dadurch ein bisschen schneller verging.
Es war ein drückend warmer Julitag des Jahres 1981. Seit den frühen Morgenstunden tagte die päpstliche Kongregation für Selig- und Heiligsprechungen in einem Verwaltungsgebäude des apostolischen Palasts. Dreißig Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe hatten sich versammelt, um sich durch ein Gebirge von Anträgen zu arbeiten, das scheinbar niemals schrumpfen wollte. Während ich meine Blicke an den schmucklosen Wänden des Konferenzraums entlang schweifen ließ, damit mir die Augen nicht zufielen, oder die Fliegen auf den Kuchenstücken zählte, die brave Nonnen Seiner Heiligkeit uns zur Stärkung aufgetischt hatten, folgte ich mit halbem Ohr der Verlesung der Fälle, über die wir zu beratschlagen hatten. Die Sitzungen der Kongregation für Selig- und Heiligsprechungen, an denen ich als Prokurator des Heiligen Stuhls und Lizentiat des kanonischen Rechts regelmäßig teilzunehmen hatte, waren für mich ein Beweis, dass der Teufel seine Opfer nicht nur körperlich durch Feuer und Schwefel quält, sondern mehr noch durch das Folterinstrument des Geistes – die Langeweile. Wie oft hatte ich das alles schon gehört, diese immer und immer wieder gleichen Geschichten, aus denen ein lächerlicher, unaufgeklärter, längst überholter Kinderglaube sprach: hier eine Bilokation, dort eine Wunderheilung, als würde es auf der Welt von Heiligen und Märtyrern nur so wimmeln. Dabei war mir in all den Jahren meiner Tätigkeit kein einziges wirkliches Wunder untergekommen, trotz mannigfach erfolgter Selig- und Heiligsprechungen, ohne die offenbar die katholische Geistlichkeit immer noch nicht auskommen zu können glaubte.
Wann würde meine Kirche endlich die Kraft finden, auf diesen Mummenschanz zu verzichten?
Da wurden plötzlich die Stimmen am Tisch lauter.
»Dieser Papst soll seliggesprochen werden? Ein Mann, der sich der Hurerei, des Mordes und sogar der Zauberei schuldig gemacht hat?«
»Ja, ich bitte den Heiligen Stuhl, offiziell zu erklären, dass Benedikt IX., vulgo Teofilo di Tusculo, in die himmlische Glorie eingegangen ist und öffentliche Verehrung verdient.«
»Das ist unerhört! Da können wir ja gleich Satan selbst seligsprechen!«
Als hätte der Heilige Geist einen Funken in meiner Seele entfacht, erwachte ich aus meinem Dämmerzustand. Hatte ich richtig gehört? War wirklich von Benedikt IX. die Rede? Ich wusste nicht viel von diesem Papst, kaum mehr, als dass er im 11. Jahrhundert gelebt hatte und bereits im Knabenalter auf den Stuhl Petri gelangt sein sollte. Doch das wenige, was von ihm überliefert war, sprach ganz und gar nicht dafür, ihn der Schar der Seligen zuzuordnen. Dieser unwürdige Stellvertreter Christi stand vielmehr im Ruf, so lasterhaft wie Caligula und so lüstern wie ein türkischer Sultan gewesen zu sein: ein der Hölle entwichener Dämon, der sich die Tiara aufgesetzt hatte, um als Papst verkleidet den Mächten des Bösen zum Triumph zu verhelfen.
Paul Mortimer, ein Bischof aus Chicago von nicht mal vierzig Jahren, sprang mit dem Eifer der Jugend von seinem Platz auf, um lautstark gegen den Vorschlag zu protestieren: »Zwei Voraussetzungen sind zur Seligsprechung unabdingbar – erstens der Ruf der Heiligkeit der in Frage stehenden Person, zweitens der Nachweis eines Wunders. Was, frage ich Sie, soll am Leben dieses liederlichen Papstes heiligmäßig gewesen sein?«
Jiao Xing, der taiwanesische Kurienkardinal, der diesen überaus merkwürdigen Antrag auf Eröffnung eines apostolischen Prozesses gestellt hatte, setzte mit feinem Lächeln und leiser, singender Stimme zur Gegenrede an: »Ich verstehe Ihre Bedenken durchaus, Bischof Mortimer. Doch hat der Kirchenvater Augustinus uns nicht gelehrt, nur wer den Stachel der Sünde in seinem Fleische spüre und der Versuchung dennoch widerstehe, der könne der Seligkeit teilhaftig werden? Ja, Benedikt IX. kannte die Sünde, vielleicht inniger und schmerzlicher als alle anderen Päpste und Heilige vor oder nach ihm, vielleicht hat er zeitweilig sogar mit dem Bösen selbst im Bunde gestanden – aber ist die Rückkehr eines Menschen zu Gott nicht umso höher einzuschätzen, je tiefer er zuvor gefallen ist?«
Ein Raunen ging durch den Saal, und einige Mitglieder der Kongregation wiegten nachdenklich die Köpfe.
»Außerdem«, fügte Kardinal Xing hinzu, um die Keimlinge der Zustimmung mit einem weiteren Argument zu kräftigen, »ist es denn unseres Amtes, nach äußerem Augenschein das Leben eines Menschen zu beurteilen? Sollten wir uns nicht vielmehr bemühen, seine Taten auch als Manifestationen der göttlichen Vorsehung zu begreifen? Vergessen wir nicht: Selbst der Verräter Judas Ischarioth hat zum Erlösungswerk des Heilands beigetragen!«
Das Raunen schwoll abermals an, und manches Haupt, das sich eben noch unschlüssig gewiegt hatte, nickte. Die älteren Brüder erinnerten sich vermutlich wie ich jenes spektakulären Falles, über den zu verhandeln vor über zwanzig Jahren ein Franziskanerpater deutscher Herkunft die Kongregation aufgefordert hatte: die Seligsprechung des Apostels, durch den Jesus Christus in die Hände seiner Häscher gefallen war.
Ich selber ertappte mich dabei, wie ich die Worte murmelte, mit denen damals der Postulator seinen Antrag begründet hatte: »Ohne Judas kein Kreuz, ohne das Kreuz keine Erfüllung des Heilsplans …«
Doch Bischof Mortimer gab sich so schnell nicht geschlagen. »Und das Wunder, das Benedikt IX. gewirkt haben soll?«
»Sie haben alles Recht, diese Frage zu stellen«, räumte Jiao Xing mit der gebotenen Ernsthaftigkeit ein. »Wir haben in diesem Fall tatsächlich weder Zeugnis von einer Bilokation noch von einer Spontanheilung. Dennoch zögere ich nicht, von einem Wunder zu sprechen – dem vielleicht größten Wunder überhaupt.«
»Aber was soll dieses Wunder sein?« Bischof Mortimers Stimme schnappte vor Erregung fast über.
Statt einer Antwort gab Kardinal Xing einem Schweizer Gardisten ein Zeichen. Eine Tür ging auf, und herein kam ein Bibliothekar mit einem Rollwagen voller versiegelter Akten.
»Dieses Konvolut«, erklärte Kardinal Xing, »ist bei Inventarisierungsarbeiten im Geheimarchiv des Vatikans unserem neuseeländischen Freund Professor Goalman in die Hände gefallen. Es enthält die Antwort auf die Frage Bischof Mortimers.« Kardinal Xing machte eine Pause und blickte mit seinen kleinen, intelligenten Augen in die Runde. »Wer von Ihnen ist bereit, nach den Bestimmungen von Paragraf 1999 bis 2141 des Codex Iuris Cononici aus diesen Akten einen Auszug herzustellen, damit die Kardinalreferenten Seiner Heiligkeit entscheiden können, ob die Eröffnung eines apostolischen Prozesses zur Seligsprechung von Papst Benedikt IX. angezeigt erscheint oder ob wir besser daran tun, ein solches Verfahren für nichtig zu erklären?«
Neugierig geworden, schaute ich auf das Konvolut uralter, verstaubter Dokumente, die seit fast einem Jahrtausend wohl keine menschliche Hand mehr berührt hatte: Zeugnisse eines längst erloschenen Lebens – im ewigen Ringen zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis, Erlösung und Verdammnis.
Welche Wahrheit würden sie zutage fördern?
Ohne die Folgen meines Tuns zu bedenken, hob ich die Hand.
»Monsignore Silvretta?« Alle Augen richteten sich überrascht auf mich, als der Vorsitzende, Kardinalpräfekt Contadini, meinen Namen nannte. Schließlich stand ich im Ruf, ein entschiedener Gegner jedweden Wunderglaubens zu sein. »Dann möchte ich Sie bitten, sich hier in unserem Beisein von der Unverletztheit der Siegel zu überzeugen.«
Während der Bibliothekar sich mit dem Rollwagen näherte, fügte ich mich mit einem Seufzer in mein selbstgewirktes Schicksal und tat, wie mir geheißen.
» Cum deo …«
Noch am selben Abend trafen die Unterlagen in meiner Privatwohnung ein, und ich machte mich an die Arbeit …
Erstes BuchVom Himmel
1021–1037
Erstes Kapitel: 1021–33Gotteszeichen
1
Noch war alles still an diesem herbstlich kühlen Morgen. Nur heiliges Schweigen erfüllte die Welt, während über der Burg Tuskulum, dem mächtigsten Kastell in den Albaner Bergen südlich von Rom, allmählich die Sonne aufging, um mit ihren wärmenden Strahlen den Tau von den Blättern der Bäume und den Zinnen der Türme zu trocknen.
Da gellte ein Schrei in der lautlosen Stille, und schwarze Vögel flatterten kreischend in den blassblauen Himmel auf, als wollten sie dem Drama von Leben und Tod entfliehen, das sich hinter den Mauern der Burg vollzog. Denn dort, im Innern der jahrhundertealten Festung, die sich inmitten schwarzgrün bewachsener Wälder auf einer einsamen Anhöhe erhob, lag im zerwühlten Bett ihrer Kemenate Contessa Ermilina, Gräfin von Tuskulum, seit einem Tag und einer Nacht in den Wehen.
»Heißes Wasser! Und bring mir die Zange!«
Wie aus weiter Ferne drangen die Anweisungen der Hebamme an Ermilinas Ohr, als würde der Schmerz, der in immer neuen Wellen von ihrem Leib Besitz ergriff, ihre Sinne betäuben, während sie den Blick Hilfe suchend auf das Lamm Gottes richtete, dessen Bildnis zum Schutz vor dem Kindbetttod ihr gegenüber an der Wand angebracht worden war. Drei Söhne hatte sie bereits geboren, und sie hätte nie gedacht, noch einmal niederzukommen. Sie war mit ihren sechsunddreißig Jahren doch viel zu alt, um von einem Mann zu empfangen, seit einer Ewigkeit hatte sie keine Blutung mehr gehabt. Aber der Einsiedler Giovanni Graziano, ein heiligmäßiger Mann, der einsam in den Wäldern hauste und ihr die Beichte abnahm, hatte ihr das Wunder gedeutet: Ihre Schwangerschaft sei ein Zeichen Gottes, wie es einst die Schwangerschaft der Stammesmutter Sarah gewesen sei, Abrahams Frau. Ihr Kind sei darum ein besonderes Kind, es sei Gottes Wille und Beschluss, dass sie es zur Welt bringe – ad maiorem dei gloriam.
»Ich kriege den Kopf nicht zu fassen! Es liegt verkehrt rum im Bauch!«
Wieder krampfte sich Ermilinas Leib zusammen, in einer Woge aus Schmerz, als wolle er das fremde, kostbare Wesen, das im Dunkel ihrer Gedärme nistete, wie ein Katapult aus sich heraus schleudern. Doch wieder staute sich die Woge an einer unsichtbaren Wand, türmte der Schmerz sich in ihrem Innern auf, um sich in einer Sturzflut zu brechen und durch die Adern bis in die letzte Faser ihres Körpers zu strömen. Würde sie diese Geburt überleben?
Die Hebamme schob ihre Oberschenkel noch weiter auseinander und drückte mit beiden Händen gegen ihren Unterbauch. »Es muss zurück, damit ich es drehen kann!«
Ermilina spürte, es war ein Kampf zwischen ihr und dem Kind. Noch halb gefangen in ihrem Leib, halb schon bei den Engeln, flüsterte sie die Namen aller Schutzpatrone, die sie kannte, griff nach dem Gürtel, den Giovanni Graziano ihr geschenkt hatte, den Gürtel der Heiligen Elisabeth, der ihr die Geburt erleichtern sollte, und hielt ihn mit ihrer ganzen Kraft. Gott liebt dieses Kind … Es soll dermaleinst sein Werkzeug sein … Es ist von der Vorsehung auserwählt … Wie Traumfetzen schossen die Worte des Einsiedlers ihr durch den Kopf, Botschaften aus einer anderen Welt, aus denen sie Kraft schöpfen konnte, während das neue Leben in ihr das alte Leben schröpfte und verzehrte.
Was hatte Gott mit diesem Kind vor, dass er ihr ein solches Martyrium auferlegte?
Durch einen roten Schleier sah Ermilina, wie die Hebamme nach der Spritze griff, die bereits mit Weihwasser gefüllt war, damit ihr Kind noch im Mutterleib getauft werden konnte, falls es zu sterben drohte. Voller Entsetzen formte Ermilina ihre Lippen zum Gebet.
»Ich flehe dich an, Herr … Nimm mein Leben im Tausch für mein Kind …«
Auf einmal war es so still, dass sie ihren eigenen Atem hörte. Erschöpft schloss sie die Augen, und für einen wunderbaren Moment schien jeder Schmerz erloschen. Hatte der Herr ihr Gebet erhört und nahm ihr Opfer an? Obwohl sie am ganzen Leib schweißnass war, fror und zitterte sie so sehr, dass die Adlersteine in der Amulettkapsel, die die Hebamme ihr ans Handgelenk gebunden hatte, um ihre Schmerzen zu lindern, leise klapperten und ihre Zähne wie im Schüttelfrost aufeinander schlugen.
»Wenn das Kind überlebt – wie soll es heißen?«
Ermilina schlug noch einmal die Augen auf und sah in das fragende Gesicht der Hebamme. Unter Aufbietung ihrer letzten Willenskraft unterdrückte sie das Schlagen ihrer Zähne, um Antwort zu geben.
»Teofilo …«, flüsterte sie. »Der, den Gott lieb hat …«
»Und wenn es ein Mädchen ist?«
Ermilina schüttelte den Kopf. »Es ist ein Junge … Ich weiß es … Und er soll Teofilo heißen …«
Mit dem Namen ihres Sohnes auf den Lippen, den Blick auf das Lamm Gottes gerichtet, schwanden ihr die Sinne, und sie sank in Ohnmacht.
2
»Wie kann das sein, dass Wein sich in Blut verwandelt?«, wollte Teofilo wissen. »Und warum wird plötzlich Brot, das wir zur Suppe essen, zum Leib Christi?«
»Das ist das Geheimnis des Glaubens«, erwiderte Giovanni Graziano. »Deinen Tod, oh Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir. Bis du wiederkommst in Herrlichkeit.«
»Ich weiß, das sagt auch Don Abbondio in der heiligen Messe. Aber könnt Ihr mir nicht zeigen, wie es passiert? Ich würde es so gerne sehen!«
Giovanni Graziano blickte ihn streng an. »Hast du das Beispiel des heiligen Thomas vergessen?«
Teofilo senkte beschämt den Kopf. Er wusste, warum sein Taufpate ihm die Frage stellte. »Ihr meint – wegen der Wundmale?«
»Richtig«, nickte Giovanni Graziano. »Der heilige Thomas wollte auch nicht glauben, dass der Herr ans Kreuz geschlagen und wiederauferstanden war. Bis er mit eigenen Augen die Wundmale sah und sie mit eigener Hand tastete. Was also lernen wir daraus?«
Teofilo brauchte nicht lange nachzudenken, um Antwort zu geben. »Dass wir nicht nur glauben sollen, was wir sehen, sondern vor allem das, was Jesus Christus sagt.«
»Siehst du?« Sein Pate strich ihm über das Haar. »Wie alt bist du jetzt, mein Sohn?«
»Sechs Jahre, ehrwürdiger Vater.«
»Meinst du nicht, dass du deinen Wissensdurst dann noch ein wenig bezähmen solltest? Die heilige Wandlung ist schließlich das erhabenste Wunder, das Gott für uns gewirkt hat.«
Wie jeden Samstag war Teofilo mit seinen Brüdern am frühen Morgen zu Giovanni Grazianos Einsiedelei gewandert. Schon Tage im Voraus fieberte er diesem allwöchentlichen Ereignis entgegen – so begierig war er auf die Unterweisung im Glauben durch seinen Taufpaten, der mit der hageren Gestalt, dem weißen, schulterlangen Haar und den pechschwarzen Augen aussah wie Johannes der Täufer auf dem Altarbild der Burgkapelle. Ihn liebte und bewunderte Teofilo mehr als seinen eigenen Vater, den mächtigen Grafen von Tuskulum, für den er eher Respekt, vor allem aber Furcht empfand. Obwohl Giovanni Graziano weder lesen noch schreiben konnte, stand er im Ruf, ein wahrer Mann Gottes zu sein – eine Lilie unter Dornen. Angeblich hatte Gott sich ihm bereits in seiner Jugend zu erkennen gegeben, als er ihm befohlen hatte, sein Elternhaus zu verlassen, um dem Beispiel Jesu Christi zu folgen und als Eremit der Welt für immer zu entsagen. Graziano hatte die Einsiedelei, die aus einem einzigen ummauerten Raum bestand, auf Gottes Geheiß am Ende eines Weges errichtet, auf dem angeblich Flaschen und Räder bergaufwärts rollten, weshalb Gläubige aus Rom und ganz Latium an diese Stätte pilgerten. Hier lebte Giovanni Graziano in vollkommener Einsamkeit und ernährte sich allein von den Früchten und Pflanzen, die im Walde wuchsen: von Sauerampfer, Pilzen und Beeren sowie von den Broten, die hin und wieder fromme Pilger vor der Tür der Einsiedelei ablegten. Seit seiner Taufe, so hatte man Teofilo gesagt, habe sein Pate diesen Ort nicht mehr verlassen. Weil ein jeder, der sich in die Welt hinaus begebe, sich unweigerlich in Sünde und Schuld verstricke.
»Ich habe auch eine Frage, ehrwürdiger Vater.«
Gregorio, Teofilos zehn Jahre älterer Bruder, ein kraftstrotzender junger Mann mit rotblonden Locken und schon sprießendem Bart, der mit bloßen Zähnen Walnüsse knacken und auf Kommando furzen konnte, hatte den Finger gehoben, um sich bemerkbar zu machen.
»Nun, was möchtest du wissen?«, fragte Giovanni Graziano.
»Warum bringt eine schwarze Katze Unglück?«
»Darauf gibt es keine Antwort, mein Sohn.«
»Warum nicht?«, erwiderte Gregorio beleidigt. »Wenn Teofilo etwas fragt, habt Ihr immer eine Antwort.«
»Weil Angst vor schwarzen Katzen Aberglaube ist.«
»Aberglaube? Das kann nicht sein! Das weiß doch jeder, dass eine schwarze Katze Unglück bringt. Oder?«
Um Zustimmung heischend, drehte Gregorio sich zu seinen Brüdern herum: Ottaviano, der mit seiner feinen, hellen Haut und dem schmächtigen Körper zwar aussah wie ein Mädchen, doch mehr essen konnte als zwei erwachsene Männer zusammen, sowie Pietro, der immer so müde war, als hätte er die ganze Nacht nicht geschlafen, und nur aufzuwachen schien, wenn ihn die Pickel juckten, die seit ein paar Monaten auf seinem Gesicht blühten.
»Natürlich bringt eine schwarze Katze Unglück«, erklärte Pietro gähnend. »Genauso, wie wenn im Wald der Kuckuck schreit.«
»Unser Jagdaufseher hat mal gehört, wie der Kuckuck fünfmal schrie«, bestätigte Ottaviano eifrig nickend. »Jetzt weiß er, dass er in fünf Jahren sterben muss.«
»Hab ich’s nicht gesagt?«, fragte Gregorio triumphierend.
Doch Giovanni Graziano schüttelte den Kopf. »Es ist Aberglaube«, wiederholte er. »Eine schwarze Katze kann höchstens dann Unglück bringen, wenn ein Dämon in sie gefahren ist. Alles andere ist Ketzerei. Und wenn du weiter so gottlose Dinge behauptest, musst du zur Strafe den Rest des Tages schweigen.«
Gregorio biss sich auf die Lippen, um dann an seinem Daumennagel zu knabbern wie ein Kaninchen an einer Mohrrübe. Das tat er immer, wenn er nicht mehr weiter wusste. Teofilo platzte fast vor Stolz. Seine Brüder waren so viel älter als er, doch er war tausendmal klüger als sie!
Plötzlich kam ihm ein Gedanke.
»Wenn Angst vor schwarzen Katzen Aberglaube ist – ist dann die heilige Wandlung nicht auch Aberglaube?«
Giovanni Graziano schlug erschrocken ein Kreuzzeichen. »Willst du dich versündigen?«
»Ich kann es einfach nicht begreifen!«
»Du sollst nicht begreifen – du sollst glauben, hörst du? Glauben! Wie oft soll ich dir das noch sagen? Oder hast du schon wieder die Lektion vergessen, die ich dir erteilt habe?« »Nein, ehrwürdiger Vater«, erwiderte Teofilo leise. »Natürlich nicht.«
Wie konnte er auch? Es war im letzten Sommer gewesen, bei der Unterweisung vor Christi Himmelfahrt. Teofilo hatte nicht glauben wollen, dass ein Mensch, und Jesus war doch ein Mensch, in den Himmel aufsteigen konnte wie ein Vogel – Jesus hatte doch keine Flügel! Da hatte der Einsiedler ihn zu der Straße geführt, die von Nemi zu der Klause führte, hatte eine mit Wasser gefüllte Schweinsblase auf den Boden gelegt, und Teofilo hatte mit eigenen Augen gesehen, was sein Verstand nicht hatte fassen können: Die Schweinsblase war tatsächlich bergauf gerollt, obwohl das doch gar nicht möglich war! Damals hatte er sich vorgenommen, nie wieder Fragen zu stellen, die sein Lehrer nicht hören wollte. Doch seine Zunge gehorchte ihm einfach nicht.
»Aber … aber«, stammelte er, »wenn die heilige Wandlung kein Aberglaube ist – was ist sie dann? Zauberei?«
Giovanni Grazianos schwarze Augen glühten wie zwei Kohlestücke. »Drei Tugenden hat uns Jesus Christus durch sein Beispiel gelehrt: Armut, Keuschheit und Gehorsam. Ihnen sollen wir folgen. Ihr Gegenteil aber, Prasserei, Wollust und Hochmut, führen uns ins Verderben. Hüte dich also vor solchen Fragen, mein Sohn! Dahinter lauert die Superbia, die Sünde des Hochmuts, die Sünde wider den Heiligen Geist.«
Noch während der Eremit sprach, öffnete sich die Tür, und Teofilos Mutter betrat die Einsiedelei.
»Wie könnt Ihr von Hochmut sprechen, ehrwürdiger Vater?«, fragte Ermilina, nachdem sie ihren Beichtvater ehrfürchtig begrüßt hatte. »Habt Ihr nicht selber gesagt, dass dieser Knabe ein besonderes Kind ist? Ein Erwählter des dreifaltigen Gottes?«
Der Eremit hob seine knochigen Hände, als wolle er böse Geister abwehren. »Erwähltheit und Verdammnis liegen oft nur einen Schritt auseinander. Die Seele des Menschen ist aus Dunkelheit und Licht geschaffen. Wehe, wenn die Dunkelheit das Licht erstickt!«
Teofilo lief ein Schauer über den Rücken. Er wusste, Licht und Dunkelheit – das waren Gott und der Teufel, die miteinander rangen, überall, im Himmel und auf Erden.
Auch in seiner Seele?
Mit einem zärtlichen Lächeln reichte seine Mutter ihm sein Wams. »Zieh dich an, mein Junge. Du wirst mit mir und deinem Vater nach Rom reisen.«
»Nach Rom?«
»Ja, zur Krönung des neuen Kaisers. Dein Onkel Romano, Seine Heiligkeit Papst Johannes, hat uns eingeladen!«
»Und ich?«, fragte Gregorio. »Darf ich etwa nicht mit?«
»Du bleibst hier, genauso wie deine anderen Brüder. Ihr müsst noch viel lernen.«
»Das ist ungerecht!«, protestierte Gregorio. »Ich bin der Erstgeborene, nicht dieser Hosenscheißer!«
Seine Mutter verpasste ihm eine Ohrfeige. »Ja, du bist der Erstgeborene – aber nur vor deinem leiblichen Vater. Nicht vor Gott, unser aller Vater und Herr im Himmel!« Während Gregorio sich die Wange rieb, wandte sie sich wieder zu Teofilo, und ihre Stimme wurde ganz weich. »Bist du so weit? Dann verabschiede dich von deinem Paten.«
Teofilo verbeugte sich vor dem Eremiten, dann kniete er auf dem gestampften Lehmboden vor dem Marienbild nieder, das als einziger Schmuck die Klause zierte, und wie jedes Mal, wenn er die Einsiedelei betrat oder verließ, küsste er darauf das Jesuskind, dessen Antlitz ihn ein kleines bisschen an sein eigenes Spiegelbild erinnerte.
»Gelobt sei Jesus Christus.«
»In Ewigkeit amen.«
Als seine Mutter ihn an die Hand nahm, war es, als würde sein Schutzengel ihn an die Hand nehmen, um ihn vor allem Bösen zu bewahren. Teofilo empfand die Berührung wie einen Segen. Solange seine Mutter ihn führte, das war für ihn so sicher wie der Sonnenaufgang jeden Morgen, solange konnte ihm nichts auf der Welt widerfahren.
Im Hinausgehen warf er Gregorio einen triumphierenden Blick zu.
Die Augen seines Bruders funkelten vor Wut. Doch als er das Gesicht seiner Mutter sah, traute er sich nicht, noch etwas zu sagen.
3
»Jetzt hör auf zu zappeln und halt endlich still!«
Um sich zu beruhigen, stellte Chiara sich vor, ein Baum zu sein. Wie angewurzelt hob sie die Arme über den Kopf, holte einmal tief Luft und hielt den Atem an, damit sie sich kein noch so kleines bisschen mehr bewegte, als die Zofe ihr das seidene Unterkleid überstreifte, das an ihrer nackten Haut entlang glitt, als würde jemand sie streicheln. Sie war so aufgeregt, dass sie die ganze Nacht nicht hatte schlafen können, und beim Frühstück hatte sie keine zwei Löffel Brei herunter bekommen. Erst gestern Abend hatte ihr Vater gesagt, dass sie ihn zur Krönung des Kaisers nach Rom begleiten durfte. In den Petersdom, in die Kirche des Papstes!
»Was meinst du, ob ich wohl das einzige Mädchen bin?«
»Ich glaube schon«, erwiderte Anna. »Dein Vater hat gesagt, dass jeder Edelmann nur seinen ältesten Sohn mitbringen darf. Nicht mal die Herzöge bringen ihre Töchter mit. Nur der Conte di Sasso!«
»Da werden die anderen aber Augen machen!« Mit Annas Hilfe zwängte Chiara sich in das eng anliegende Oberkleid, eine Tunika aus grünem Damast, die sie selber genäht und mit Perlen bestickt hatte. »Ob mein Vater wohl lieber einen Sohn gehabt hätte als nur ein Mädchen?«, fragte sie.
»Wie kommst du denn darauf? Ich habe noch keinen Mann gesehen, der seine Tochter so lieb hat wie dein Vater! Oder kennst du vielleicht noch einen Vater, der jeden Abend mit seiner Tochter Trictrac spielt?«
Anna bückte sich und verflocht die kleinen bunten Bänder an ihrem Kleid mit den Ärmeln der Tunika. Dabei kitzelten die Bänder Chiara an der Schulter, und weil sie es nicht ausstehen konnte, wenn etwas sie nur auf einer Seite juckte oder drückte oder sonst wie störte, kratzte sie sich nicht nur die linke, sondern auch die rechte Schulter.
»Wenn deine Mutter nur heute bei uns sein könnte«, sagte Anna. »Sie wäre so stolz auf dich.«
Bei den Worten ihrer Zofe senkte sich ein feiner grauer Schleier auf Chiaras Seele. Sie hatte ihre Mutter nie kennen gelernt – so lange sie zurückdenken konnte, war immer nur Anna da gewesen. Ihre Mutter, das wusste sie von ihrem Vater, war bei der Geburt eines Sohnes gestorben, der tot zur Welt gekommen war. Chiara war damals noch keine zwei Jahre alt gewesen und hatte keine Erinnerung an sie. Es gab nur ein Bild von ihr, das aber nicht fertig geworden war – weil es eine Sünde sei, Bilder von einer sterblichen Frau zu malen, hatte der Maler sich geweigert, es fertig zu stellen. Jetzt hing es, versteckt vor den Blicken Fremder, im Kabinett ihres Vaters, und zeigte eine wunderschöne Frau mit herrlichen blonden Locken und einem halben Gesicht. Chiara hatte einmal gesehen, wie ihr Vater vor dem Bild saß und weinte. Seitdem mochte sie das Kabinett nicht mehr betreten.
»Nicht traurig sein«, sagte Anna. »Ich bin sicher, sie schaut gerade vom Himmel auf dich herab.«
»Glaubst du wirklich?«
»Ganz bestimmt!«
Die Vorstellung reichte, damit der graue Schleier wieder verschwand.
»Darf ich heute meine zweifarbigen Strümpfe anziehen?«
»So eitel kenne ich dich ja gar nicht«, lachte Anna. »Eitel bist du doch sonst nur, wenn es um deine Haare geht!« Sie schaute Chiara an. »Willst du vielleicht dem Kaiser gefallen? Oder gibt es sonst einen Grund?«
Chiara spürte, wie sie unter Annas Blicken rot wurde, und hätte am liebsten geschwiegen. Aber das hatte keinen Zweck. Denn Anna war mit ihren sechzehn Jahren nicht nur viel älter und erfahrener als sie und wusste in solchen Sachen Bescheid, sie kannte sie auch so in- und auswendig, dass sie sowieso alles erriet, was in ihr vorging. Anna wusste sogar, dass sie niemals ihre blonden Locken mit einem Schleier oder Tuch bedecken würde, nicht mal als erwachsene Frau!
»Vielleicht«, sagte Chiara leise, »ist mein Bräutigam ja auch da.«
»Ach Gottchen, du bist ja richtig verliebt!«, rief Anna. »Komm her, mein Schatz, damit ich dein Haar bürsten kann!«
4
Es war der höchste Festtag im Kirchenjahr, der heilige Ostersonntag, als König Konrad mit seinem Gefolge in den Petersdom einzog, um sich zum neuen römischen Kaiser krönen zu lassen, zum Augustus und Imperator Romanum, dem mächtigsten Herrscher der Welt. Schon seit dem frühen Morgen harrte Teofilo an der Seite seiner Mutter in der düsteren Basilika aus, die ihm mit ihrer drückenden Gewölbedecke und den schmalen Fensterschlitzen, durch die kaum Tageslicht ins Innere drang, so unheimlich war wie das Verlies in der Burg seines Vaters. Während die gleichförmigen Gesänge eines Chores von den kalten und feuchten Wänden widerhallten, drängte das Volk sich bis in die hintersten Nischen und Ecken des Gotteshauses. Teofilo stellte sich auf die Zehenspitzen und verrenkte sich den Hals, um zwischen all den Rücken und Schultern und Köpfen der Erwachsenen überhaupt etwas zu sehen. In dem spärlichen Licht erkannte er einen großen, bärtigen Mann, in einem goldenen Gewand voller Perlen und Juwelen. Das musste der König sein! Ernste, in Brokat gekleidete Männer schritten an seiner Seite, einer trug ihm das blanke Schwert auf einem Samtkissen voraus, andere streuten Geldmünzen links und rechts des Weges, den Könige, Herzöge und Grafen säumten, Kardinäle, Bischöfe und Äbte, Ritter und Milizen und Knappen. Gemeinsam bildeten sie eine Gasse in Richtung eines kreisrunden, dem Boden eingefügten Steins, wo die wichtigsten römischen Edelleute versammelt waren, um den König und Papst zu empfangen, mit Alberico an der Spitze, Teofilos Vater und Bruder des Papstes, ein gewaltiger, breitschultriger Mann mit einem Gesicht wie aus Fels gehauen und rotblondem Bart: der erste Konsul von Rom, neben dessen imposanter Erscheinung die Oberhäupter der anderen Familien, die Sabiner und Crescentier und Oktavianer und Stephanier, wie Gefolgsleute niederen Ranges wirkten.
Eine Fanfare ertönte, und die Gesänge verstummten. Mit der Krone Karls des Großen in den Händen trat Papst Johannes XIX., unter dessen Tiara Teofilo das vertraute Gesicht seines Onkels Romano erkannte, auf den König zu.
»Nimm das Zeichen des Ruhmes, das Diadem des Königtums, die Krone des Reiches, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes!«
Wie auf ein unsichtbares Kommando sanken all die mächtigen und wichtigen Männer vor Teofilos Onkel zu Boden: die Könige und Herzöge und Grafen, die Kardinäle, Bischöfe und Äbte, die Ritter und Milizen und Knappen – ja, sogar Konrad selbst, der neue Kaiser, beugte vor seinem Onkel das Knie, um dessen Fuß zu küssen. Teofilo sah es und konnte es nicht glauben.
»Ist der Papst mächtiger als der Kaiser?«, flüsterte er voller Andacht.
Seine Mutter nickte. »Ja, der Papst ist der mächtigste Mensch auf Erden. Weil er der Stellvertreter Gottes ist.«
Teofilo schauderte. Für einen Moment gab er sich der berauschenden Vorstellung hin, selber einmal solche Macht zu besitzen. Was für ein herrliches, wunderbares Gefühl musste es sein, so hoch erhaben über allen anderen Menschen zu stehen! Doch diese Vorstellung währte nur einen Wimpernschlag. Denn plötzlich durchströmte ihn ein anderes, ganz sanftes, unendlich beglückendes Gefühl, ein Gefühl, wie wenn man morgens fröstelnd im Bett die Augen aufschlägt und die Sonne scheint einem wärmend ins Gesicht. Ein Mädchen, so alt wie er selbst, ein blond gelockter Engel mit einer Haut wie Alabaster und zartrosa Lippen, gewandet in eine grüne, perlenbesetzte Tunika, stand ihm genau gegenüber, zwischen zwei Säulen, und sah ihn mit ihren himmelblauen Augen unverwandt an: seine Cousine Chiara, das Mädchen, das er laut Beschluss ihrer beider Väter dermaleinst heiraten sollte … Im selben Moment fing Teofilos Herz an zu schlagen, als galoppierte ein Pferd in seiner Brust. Chiara war das einzige Mädchen, das sich traute, die Haare offen zu tragen, und bei ihrer ersten und einzigen Begegnung hatten unter dem Saum ihrer Tunika zwei verschiedenfarbige Strümpfe hervorgelugt, die ihm den Atem geraubt und ihn bis in seine Träume verfolgt hatten. Ob sie die Strümpfe heute wohl wieder trug?
»Chiara …«, flüsterte er.
Als würde sie seine Gedanken erraten, schlug sie die Augen nieder. Doch wie sie das tat und dabei rot wurde und an ihrem blonden Engelshaar zupfte, war so unglaublich schön, dass er nur noch den einen Wunsch verspürte, zu ihr zu laufen und sie in den Arm zu nehmen. Herrgott, warum dauerte im Leben immer alles so fürchterlich lange? Ein Jahr musste er noch warten, bis seine Ausbildung als Page begann. Aber erst wenn er zum Knappen ernannt worden war, war er ein richtiger Mann, den ein so überirdisches Wesen wie Chiara überhaupt beachten würde …
»Wie alt muss man sein, damit man heiraten kann?«
Teofilo hatte gar nicht gemerkt, dass er die Frage tatsächlich ausgesprochen hatte. Irritiert drehte seine Mutter sich zu ihm herum.
»Pssst, mein Liebling«, erwiderte sie. »Dein Leben liegt in Gottes Hand. Er wird uns zeigen, was sein Wille ist. Und wer weiß, vielleicht will er ja gar nicht, dass du …«
Bevor sie den Satz zu Ende gesprochen hatte, schlugen die Glocken der Basilika zu einem machtvollen Festgeläut an, und ein Jubel aus tausend Kehlen erschallte und füllte das dunkle Gewölbe.
»Leben und Sieg dem Kaiser! Dem Beschützer des Imperiums!«
Während das Volk den neuen Herrscher pries, in allen Sprachen, die seit dem Turmbau zu Babel von Menschen gesprochen wurden, erhob Konrad sich von den Knien, und der Jubel wurde zum Orkan. Mit ernstem Lächeln winkte der neu gekrönte Kaiser seinen Untertanen zu – da brach, nicht weit von Teofilo entfernt, ein Tumult los, in den Reihen junger Adliger, die sich gegenseitig aus dem Weg drängten, um dem Herrscher möglichst nah zu sein, genau zwischen den zwei Säulen, zwischen denen Teofilo eben noch Chiara gesichtet hatte.
Ihm stockte der Atem. Wo war sie geblieben?
Anstelle seiner Cousine sah er nur ein wüstes Knäuel wild aufeinander einschlagender Männer. Fäuste sausten durch die Luft, Schwerter zuckten aus den Scheiden, und plötzlich, inmitten des schlimmsten Getümmels, eine grüne Tunika, die kleine, zarte, zerbrechliche Gestalt eines Mädchens, zwei zappelnde Beine, in unterschiedlichen Strümpfen – der eine rot, der andere gold …
»Chiara!«
5
Chiara wollte schreien, doch während sie versuchte, auf allen Vieren kriechend dem Getümmel zu entkommen, traf ein Stiefel sie mit solcher Macht in den Rippen, dass ihr kein Ton über die Lippen kam. Nach Luft schnappend, hielt sie sich die schmerzende Seite. Wohin sie schaute, über ihr, neben ihr, vor ihr, hinter hier: überall war sie von Männern umzingelt, die doppelt so groß waren wie sie und übereinander her fielen – ein einziges Ringen und Hauen, Stoßen und Quetschen. Ein Mann flog rückwärts in ihre Richtung, und prallte mit dumpfem Schlag neben ihr auf.
Wie sollte sie hier nur herauskommen?
Plötzlich tat sich eine Lücke vor ihr auf, und sie schaffte es, bis zu einer Säule vorzudringen. Die Rippen taten ihr so weh, dass sie kaum atmen konnte. Voller Angst schaute sie sich in dem düsteren Gotteshaus um. Wo war ihr Vater? Die Wachen des Papstes hatten sie daran gehindert, ihn zur Mitte der Basilika zu begleiten, wo die Oberhäupter der Adelsfamilien den Kaiser und den Papst empfingen, sodass er sie in der Obhut irgendeines Fremden unweit des Portals zurückgelassen hatte, bei einem Sabiner, der sich aber, als der Streit losgebrochen war, sogleich in den Kampf geworfen und sie vergessen hatte. In ihrer Verzweiflung schickte sie ein Stoßgebet zum Himmel: »Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt und in der Stunde unseres Todes …«
»Chiara!«
Als sie aus ihrer Deckung lugte, um zu schauen, wer ihren Namen gerufen hatte, traf sie ein Ellbogen an der Schulter, und sie taumelte zurück gegen die Säule.
»Chiara! Hier! Hier bin ich!«
Endlich sah sie sein Gesicht.
»Teofilo!«
Noch während sie seinen Namen rief, duckte er sich und schlüpfte zwischen einer Horde prügelnder Männer hindurch in ihre Richtung.
»Bleib, wo du bist! Ich hole dich!«
Flink wie ein Wiesel wich er den Schlägen und Tritten aus und nutzte jede Lücke, um in ihre Nähe zu kommen. Bald war er nur noch eine Körperlänge entfernt, und sie konnte fast schon seine ausgestreckte Hand ergreifen, da packte ihn ein schwarz gewandeter Riese wie einen Welpen im Nacken und warf ihn beiseite. Teofilo stieß einen so lauten Schrei aus, dass für einen Moment alles erstarrte, seine Augen glänzten, als wäre ein Dämon in ihn gefahren. Wie ein tollwütiger Hund stürzte er sich auf den schwarzen Riesen und biss ihm ins Gesicht.
»Los, Chiara! Lauf!«
Für einen Wimpernschlag war der Weg frei. Doch es war, als hätte sie Blei in den Schuhen.
»Ich … ich kann nicht …«
»Du musst!«
Bevor sie sich’s versah, war Teofilo bei ihr, nahm ihre Hand und riss sie mit sich fort – zum Kirchentor, in Richtung Licht, ins Freie …
6
Warm schien die Oktobersonne von dem dunkelblauen Herbsthimmel herab, und in der Ferne, unterhalb des Felsvorsprungs, der aus Schwindel erregender Höhe senkrecht in die Tiefe fiel, glitzerten die Strahlen wie goldene Brokatfäden auf der gekräuselten Oberfläche eines Sees, von dem es hieß, er könne Wunder wirken.
»Was meinst du mit Überraschung?«, fragte Chiara.
»Nicht hier. Erst wenn wir da sind«, erwiderte Teofilo.
Er versuchte, mit so tiefer Stimme wie ein Mann zu sprechen – oder wie Domenico, der Sohn des Crescentiergrafen, der Chiara zu ihrem zwölften Geburtstag eine Kette aus bunten Holzperlen geschenkt hatte. Zwar hatte seine Braut die Kette nie getragen, aber konnte man wissen, was so ein Mädchen insgeheim tat? Vielleicht trug sie die Kette ja in der Nacht, wenn sie im Bett lag, und dachte dabei an Domenico … Unter Chiaras Tunika zeichneten sich schon zwei zarte, alle Glückseligkeit versprechende Wölbungen ab, und er selber war noch nicht mal im Stimmbruch, geschweige dass endlich sein Bart anfing zu sprießen, obwohl er in einem Alter war, in dem seine älteren Brüder schon zu Knappen ernannt worden waren! Was für eine Ungerechtigkeit!
Ob sie sein Geschenk, das ihm in der Tasche brannte wie ein Stück Kohle, wohl tragen würde?
Der Anblick ihres offenen Haars, das ihr in Locken auf die Schultern fiel, machte ihn ganz verrückt. Ungeduldig griff er nach ihrer Hand, und gemeinsam überquerten sie die Lichtung, die den Felsvorsprung mit dem dahinter liegenden Wald verband, und verschwanden in ihrem Geheimversteck, einer Dickichthöhle so groß wie eine Kapelle inmitten einer verwachsenen Brombeerhecke, in der nichts als die sonnendurchtränkte Stille des Altweibersommers sie umfing. Seit der Kaiserkrönung vor sechs Jahren verbrachten sie jede freie Stunde zusammen, die Teofilo sich aus seinem Pagendienst am Hofe seines Vaters davonstehlen konnte, und mindestens einmal in der Woche trafen sie sich an diesem geheimen Ort, den niemand außer ihnen kannte, um ganz allein zusammen zu sein. Im hintersten Winkel ihrer Höhle, wo die süßesten Brombeeren wuchsen, hatten sie sich ein Lager aus alten Kissen und Decken eingerichtet. Hier verbrachten sie ganze Nachmittage damit, Seite an Seite auf den Bäuchen liegend mit den Zähnen die Früchte von den Zweigen zu pflücken, bis sie glaubten zu platzen, oder sie schauten zwischen den struppigen Dornenzweigen hindurch auf den See hinaus, um wortlos schweigend von den Wundern zu träumen, die vielleicht eines Tages für sie aus den fernen glitzernden Fluten aufsteigen würden.
»Und jetzt die Überraschung«, sagte Teofilo. Er griff in seine Tasche, nahm Chiaras Hand und steckte ihr einen Ring an den Finger, dessen in Gold eingefasster Stein lauter rote Funken sprühte. »Der ist für dich.«
»Für mich? Wirklich?«
Chiara streckte die gespreizten Finger von sich und betrachtete ungläubig den Ring. Dabei schienen ihre Augen mit dem Edelstein um die Wette zu funkeln. Zumindest kam es Teofilo so vor. Doch plötzlich erlosch das Leuchten in ihrem Gesicht, und mit ernster Miene blickte sie ihn an.
»Woher hast du den Ring?«, wollte sie wissen.
»Das ist doch egal.«
»Ist es gar nicht! Hast du ihn etwa geklaut?«
»Nein«, rief Teofilo. »Nur geliehen! Aus der Schatulle meiner Mutter.«
»Ohne sie zu fragen?«
Teofilo empfand ihre Blicke wie Nadelstiche und schlug die Augen nieder.
»Ich dachte«, flüsterte er so leise, dass er seine eigene Stimme kaum hörte, »wir brauchen doch einen Ring. Ich meine – zur Verlobung.«
Einen endlos langen Augenblick schwebte das Wort zwischen ihnen in der Stille. Teofilo wagte kaum, Chiara anzusehen. Er hatte seinen ganzen Mut zusammengenommen, um dieses eine Wort zu sagen. Wenn Chiara ihm jetzt den Ring zurückgab, würde er sich von dem Felsen in den Abgrund stürzen – vor ihren Augen.
»Teofilo?«
»Ja?«
Voller Angst, dass sie den Ring von ihrem Finger streifte, hob er seinen Blick. Chiara war so rot im Gesicht, als wäre sie den ganzen Weg von der Burg bis hierher gerannt. War sie so wütend auf ihn? Teofilo machte sich auf das Schlimmste gefasst. Doch dann geschah etwas, was er sich so oft schon vorgestellt hatte, wenn er abends im Bett lag und an sie dachte, doch wovon er nie im Leben geglaubt hätte, dass es einmal Wirklichkeit werden würde: Statt ihm den Ring zurückzugeben, beugte Chiara sich vor und gab ihm einen Kuss – mitten auf den Mund!
»Danke«, flüsterte sie.
Teofilo war unfähig, etwas zu erwidern. Der Kuss auf seinen Lippen schmeckte noch süßer als die süßeste Brombeere. Zum Glück übernahm Chiara auch weiter das Reden.
»Ich … ich habe eine Frage.«
Teofilo räusperte sich. »Was denn?«
»Aber nur, wenn du mir versprichst, mich nicht auszulachen.« Sie schien genauso verlegen wie er.
»Versprochen!«
Sie holte tief Luft, dann sagte sie: »Weißt du eigentlich, was Männer und Frauen miteinander tun, wenn sie verheiratet sind?«
»Um Gottes willen! Wie kommst du denn darauf?«
»In zwei Jahren werden wir heiraten, und da will ich endlich wissen, was wir dann …« Sie machte eine Pause und schaute ihn an. »Du weißt es also auch nicht, oder?«
Teofilo musste schlucken. Natürlich wusste er die Antwort, seine älteren Brüder hatten es ihm erklärt, als sie dabei zugesehen hatten, wie der Hengst ihres Vaters eine Stute besprang. Aber das konnte er Chiara unmöglich sagen.
Plötzlich fiel Teofilo ein Satz ein, von dem er nicht wusste, woher er stammte, doch der alles in sich schloss, was er mit der Vorstellung von Hochzeit und Heirat und Ehe verband.
»Ich glaube, sie zeigen sich den Himmel.«
»Den Himmel?«, wiederholte Chiara staunend. »Wie soll das gehen?«
Ein Schmetterling tanzte vor ihrem Gesicht, aufgeregt flatternd stand er für einen Moment in der Luft und setzte sich dann auf ihr Knie, das nackt unter ihrer Tunika hervorschaute.
Teofilo spürte, wie ihm der Mund austrocknete, die Augen wie gebannt auf den Schmetterling gerichtet, der da auf dieser nackten Haut saß. Jetzt konnte kein Wort der Welt ihm weiter helfen – viel zu stark war das Gefühl, das ihn überkam.
»Was … was hast du?«, fragte Chiara.
Am ganzen Leib zitternd, starrte Teofilo auf den Schmetterling. Und obwohl er wusste, dass es etwas Verbotenes war, berührte er Chiaras Knie und schob seine Hand unter den Saum ihres Gewands.
7
Chiara hielt den Atem an, als sie die Hand auf ihrem nackten Schenkel spürte. Was war das für eine Gänsehaut, die plötzlich an ihren Beinen hinaufkroch, immer höher und höher, ein gleichzeitig fürchterliches und ganz wunderbares Gefühl? Teofilo zog ein Gesicht, als würde er beten. Seine großen grünen Augen, die manchmal so spöttisch und hochmütig blickten, verloren sich in ihren Anblick, und sein Mund mit den vollen Lippen stand einen Spalt weit auf. Eine schwarzbraune Locke fiel ihm in die Stirn und warf einen Schatten auf seine olivfarbene Haut. Ohne die Augen von ihr zu lassen, blies er die Locke aus seinem Gesicht, während er mit erstarrter Miene der Bewegung seiner eigenen Hand folgte. Wusste er vielleicht selber nicht, wohin sie wanderte? Das unheimliche Gefühl drang jetzt bis in Chiaras Schoß und breitete sich von dort in ihrem ganzen Körper aus. Kein einziger Laut war zu hören, nur ein leises Knacken der Zweige.
»Was … was tust du da?«
Teofilo warf die Locken aus der Stirn und schaute sie mit seinen grünen Augen an. Als sie den Glanz darin sah, erschrak sie. Diesen Glanz hatte sie schon einmal gesehen, damals, in der Basilika, bei der Kaiserkrönung, als er den schwarzen Ritter angesprungen hatte.
»Du … du machst mir Angst …«
Ihre beiden Schultern juckten gleichzeitig, aber bevor sie sich kratzen konnte, knackte und krachte es in den Zweigen, lautes Gejohle ertönte, und ein Dutzend Jungen brach in ihr Versteck ein, wie eine Horde Buschräuber. Chiara kannte die meisten Gesichter, die Angreifer waren nur ein paar Jahre älter als sie und gehörten zu den Crescentiern und Sabinern, zweier mit den Tuskulanern rivalisierenden Adelsfamilien. Wie von einer Tarantel gestochen, schoss Teofilo in die Höhe.
»Packt ihn!«, rief Ugolino, der Sohn des Sabinergrafen, der die Horde anführte.
Teofilo schlug um sich und trat nach allem, was sich bewegte, aber es waren zu viele. Die Angreifer warfen sich über ihn, drehten ihm die Arme auf den Rücken und zerrten ihn durch das Dornengestrüpp hinaus auf die Lichtung, um ihn dort an einen Baum zu binden, direkt über dem Abgrund. Eilig folgte Chiara ihnen nach.
»Zieht ihm die Hose runter!«, befahl Ugolino, als sie aus der Hecke gestolpert kam.
»Ich warne euch!«, rief Teofilo, den zwei seiner Gegner an den Armen hielten, während zwei andere den Strick festzurrten. »Wenn ihr das tut, dann …«
»Was dann?«, fragte Ugolino höhnisch.
Mit der einen Hand setzte er ein Messer an Teofilos Kehle, als wolle er ihn rasieren, während er mit der anderen Hand an seiner Hose nestelte.
»Hör auf, das reicht jetzt!«
Domenico, der Sohn des Crecentiergrafen, der Chiara die bunte Holzkette geschenkt hatte, die sie niemals trug, trat Ugolino entgegen und wollte ihm das Messer wegnehmen, obwohl der Sabiner einen Kopf größer war und doppelt so stark. Doch Ugolino dachte gar nicht daran, der Aufforderung nachzukommen.
»Aufhören? Jetzt fängt der Spaß doch erst an!«
Er stieß Domenico einfach beiseite, und bevor jemand ihn daran hindern konnte, schlitzte er den Hosenbund seines Opfers auf.
Plötzlich war Teofilo nackt.
»Na, hast du deinen Liebsten so schon mal gesehen?«
Chiara wusste nicht, wohin sie blicken sollte. Sie wollte davonlaufen, aber zwei aus Ugolinos Bande hielten sie fest und zwangen sie, alles mit anzuschauen. Gefangen in seinen Fesseln, zitterte Teofilo am ganzen Leib. Erst jetzt bemerkte Chiara, dass ihr Freund von den Dornen zerkratzt war. An den Armen, am Hals, im Gesicht – überall quoll Blut aus den Ritzen seiner Haut. Ugolino richtete die Spitze seines Messers auf Teofilo und fuhr damit an seinem Bauch entlang, ganz langsam und genüsslich.
»Na, du Winzling, sollen wir dir die Eier abschneiden?«
Während die Klinge gefährlich in der Sonne blinkte, näherte sich Hufgetrappel. Chiara fuhr herum. Aus dem Wald drang das Geräusch von splitterndem Geäst, als bräche eine Wildsau aus dem Unterholz hervor. Im nächsten Moment galoppierte ein Reiter auf die Lichtung.
»Gregorio!« Teofilo hatte seinen Bruder erkannt. »Hierher!«, rief er. »Hier bin ich!«
Gregorio parierte sein Pferd und trieb es in die Richtung des Baums, an dem Teofilo angebunden war. Unsicher ließ Ugolino sein Messer sinken. Gregorio war nicht nur mehrere Jahre älter, sondern galt auch als der stärkste junge Ritter weit und breit.
Chiara atmete auf. Doch als Gregorio sah, was los war, grinste er über das ganze Gesicht.
»Hat dir jemand die Hose geklaut, Bruderherz?« Mit gespieltem Bedauern schüttelte er den Kopf. »Tss, tss, tss. Das wird deiner Mutter aber gar nicht gefallen. Ihr kleiner Liebling splitternackt im Wald.«
»Los, Gregorio, hilf mir! Die wollen mich kastrieren!«
Sein Bruder zuckte nur mit der Schulter. »Was geht mich euer Kinderkram an?« Er wendete sein Pferd und schnalzte mit der Zunge.
»Bitte! Lass mich nicht im Stich!«
»Was ist denn heute los mit dir?«, fragte Gregorio über die Schulter. »Du bist doch sonst immer so stark! Zumindest mit deiner Klappe!«
Er nahm die Zügel auf, um davonzureiten. In diesem Moment war es um Teofilos Beherrschung geschehen. Obwohl er die Zähne so fest zusammenpresste, wie er nur konnte, und kein einziger Laut über seine Lippen drang, spritzten ihm die Tränen aus den Augen. Während die anderen in lautes Triumphgeheul ausbrachen, riss Chiara sich von Ugolino los und bedeckte Teofilos Blöße mit seinem zerschlitzten Oberkleid.
»Wie rührend!«, lachte Gregorio. »Als ob es da was zu verstecken gäbe!«
Er gab seinem Wallach schon die Sporen, als er noch einmal stutzte. Während sein Pferd nervös auf der Stelle tänzelte, beugte er sich aus dem Sattel und griff nach Chiaras Hand.
»Was ist denn das für ein Ring?«, fragte er. »Den kenne ich doch!«
Chiara fühlte sich, als habe man sie beim Stehlen erwischt. Was würde passieren, wenn Gregorio erfuhr, woher sie den Ring hatte? Gregorio war dafür bekannt, dass er vor nichts zurückschreckte. Auch nicht bei Mädchen. Angeblich hatte er die Tochter eines Ritters, die sich nicht von ihm hatte küssen lassen wollen, zu den abscheulichsten Dingen gezwungen …
Während er sie misstrauisch musterte, schlug in der Ferne eine dunkle Glocke an. Im selben Moment verstummte das Gejohle, und alle schauten in die Richtung, aus der das Geläut kam.
Ugolino wurde blass. Das war die Totenglocke der Sabiner.
Gregorio grinste über das ganze Gesicht. »Sieht so aus, als wäre dein Alter gestorben, Ugolino«, sagte er. »Dann bist du ja wohl jetzt der neue Graf! Schön für uns! Das wird vieles leichter machen.«
Er hatte noch nicht ausgesprochen, da ertönte eine zweite, ebenso dunkle Glocke, doch aus der entgegengesetzten Richtung – aus Richtung Süden, wo die Burg der Tuskulaner sich erhob.
8
Obwohl erst Oktober war, fror Ermilina in der dunklen, kaltfeuchten Halle der Burg so sehr, dass sie am liebsten ein Feuer in dem mannshohen Kamin angezündet hätte. Doch abgesehen davon, dass ihr Gatte, solange draußen noch ein einziges Blatt an den Bäumen hing, kaum Brennholz zum Heizen freigeben würde, sondern höchstens getrockneten Pferdemist, war jetzt keine Zeit zum Feuermachen. Petrus da Silva Candida, der Kanzler des Vatikans, war vor wenigen Stunden aus Rom mit einer Nachricht herbeigeeilt, wie sie schlechter nicht sein konnte: Papst Johannes XIX., Ermilinas Schwager und Bruder ihres Mannes, war im Alter von nur achtundvierzig Jahren an der Schwindsucht gestorben. Wahrscheinlich herrschte in den päpstlichen Privatgemächern dieselbe ungesunde feuchte Kälte wie in den unbeheizten, nach Blut und Hundedreck stinkenden Wohnräumen der Tuskulanerburg.
»Und wie soll es nun weitergehen?«, fragte Petrus da Silva.
Ermilina zog sich fröstelnd den Schal um die Schulter. Der Kanzler war ein junger Kardinal von gerade dreißig Jahren, eine überaus elegante Erscheinung mit seiner hoch gewachsenen Gestalt, dem makellos rasierten Gesicht und dem pechschwarzen, mit Öl geglätteten Haar. Eine etwas zu elegante Erscheinung, nach Ermilinas Geschmack. Obwohl sie den Eindruck hatte, dass Petrus da Silva allein dem Wohl der heiligen katholischen Kirche zu dienen trachtete, ihr auch nichts von einer Konkubine, mit der fast alle Vertreter der Geistlichkeit schamlos das Gelöbnis der Ehelosigkeit brachen, zu Ohren gekommen war, traute sie diesem aalglatten Menschen nicht über den Weg. Erstens war der Kanzler zu eitel für einen wahren Gottesmann – angeblich trug er eine mit Schwanenhaut gefütterte Soutane –, und zweitens hatte Ermilina ihn noch kein einziges Mal lächeln oder gar lachen sehen. Nie verzog Petrus da Silva das Gesicht, nie verlor er die Beherrschung, und sein Mienenspiel war so reglos und unergründlich wie seine grauen Augen. Vielleicht, damit niemand seine faulen braunen Zähne sah? Um seinen Mundgeruch zu bekämpfen, kaute er fortwährend Pfefferminze.
»Lasst Euch was einfallen«, polterte Alberico, während er mit seinem steifen Bein, das er seit einem Reitunfall nicht mehr beugen konnte, durch die mit Jagdtrophäen geschmückte Halle humpelte. »Hauptsache, wir behalten die Papstwürde in der Familie. Die weltliche und geistliche Macht gehören zusammen! Mein Amt als Roms erster Konsul ist ohne die Cathedra einen Scheißdreck wert!«
»Aber wer könnte die Nachfolge Eures Bruders antreten?«, erwiderte Petrus da Silva, der bei dem Fluch einmal kurz zusammengezuckt war.
»Meint Ihr, ich könnte zaubern?«, fragte Alberico zurück. »Wie Ihr wisst, habe ich bereits zwei Brüder auf den Stuhl Petri gesetzt – nicht nur Johannes, auch seinen Vorgänger Benedikt. Woher soll ich einen dritten Bruder nehmen?« Alberico blieb am Kamin vor dem ausgestopften Bären stehen, den er vor Jahren selber erlegt hatte, und strich sich mit der mächtigen Hand über die Halbglatze, die von einem bis auf die Schulter wallenden Lockenkranz umstanden war. »Himmelherrgottsakrament – dass die es auch so verdammt eilig hatten mit dem Sterben. Als hätten sie es gar nicht erwarten können, in den Himmel zu kommen. Dabei haben sie an den Unsinn doch gar nicht geglaubt!«
Ermilina war sicher, dass die letzte Bemerkung ihres Mannes den Kanzler genauso verletzt haben musste wie sie selbst. Doch statt aufzubegehren, fuhr Petrus da Silva in dem Gespräch fort, als habe er die Worte nicht gehört.
»Um ganz offen zu sein, Euer Gnaden, dachte ich weniger an einen weiteren Bruder als an einen Eurer Söhne. Vor allem an Euren Erstgeborenen, Gregorio. Wenn ich recht unterrichtet bin, kommt er bald in sein einundzwanzigstes Jahr und ist damit durchaus in einem Alter, in dem man seine Wahl in Betracht ziehen könnte.«
Alberico schüttelte den Kopf, als habe man ihm eine verdorbene Speise vorgesetzt. »Gregorio kommt nicht in Frage«, erklärte er. »Er wird für andere Aufgaben gebraucht – er soll später als Präfekt von Rom das Stadtregiment kommandieren. Außerdem, für ein geistiges Amt ist er so wenig geeignet wie der Igel zum Arschwisch.« Alberico drehte sich zu Petrus da Silva herum. Wie immer, wenn er über einen schwierigen Sachverhalt nachdachte, kniff er dabei mit offenem Mund sein linkes Auge zu. »Und was wäre, wenn ich mich selber zum Nachfolger meiner Brüder wählen ließe? Ich meine, wenn ich der Ehe entsage, und irgendein Bischof weiht mich zum Priester?«
»Was … was wollt Ihr damit sagen? Ihr wollt Euch selber zum Papst erheben?« Ermilina, die das Gespräch der Männer bislang schweigend verfolgt hatte, schnappte nach Luft. Auch wenn ihr Mann sie seit Jahren nicht mehr beschlief – eine Ehe war eine Ehe. »Das ist gotteslästerlich!«, rief sie. »Ihr seid ein verheirateter Mann! Und was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht scheiden! – Jetzt sagt Ihr doch auch was, Eminenz!«
Der Kanzler hob nur interessiert die Brauen. »Was für eine sinnreiche Idee, Euer Gnaden. Ein solcher Fall ist meines Wissens zwar noch nie vorgekommen, doch andererseits – wenn es unserer geliebten Kirche dient?« Nachdenklich rieb er sich sein glatt rasiertes Kinn. »Man müsste die Kirchenväter studieren, Augustinus, den heiligen Hieronymus. Auf jeden Fall sollten wir den Gedanken verfolgen. Vielleicht lässt sich ja ein Weg finden.«
9
Nackt, wie seine Mutter ihn vor über sechzig Jahren geboren hatte, stieg Giovanni Graziano in das eisig kalte Wasser des Bergbachs, der sich an einer Felswand unweit seiner Klause zu einem kleinen Becken staute, watete mit seinen bloßen Füßen über den glitschigen Grund, bis er die tiefste Stelle erreichte, und ging dann in die Hocke, damit das Wasser über seinem Kopf zusammenschlug.
»Die Welt vergeht mit ihrer Lust.« Mit dem Vers des Johannesbriefs auf den Lippen tauchte er unter.
Trotz seines hohen Alters, und obwohl er jeden Abend vor dem Schlafengehen Gott um Beistand gegen die Sünde bat, war er am Morgen mit einem Samenerguss aufgewacht. Was nötigte ihn, sich immer noch mit solchen Pollutionen zu beflecken? Wollte Gott ihn auf diese Weise an die Sündhaftigkeit seines Fleisches erinnern? Um ihn vor der schlimmsten aller Sünden zu bewahren, der Sünde der Superbia, der Sünde des Hochmuts wider den Heiligen Geist? Am ganzen Körper zitternd tauchte er aus dem kalten Wasser wieder auf.
»Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt.«
Gereinigt an Leib und Seele, stieg Graziano aus dem Bad und streifte sich seine leinene Kutte über, um zu seiner Klause zurückzukehren. Auch wenn die Lust des Fleisches ihn nächtens immer noch heimsuchte – gegen die Lust der Augen war er gefeit. Seit vielen Jahren schon konnte er die Farben, mit denen die Welt die Menschen verführte, so wenig unterscheiden wie ein Maulwurf. Was anderen bunt und verlockend erschien, war für ihn nur ein einziges Grau in Grau – eine Schwäche der Sinne, für die er seinem Herrgott täglich dankte.
»Ehrwürdiger Vater!«
Giovanni Graziano war so tief in seine Gedanken versunken, dass er die Frau, die vor der Einsiedelei auf ihn wartete, gar nicht bemerkt hatte.
»Contessa Ermilina! Was führt Euch zu mir?«
»Die Sorge um meinen Mann.«
»Grämt Ihr Euch, dass er nicht mehr das Bett mit Euch teilt? Ich habe Euch schon wiederholt gesagt – dazu habt Ihr keinen Grund. Ihr habt Eurem Gatten vier Söhne geboren. Der Herr hat Eure Ehe reichlich gesegnet.«
»Ach, wenn es nur das wäre. Aber es ist viel schlimmer.«
»Dann spannt mich nicht auf die Folter.«
»Mein Mann will sich von mir trennen – um sich zum Papst erheben zu lassen!«
»Was sagt Ihr da?«