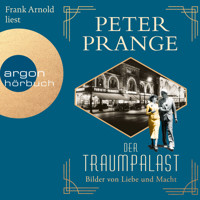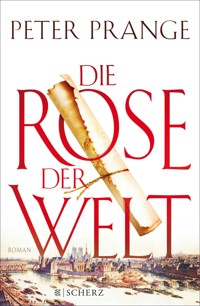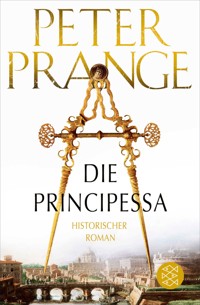12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte von Liebe und Freundschaft über alle Grenzen hinweg. In einem Europa, das es einmal gab, bevor es sich selbst zerstörte. Karlsbad, 1871. Die Zeit der Kriege scheint für immer vorbei, im böhmischen Kurort treffen sich Gäste aus ganz Europa. So auch Vicky, Tochter einer Londoner Industriellenfamilie, die den Ärmelkanal untertunneln will, um England mit dem Kontinent zu verbinden; Paul, ein Berliner Ingenieur, der hofft, am Bau einer Prachtstraße namens Kurfürstendamm mitzuwirken; und Auguste Escoffier, angehender Meisterkoch aus Paris, dessen Name zum Inbegriff der französischen Kochkunst werden soll. Vereint im Glauben, dass herrliche Zeiten anbrechen, werfen die drei sich ins Leben und in die Liebe. Von großen Träumen beseelt ahnen sie nicht, dass Europa schon bald von Erschütterungen heimgesucht wird, die nicht nur den Frieden bedrohen, sondern auch ihr persönliches Lebensglück. Die große Dilogie zur Jahrhundertwende: verblüffend aktuell, atmosphärisch dicht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Peter Prange
Herrliche Zeiten
Die Himmelsstürmer
Roman
Über dieses Buch
Karlsbad, 1871. Die Zeit der Kriege scheint für immer vorbei, und in dem böhmischen Kurort à la mode kommen wieder Badegäste aus ganz Europa zusammen. Hier begegnen sich drei junge Menschen: Vicky ist die Tochter einer Londoner Industriellenfamilie, die den Ärmelkanal untertunneln will, um England mit dem Kontinent zu verbinden; sie selbst will die Welt, die sich vor ihr auftut, mit allen Sinnen entdecken. Paul, ein Berliner Ingenieur, träumt davon, in der Hauptstadt des jungen Kaiserreichs am Bau einer Prachtstraße namens Kurfürstendamm mitzuwirken, als die Familienfirma einen schweren Schlag erleidet. Auguste Escoffier will als zukünftiger Meisterkoch aus Paris die französische Küche entscheidend prägen, auch wenn seine Künste noch nicht gewürdigt werden.
Alle drei glauben fest daran, dass herrliche Zeiten anbrechen werden und machen sich auf, ihren Weg zu Erfolg und Erfüllung zu gehen, auch wenn dunkle Wolken über Europa aufziehen. Angetrieben von großen Träumen ahnen sie nicht, wie stark die politischen Umbrüche den Frieden erschüttern und auch ihr eigenes Leben verändern werden. Eine Schicksalsbegegnung zu dritt. In einer Welt, in der ein offenes Europa möglich schien, bis es sich selbst zerstörte.
Der erste Band der großen Dilogie zur Jahrhundertwende. Band 2 erscheint im Herbst 2025.
Weitere Titel von Peter Prange:
»Der Traumpalast. Im Bann der Bilder«, »Der Traumpalast. Bilder von Liebe und Macht«, »Eine Familie in Deutschland. Zeit zu hoffen, Zeit zu leben«, »Eine Familie in Deutschland. Am Ende die Hoffnung«, »Winter der Hoffnung«, »Unsere wunderbaren Jahre«, »Das Bernstein-Amulett«, »Himmelsdiebe«, »Der Kinderpapst«, »Die Rose der Welt«, »Ich, Maximilian, Kaiser der Welt«, »Die Rebellin«, »Die Philosophin«, »Die Principessa«, »Die Gärten der Frauen«, »Werte: Von Plato bis Pop – alles, was uns verbindet«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Bestsellerautor Peter Prange ist der große Erzähler der deutschen und europäischen Geschichte. Als Autor aus Leidenschaft gelingt es ihm, die eigene Begeisterung für seine Themen auf Leser und Zuhörer zu übertragen. Die Gesamtauflage seiner Werke beträgt weit über drei Millionen. ›Herrliche Zeiten‹ ist sein fünfter großer Deutschland-Roman. Die Vorläufer sind Bestseller, etwa seine Romane in zwei Bänden, ›Eine Familie in Deutschland‹ und ›Der Traumpalast‹. ›Das Bernstein-Amulett‹ wurde erfolgreich verfilmt, der TV-Mehrteiler zu ›Unsere wunderbaren Jahre‹ begeisterte in zwei Staffeln ein Millionenpublikum. Der Autor lebt mit seiner Frau in Tübingen.
Impressum
Zu diesem Buch ist bei Argon ein Hörbuch erschienen.
Erfahren Sie mehr über Peter Prange und seine Romane auf www.facebook.com/peterprange
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2024 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, München.
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: Eugene Boudin / Lefevre Fine Art Ltd., London / Bridgeman Images
ISBN 978-3-10-491439-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Vorbemerkung
[Motto]
Erstes Buch Die Himmelsstürmer
Prolog Karlsbad
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
Teil 1 Fraises Victoria
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
Teil 2 Der Tunnel
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
Teil 3 Der Boulevard
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
Danke
Liste der handelnden Personen
Deutschland
England
Frankreich
Weitere Personen
[Newsletter von Peter Prange]
Für Rolf Schnellecke
zum 80. Geburtstag.
In Freundschaft.
Vorbemerkung
Die nachfolgende Geschichte ist, obwohl angelehnt an historische Ereignisse, frei erfunden. Rückschlüsse auf die tatsächliche Lebenswirklichkeit der geschilderten Personen sollen in keiner Weise nahegelegt oder ermöglicht werden. Die einzelnen Handlungsstränge sind ebenso wie die Lebenswege der Protagonisten Erfindungen des Autors. Dies gilt insbesondere für deren politische Verstrickungen und die Schilderung ihrer Privatsphäre. Alle intimen Szenen sowie die Dialoge und die Darstellung der Gefühlswelt des gesamten Romanpersonals sind reine Fiktion.
»Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel also auch auf Erden.«
Evangelium nach Matthäus, 6,10f.
»Alle die fahlen Rosse der Apokalypse sind durch mein Leben gestürmt, Revolution und Hungersnot, Geldentwertung und Terror, Epidemien und Emigration. Ich habe die großen Massenideologien unter meinen Augen wachsen und sich ausbreiten sehen, vor allem die Erzpest, den Nationalismus, der die Blüte unserer europäischen Kultur vergiftet hat.«
Stefan Zweig, ›Die Welt von Gestern‹
Erstes BuchDie Himmelsstürmer
1871–1900
»Wie in einen Lostopf greifst du in die dunkle Zukunft:
Was du fassest, ist noch zugerollt,
Dir unbewusst, sei’s Treffer oder Fehler.«
Goethe, ›Egmont‹, Vierter Aufzug
PrologKarlsbad
1871
1
Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee weckte Vicky aus unruhigen Träumen, zusammen mit einer wohlvertrauten Stimme.
»Aufstehen! Frühstück!«
Wie jeden Morgen war sie sofort hellwach. Doch als sie die Augen aufschlug, war nichts wie an anderen Morgen. Das Zimmer war nicht ihr Zimmer, das Bett nicht ihr Bett. Nur ihre Gouvernante Roberta stand wie gewohnt vor ihr, mit einem Kleid über dem Arm, das glatte, scheitellos nach hinten gekämmte Blondhaar im Nacken geknotet, das Gesicht eine einzige, strenge Mahnung.
»Raus aus den Federn!«
»Wo … wo bin ich?«
»Hast du das wirklich vergessen?« Roberta schüttelte den Kopf. »Nachdem du dich so sehr darauf gefreut hast?«
Vicky blickte sich um. Ein heller Lichtstrahl brach durch einen Spalt zwischen zwei schweren Vorhängen, die von einer hohen stuckverzierten Zimmerdecke herabhingen. Natürlich, sie war auf dem Kontinent – die Europareise, die ihre Mutter und Onkel Georgie ihr zum Geburtstag geschenkt hatten!
Im selben Moment durchströmte sie ein herrliches Glücksgefühl, dasselbe freudig jauchzende Gefühl der Erwartung, das sie schon als kleines Mädchen verspürt hatte, wenn sie an einem Geburtstagsmorgen die Augen aufschlug. Konnte es etwas Schöneres geben, als in einer neuen, unbekannten Welt aufzuwachen, die nur darauf wartete, entdeckt zu werden?
Sie sprang aus dem Bett und eilte ans Fenster, um einen ersten Blick auf diese Welt zu werfen. Am Abend bei der Ankunft hatte sie in der Dunkelheit ja kaum etwas gesehen.
Als sie die Vorhänge zurückzog, flutete heller Sonnenschein ins Zimmer. Mit beiden Armen öffnete sie die Fensterflügel, und während sie die frische Morgenluft in ihre Lungen strömen ließ, schaute sie hinaus auf den Vorplatz des Grandhotel Pupp, in dem sie wie die meisten englischen Kurgäste von Stand in Karlsbad logierte. Ein neuer, wunderbarer Tag brach an, voller aufregender, unvorhersehbarer Abenteuer! In dem böhmischen Kurort à la mode am Ufer der Tepl, fernab der Welt und doch mitten in Europa gelegen, kamen alljährlich Hunderttausende Kurgäste zusammen, aus allen Ländern des Kontinents, im Vertrauen auf die Heilkräfte der hier sprudelnden Quellen, die angeblich schon in der Römerzeit Gesundheit und Wohlergehen versprachen. Wer an diesen Ort kam, so die Fama, werde ihn geheilt verlassen.
Mit ihren siebzehn Jahren gedachte Vicky von den Kuranwendungen keinen Gebrauch zu machen, dafür aber umso mehr von den hier herrschenden Freiheiten. Anders als in London, wo ihre Mutter ein strenges Regiment führte und sie keinen Schritt ohne Roberta vor die Tür setzen durfte, konnten laut Baedeker junge, unverheiratete Frauen wie sie sich in Karlsbad ohne Aufsicht in der Öffentlichkeit zeigen. Die Kurpromenade stand in dem Ruf, eine Art Freilichtbühne zu sein, wo Fremde beiderlei Geschlechts einander so zwanglos begegneten wie sonst kaum irgendwo auf dem ohnehin sehr freizügigen Kontinent, und es hieß, dass unter den Kolonnaden Bekanntschaften gemacht würden, die nicht selten zu ausgelassenen Gelagen im Grünen führten und manchmal gar zu heimlichen Verabredungen tête-à-tête in den umliegenden Wäldern.
Noch aber herrschte Ruhe auf den Straßen, nur ein paar Frühaufsteher pilgerten mit ihren Schnabeltassen zu den Kuranlagen, vorbei an den mondänen Hotels und schmucken Privatpensionen, die sich wie Perlenschnüre an beiden Ufern des Flusses aneinanderreihten, während die träge dahinfließende Tepl mit ihren Lichtreflexen noch verschlafen in die Sonne blinzelte. Alles atmete einen so tiefen Frieden, als könnte es gar nicht anders sein. Dabei war es noch vor wenigen Wochen ungewiss gewesen, ob man die Reise überhaupt würde antreten können. Drei Kriege, in denen Deutschland sich einen Platz in der ersten Reihe unter den Nationen Europas erobert hatte, hatten den Kontinent ein Jahrzehnt lang in Angst und Schrecken versetzt, zuletzt in dem wütenden Völkerringen der Erbfeinde Deutschland und Frankreich, Höhepunkt einer jahrhundertealten Fehde, die nach der Niederlage der Franzosen im Winter dieses Jahres plötzlich wieder auszubrechen drohte, als der König von Preußen sich ausgerechnet in Versailles zum deutschen Kaiser hatte krönen lassen. Onkel Georgie, der Reisen hasste und England nur unter Protest verließ, hatte schon gehofft, dass das Schicksal ihm auf diese Weise die Reise ersparen würde und er in seinem geliebten London bleiben konnte. Doch dann hatten Deutschland und Frankreich nach langen, zähen Verhandlungen Frieden geschlossen, so dass die Menschen wieder aus ganz Europa nach Karlsbad reisten, um die Kur zu gebrauchen.
Vicky ließ ihren Blick über die Hügel auf der anderen Talseite schweifen. Irgendwo in den dunklen Wäldern musste sich der Dianaturm verbergen, wo sich laut Baedeker Liebespaare heimlich trafen, doch zu ihrem Missvergnügen konnte sie ihn nirgendwo entdecken.
Ob sie hier wohl auch Bekanntschaften machen würde, die zu einem Gelage im Grünen oder gar einem Tête-à-tête am Dianaturm führten?
»Da! Eine Nymphe!«
»Wo?«
»Da oben, am Fenster! Im Nachthemd!«
Zwei Bäckerjungen schauten lachend von der Straße herauf. Noch bevor Vicky reagieren konnte, zerrte Roberta sie vom Fenster fort.
»Jetzt aber Tempo! Deine Mutter und dein Onkel sind schon beim Frühstück.«
Die Mahnung zur Eile war überflüssig, Vicky konnte es ja selbst kaum erwarten, den neuen Tag zu beginnen. Sie beschränkte die Morgentoilette darum nur auf das Allernotwendigste: einmal schnell die Zähne geputzt und eine kurze Katzenwäsche – das musste heute reichen. Nachdem sie sich mit Robertas Hilfe angekleidet hatte, warf sie noch einen Blick in den Spiegel. Eigentlich hatte sie allen Grund, mit dem Anblick zufrieden zu sein: türkisfarbene Augen, schwarze Locken, voller roter Mund. Das Einzige, was sie an ihrem Aussehen störte, war die Tatsache, dass sie ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten war.
Während Roberta die verstreut im Zimmer herumliegenden Kleidungsstücke auflas, trat Vicky hinaus auf den Flur. Um den Weg zum Frühstücksraum abzukürzen, nahm sie den Dienstbotenabgang. Erst jetzt spürte sie, wie hungrig sie war. Doch als sie im Erdgeschoss ankam, hörte sie plötzlich seltsame Laute. Was war das? Das Hoteläffchen Pippo, das gestern bei ihrer Ankunft in der Halle seine Faxen gemacht hatte? Hatte es sich womöglich aus seinem Käfig befreit?
Sie verharrte. Nein, das waren keine Tierlaute, das waren menschliche Stimmen, sie gehörten zwei Männern, die sich ein leises, gepresstes Wortgefecht lieferten, auf Deutsch und Französisch.
Durch die halb offene Tür eines Wirtschaftsraums sah sie die beiden, sie waren vielleicht sechs, sieben Jahre älter als sie: ein hübscher, zierlicher Franzose mit pechschwarzen Augen und ebensolchem Oberlippenbart und ein hochgewachsener, breitschultriger Deutscher mit glattrasiertem Gesicht und blondem Bürstenhaar.
Zwei Hotelangestellte?
Obwohl es sich ganz und gar nicht gehörte, trat Vicky näher, um zu lauschen – ihre Neugier hatte mehr Macht über sie als ihre gute Erziehung. Dank einer französischen Nanny, die sie bis zum zwölften Lebensjahr großgezogen hatte, und Roberta, die aus Berlin stammte und ausschließlich Deutsch mit ihr sprach, verstand sie jedes Wort. Die zwei Streithähne bekriegten einander mit so verbissener Wut, dass vor Vickys innerem Auge plötzlich Schlachtenbilder auftauchten, die sie aus der Times kannte, mit Heerscharen von Soldaten sowie Verwundeten und Toten – fast glaubte sie, den Kanonendonner zu hören und den Pulverdampf zu riechen!
2
Vom Donner der Kanonen dröhnten Paul die Ohren, und der Pulverdampf brannte ihm in den Augen. Durchnässt bis auf die Haut, die Pickelhaube auf dem Kopf, spähte er mit dem Fernglas über den Rand des Schützengrabens. Wie ein feuerspeiender Drache erhob sich die Festung Metz mit ihren Türmen und Bollwerken in den grauen Himmel, von dem der Regen in Kübeln herabströmte, und während die Erde im Morast versank, feuerten die Franzosen aus allen Rohren.
Würden sie heute den Ausbruch wagen?
Paul hatte die Nacht kein Auge zugetan, und vor Hunger knurrte ihm der Magen. Drei Monate dauerte die Belagerung schon an, und dreimal hatten die Franzosen versucht auszubrechen.
Während ihm der Regen in den Nacken rann, stellte er die Schärfe seines Fernglases nach. Da flogen die Tore der Zitadelle auf, in Scharen stürmte der Feind aufs Feld, zu Hunderten, zu Tausenden, und überall blitzte Mündungsfeuer auf.
Dann ein ohrenbetäubender Knall, und gleich darauf ein Schlag, als würde die Erde bersten.
Auf einmal war alles schwarz und still.
Als Paul zu sich kam, schmerzte ihn jeder Muskel im Leib. Der Helm war ihm vom Kopf geflogen, in seinem Schädel hämmerte es wie in einer Schmiede, und auf den Lippen schmeckte er Blut. Hatte es ihn erwischt? Seine Lider waren schwer wie Blei, blinzelnd öffnete er die Augen. Um ihn herum lagen Tote und Verletzte, und mit gefletschten Zähnen grinste ihn das zerschossene Gesicht des Zahlmeisters an.
Aber er war davongekommen, er lebte!
Da ertönte die Stimme seines Kompaniechefs.
»Aaaaaattacke!«
Mit Gebrüll sprangen links und rechts von ihm Kameraden aus dem Graben. Mühsam rappelte er sich wieder auf, dann nahm er sein Gewehr und den Helm, und so schnell er konnte, kletterte auch er aus dem Graben, um den anderen hinterherzustolpern.
Sieg oder Tod!
Wie ein unablässig grollendes Gewitter drang der Geschützdonner in den Verschlag, der in der eingeschlossenen Festung als Küche für das Offizierscasino diente. Während Auguste sein Messer wetzte, um für General Bazaine und die Stabsoffiziere das letzte Fleischgericht zuzubereiten, wurde der Schlachtenlärm übertönt vom Meckern der Ziege, die er in der Küche gefangen hielt. Mit den Hörnern voran rannte das verängstigte Tier wieder und wieder gegen die Bretterwände, in der verzweifelten Hoffnung, seinem Schicksal zu entkommen.
Ahnte es, dass der Tod schon wartete?
Mit dem Daumen prüfte Auguste die Schärfe der Klinge. Zu Beginn der Belagerung hatte er noch aus dem Vollen schöpfen können, ein Planwagen mit Kisten voller Würste und Dosenfisch, Trockengemüse und Fleischextrakt, Branntwein und Kaffee hatte es vor der Einkesselung noch mit knapper Not in die Festung geschafft. Auch hatte er unweit der Zitadelle einen kleinen Bauernhof einrichten können, mit Hühnern und Enten und Gänsen, zwei Schweinen, einem Schaf sowie einer Ziege, und als die Fleischvorräte schrumpften, hatte er mit Erlaubnis des Kommandanten Kavalleriepferde geschlachtet – dank seines pot-au-feu de cheval galt das Offizierscasino als Feinschmeckeroase inmitten der verhungernden Stadt, in der zwanzigtausend Soldaten an der Ruhr daniederlagen. Doch irgendwann hatte es auch keine Pferde mehr gegeben, und jetzt, nach drei Monaten Belagerung, war nur noch diese eine Ziege als einziges Stück Schlachtvieh übrig. Auguste wollte sie zu einem Ragout verarbeiten, ein Ragout war ergiebiger als ein Braten. Am Morgen hatte er das Tier noch einmal gemolken, mit Wasser verdünnt konnte die Milch als Basis für eine Sauerampfersuppe wertvolle Dienste leisten.
Mit sicherem Griff packte er die Ziege. Doch als er ihr das Messer an die Kehle setzte, stutzte er.
Was war das? Der Geschützlärm war verstummt und einer unheimlichen Stille gewichen.
Irritiert schaute er zum Fenster hinaus.
Über der Zitadelle wehte eine weiße Fahne.
Das konnte nur eins bedeuten: General Bazaine hatte kapituliert.
3
Ja, Leute totschießen, das könnt ihr! Mörder seid ihr! Barbaren!«
»Ihr habt den Krieg angefangen, nicht wir! Wir haben uns nur verteidigt!«
»Schon euer Essen! Das verfüttert man bei uns nicht mal an die Schweine!«
»Ihr seid ja nur schlechte Verlierer! Weil wir euch den Arsch versohlt haben!«
»Sale boche!«
»Elender Küchenschwengel!«
Bei dem letzten Wort explodierte der Franzose. Obwohl er einen Kopf kleiner war, sprang er dem Deutschen an die Gurgel.
Ohne zu überlegen, was sie tat, fuhr Vicky dazwischen: »Arrêtez! Aufhören! Alle beide! Tout de suite!«
Zu ihrer Überraschung hielten beide tatsächlich inne.
»Bitte verzeihen Sie, gnädiges Fräulein«, sagte der Deutsche, sichtlich verlegen. »Wir hatten ja keine Ahnung, dass man uns hören kann …«
»Oui, Mademoiselle«, pflichtete der Franzose bei, »es ist uns sehr peinlich. Mille fois pardon …«
Energisch trat Vicky auf die zwei zu. »Sie sollten sich schämen, meine Herren. Ist es nicht genug, dass Ihre Soldaten sich fast ein Jahr lang gegenseitig totgeschossen haben?« So streng sie konnte, blickte sie erst den Franzosen, dann den Deutschen an. »Ihrem Alter nach müssten Sie wohl dabei gewesen sein? Habe ich recht?«
Die beiden verstummten.
»Und«, fragte sie. »Hat Ihnen das Vergnügen bereitet?«
»Vergnügen? Nein!«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Weil Sie offenbar immer noch nicht genug davon haben.«
Der Deutsche lief rot an, und der Franzose schlug die Augen nieder. Vicky registrierte es mit Genugtuung.
»Erkenne ich da eine gewisse Einsicht? Bravo, meine Herren! Offenbar haben Sie begriffen, wie kindisch Ihr Verhalten war. Dann kann ich ja jetzt beruhigt frühstücken.«
Sie wollte sich abwenden, aber der Franzose hielt sie zurück.
»Bitte noch einen Moment, Mademoiselle.«
»Was denn noch? Mir knurrt der Magen.«
»Geben Sie uns die Möglichkeit, unseren Fehler wiedergutzumachen.«
»Ja, das wäre auch in meinem Sinn«, fiel der Deutsche ein. »Als Reparationsleistung, sozusagen.«
Beide lächelten sie an, der Franzose mit einem Augenzwinkern, der Deutsche leicht verlegen, doch das machte sein Lächeln nur noch reizender. Konnte es sein, dass die zwei mit ihr flirteten? Vicky war entzückt. Offenbar hatte der Baedeker nicht zu viel versprochen!
Einen Moment dachte sie nach, dann sagte sie: »Würden die Herren mir bitte verraten, in welcher Eigenschaft Sie hier im Hause tätig sind?«
»Meine Aufgabe ist es, für das leibliche Wohl der Gäste zu sorgen«, erklärte der Franzose.
»Das heißt, Sie sind Koch?«
»Mit Leib und Seele, Mademoiselle.«
Sie wandte sich an den Deutschen. »Und Sie?«
»Ich leite den Bau des neuen Ballsaals. Aber warum fragen Sie?«
»Weil ich eine Idee habe, wie Sie Ihren Fauxpas wiedergutmachen können.«
»Nämlich?«
»Nicht jetzt«, sagte sie. »Ich werde an der Rezeption die nötigen Anweisungen für Sie hinterlegen. Allerdings bräuchte ich dafür Ihre Namen.«
Der Deutsche machte eine etwas ungelenke Verbeugung. »Paul Biermann.« Dabei lächelte er wieder sein schüchternes Lächeln, das ihm wirklich ausgezeichnet stand.
Noch während sie sein Lächeln erwiderte, nahm der Franzose ihre Hand und deutete einen Handkuss an. »Auguste Escoffier. Aber ›Auguste‹ bitte in der französischen Aussprache – Ogüüüst. Mit Betonung auf der zweiten Silbe und ohne ›e‹ am Ende.«
4
Die nächsten zwei Tage kamen Vicky vor wie eine Ewigkeit. Ob bei den Mahlzeiten im Hotel, beim Spaziergang im Kurpark oder auf der Promenade, beim Kurkonzert oder bei den Wasserkuren, zu denen sie sich entschloss in der Hoffnung, auf diese Weise ihrer inneren Unruhe Herr zu werden – wo immer sie ging und stand, hatte sie nur einen Gedanken: Was würde am dritten Tag passieren?
Wie angekündigt, hatte sie an der Rezeption zwei Billetts für ihre Kavaliere hinterlegt. Darin hatte sie diesen nicht nur mitgeteilt, welche Reparationsleistungen sie erwartete, sondern sie auch zur Ausführung der Wiedergutmachung an jenen Ort bestellt, der für sie Inbegriff von Freiheit und Abenteuer war.
Obwohl sie am Morgen des dritten Tags überpünktlich zum Frühstück erschien, saß ihre Mutter bereits am Tisch. Sie sahen einander tatsächlich zum Verwechseln ähnlich, nur dass sich in das Gesicht der Mutter die Sorgen und Nöte eines bereits zweiundvierzig Jahre währenden Lebens eingeprägt hatten, von denen in Vickys Zügen noch keine Spur zu finden war. Dafür war die Mutter umso perfekter frisiert und geschminkt, ganz die große Dame, als die sie in London auftrat. Ihr gegenüber am Tisch saß ihr jüngerer Bruder, Onkel George, von jedermann »Georgie« genannt, ein Dandy mit extravagantem, braun-weiß gestreiftem Leinenanzug, der gerade mit ausgesuchten Manieren sein Porridge zu sich nahm, auf dem er wie überall auf ihrer Europareise anstelle des kontinentalen Frühstücks bestanden hatte.
Die zwei sprachen von ihren Plänen für den Tag, doch Vicky war unfähig, dem Gespräch zu folgen. Um elf am Dianaturm … Während sie vor Aufregung kaum einen Bissen runterbekam, verkündete die Mutter, dass sie eine Konzertmatinée besuchen wolle – ob jemand sie begleite? Onkel Georgie zeigte wenig Neigung, er sei auf der Kurpromenade verabredet.
»Du weißt ja, die heilenden Kräfte der hiesigen Quellen.«
»Ja, ja. Vermutlich dargereicht von der hübschen Balletteuse, die du gestern Abend in der Garderobe mit einem Armvoll Rosen aufgesucht hast.«
»Wie gut du mich doch kennst, liebe Schwester.«
Die Mutter köpfte ihr Frühstücksei. »Bist du nicht langsam zu alt für diese Junggesellenallüren? Wann wirst du endlich eine Familie gründen?«
Onkel Georgie zog sein unschuldigstes Unschuldsgesicht. »Warum sich mit einer einzelnen Rose begnügen, wenn Gott in seiner Güte Abermillionen erblühen ließ?«
Die Mutter verdrehte die Augen. »Und du?«, wandte sie sich an Vicky. »Was sind deine Pläne?«
Vicky hatte mit der Frage gerechnet, und so beiläufig wie möglich trug sie ihre vorbereitete Ausrede vor: »Ich denke, ich nehme an der Waldführung teil, die die Kurdirektion für heute angekündigt hat. Eine Erkundung der hiesigen Flora und Fauna. Das wird wohl mehrere Stunden in Anspruch nehmen.«
Die Mutter, die gerade ihren Eierlöffel zum Mund führte, hielt in der Bewegung inne. »Seit wann interessierst du dich für die Natur? Das ist doch gar nicht deine Art!«
Vicky fürchtete, unter dem Blick der Mutter zu erröten, doch zum Glück kam Onkel Georgie ihr zu Hilfe. »Das ist doch ein Grund zur Freude, Schwesterherz! Deine Tochter kommt ins heiratsfähige Alter, da wird es höchste Zeit, dass sie alles über das Leben der Bienen und Schmetterlinge erfährt.«
»Hältst du wohl deinen Mund? Das Thema ist zu ernst für deine Albernheiten. Es geht um Vickys Zukunft!«
Bei der Replik ihrer Mutter bekam Vicky plötzlich Angst vor der eigenen Courage. Vor lauter Vorfreude auf ihr Abenteuer hatte sie keinen Gedanken daran verschwendet, wie abenteuerlich dieses Abenteuer womöglich werden könnte. War sie verrückt gewesen, sich mit zwei wildfremden Ausländern zu verabreden? Ohne Begleitung? Auf einmal erschien ihr ein Kurkonzert gar nicht so unattraktiv. Man würde Werke von Johann Strauß Vater und Sohn zu Gehör bringen, und dabei ließ sich wunderbar träumen. Doch andererseits, wenn sie sich vorstellte, dass sie den Tag mit Träumen verbringen würde, während am Dianaturm vielleicht das wirkliche Leben auf sie wartete … Wie immer, wenn sie in Entscheidungsnot war, suchte sie im Geist Rat bei ihrem verstorbenen Vater. Und wie immer hatte der eine Idee: Wahrscheinlich war es ihren Kavalieren ja gar nicht möglich, zu der Verabredung zu erscheinen. Die zwei waren ja nicht zum Vergnügen in Karlsbad, sie mussten arbeiten, um Geld zu verdienen. Und selbst wenn sie sich freinehmen könnten, war ihnen inzwischen sicher bewusst geworden, wie ungehörig ein solches Treffen wäre – die Herren waren ja weit unter ihrem Stand … Nein, es war doch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das Rendezvous à trois stattfinden würde … Bei dem Gedanken beruhigte sie sich ein wenig, doch eine Frage blieb: Wie sollte sie herausfinden, ob es so war oder nicht?
Während die Mutter sich wie nach jeder Mahlzeit eine Verdauungszigarette anzündete und Onkel Georgie sich in die Times vertiefte, um die nächste Stunde wenigstens im Geiste in London zu verbringen, verließ sie den Frühstückstisch, um sich Gewissheit zu verschaffen. Doch als sie die ganz in Rosa und Stuck und Marmor gehaltene Eingangshalle betrat, herrschte dort große Aufregung. Das Äffchen Pippo war aus seinem Käfig ausgebrochen, verzweifelt suchten die Portiers und Pagen nach dem kleinen Faxenmacher, aber der war wie vom Erdboden verschwunden.
Es dauerte darum eine gehörige Weile, bis jemand Zeit für Vicky und ihr Anliegen hatte. Doch ihre Hoffnung, dass ihre Kavaliere ihr die Entscheidung abgenommen hätten, erfüllte sich nicht. Monsieur Escoffier und Herr Biermann, so die Auskunft des Chefportiers, hatten ihre Billetts schon vor drei Tagen abgeholt – kaum dass Vicky diese an der Rezeption deponiert hatte.
5
Ohne noch einmal auf ihr Zimmer zurückzukehren, machte Vicky sich auf den Weg. Da dieser durch den Wald führte, hatte sie ihre Stiefeletten, mit denen es sich so wunderbar über die Kurpromenade stöckeln ließ, schon vor dem Frühstück gegen derbes Schuhwerk getauscht, das zum Glück unter ihren bodenlangen Röcken verschwand, so dass ihre Mutter und Onkel Georgie keinen Verdacht hatten schöpfen können. Der Dianaturm befand sich auf einer Anhöhe, die sich unmittelbar hinter dem Hotel erhob – kein Wunder, dass sie ihn von ihrem zum Fluss hinausgehenden Zimmer nicht gesehen hatte. Als sie sich an der Rezeption nach dem Turm erkundigt hatte, hatte der Portier ihr verschwörerisch zugezwinkert, doch ein einziger Blick hatte genügt, um ihn in die Schranken zu weisen, so dass er sich im Nu wieder in den dienstbaren Geist zurückverwandelte, der zu sein seiner Stellung entsprach, und statt sich weiter eine Vertraulichkeit anzumaßen, die Vicky ihm unmöglich zugestehen konnte, hatte er ihr wortreich zur Wahl ihres Ausflugsorts gratuliert – die Aussicht von dem Turm sei eine ganz und gar außerordentliche, und wer sie nicht kenne, der sei ja gar nicht wirklich in Karlsbad gewesen.
Der Aufstieg auf den Hügel war am bequemsten von einer Gasse aus zu erreichen, die sich an den Vorplatz des Hotels anschloss, doch um unnötiges Aufsehen zu vermeiden, verließ Vicky das Gebäude durch den Hinterausgang, von wo aus eine Folge steiler Treppen hinauf in den Wald führte. Mit jeder Stufe, die sie erklomm, schlug ihr Herz ein bisschen schneller. In London war sie keine Sekunde am Tag wirklich frei; sobald sie das Haus verließ, folgte Roberta ihr wie ein Schatten, die Gouvernante brachte sie zur Tanzstunde und zum Musikunterricht und holte sie von dort auch wieder ab; jedes Buch, das sie las, wurde kontrolliert; und damit sie auch zu Hause keinen unbestimmten oder gar gefährlichen Gedanken nachhing, hielt man sie fortwährend an, Klavier zu üben oder zu sticken oder zu zeichnen oder fremde Sprachen oder Kunst- und Literaturgeschichte zu lernen. Doch hier im Wald herrschte nichts als Natur. Geheimnisvoll duftete es nach Moos und Tannen, kühle und warme Abschnitte wechselten zwischen den Laub- und Nadelbäumen einander ebenso ab wie Licht und Schatten, und während der elastische Waldboden unter den Füßen zu federn schien und sie mit gerafften Röcken den Hang hinaufeilte, fühlte sie sich so frei wie die Vögel, deren Zwitschern sie auf ihrem Weg begleitete. Natürlich war es verrückt, sich heimlich mit zwei Männern zu treffen, die nicht nur weit unter ihrem Stand, sondern ihr auch vollkommen fremd und obendrein Ausländer waren. Aber war es deshalb falsch? Nein, sie war schließlich hier, um Abenteuer zu erleben, und sie wusste, später würde sie es bitterlich bereuen, wenn sie auf ein solches Abenteuer verzichtete, nur weil sie sich nicht traute. Denn am Ende des Lebens, so hatte sie mal in einem Roman gelesen, bereue jeder Mensch weniger das, was er getan, als was er nicht getan habe.
Was würde sie am Dianaturm erwarten?
Sie war von dem Aufstieg leicht erhitzt, als sie die Lichtung erreichte, die sie in ihren Billetts angegeben hatte. Sie hatte darin als »Reparationsleistung« ein Picknick verlangt – der Franzose sollte für Speisen und Getränke sorgen, der Deutsche für die Bequemlichkeit und Unterhaltung. Doch als sie sah, was die beiden vorbereitet hatten, gingen ihr die Augen über: Das war kein Picknick, sondern ein veritables Déjeuner. Auf einer Wiese war eine so große Decke ausgebreitet, dass man sich bequem zu dritt darauf niederlassen konnte, dahinter war eine Stellage aufgeschlagen, auf der ein Dutzend Tiegel und Töpfe in der Sonne blitzten, flankiert von feinstem Porzellan und Silberbesteck, während auf einem Tisch im Schatten mehrere mit Kühlmanschetten versehene Flaschen samt Gläsern bereitstanden.
»Herzlich willkommen!«
»Soyez la bienvenue!«
Vicky hätte am liebsten vor Freude gejauchzt, doch das kam natürlich nicht in Frage. Während sie ein Gesicht zog, als hätte sie nichts anderes erwartet, verbeugten sich ihre Kavaliere wie Schauspieler auf einer Theaterbühne. Die zwei hatten nicht nur den Ort, sondern auch sich selbst herausgeputzt: Auguste trug eine schwarze Samtjacke und dazu ein ebenfalls schwarzes Samtbarett, Paul ein kariertes Sportsakko sowie Knickerbocker. Die Vorstellung, dass die beiden sich für sie derart ins Zeug gelegt hatten, schmeichelte Vicky mehr, als sie sich eingestehen mochte – und machte ihr gleichzeitig ein kleines bisschen Angst. Was, wenn die Herren »Absichten« hatten? Für einen Moment musste sie an ein Ölgemälde denken, das sie vor Jahren bei einem Parisbesuch gesehen hatte: zwei elegant gekleidete Männer bei einem Picknick im Grünen, und zwischen ihnen eine splitternackte Frau. Ein Künstler namens Manet oder Monet hatte es gemalt, sie konnte die Namen nie auseinanderhalten.
Aber die Verunsicherung dauerte nur eine Sekunde. Unsinn, sie war schließlich das Gegenteil von splitternackt! Sie trug eine hochgeschlossene, doppelt geknöpfte Rüschenbluse und dazu ein halbes Dutzend Röcke, die nicht nur ihre Waden, sondern auch ihre Knöchel bedeckten – und darunter eine so enge Korsage, dass es ihr nur mit Mühe gelang, sich einigermaßen anmutig auf der Decke niederzulassen. Noch während sie versuchte, eine irgendwie bequeme Stellung einzunehmen, reichte Auguste ihr schon einen Teller mit etwas darauf, das wie ein Törtchen aussah.
»Bon appétit!«
Mit der Hand führte sie den Bissen zum Mund. Im nächsten Moment war alles andere vergessen. So etwas Köstliches hatte sie ihr Lebtag nicht gegessen! Sie hatte keine Ahnung, was das war, ein Törtchen war es jedenfalls nicht, es war nicht süß, sondern salzig, aber das war völlig egal. So musste es im Schlaraffenland schmecken!
Mit großen Augen schaute sie den Koch an: »Sie sind ja ein Künstler!«
Auguste warf Paul einen triumphierenden Blick zu, um dann mit gespielter Bescheidenheit das Kompliment zurückzuweisen: »Nur ein kleines Amuse bouche, nicht der Rede wert.«
Noch während Vicky das Glas nahm, das Paul ihr reichte, servierte Auguste ihr schon den nächsten Leckerbissen. »Machen Sie mir la joie, auch diese petitesse zu kosten«, forderte er sie in seinem charmanten deutsch-französischen Kauderwelsch auf.
Sie konnte es kaum fassen, aber der zweite Happen war noch köstlicher als der erste. Wie war das möglich? Eine Delikatesse folgte auf die andere, so dass sie aus dem Staunen gar nicht mehr herauskam. Auguste wartete ihr mit immer wieder neuen, überraschenden Kompositionen auf, die er ihr in winzig kleinen, mundgerechten Portionen darreichte, als habe er Angst, sie könne vorzeitig den Appetit verlieren. Doch sollte dies seine Sorge sein, war sie ganz und gar unangebracht. Gleichgültig, ob kalt oder warm, Gemüse oder Salat, Fisch oder Fleisch – jeder Gang war eine solche Offenbarung, dass Vicky gar nicht genug davon bekommen konnte.
Der letzte Höhepunkt war ein Dessert, das sich wie eine die Sinne verwirrende Symphonie von Aromen in ihrem Mund entfaltete.
»Sie müssen mir unbedingt das Rezept verraten«, bat sie.
Zu ihrer Verblüffung schüttelte Auguste den Kopf. »Diesen Wunsch kann ich Ihnen leider nicht erfüllen. Beziehungsweise erst, wenn auch Monsieur Biermann seinen Beitrag geleistet hat.«
»Ach ja, die Unterhaltung! Die hätte ich fast vergessen!« Vicky drehte sich zu Paul herum. »Darf ich fragen, was Sie für uns vorbereitet haben?«
Paul, der sich die ganze Zeit im Hintergrund gehalten hatte, um nur hin und wieder die Gläser nachzufüllen, wurde sichtlich verlegen und sein großes, freundliches Gesicht lief rot an. »Ich fürchte, nach Herrn Escoffiers Demonstration kann ich Sie nur enttäuschen. Leider spiele ich kein Instrument, und irgendwelche Kunststücke beherrsche ich auch nicht.«
Vicky war in der Tat enttäuscht. »Dann muss ich wohl feststellen, dass Sie Ihren Part nicht erfüllt haben«, sagte sie.
Ein Zucken ging durch sein Gesicht. In der Hoffnung, dass er vielleicht nur gescherzt hatte, um doch noch mit einer Darbietung aufzuwarten, erwiderte sie seinen Blick. Doch ihre Hoffnung war vergebens. Eine Entschuldigung stammelnd, wandte er sich ab und entfernte sich in Richtung Wald, steif und ungelenk.
Kopfschüttelnd schaute sie ihm nach. Wie schade, er hatte doch ein so hübsches Lächeln.
»Voilà les allemands …«
Auguste sprach aus, was Vicky insgeheim dachte: Ja, so waren sie, die Deutschen – fleißig und bemüht, aber leider auch ein bisschen langweilig. Während Paul zwischen den Bäumen verschwand, wandte sie sich wieder ihrem ersten Kavalier zu.
»Nun, dann wird es wohl Ihre Aufgabe sein, mich zu unterhalten, Monsieur Escoffier. Amüsieren Sie mich, seien Sie brillant. Schließlich sind Sie Franzose.«
Auf eine solche Aufforderung schien Auguste nur gewartet zu haben. Sprühend vor Esprit und Charme, zählte er die Verlustierungen auf, die rund um den Dianaturm möglich waren. Angeblich gab es in der Nähe eine Schmetterlingssammlung, deren Besuch sich unbedingt lohne – in ihrer bunten Flatterhaftigkeit seien die possierlichen Tierchen geradezu pariserisch. Auch könne man Blumen pflücken, Beeren sammeln, vielleicht sogar Pilze? Wobei man dafür allerdings, fügte er mit einem bedeutungsvollen Blick aus seinen schwarzen Augen hinzu, sehr, sehr tief in den Wald eindringen müsse.
Vicky spürte die Absicht und war für eine Sekunde verstimmt.
»Nein, nein, Monsieur, das kommt nicht in Frage. – Oder?«
Das letzte Wort war ihr ohne eigenes Zutun rausgerutscht. Auguste quittierte es mit einem Grinsen, um nur eine Sekunde später eine übertrieben zerknirschte Miene aufzusetzen.
»Bitte verzeihen Sie meine fauxpas. Meine einzige excuse est votre beauté.«
Sogleich war Vicky wieder versöhnt. Konnte ein Mann sich charmanter für ein Vergehen entschuldigen als mit der Schönheit der Frau, die ihn dazu verleitet hatte?
»Und was machen wir jetzt?«, fragte sie.
»Steigen wir auf den Dianaturm. Die Aussicht ist phantastique!«
»Eine gute Idee! Vielleicht entdecken wir die Göttin ja sogar bei der Jagd.«
»Das wird kaum möglich sein«, erwiderte er. »Parceque … ich habe die Göttin schon entdeckt. Sie sitzt ja vor mir, vis-à-vis.«
Dabei schaute er ihr noch tiefer in die Augen, und als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, nahm er ihre Hand, um ihr aufzuhelfen. Aber sie stand kaum auf den Beinen, da ertönte aus dem Wald ein ohrenbetäubendes Tschinderassabum. Was in aller Welt war das? Irritiert drehte sie sich um. Paul war zurückkehrt, aber er war nicht allein, an einer Leine führte er das Hoteläffchen bei sich, Pippo. Mit Frack und Zylinder ausstaffiert, schlug das Tier zwei Becken gegeneinander, dass es nur so schepperte.
»Was für eine reizende Idee!«, lachte Vicky.
Auguste hingegen schien weniger amüsiert. Mit offenem Mund blickte er auf seinen Rivalen, und noch bevor er den Mund wieder zubekam, drückte Paul ihm die Leine in die Hand.
»Würdest du dich bitte um den Herrn Kapellmeister kümmern?«
Mit einer Verbeugung, die weder steif noch ungelenk war, sondern überraschend geschmeidig und elegant, forderte er Vicky zum Tanz auf. Immer noch lachend raffte sie ihre Röcke, und mit einem angedeuteten Hofknicks willigte sie ein. Offenbar war dieser Deutsche doch nicht so langweilig, wie sie für einen Moment gedacht hatte. Beherzt ergriff er ihre Hand und umfasste gleichzeitig mit seiner Rechten ihre Taille, um sie zu der Höllenmusik des Äffchens in eine erste Drehung zu führen. Vicky spürte ein wunderbares Kribbeln. Trotz seines massigen Körpers erwies sich dieser deutsche Hüne als ein überaus leichtfüßiger Tänzer, der sie ebenso sicher wie einfühlsam führte. Die Augen unverwandt auf sie gerichtet, drehte er sie im Kreise, immer wieder und wieder, immer schneller und schneller, bis ihr schwindlig wurde vor lauter Tanzen und Drehen und Kreisen und sie beide schließlich lachend ins Gras fielen, während Pippo weiter Becken schlagend um sie herumhüpfte.
6
Alles war still, nur das Zirpen der Grillen war in der Nachmittagssonne zu hören, die hell und warm auf die Lichtung herabflutete. Angenehm müde vom Essen und vom Wein ruhte Vicky zusammen mit Paul und Auguste auf der Decke im Gras. Unten im Tal schlängelte sich der Fluss zwischen den Waldhängen entlang, gesäumt von den Straßenzügen des Kurortes. Winzig klein und fern und lautlos erschien von hier oben das sonst so aufregende Treiben auf der Promenade. Die ganze Welt atmete Glückseligkeit. Sogar das Äffchen, angeleint an einem Baumstamm, machte Pause und tat sich an einer Banane gütlich.
»Warum haben Sie sich im Hotel eigentlich so fürchterlich gestritten?«, fragte Vicky in die Stille hinein. »Offenbar sind Sie doch Freunde.«
»Das sind wir auch«, erklärte Paul. »Wir teilen uns sogar dasselbe Zimmer. Nur wenn die Rede auf die Politik kommt, dann …«
»Dann keine Politik! Es ist alles gerade so friedlich.«
»Aber wenn die Deutschen immer wieder Krieg anfangen?«
»Von wegen, die Deutschen. Ihr Franzosen habt uns den Krieg aufgezwungen!«
»Assez!«, fuhr Vicky dazwischen. »Alle beide!« Sie blickte sie der Reihe nach an. Dann fügte sie sanfter hinzu: »Mir zuliebe. Bitte …«
Die zwei zogen die Köpfe ein.
»D’accord.«
»Einverstanden.«
»Danke«, sagte sie. »Viel mehr als die dumme Politik würde mich nämlich etwas ganz anderes interessieren.« Sie zögerte einen Moment, aus Sorge, vielleicht zu indiskret zu sein. Doch einmal mehr war ihre Neugier stärker als ihre gute Erziehung. »Warum haben Sie eigentlich Paris verlassen, Monsieur Escoffier? Paris ist doch die schönste Stadt der Welt.«
»Je suis ravi von Ihre Meinung«, antwortete Auguste. »Ja, Paris ist wunderbar, und es ist ein Privileg, dort zu leben. Aber nach dem Krieg ging es in der Stadt drunter und drüber, überall wurde gekämpft – jeder gegen jeden! Republikaner gegen Monarchisten, Kommunarden gegen Polizisten, Bürger gegen Soldaten. Wie sollte ich mich da auf das konzentrieren, was für mich das Wichtigste ist?«
»Und was ist für Sie das Wichtigste?«
»Kochen natürlich!«
Für eine Sekunde war Vicky enttäuscht, von einem Franzosen hätte sie eine andere Antwort erwartet. Doch bevor sie etwas entgegnen konnte, sprach Auguste weiter.
»Jetzt hat sich Gott sei Dank die Lage beruhigt. Und sobald hier die Saison vorbei ist, fahre ich zurück nach Paris, um meine erste Stelle als Küchenchef anzutreten – in einem der besten Restaurants der Stadt«, fügte er mit sichtlichem Stolz hinzu.
»Dann wünsche ich Ihnen alles Glück dieser Welt, von Herzen.« Sie schenkte ihm ein Lächeln, dann drehte sie sich zu Paul herum. »Und Sie, Herr Biermann – zieht es Sie auch wieder in die Heimat?«
»Allerdings«, erwiderte er. »Doch erst mache ich noch Station in Wien. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, aber in zwei Jahren findet dort die Weltausstellung statt. Da werden jede Menge Bauingenieure gebraucht. Ich kann dort sehr viel lernen, und Lernen ist das Wichtigste überhaupt, wenn man vorankommen will!«
Bei dem Stichwort Weltausstellung biss Vicky sich auf die Lippe. Und ob sie davon gehört hatte! Die allererste Weltausstellung, 1851 im Londoner Hyde Park, war ja nur möglich gewesen, weil ihr Großvater Joseph Paxton das dafür nötige Gebäude konstruiert hatte, den weltberühmten Kristallpalast, ein gigantisches, überdimensioniertes Gewächshaus aus Glas und Stahl, das fast zehnmal so groß war wie der Petersdom in Rom und in einer Rekordzeit von nur drei Monaten errichtet worden war und deshalb als das größte Wunderwerk der Ausstellung überhaupt gegolten hatte. Obwohl alles in ihr danach drängte, die Geschichte zu erzählen, beherrschte sie sich. Man würde sonst glauben, sie wolle sich produzieren, und das keineswegs zu Unrecht.
»Ist es nicht wunderbar«, fragte sie stattdessen, »wenn die Menschen, statt sich gegenseitig nach dem Leben zu trachten, zu einem solchen Völkerfest zusammenkommen? Um all die Wunderwerke zu feiern, die der Fortschritt hervorgebracht hat? Ich glaube, wir wissen gar nicht, in was für herrlichen Zeiten wir leben.«
Auguste und Paul drehten verwundert die Köpfe zu ihr herum.
»Was schauen Sie mich so an?«, fragte sie. »Nach zehn Jahren Krieg in Europa herrscht auf dem ganzen Kontinent Frieden – was für ein Geschenk! Niemand muss sich mehr totschießen lassen, jeder braucht sich nur noch um sein eigenes Vorankommen zu kümmern. – Apropos«, wandte sie sich an Paul. »Was sind Ihre Pläne, wenn Sie nach Ihrer Station in Wien nach Berlin zurückkehren?«
Bei der Frage ging ein Leuchten durch sein Gesicht. »Berlin wird sich verändern wie keine andere Stadt in Europa. Eine Metropole wird entstehen, die es vielleicht schon bald mit London und Paris aufnehmen kann. Da will ich dabei sein!«
Vicky nickte. »Die Entstehung einer neuen Welt, was für ein großartiger Gedanke.« Sie richtete ihren Blick auf Auguste. »Und was ist Ihr Traum?«
Auguste zögerte keine Sekunde. »Ich werde die französische Kochkunst von Grund auf erneuern, um sie in alle Welt hinauszutragen.«
»Oh, wollen Sie etwa die ganze Menschheit füttern?«
»Allerdings. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Menschen aller Völker und Nationen, die an meinem Tisch zusammenkommen, um miteinander zu genießen, was ich für sie zubereite, an meinem Herd, mit meiner Kunst.«
In seiner Stimme lag solcher Ernst, dass Vicky ihre ironische Frage bereute. »Sie haben recht, das ist wirklich eine schöne Vorstellung.« Sie hielt für einen Moment inne, dann fügte sie leise hinzu: »Weil, solange Menschen miteinander essen, schießen sie nicht aufeinander. Dann gäbe es vielleicht nie wieder Krieg …« Aus Angst, etwas Dummes oder Peinliches zu sagen, verstummte sie.
Wie konnten zwei Männer, die so weit unter ihr standen, so wunderbare Träume haben? Obwohl sie wusste, dass es sich nicht gehörte, fasste sie nach links und rechts und ergriff ihre Hände.
»Dann haben Sie ja beide wirklich Einzigartiges vor …«
Eine Weile blieben sie so sitzen, Hand in Hand, ohne dass es jemandem peinlich oder dumm oder ungehörig erschien, in stummem, wortlosem Einverständnis verbunden, während um sie herum die Grillen zirpten und unten im Tal die Fluten der Tepl in der Sonne funkelten.
»Und Sie«, fragte Paul irgendwann, »was sind Ihre Pläne, wenn Sie wieder in London sind?«
»Meine Pläne?« Die Frage kam so überraschend, dass Vicky keine Antwort einfiel.
»Mais quelle question?«, kam Auguste ihr zu Hilfe. »Wozu blüht die Blume? Um die Welt zu verschönern! Sie muss nur da sein, mehr nicht.« Er beugte sich über ihre Hand, um sie zu küssen. »N’est-ce pas?« Lachend schlug er die Augen zu ihr auf.
Charmiert fiel Vicky in sein Lachen ein – doch nur einen Moment. War das wirklich genug? Einfach nur da sein? Ein seltsam unwohles Gefühl beschlich sie, eine Mischung aus Verunsicherung und Beschämung.
»Was ist?«, fragte Paul. »Ist Ihnen nicht gut?«
»Nein, nein! Wie kommen Sie darauf?« Entschiedener, als ihr zumute war, schüttelte sie den Kopf. »Aber warten Sie, ich habe etwas für Sie – für Sie beide.« Sie öffnete den kleinen Nécessaire-Beutel, den sie am Handgelenk trug, und holte zwei Münzen daraus hervor, um sowohl Paul als auch Auguste eine zu geben. »Ein Glückspenny für Sie. Damit Ihre Träume in Erfüllung gehen. Und Sie diesen Tag niemals vergessen.«
Teil 1Fraises Victoria
1873
1
Wie das Skelett eines Riesen ragte die noch im Rohbau befindliche Rotunde, der größte Kuppelbau der Welt und schon jetzt Wahrzeichen der Wiener Weltausstellung, in einen dunklen, wolkenverhangenen Himmel hinauf, als Paul aus dem Pumpwerk ins Freie trat. Das Pumpwerk war das Herzstück der unterirdischen Wasserleitungsanlagen, für dessen Installation er seit nunmehr anderthalb Jahren wie ein Maulwurf im Erdreich wühlte, zusammen mit einem Dutzend anderer Ingenieure sowie Hunderten Arbeitern. Dieses absolut neuartige, dem Auge verborgene Röhrensystem sollte, einmal in Betrieb genommen, das ganze Ausstellungsgelände mit dem Lebenselixier Wasser versorgen. Wasser war nicht nur für die Pflege der Gartenanlagen mit ihren Blumen und Pflanzen und Grünflächen unverzichtbar, sondern auch für die gastronomischen Betriebe und die sanitären Einrichtungen. Wasser würde zur Erfrischung der Besucher gebraucht, Wasser sollte zur allgemeinen Ergötzung aus Brunnen und Fontänen sprudeln, und schließlich musste Wasser für den Fall einer Feuersbrunst in dreihundert Spritzen und Hydranten eingespeist werden, die in den Ausstellungshallen sowie in den Außenbereichen zur Brandbekämpfung bereitstanden.
Heute allerdings war der Ausbruch einer Feuersbrunst so wenig wahrscheinlich wie eine plötzliche Dürre. Obwohl bereits der März angebrochen war, war der Winter noch einmal zurückgekommen, seit einer Woche ging ein mit nassschweren Schneeflocken vermischter Dauerregen auf Wien nieder, um das Gelände der Weltausstellung in einen einzigen Sumpf zu verwandeln. Eine Katastrophe angesichts des Zeitdrucks, unter dem die Arbeiten standen – in weniger als zwei Monaten, am 1. Mai, sollte das Völkerfest beginnen, und noch kein einziger Pavillon war bezugsfertig.
Ganz Wien betete darum für besseres Wetter, und im Stephansdom wurden Messen abgehalten, um die himmlischen Mächte um Beistand zu bitten. Schon nach der ersten Weltausstellung 1851 in London hatte sich in der k.u.k. Monarchie der Wunsch geregt, eine solche industrielle Musterschau zur Förderung der heimischen Wirtschaft in der Hauptstadt Wien zu veranstalten, doch war das Vorhaben den Wirren des damaligen Krieges gegen die Deutschen sowie der üblichen kakanischen Saumseligkeit zum Opfer gefallen, so dass 1867, ausgerechnet im Jahr des Zusammenschlusses der österreichisch-ungarischen Monarchie, Paris statt Wien den Zuschlag erhalten hatte, und es wäre vielleicht für alle Zeit bei dem frommen Wunsch geblieben, hätte nicht auch London sein Interesse für die nächste Veranstaltung im Jahr 1873 bekundet. Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, sogar an der schönen, blauen Donau. Im Mai 1871 hatte Kaiser Franz Joseph darum endlich den Erlass zur Abhaltung der Ausstellung unterschrieben und ein Budget von fast sechzehn Millionen Gulden bereitgestellt, so dass im Jahr darauf die Arbeiten tatsächlich beginnen konnten, im Prater, dem ehemaligen kaiserlichen Jagdrevier, das das Herrscherhaus bereits hundert Jahre zuvor der Wiener Bevölkerung als Erholungsgebiet geschenkt hatte. Jetzt sollte die Weltausstellung, als sechste Veranstaltung ihrer Art überhaupt und erste in einem deutschsprachigen Land, nach dem verlorenen Krieg gegen Preußen vor Gott und der Welt die Größe Österreich-Ungarns demonstrieren, auf einer Fläche, die mit zweihundertdreiunddreißig Hektar fünfmal so groß war wie das Marsfeld in Paris, wo 1867 die bis dato letzte Weltausstellung stattgefunden hatte, und sogar zwölfmal so groß wie die der ersten Weltausstellung im Londoner Hyde Park. Deshalb musste die Veranstaltung auf Gedeih und Verderb gelingen. Sonst war die stolze k.u.k. Monarchie vor Gott und der Welt bis auf die Knochen blamiert.
Um sich gegen den peitschenden Schneeregen zu schützen, zog Paul den Hut in die Stirn und schlug den Kragen seines Arbeitsmantels hoch, dann machte er sich in seinen Gummistiefeln auf den Weg zur Baubaracke. Das Fontänen-Wasserwerk sollte mit einem Windkessel betrieben werden, dabei hatte sich ein unerwartetes Problem ergeben, so dass er noch einmal die Pläne einsehen musste.
»Verfluchte Scheiße!«
Vor der Baracke versuchte ein halbes Dutzend Männer, einen mit Backsteinen beladenen, von Pinzgauer Kaltblütern gezogenen Wagen freizubekommen, der im Morast feststeckte. Paul spuckte in die Hände, um mit anzupacken. Als er in die Speichen griff, durchzuckte ihn ein so heftiger Schmerz, als wäre ein Blitz in ihn gefahren – ein schlecht vernarbter Bauchschuss, den er sich bei der Belagerung von Metz eingefangen hatte. Doch er biss die Zähne zusammen – Hauptsache, der Wagen kam frei!
»Hau ruck!«
»Hau ruck!«
»Hau ruck!«
Er spannte seine Muskeln an, und der Kutscher ließ die Peitsche knallen. Die Tiere legten sich ins Geschirr, mit der ganzen Wucht ihrer massigen, schweren Körper, ein wütendes Schnauben und Stampfen, so dass der Matsch unter den Hufen nur so aufspritzte.
»Und noch einmal! Hau ruck!«
Endlich! Die Räder bewegten sich, einmal, zweimal, dreimal – dann war es geschafft. Außer Atem ließ Paul die Speichen los. Während der Wagen langsam davonrollte, wischte er sich den Schweiß von der Stirn. Nachdem er einen Moment verschnauft hatte, stieg er die Stufen zu dem hölzernen Baubüro hinauf.
Als er die Baracke betrat, blickte Fräulein Rosalie, die brünette, blutjunge Sekretärin des Oberingenieurs und wegen ihres auffallend hübschen Gesichts und ihrer noch auffallenderen üppigen Formen Schwarm aller fünftausend Arbeiter auf der Baustelle, mit großen Augen von ihrem Schreibtisch auf.
»Jessas! Wie schauen Sie denn aus, Herr Ingenieur?«
Erst jetzt wurde Paul bewusst, dass er vollkommen verdreckt war, nicht nur die Kleider an seinem Körper, auch sein Gesicht war voller Schlamm und Matsch.
Rosalie verließ ihren Schreibtisch. »Warten Sie, das haben wir gleich!«
Sie nahm einen Lappen, und ohne um Erlaubnis zu fragen, begann sie sein Gesicht zu säubern. Die himmelblauen Augen unverwandt auf ihn gerichtet, trat sie so dicht an ihn heran, dass er unwillkürlich einen Schritt zurückwich, aber sie nahm einfach seine Hand und hielt ihn fest. Mit einem Lächeln, zu dem nur eine Wienerin fähig war, bearbeitete sie sein Gesicht, erst die Stirn, dann seine Wangen und schließlich auch die Mundpartie. Dabei ließ sie solche Fürsorge walten, dass ihm ganz anders wurde.
»Wann führen Sie mich denn endlich einmal aus, Herr Ingenieur?«
Ihre plötzliche Frage brachte ihn noch mehr in Verlegenheit als ihre Berührungen. Er mochte das Mädchen, sehr sogar, aber …
Verlegen räusperte er sich. »Für was für einen Schuft halten Sie mich, Fräulein Rosalie. Ich … ich bin doch nur noch zwei Monate in Ihrem schönen Wien, dann kehre ich nach Berlin zurück.«
»Na, und?«, erwiderte sie und tippte ihm mit dem Zeigefinger auf die Nasenspitze. »In zwei Monaten lässt sich so manches erleben, und a bissl Schuft tät mir vielleicht ja grad gefallen.«
Ein paar endlose Sekunden wieder nur ihr himmelblauer Blick. Paul spürte, wie es ihm immer dringlicher wurde. »Ist … ist Post für mich da?«, fragte er.
Mit einem Seufzer ließ Rosalie von ihm ab. »Was müssen S’ auch immer so preußisch sein, Herr Ingenieur? Kann man Ihnen das wirklich nicht austreiben?« Kopfschüttelnd nahm sie einen Brief vom Schreibtisch und reichte ihn ihm. »Der ist soeben für Sie gekommen.«
Erleichtert öffnete Paul das Kuvert.
Der Brief war aus Berlin, von seinem Vater.
Mein innig geliebter, treuer Sohn,
auch wenn mir bewusst ist, wie sehr Deine jetzige Tätigkeit, bei der Du so viele neue und nützliche Kenntnisse über unser Metier erwirbst, vor allem den Tiefbau betreffend, Dich beglücken muss, zähle ich doch die Tage bis zu Deiner Rückkehr. Wir wissen kaum noch, wie wir der Arbeit ohne Dich Herr werden sollen. Heinrich Quistorp, ein äußerst erfolgreicher Spekulant, hat sich in unsere Firma eingekauft. Die Entscheidung, einen Fremden an der von meinem Vater gegründeten Familienunternehmung zu beteiligen, ist mir, wie Du Dir wohl denken magst, nicht leichtgefallen, und ich musste lange mit mir ringen, doch jetzt erweist sie sich als wahrer Segen. Quistorp ist nicht nur ein Finanzgenie, er unterhält auch allerbeste Kontakte zu dem neuen Stadtbaurat, und dieser schanzt uns so viele Aufträge zu, dass unser alter Konkurrent Gumbrecht & Cie. das Nachsehen hat. Alles geht im Höllentempo voran, Geld scheint keine Rolle zu spielen, dank der fünf Milliarden Goldfranken, welche die Franzosen als Reparationsleistung für den verlorenen Krieg an das Reich zahlen mussten, wird auf Teufel komm raus investiert, so dass Berlin aus allen Nähten platzt. Und jetzt hat Fürst Bismarck eine Idee in die Welt gesetzt, die alles in den Schatten stellt. Der Kanzler hat angeregt, den Churfürsten Damm zwischen dem Stadtschloss der kaiserlichen Familie und dem Jagdschloss in Charlottenburg zu einer Prachtstraße nach dem Vorbild der Pariser Champs-Élysées auszubauen – wenn möglich noch großartiger als dieser, um die Franzosen nach unserem herrlichen Sieg im Felde auch darin zu übertrumpfen …
Paul hielt in der Lektüre inne, er kannte die Champs-Élysées, nach dem Fall von Paris hatte er Gelegenheit gehabt, die Stadt zu besichtigen. Einen solchen Boulevard hatte er nie zuvor gesehen, mehrere Male war er die Gehsteige, die breiter waren als andernorts ganze Straßen, hinauf- und hinabgegangen, weil er sich gar nicht hatte sattsehen können. Der Eindruck war ihm noch so gegenwärtig, dass die Vorstellung, dass etwas Vergleichbares in Berlin entstehen sollte, ihn elektrisierte.
Ob es wohl eine Möglichkeit gab, daran mitzuwirken?
Er wollte den Brief schon zusammenfalten, aber dann sah er, dass der Vater unter seinen Namenszug noch ein Postskriptum gesetzt hatte.
P.S. Hast Du schon mal von den Gebrüdern Cubitt gehört? Es handelt sich um zwei englische Architekten beziehungsweise Ingenieure, die das Bauhandwerk von Grund auf revolutioniert haben sollen. Hermann Blankenstein, der neue Stadtbaurat, hat mich auf sie aufmerksam gemacht. Sie haben angeblich in London ein ganzes Stadtviertel hochgezogen, buchstäblich im Handumdrehen, mit völlig neuen Methoden. Bitte mach Dich doch einmal kundig, wenn es Dir keine allzu großen Umstände bereitet.
Paul steckte den Brief ein. Nein, von den Gebrüdern Cubitt hatte er noch nicht gehört, doch was man nicht wusste, konnte man in Büchern nachlesen, dafür waren diese da. Also beschloss er, nach Feierabend die Universitätsbibliothek aufzusuchen, die älteste und bedeutendste in ganz Europa. Dort würde er sicher fündig werden.
Er schaute in seiner Börse nach, ob er den Bibliotheksausweis dabeihatte, da entdeckte er zwischen seiner deutschen und österreichischen Barschaft eine fremdländische Münze: einen englischen Penny, den er seit seiner Station in Karlsbad bei sich trug.
Während er mit einem Anflug von Wehmut die Münze betrachtete, kam ihm plötzlich eine Idee. Vielleicht gab es ja eine viel bessere Möglichkeit, sich über die Gebrüder Cubitt kundig zu machen, als Bücher zu wälzen!
2
Paxton House, das Stadtpalais von Vickys Familie, erhob sich unweit des Royal Court Theatre am Sloane Square, mitten im Herzen von Chelsea, jenem Londoner Stadtteil also, in dem der im Laufe des Jahrhunderts zu immer größerem Reichtum gelangte industrielle Mittelstand sein bevorzugtes Quartier gefunden hatte – die meisten der hier lebenden Familien brauchten, was die Vermögensverhältnisse betraf, keinen Vergleich mit dem von der Agrarwirtschaft lebenden Landadel zu scheuen. Die Vorderseite des drei Stockwerke hohen, im klassizistischen Stil erbauten Gebäudes war dem regen Stadtverkehr zugewandt, während man von der Rückseite aus auf einen zum Anwesen gehörenden, sorgsam gepflegten Garten blickte, dahinter auf die Peterskirche am Eaton Square und in etwas weiterer Ferne den Buckingham-Palast, über dessen Türmen der im Winde wehende Union Jack die Anwesenheit der Königin verkündete, wann immer diese in ihrem Londoner Hauptschloss weilte.
In diesem Haus war Vicky geboren und aufgewachsen, und sie hatte sich nie gefragt, warum eine einzige Familie ein so riesiges Gebäude zu ihrer Unterbringung brauchte, schließlich lebten fast alle Familien, mit denen die ihre verkehrte, in ähnlich großen Häusern. Die Wohnfläche verteilte sich auf etwa drei Dutzend Zimmer, dazu gehörten neben den Schlafgemächern und Gästesuiten die unterschiedlichsten Gesellschafträume, von der hohen, holzvertäfelten Eingangshalle über mehrere Salons, Speise- und Empfangszimmer bis hin zu einem weit in die Natur hinausragenden, großflächig verglasten Wintergarten, vor allem aber eine rund zwanzigtausend Bände umfassende Bibliothek, der ganze Stolz des ursprünglichen Hausherrn, Vickys Großvater Joseph Paxton. Dieser aus bescheidensten Verhältnissen stammende Mann verdankte seinen immensen Reichtum einer landesweit beispiellosen Karriere. Als Gärtner des Herzogs von Devonshire war es ihm in seinen frühen Jahren gelungen, eine aus dem Amazonasgebiet nach England importierte Riesenseerose unter künstlichen Bedingungen zum Erblühen zu bringen. Das hatte in ganz Europa noch kein Gärtner vor ihm vollbracht und war seinerzeit eine solche Sensation gewesen, dass sogar Königin Victoria höchstselbst sich in seinem Gewächshaus eingefunden hatte, um das Wunder zu bestaunen. Dieser Begegnung, bei der er die Pflanze zu Ehren ihrer Majestät auf den Namen Victoria regia getauft hatte, war der Grund für seine zehn Jahre später erfolgte Berufung zum Architekten der ersten Weltausstellung im Londoner Hyde Park gewesen, mit der wiederum aufs engste sein einzigartiger Erfolg im Eisenbahngeschäft verbunden war, mit dem er es in kürzester Zeit zu einem Vermögen von über einer Million Pfund Sterling gebracht hatte.
Obwohl Joseph Paxton bereits vor Jahren verstorben war, atmete das Haus immer noch seinen Geist, Vicky spürte ihn in jedem Zimmer, in jedem Winkel, und das erfüllte sie mit dem wunderbaren Gefühl, dass sie ganz allein in dieses Haus gehörte und kein anderes. Als Kind war ihr der Großvater als der bedeutendste Mensch auf Erden erschienen, ein Mann, der gleich nach dem lieben Gott kam, und daran hatte sich bis heute kaum etwas geändert. Kein Wunder, ihre Mutter Emily wurde nicht müde, von den Abenteuern zu erzählen, die sie an der Seite ihres berühmten Vaters erlebt hatte, insbesondere beim Besuch der Königin, als sie im Alter von zehn Jahren auf dessen Geheiß eines der riesigen Seerosenblätter bestiegen hatte, um deren Tragfähigkeit zu demonstrieren, wobei sie am Ende jedoch ausgerutscht und in den Teich gefallen war, weil ein Dorfjunge vom Dach des Gewächshauses einen Sack Rosenblätter auf sie herabgeschüttet hatte. Der Familienlegende zufolge verdankte Vicky diesem oft belachten Ereignis sogar ihren Namen, wobei allerdings stets unklar blieb, ob diese Namensgebung in Erinnerung an die Königin oder an die nach dieser benannte Seerose des Großvaters erfolgt war. Auch zeugten Dutzende naturkundlicher Bände in der Bibliothek, die Joseph Paxton verfasst und Vickys Mutter in ihrer Jugend mit erstaunlicher Kunstfertigkeit illustriert hatte, von der engen Verbundenheit zwischen Vater und Tochter, und wann immer es eine Meinungsverschiedenheit in der Familie gab, versuchte Vickys Mutter die Sache unter Berufung auf den Ahnherrn des Hauses zu entscheiden.