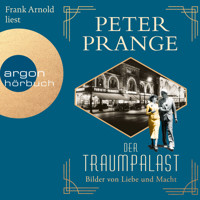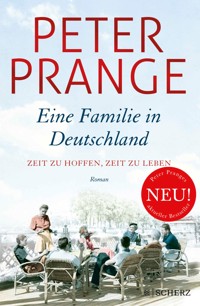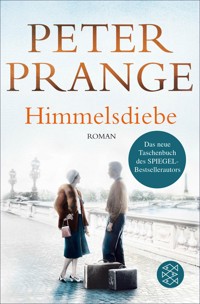9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der große Deutschland-Roman über die Geschichte der Bundesrepublik - jetzt die 2. Staffel in der ARD Es ist der 20. Juni 1948. Das neue Geld ist da – die D-Mark. 40 DM "Kopfgeld" gibt es für jeden. Für die drei so verschiedenen Schwestern Ruth, Ulla und Gundel, Töchter des geachteten Fabrikanten Wolf in Altena. Für Tommy, den charmanten Improvisateur, für den ehrgeizigen Jung-Kaufmann Benno, für Bernd, dem Sicherheit das Wichtigste ist. Was werden die sechs Freunde mit ihrem Geld beginnen? Welche Träume und Hoffnungen wollen sie damit verwirklichen? Schicksalhaft sind sie alle verbunden – vom Wirtschaftswunder über die Geschäfte zwischen den beiden deutschen Staaten bis zum Begrüßungsgeld nach dem Mauerfall. Sechs Freunde und ihre Familien machen ihren Weg, erleben über drei Generationen die Bundesrepublik der D-Mark – und den Beginn der neuen, europäischen Währung. Authentisch, spannend und detailreich ist der Roman ›Unsere wunderbaren Jahre‹ von Bestseller-Autor Peter Prange ein Spiegel unserer Biographien. Wie wir wurden, was wir sind: Der Bestseller-Roman über die Bundesrepublik – eine bewegende Familiengeschichte von Erfolgsautor Peter Prange, in der die gesamte Nachkriegszeit bis zur Gegenwart lebendig wird. Staffel 1 der großen ARD-Verfilmung begeisterte 8 Millionen Zuschauer. Am 11. März startet die Fortsetzung des TV-Highlights. Die ganze Geschichte finden Sie im Roman von Peter Prange. Sein aktueller Roman in zwei Bänden ›Der Traumpalast‹ führt in die Geschichte Deutschlands in den zwanziger Jahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1615
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Peter Prange
Unsere wunderbaren Jahre
Ein deutsches Märchen.
Roman
Über dieses Buch
Es ist der 20. Juni 1948. Das neue Geld ist da – die D-Mark.40 DM »Kopfgeld« gibt es für jeden. Für die drei so verschiedenen Schwestern Ruth, Ulla und Gundel, Töchter des geachteten Fabrikanten Wolf in Altena. Für Tommy, den charmanten Improvisateur, für den ehrgeizigen Jung-Kaufmann Benno, für Bernd, dem Sicherheit das Wichtigste ist. Was werden die sechs Freunde mit ihrem Geld beginnen? Welche Träume und Hoffnungen wollen sie damit verwirklichen? Schicksalhaft sind sie alle verbunden – von den Erfolgen des Wirtschaftswunders über den Schock der »Ölkrise«, die Geschäfte zwischen den beiden deutschen Staaten bis zum Begrüßungsgeld nach dem Mauerfall. Sechs Freunde und ihre Familien machen ihren Weg, erleben über drei Generationen die Bundesrepublik der D-Mark – und den Beginn der neuen, europäischen Währung. Authentisch und detailreich ist Peter Pranges Roman ein Spiegel unserer Biographien – und ein wahres deutsches Märchen. Der erste Teil des Romans ist als großer TV-Dreiteiler verfilmt.
Weitere Titel des Autors:
›Eine Familie in Deutschland‹ Bd. 1 und Bd. 2
›Das Bernstein-Amulett‹
›Himmelsdiebe‹
›Die Rebellin‹
›Die Rose der Welt‹
›Ich, Maximilian, Kaiser der Welt‹
›Die Philosophin‹
›Die Principessa‹
›Werte: Von Plato bis Pop - alles, was uns verbindet‹
Die Webseite des Autors: www.peterprange.de
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Peter Prange ist als Autor international erfolgreich. Er studierte Romanistik, Germanistik und Philosophie in Göttingen, Perugia und Paris. Nach der Promotion gewann er besonders mit seinen historischen Romanen eine große Leserschaft. Seine Werke haben eine internationale Gesamtauflage von über zweieinhalb Millionen verkaufter Exemplare erreicht und wurden in 24 Sprachen übersetzt. Mehrere Bücher wurden verfilmt bzw. werden zur Verfilmung vorbereitet. Der Autor lebt mit seiner Frau in Tübingen.
Inhalt
[Widmung]
[Motto]
Vorbemerkung
Prolog: Zwischen den Zeiten
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
Teil eins | Erstes Buch: Der große Anfang
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
Teil eins | Zweites Buch: Der große Anfang
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
Teil zwei | Erstes Buch: Status quo
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
Teil zwei | Zweites Buch: Status quo
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
Teil drei | Erstes Buch: Wiedergeburt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
Teil drei | Zweites Buch: Wiedergeburt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
Epilog: Hier und heute
Danke
Liste der handelnden Personen
Dem Andenken meiner Eltern gewidmet,
Ernst und Christel Prange
Für die bucklige Verwandtschaft –
und die alten Altenaer Kumpel
Und, last not least,
für Prof. Dr. Arnulf Baring,
der keine Ahnung hat,
wie viel ich ihm verdanke.
Er hat mich zum Schreiben ermutigt,
als mir selbst jeder Mut dazu fehlte.
Es war ein reicher Mann, der ließ zehn seiner Knechte zu sich rufen, verteilte unter ihnen sein Vermögen, welches zehn Talente betrug, und sprach: Handelt damit, bis ich wiederkomme … Und siehe, als er wiederkam, hieß er dieselben Knechte, welchen er sein Geld anvertraut hatte, abermals zu sich rufen. Auf dass ein jeglicher von ihnen Rechenschaft ablegte, was er mit seinen Talenten erhandelt hätte …
Lukasevangelium, Kapitel 19, Vers 12–15
Vorbemerkung
Die nachfolgende Geschichte ist, obwohl in der Heimatstadt des Autors angesiedelt, frei erfunden. Rückschlüsse auf noch lebende oder bereits verstorbene Personen sollen in keiner Weise nahegelegt oder ermöglicht werden. Die Handlungsstränge der Geschichte sind ebenso wie die Lebenswege der Protagonisten Erfindungen des Autors. Dies gilt insbesondere für die Verstrickungen einiger Handlungsträger in der Nazizeit und die Schilderung ihrer Privatsphäre. Alle intimen Szenen sowie die Dialoge und die Darstellung der Gefühlswelt des gesamten Romanpersonals sind reine Fiktion. Dies gilt auch für die Figur des Autors, die unter dem Namen »Peter Prange« in einer Nebenrolle erscheint.
Prolog
Zwischen den Zeiten
Zahlungsunfähig
18./19. Juni 1948
1
Ulla wusste, sobald die Partitur den Einsatz der Bratsche verlangte, würde ihre Schwester aus dem Takt geraten. Weil es die Bratsche in ihrem Quartett nicht mehr gab und Gundel jedes Mal, wenn die Stelle kam, kurz stutzte und dann patzte.
Das Cello zwischen den Knien, lauerte Ulla auf das Malheur ihrer Schwester, das so sicher kommen würde wie das Amen in der Kirche. Wie immer, wenn Gundel sich anstrengte, liefen ihre Wangen dunkelrot an – so heftig bearbeitete sie ihre Geige mit dem Bogen, dass sich schon die ersten Strähnen aus ihren Affenschaukeln lösten, zu denen sie ihr glattes braunes Haar gebunden hatte. Trotzdem schaffte sie es kaum, ihrem Vater zu folgen, der im Duett der beiden Violinen das Thema in einem solchen Höllentempo kontrapunktierte, dass einem schwindlig davon wurde, und dabei trotzdem noch Zeit fand, hin und wieder einen Blick mit seiner Frau zu tauschen, die, mit einer Tasse Tee in der Hand und einem verträumten Lächeln in dem schon etwas müden Gesicht, der Hausmusik lauschte, als würde die Zeit stillstehen und es nichts anderes auf der Welt geben als diese Musik in ihrem dämmrigen Salon voller Samt und Plüsch und exotischen Zierpflanzen.
»Wo bleibt dein Einsatz, Ulla?« Verärgert klopfte Eduard ab. »Vor der Bratsche übernimmt das Cello! Kannst du plötzlich keine Noten mehr lesen?«
Ulla war sich ihres Fehlers bewusst. Doch bevor sie ihn zugeben würde, biss sie sich lieber die Zunge ab.
»Was müssen wir auch immer das alte Zeug spielen?«, sagte sie.
»Das ist kein altes Zeug.« Den Bogen in der Hand, rückte ihr Vater seine Fliege zurecht. »Das ist Joseph Haydn, Kaiserquartett.«
»G – E – F – D – C«, sagte Gundel, wie immer die Musterschülerin, die nicht nur die richtige Antwort wusste, sondern das auch demonstrierte. »Die ersten fünf Töne des Kopfsatzes. GotterhalteFranzdenCaiser.«
»Das haben die Nazis aber ganz anders übersetzt«, erwiderte Ulla. »Deutschland, Deutschland über alles … Ich denke, das haben wir in den letzten tausend Jahren genug gehört!«
»Was kann eine unschuldige Melodie dafür, wenn man sie so schändlich missbraucht?«, fragte ihr Vater. »Das Kaiserquartett ist eines der wunderbarsten Streichquartette der gesamten Hausmusik-Literatur. Das lasse ich mir von dem braunen Pack nicht kaputtmachen!«
»Aber mitgesungen hast du damals auch. Nicht nur G – E – F – D – C.«
»Jetzt tut mir die Liebe und streitet euch nicht!«, sagte Christel. »Es war gerade so schön. Außerdem wird sonst mein Tee kalt.«
Um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, nippte sie an ihrer Tasse aus durchschimmerndem China Bone. Obwohl Eduard offenbar noch eine Replik auf der Zunge lag, schluckte er sie herunter, und auch Ulla verkniff sich jeden weiteren Kommentar. Wenn ihre Mutter damit drohte, dass ihr Tee kalt würde, wurde es ernst in der Villa Wolf, die Eduards Vater vor einem halben Jahrhundert auf dem Gelände der familieneigenen Drahtzieherei errichtet hatte. Und die Hausmusik, zu der man sich einmal im Monat versammelte, seit die drei Schwestern Ulla, Gundel und Ruth einen Bogen führen konnten, war Christel heilig – fast so heilig wie der Gummibaum, den sie einst als junges Mädchen zur Konfirmation bekommen hatte und der auf seiner schwarz gelackten Konsole alles überwuchernd inzwischen bis hinauf zur Zimmerdecke reichte, als bezögen seine Wurzeln ihre Kraft immer noch aus den Regenwäldern des Amazonas, von wo er angeblich stammte. »Zwei Weltkriege hat Deutschland hinter sich«, sagte sie manchmal, wenn sie die Blätter der Pflanze abstaubte und mit Bohnerwachs zum Glänzen brachte, »aber mein Ficus wächst und gedeiht. Solange er das tut, kann uns nichts und niemand etwas anhaben.«
Gundel bändigte die losen Strähnen wieder in ihren Affenschaukeln. »Ich finde, Ruth sollte wieder bei uns wohnen«, sagte sie.
»Nicht mit diesem Mann!«, erwiderte ihr Vater.
»Aber warum denn nicht? Wir haben doch mehr Platz als genug.«
»Du weißt, wie ich darüber denke.« Energisch strich er sich, um das Gespräch zu beenden, über sein sorgfältig gepflegtes Menjou-Bärtchen, das so weiß war wie sein Haupthaar.
Ulla sah, wie ihre Schwester mit sich kämpfte. Im Gegensatz zu ihr fiel es Gundel entsetzlich schwer, ihre Meinung zu behaupten, und die wenigen Widerworte, die sie ihren Eltern in den achtzehn Jahren ihres Lebens gegeben hatte, konnte man an einer Hand abzählen. Andererseits litt sie unter Ruths Verbannung mehr als jeder sonst in der Familie.
»Dann lass sie wenigstens zum Musizieren ins Haus«, sagte sie schließlich. »Ich meine, wie soll man denn zu dritt ein Quartett spielen?«
»Papperlapapp!« Statt eines weiteren Worts klemmte Eduard sich die Geige unters Kinn. »Noch mal von vorne! Und diesmal aufgepasst, Ulla, damit du nicht wieder den Einsatz verpasst. Das gilt übrigens auch für dich«, fügte er, an Gundel gewandt, hinzu. »Nicht vergessen – in der dritten Variation übernehme ich anstelle der Bratsche.«
Er hob den Bogen über die Saiten seines Instruments und warf den Kopf in den Nacken. Als er mit energischem Nicken den Einsatz gab, fielen seine Töchter in das Thema ein, Ulla mit dem Cello, Gundel mit der zweiten Geige, und in feierlich getragenem Jubel wand die Hymne ihre unsichtbaren Kränze um die Möbel und Pflanzen des Salons.
G – E – F – D – C
Die Teetasse in der Hand, schloss Christel die Augen, um im Geist die Melodie mitzusummen, während über ihrem in zweiundfünfzig Jahren ergrauten Lockenkopf die Blätter ihres Ficus leise zitterten, ganz und gar vertieft in die Musik, so dass sie nicht einmal hörte, dass draußen in der Diele das Telefon klingelte.
2
Ruth spürte, wie sich das Kind in ihr bewegte. Doch die leichte Übelkeit, die sie dabei empfand, hatte nichts damit zu tun. Seit sie in dieser Mansardenwohnung hauste, war ihr fast immer ein bisschen übel, und der Grund dafür war nicht ihre Schwangerschaft, sondern der Geruch. Obwohl der Kolonialwarenladen ihrer Vermieterin sich im Erdgeschoss des Hauses befand, drangen die Ausdünstungen des Lebensmittellagers bis hinauf unters Dach, und sie konnte die zwei Zimmer, in denen sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn lebte, so oft lüften, wie sie wollte, der käsige Geruch hing in allen Gardinen und Kleidern und Vorhängen und war nicht fortzukriegen.
Im Treppenhaus wurden Schritte laut.
»Vati!«, rief Winfried. »Vati kommt nach Hause!«
Ruth schaute von ihrer Näharbeit auf. »Dann kannst du ihm ja zeigen, was du geübt hast.«
Aufgeregt lief ihr Sohn zur Tür. Er hatte stundenlang darum gebettelt, für seine kleine Vorführung den grauen Janker und die kurze Lederhose anziehen zu dürfen, die seine Großmutter ihm zusammen mit den Haferlschuhen hinter dem Rücken ihres Mannes zum fünften Geburtstag geschenkt hatte. Obwohl das seine einzigen Sonntagskleider waren, hatte Ruth schließlich nachgegeben. Jetzt platzte er fast vor Stolz, dass er sie an einem gewöhnlichen Freitagabend tragen durfte.
Als die Tür aufging, schlug Winfried die Hacken zusammen und stand stramm wie ein Soldat, die rechte Hand an die kahlrasierte Schläfe gelegt, auf die das schwarze, wie mit einem Lineal gescheitelte Haar in schrägen Strähnen herabfiel. Doch sein Vater achtete nicht auf ihn. Mit grauem, leerem Gesicht ging er an ihm vorbei zum Küchenschrank, um sich ein Bier zu holen.
»Wie war das Treffen mit den Kameraden?«, fragte Ruth, als sie seine Miene sah.
»Du weißt doch, dass ich darüber nicht sprechen darf.« Während Fritz die Flasche öffnete, wies er mit dem Kinn auf die Bratsche, die außer einem gerahmten Foto von ihm in Uniform als einziger Schmuck an der Wand der kleinen Wohnküche hing. »Wann willst du den Staubfänger endlich zu Geld machen?«
»Ich weiß nicht«, sagte Ruth zögernd. »Vielleicht bekomme ich ja irgendwann doch wieder Lust zu spielen.«
»Typisch höhere Tochter«, brummte ihr Mann. »Kohldampf schieben bis unter die Achseln, aber zu stolz, um eine nutzlose Geige zu verscheuern.« Er setzte sich an den Tisch und trank einen winzigen Schluck, kaum so viel, wie nötig war, um die Lippen zu benetzen. Die Flasche musste den ganzen Abend reichen, bis Zeit zum Schlafengehen war.
»Das ist keine Geige, sondern eine Bratsche«, sagte Ruth. »Aber schau doch mal, dein Sohn möchte dir die ganze Zeit schon etwas zeigen.«
Mit vor Aufregung rotem Gesicht stand Winfried immer noch stramm und salutierte. »Ist das so richtig, Vati?«
Fritz drehte sich um. Als er seinen Sohn endlich ansah, flackerte in seinen müden, tiefliegenden Augen für einen Moment so etwas wie Stolz auf, und um seinen Mund, der wie ein Strich die ausgemergelten Wangen verband, spielte ein Lächeln.
»Brav, Kamerad.«
Er hob seinen gesunden linken Arm, um Winfrieds Wange zu tätscheln. Dabei verstärkte sich das Schütteln seines rechten Arms so sehr, dass Ruth kaum hinschauen konnte. Was für ein schneidiger Kerl war Fritz Nippert gewesen, als sie sich in ihn verliebt hatte … Gegen den Willen ihrer Eltern hatte sie das Lyzeum abgebrochen, ein Jahr vor dem Abitur, um sich als Krankenschwester an die Front zu melden. Fritz, ein blutjunger Rottenführer, hatte sie im belgischen Niemandsland aufgelesen, nachdem der Zug irgendwo auf freiem Feld angehalten hatte, und sie mit seinem Motorrad zum Lazarett gebracht. Die Entschlossenheit, mit der er den Sanitätern Befehle gab, hatte sie noch mehr beeindruckt als seine Uniform. Fritz war ein Mann, ein richtiger Mann! Als sie ein paar Wochen später schwanger war, hatten sie in einer kleinen Dorfkirche geheiratet, gerade noch rechtzeitig, bevor Fritz im dritten Kriegsjahr nach Russland abkommandiert worden war. Als er von dort zurückkam, hatte sie ihn nicht wiedererkannt. Nach mehreren schweren Verwundungen, drei Malariaanfällen und zwei Jahren in einem sibirischen Bergwerk war er nur noch ein Wrack, abgemagert bis auf die Knochen und mit dieser Schüttelhand, die nicht mal im Schlaf Ruhe fand. Selbst sein Haar, das früher so voll und schwarz gewesen war wie jetzt das seines Sohnes, war ihm ausgefallen, mit der Glatze und dem eingefallenen Gesicht sah sein Kopf wie ein Totenschädel aus. Manchmal, wenn sie ihn mit seinem Bild an der Wand verglich, konnte sie kaum glauben, dass dies ein und derselbe Mann sein sollte.
»Wegtreten!«, sagte Fritz mit leiser, schwacher Stimme.
Doch Winfried rührte sich nicht vom Fleck. Wie gebannt schaute er auf den rastlosen Unterarm seines Vaters.
»Warum macht die Hand das immer?«
»Das hab ich dir doch schon hundertmal gesagt – das kommt von der Gefangenschaft.«
»Bei den bösen Russen?«
»Ja, bei den bösen Russen«, antwortete Ruth für ihren Mann. Sie biss den Nähfaden ab und reichte Fritz die Arbeitsjacke, an der sie einen losen Knopf befestigt hatte.
Mit finsterem Blick schaute er auf den schäbigen, mehrmals geflickten Halbkittel. »Dass es mal so weit mit uns kommen würde …« Statt den Satz zu Ende zu sprechen, schüttelte er nur den Kopf.
Für einen Moment ließ Ruth sich von seiner Stimmung anstecken. Er hatte ja recht – auch sie trug Kleider, für die sie sich früher zu Tode geschämt hätte, zu essen gab es kaum etwas anderes als Margarinebrote und Pellkartoffeln, im Winter froren sie und badeten in einer Zinkwanne alle drei der Reihe nach im selben Wasser, weil Holz und Kohle zu teuer waren, um für jeden extra zu heizen, und die Wohnküche, in der sich ihr gesamtes Familienleben abspielte, war kleiner als das Bügelzimmer ihrer Mutter.
»Warte nur ab, es kommen auch wieder andere Zeiten«, sagte sie. Um die düsteren Gedanken abzuschütteln, stand sie auf und stellte den Volksempfänger an – der einzige Luxus in ihrer Wohnung. Fritz hatte ihr den Apparat zu Weihnachten geschenkt, einer seiner Kameraden hatte ihn unter der Hand aus irgendwelchen alten Beständen in Berlin organisiert.
Zuerst nur ein grünlicher Schimmer, glühte die Röhre allmählich auf, und leise anschwellend drang die Musik aus dem Lautsprecher.
Komm, wir machen eine kleine Reise, in ein Land so wunderschön … Denn die Welt dreht weiter sich im Kreise, und du musst mit ihr dich drehn …
3
Stell Dir vor, wir zögen in die Ferne, unser Traumland anzuseh’n … Über uns der Mond und tausend Sterne, unser Glück wär’ traumhaft schön …
Laut scheppernd tönte der Schlager, der seit Wochen auf allen Radio-Stationen gespielt wurde, als gäbe es keine anderen Lieder mehr in Deutschland, aus den übergroßen Lautsprechern des Ballsaals Lennestein, in dem zwei Dutzend Sauerländer Jungbauern sowie fünf Dutzend junger Mädchen und weniger junger Damen unter Anleitung von Tommy Weidner mit unterschiedlichem Erfolg ihre ersten Tanzschritte übten. Der Lennestein war der einzige Ballsaal in der kleinen, zwischen Ruhrgebiet und Sauerland gelegenen Industriestadt Altena, deren zahllose, zum Teil jahrhundertealte Fabriken in den drei engen Tälern von Lenne, Rahmede und Nette früher einmal zwei Drittel des großdeutschen Drahtbedarfs produziert hatten, wie jedem der rund zwanzigtausend Einwohner schon als I-Männchen eingebläut worden war. In dem stuckverzierten, auch während des Sommers stets irgendwie kalten Saal hatten zu Friedenszeiten die großen Feste der Altenaer Bürgerschaft stattgefunden, der Königinnenball der Friedrich-Wilhelms-Schützengesellschaft, der Winterball des Reit- und Fahrvereins, der Stiftungsball der Gesellschaft »Erholung«, und auch im Krieg hatte der Saalbau als Veranstaltungsort für Parteiversammlungen sowie als Sammelstelle des Winterhilfswerks sowie schließlich, nachdem Altena im April 45 zur Lazarettstadt für das zerstörte Ruhrgebiet erklärt worden war, als Erweiterung des St.-Vinzenz-Krankenhauses wertvolle Dienste geleistet. Seit dem Zusammenbruch aber stand der Bau die meiste Zeit ungenutzt leer – bis auf Freitagabend, wenn Tommy Weidner Tanzkurs hielt. Dann kam wieder Leben in die kalte Pracht.
Da Tommy bei den Herren, im Unterschied zu den Damen, nur Zahlungen in Naturalien akzeptierte, weil das Besatzungsgeld der Alliierten genauso wenig wert war wie die alte Reichsmark, rekrutierten sich die männlichen Teilnehmer seines Kurses fast ausschließlich aus den umliegenden Dörfern. Aus Dahle und Evingsen, aus Einsal und Mühlenrahmede, vom Hegenscheid und vom Wixberg kamen die heiratswilligen Bauernsöhne in die Stadt, wo Rahmede und Nette zu Füßen einer mittelalterlichen Burg in die von abgelassenen Fabriksäuren ockerfarben eingefärbte Lenne flossen – die Ärmeren zu Fuß, die Wohlhabenderen mit dem Fahrrad oder auf dem Rücken eines Ackergauls, die Reichen mit einem Auto oder Motorrad, doch alle mit Kartoffeln oder Eiern, Gemüse, Obst oder Speck, um die Kursgebühr zu bezahlen und die Herzen der Bürofräuleins und Fabrikarbeiterinnen und Kriegerwitwen zu erobern, unter denen sie, weil in deutlicher Unterzahl, die Qual der Wahl hatten und auch die weniger Ansehnlichen oder gar Versehrten sich noch die hübschesten aussuchen konnten.
Leben, ist es denn nicht schön zu leben? Sieh, ich will mein Herz dir geben … Und was dann noch fehlt zum Glücklichsein, sind Träumerei’n …
Als der Refrain einsetzte, schaute Tommy auf seine Füße. War das wirklich ein Foxtrott? Oder vielleicht doch eher ein Slowfox? Da er Slowfox nicht konnte, hatte er sich für Foxtrott entschieden. Wenn er hin und wieder aus dem Takt kam, war das also nicht allein die Schuld seiner begriffsstutzigen Tanzschülerin Annegret, die, wohlgenährt und rotbackig, ihn mit ihren Kuhaugen fortwährend anhimmelte, als wäre er Jopi Heesters, während er ebenso verzweifelt wie erfolglos versuchte, ihr den Grundschritt beizubringen. Obwohl er seit der Entlassung aus der britischen Gefangenschaft sein Leben damit bestritt, anderen Foxtrott, Tango und vor allem seinen Lieblingstanz Jive beizubringen, hatte er selbst nie wirklich tanzen gelernt, und wenn man ihn nach dem präzisen schritttechnischen Unterschied zwischen langsamem und Wiener Walzer gefragt hätte, wäre er in Verlegenheit geraten. Aber dieses Defizit machte er mit seinem Rhythmusgefühl mehr als wett. Improvisieren lag ihm im Blut – seit er vor gut fünfundzwanzig Jahren geboren worden war, musste er improvisieren, sein Leben lang. Der Grund dafür war die einzige Sünde im Leben seiner Mutter, ein Mensch namens Heinz-Ewald, seines Zeichens Handelsvertreter, auf den sie sich vor knapp sechsundzwanzig Jahren eingelassen hatte, als er auf Durchreise in Altena war: ein »Hallodri«, wie sie immer gesagt hatte, aber von »blendendem Aussehen« und »vornehmen Manieren«, der sie mit seinen »herrlichen Witzen« und seinem »lausbübischen Lächeln«, vor allem aber mit den »wundervollsten Komplimenten, die eine Frau sich nur wünschen kann«, an einem einzigen Abend um den Finger gewickelt hatte und dem Tommy angeblich auf erschreckende Weise nachgeraten sei – »sogar sein Lachen hast du von dem Hallodri geerbt, genauso wie die braunen Augen und die braunen Locken«. Heinz-Ewald hatte sich nie wieder bei ihr gemeldet, und da sie nicht mal seinen Nachnamen gekannt hatte, geschweige denn seinen Wohnort oder die Firma, die er vertrat, hatte sie Tommy allein großgezogen, als Putzfrau im Rathaus, mit einem Lohn von fünfundfünfzig Pfennigen pro Stunde. Bis zum Notabitur und seiner Einberufung als Soldat hatte Tommy nie gewusst, ob er auf seine Mutter stolz sein durfte oder ob er sich für sie schämen musste. Schließlich war er auf dem Gymnasium, dessen Besuch der Direktor der Volksschule ihm mit Unterstützung des Ortsgruppenleiters ermöglicht hatte, der einzige Junge ohne einen Vater gewesen, ein »Bastard«, und wenn er im Kreis seiner Mitschüler, die fast allesamt Söhne von Fabrikbesitzern und Kaufleuten und höheren Beamten waren, überhaupt hatte bestehen können, dann vor allem wegen seiner großen Klappe sowie der Tatsache, dass die Rädchen in seinem Gehirnkasten offenbar etwas schneller arbeiteten als bei anderen – Heinz-Ewalds Erbe sei Dank. Erst als ihn im März 1945 ein Feldpostbrief mit der Nachricht erreicht hatte, dass seine Mutter bei einem der wenigen Bombenangriffe, die es in Altena gegeben hatte, ums Leben gekommen sei, bei einem Fliegerbeschuss der Kleinbahn zwischen Mühlenramede und Altroggenrahmede, die sie benutzt hatte, um sich mit Putzen in den Büros der Schraubenfabrik Forkert ein paar Pfennige dazuzuverdienen, damit sie ihrem Sohn ab und zu ein paar Zigaretten an die Front schicken konnte, hatte er begriffen, wie sehr sie seinen Stolz verdiente.
»Ich könnte stundenlang so mit dir tanzen«, sagte Annegret mit einem innigen Augenaufschlag.
»Pssst«, erwiderte Tommy. »Sonst kommen wir aus dem Takt. Lang, lang, kurz-kurz, lang …«
Doch zu spät! Annegret hatte sich schon so sehr verstolpert, dass sie gegen ihn taumelte. Warm und weich spürte er ihren mächtigen Busen auf seiner Brust. War das wirklich nur Unvermögen – oder vielleicht Absicht? Ihr Vater, Hermann Lüsebrink aus Wiblingwerde, hatte in einem einzigen Kriegsjahr alle seine drei Söhne verloren und suchte händeringend nach einem Mann für seine Tochter und einen Jungbauern für seinen Hof. Als Tommy das Gesicht seiner Tänzerin sah, wusste er Bescheid. Nein, er hatte sich nicht geirrt: Annegret war reine, sehnsuchtsvolle Hingabe.
Um ihren Blick nicht erwidern zu müssen, drehte er sich nach Bernd und Benno um, seinen zwei Freunden, die sich für ein paar in Aussicht gestellte Fressalien bereit erklärt hatten, den Frauenüberschuss im Kurs ein wenig auszugleichen. Bernd, der im selben Infanterieregiment, in dem Tommy Leutnant gewesen war, als Obergefreiter gedient hatte, war vollkommen unmusikalisch und hatte alle Mühe, seine Tanzpartnerin, die ihm kaum bis an die breiten Schultern reichte, mit seinen Maurerhänden über das Parkett zu führen, so dass er, die Zungenspitze angestrengt zwischen den Lippen, weder nach links noch nach rechts schaute, während Benno, der gerade elegant einen ihm in die Quere kommenden einarmigen Tänzer samt Partnerin umkurvte, mit unverhohlener Schadenfreude zu ihm herübergrinste.
»Kopf hoch und an den Führer denken!«, raunte er, als sie aneinander vorbeischoben.
»Du hast gut reden«, raunte Tommy zurück. Obwohl Benno mit seinen achtzehn Jahren noch nicht mal einen richtigen Bart hatte, tanzte er schon den ganzen Abend mit dem hübschesten Mädchen im Saal. Dank seiner offenen und stets freundlichen Art, vor allem aber dank seiner grundanständigen Ausstrahlung hatte er Schlag bei Frauen, insbesondere bei denen, die einen Bogen um Tommy Weidner machten, weil sie sich nicht die Finger verbrennen wollten. Dabei wusste die ganze Stadt, dass Benno Krasemann so gut wie verlobt war – mit Gundel Wolf, der jüngsten Tochter der alteingesessenen Firma Wolf, einer der größten Altenaer Drahtfabriken, in der Benno, nachdem auch er die letzten zwei Kriegswochen noch in Tommys und Bernds Regiment als Soldat gekämpft hatte und dann zusammen mit ihnen für drei Monate in britische Gefangenschaft geraten war, eine Lehre zum Industriekaufmann absolvierte, also im Büro seines künftigen Schwiegervaters, wenn alles nach Plan verlief.
Aber was verlief schon nach Plan? Wenn alles nach Plan verlaufen wäre, wäre Tommy schon mit Gundels Schwester Ulla verheiratet – der einzigen Frau, von der er sich hatte vorstellen können, ihr für immer die Treue zu halten.
»Siehst du«, raunte Benno, als er wieder an ihm vorübertanzte, »da kommt schon die Belohnung.«
Tatsächlich – Bauer Lüsebrink kam in den Saal marschiert, einen überbordenden Fresskorb vor sich hertragend wie einen Siegerpokal. Kaum hatte Tommy ihn erblickt, ließ er Annegret stehen und klatschte in die Hände.
»Danke, meine Damen und Herren! Schluss für heute!«
Ein enttäuschtes Ooooh ertönte, man hätte zu gerne weitergetanzt, doch niemand wagte zu protestieren. Während die Herren die Damen zu ihren Plätzen führten, wie Tommy es ihnen beigebracht hatte, marschierte Hermann Lüsebrink mit seinem Korb direkt auf ihn zu. Tommy konnte sich nicht beherrschen, vorsichtig nach dem Inhalt zu schielen. Ob wohl wieder ein Kringel von der selbstgemachten Leberwurst dabei war?
»So können Sie immer leben, Herr Weidner, alle Tage«, sagte der Bauer voller Wohlwollen und drückte ihm den Korb in die Hand. »Sie brauchen nur ja zu sagen.«
Tommy warf einen Blick auf den Korb, dann auf Annegret, die über beide Backen strahlte, dann wieder auf den Korb, in dem er nicht nur einen, sondern sogar zwei Kringel Leberwurst entdeckte. Doch ein erneuter Blick auf Annegret, die schon zu glucksen begann, reichte, um ihn von der Versuchung zu kurieren.
»RUHE!«, rief plötzlich Bernd in den Saal. »Der Tag X ist da!«
Wie auf ein Zauberwort flogen alle Köpfe zu ihm herum. Jeder wusste, was mit »Tag X« gemeint war – seit Wochen war von nichts anderem mehr die Rede. Auch Tommy spürte, wie ihm vor Aufregung der Mund austrocknete. Während es mucksmäuschenstill im Lennestein wurde, drehte Bernd das Radio lauter.
»Wie wir soeben erfuhren«, verkündete ein unsichtbarer Sprecher, »haben die Militärregierungen der drei Westzonen den Stichtag der Währungsreform auf kommenden Sonntag, den 20. Juni 1948, festgelegt …«
Kaum waren die Worte gesprochen, brach im Saal so lauter Jubel aus, dass alle weiteren Erklärungen darin untergingen. Auf diese Meldung hatte ganz Deutschland gewartet! Während die Tanzpaare sich lachend in die Arme fielen, schoss Tommy ein einziger, wunderbarer Gedanke durch den Kopf.
Jetzt fing sein Leben erst wirklich an!
4
Mit angehaltenem Atem, um ja kein Wort zu verpassen, verfolgte Ruth in ihrer Wohnküche die Ankündigung am Lautsprecher ihres Volksempfängers. Auch Fritz lauschte mit großen, leeren Augen.
»Die D-Mark löst mit sofortiger Wirkung die Reichsmark ab. Ab Montag, den 21. Juni, wird die neue Währung das alleinige Zahlungsmittel in den drei alliierten Westzonen sein. Die Bevölkerung ist aufgerufen, die entsprechenden Aushänge an den öffentlichen Gebäuden zu beachten, mit denen die Militärregierung über die Einzelheiten der Umstellung informiert …«
»Was sagt der Onkel?«, fragte Winfried.
»Pssst!«, machten Ruth und Fritz wie aus einem Mund.
»… Die örtlichen Umtauschstellen sind von neun Uhr morgens an geöffnet. Jeder Bürger der drei Westzonen bekommt bei Vorlage seines Ausweises für vierzig Reichsmark vierzig neue D-Mark ausgezahlt, zum Wechselkurs eins zu eins …«
Ruth biss sich vor Freude auf die Lippe. »Habe ich nicht gesagt, es kommen auch wieder andere Zeiten?«
Fritz zuckte die Achseln. »Das glaube ich erst, wenn es so weit ist.«
»Aber wenn sie es doch im Radio sagen! Übermorgen ist es so weit! Vierzig Mark für jeden! Das sind achtzig Mark für uns beide! Und vielleicht gibt’s ja noch mal vierzig Mark für Winfried. Das wären insgesamt einhundertzwanzig neue D-Mark. Einhundertzwanzig«, wiederholte sie voller Andacht, weil sie die Zahl kaum fassen konnte. »Nur für uns drei!« Voller Hoffnung blickte sie ihren Mann an. »Was meinst du, was werden wir damit machen?«
Fritz nahm einen tiefen Schluck aus seiner Flasche. Dann wischte er sich mit dem Handrücken den Schaum vom Mund. »Darüber muss ich sehr gründlich nachdenken.«
5
Die holzgetäfelten Wände im Schwarzen Raben waren vom Tabakqualm all der Zigarren, Pfeifen und Zigaretten, die Generationen von Fabrikarbeitern, Handwerkern und kleinen Ladeninhabern hier geraucht hatten, fast schwarz, und obwohl sich in diesen Zeiten kaum noch jemand echten Tabak leisten konnte und die meisten Besucher der dunklen, engen Kneipe, in der sich seit Menschengedenken die halbe Freiheitstraße zum Feierabend traf, getrocknete Kastanienblätter rauchte, war die Luft zum Schneiden. Die Jungfrau Annemarie, wie die Wirtin trotz ihrer siebzig Jahre aus Respekt vor ihrem Ledigenstand immer noch hieß, thronte mit ihrer gewaltigen Leibesfülle von zweieinhalb Zentnern auf einem erhöhten Schemel hinter dem Tresen, umrankt von Weinreben, die irgendwann ein unbekannter Künstler auf die gekachelte Wand in ihrem Rücken gepinselt hatte, zapfte Bier und kassierte von ihren Gästen die Bezugsmarken, die zusätzlich zum Geld zur Bezahlung nötig waren und ohne die es weder Speisen noch Getränke gab. Dabei spähte sie immer wieder neugierig zu Tommy und seinen Freunden herüber, die sich in die hinterste Ecke der bier- und schnapsgedünsteten Höhle verkrochen hatten, um die Ausbeute des Abends miteinander zu teilen.
Auf dem Tisch vor ihnen türmten sich Berge von Kartoffeln, Äpfeln und Zwiebeln, bekrönt von einer Speckschwarte, einem Töpfchen Schmalz und zwei Kringeln Leberwurst. So großzügig, wie er es vor seinem Gewissen verantworten konnte, schob Tommy, eine John Player zwischen den Lippen, seinen zwei Eintänzern den Lohn für ihren aufopferungsvollen Einsatz im Lennestein zu.
»Ein Kringel für euch, ein Kringel für mich.«
Bernd zog ein Klappmesser aus der Tasche, nahm mit Hilfe seines Daumens Maß und zerschnitt seine und Bennos Wurst in zwei exakt gleiche Hälften. »Ich an deiner Stelle würde mir das Angebot nicht zweimal überlegen«, sagte er.
»Du meinst – Annegret Lüsebrink?«, fragte Tommy. »Um Gottes willen!«
»Sei kein Idiot!«, sagte Bernd und leckte die Leberwurstspuren von der Klinge. »Als ihr Mann hättest du immer satt zu essen.« Er klappte das Messer zusammen und steckte es zurück in die Jackentasche.
»Und eine Familie hättest du dann auch«, fügte Benno hinzu. »Ich meine, du hast doch sonst niemanden.«
Tommy schaute seinen Freund an. War das eine Anspielung darauf, dass Ulla ihm den Laufpass gegeben hatte? Doch Benno erwiderte so arglos seinen Blick, dass Tommy den Verdacht beiseiteschob. Nein, die Anspielung hatte nur seiner Mutter gegolten, und dem verschollenen Heinz-Ewald.
»Seid ihr vom Affen gebissen?«, schnaubte er. »Könnt ihr euch mich als Bauer vorstellen? In einem Kaff wie Wiblingwerde?«
»Aber die Fressalien!«, gab Bernd zu bedenken.
Tommy schüttelte den Kopf. »Wenn die D-Mark kommt, sind Hermann Lüsebrinks Schätze nicht mal mehr ein Zehntel so viel wert wie heute.«
»Blödsinn«, erwiderte Bernd. »Fressen müssen die Leute immer. Ob mit oder ohne D-Mark.«
»Das hat mit Fressen nichts zu tun.«
»Alles hat mit Fressen zu tun.«
»Ja, aber nicht nur. Es gibt auch noch andere Dinge, die zählen.«
»Außer Fressen? Da bin ich aber gespannt.«
Tommy fragte sich manchmal, ob es in dem Maurerschädel seines Freundes auch noch etwas anderes gab als Bratkartoffeln, Eier und Speck. Bernd war stark wie ein Bär, er konnte zwei Sack Zement auf seinem breiten Buckel schleppen, dabei war er eine Seele von Mensch – aber das Einmaleins hatte er so wenig erfunden wie das Abc.
»Also gut, ich will es dir erklären«, seufzte Tommy und überlegte, wie er es anstellen sollte. »Bis jetzt waren Fressalien außer Zigaretten die einzige Währung, die jeder akzeptierte – das alte Geld war ja nur noch Papier. Darum waren sie viel teurer, als sie in Wirklichkeit wert sind, und du konntest dir auf dem Schwarzmarkt dafür fast alles kaufen. Aber wenn es ab Sonntag wieder richtiges Geld gibt, Geld, an dessen Wert die Leute glauben, ist es damit vorbei. Mit der neuen D-Mark verändert sich alles. Dann sind Fressalien und Zigaretten nur noch irgendwelche Dinge wie andere auch, und du kannst dir nichts mehr dafür auf dem Schwarzmarkt kaufen. Weil es dann gar keinen Schwarzmarkt mehr gibt.«
»Keinen Schwarzmarkt mehr?«, staunte Bernd. »Unmöglich!«
»Und trotzdem wird es so sein, verlass dich drauf! Wenn du was brauchst, gehst du einfach in ein Geschäft. Hier die Ware, da das Geld.«
»Du meinst – wie in Friedenszeiten vor dem Krieg?«
»Genau, nur besser. Weil jetzt statt der Nazis die Amis und Engländer und Franzosen das Sagen haben.«
Bernd fuhr sich mit seiner Pranke über das kurzgeschorene, aschblonde Haar. »Und was ist mit der Ostzone? Da sind doch die Russen. Kriegen die auch das neue Geld?«
»Natürlich nicht! Die behalten das alte.«
»Aber wie soll das denn gehen – zwei verschiedene Währungen in ein und demselben Land?«
So schwer von Kapee Bernd im Allgemeinen war, stellte er manchmal Fragen, die klüger waren als er selbst. Während Tommy überlegte, was er seinem Freund zur Antwort geben sollte, ohne dass die anderen merkten, dass er genauso ahnungslos war, ging die Tür auf, und herein kam ein britischer Sergeant.
»Ach du dicke Scheiße!«, zischte Benno.
Wie auf Kommando ließen die drei ihre Beute unter dem Tisch verschwinden.
»Good evening«, sagte der Brite.
»Guten Tach sagt man hier«, erwiderte die Jungfrau Annemarie auf ihrem Thron.
»I’m looking for Mr Weidner. Can you please help me?«
»Sprich Deutsch, Jüngsken, wenn du was von mir willst. Oder halt die Klappe.«
Zum Glück schien der Soldat kein Deutsch zu verstehen. Während er sich suchend in der Kneipe umschaute, verstummten die Gespräche. Schweigend stierten die Gäste in ihre Gläser. »Ah, there he is!«
Mit breitem Lächeln näherte der Sergeant sich dem Tisch. Tommy wünschte, er wäre unsichtbar. Zwar wussten die Briten, womit er sein Leben bestritt, und ließen ihn für gewöhnlich in Ruhe – schließlich brachte er auch den Besatzungsoffizieren das Tanzen bei und besorgte für ihren Kurs die hübschesten Mädchen der Stadt. Doch die stillschweigende Duldung seiner Schwarzmarktgeschäfte galt nur, solange man ihn nicht bei ihrer Ausübung erwischte.
»Don’t worry«, sagte der Brite und hob die Speckschwarte, die im Eifer des Gefechts zu Boden gefallen war, wieder auf und drückte sie Tommy in die Hand. »Ick habe nix gesähän. I’m here in Auftrag von Commander Jones. Er will wissen, whether you can teach us Schuhplattler?«
»Schuhplattler?«, wiederholte Tommy verblüfft.
»Yes«, bestätigte der Soldat. »The most crazy deutsche Volkstanz!«
»Ach so.« Tommy atmete auf. »Na klar – sure I can!«
6
Das Hauskonzert in der Villa Wolf war beendet, längst schwiegen Geigen und Cello im Dämmerlicht des Salons. Trotzdem hielt Ulla immer noch mit vor Anspannung feuchten Händen ihr Instrument zwischen den Knien, während sie zusammen mit ihrer Schwester und ihren Eltern den Erläuterungen zur Durchführung der Währungsreform lauschte, die aus dem Lautsprecher der schweren, hochglanzpolierten Radiotruhe unter dem Gummibaum drangen.
Würden vierzig neue D-Mark reichen, damit ihr großer Traum in Erfüllung ging? Ulla spürte, wie ihr Herz höher schlug. Wenn ihre Mutter im Salon der Villa Wolf eine Radiosendung mit politischen Nachrichten duldete und darüber sogar ihren Tee kalt werden ließ, war nichts mehr unmöglich.
Ulla konnte sich noch gut daran erinnern, wie vehement ihre Mutter sich dagegen gewehrt hatte, dass die »Hitlerei« in Gestalt dieses Mahagoni-Ungetüms in ihrem Heiligtum Einzug hielt, und wenn aus den gelbmaschigen Lautsprechern das Geschrei des Führers oder dessen Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda zu hören gewesen war, hatte niemand es gewagt, den Apparat in ihrer Gegenwart einzuschalten – nur Konzertübertragungen waren erlaubt, vorzugsweise Operetten. Doch heute hatte Christel eine Ausnahme gemacht und das Radio selbst eingeschaltet, nachdem Benno Krasemann, der Lehrling der Firma und Freund ihrer jüngsten Tochter, aus dem Schwarzen Raben in der Villa angerufen hatte, um sie von der Sondermeldung in Kenntnis zu setzen. Jetzt wusste auch sie sich kaum zu halten vor Glück über die Nachrichten, die der Sprecher verkündete, daran ließ der verräterisch feuchte Glanz in ihren blauen Augen keinen Zweifel.
»Was meint ihr, ob es bei Café Dunkel wohl wieder die herrliche Buttercremetorte geben wird?«, fragte sie. »Mit echter deutscher Markenbutter?«
Ulla schüttelte lächelnd den Kopf. »Du und deine Buttercremetorte …«
»Auf jeden Fall gibt es ab Montag in den Geschäften wieder was zu kaufen«, meinte Gundel. »Es heißt, die Einzelhändler haben Berge von Waren gehortet.«
»Auch wenn wir selbst noch so sehr darunter gelitten haben«, erwiderte ihre Mutter, »ich kann es den braven Leuten nicht verübeln. Die Reichsmarkscheine bestanden ja nur noch aus Nullen. Dafür die guten Sachen hergeben? Seien wir ehrlich, das hätten wir doch auch nicht getan.« Mit einem Stirnrunzeln schaute sie Ulla an. »Aber sag mal, Kind, hast du deine Perlenkette immer noch nicht wiedergefunden?«
Unwillkürlich fasste Ulla sich an den Hals. Früher hatte sie die Kette, die Tommy ihr nach dem ersten Kuss geschenkt hatte, nahezu täglich getragen – ganz gleich, ob sie zu ihrer Kleidung gepasst hatte oder nicht. Doch vor einem halben Jahr war ihr nichts anderes übrig geblieben, als sie zu versetzen, sie hätte sonst nicht gewusst, woher sie das Geld hätte nehmen sollen, das sie so dringend gebraucht hatte und um das sie ihre Eltern unmöglich hätte bitten können. Um das Verschwinden des Schmuckstücks zu erklären, hatte sie behauptet, sie hätte es verlegt.
Zum Glück ersparte ihr Vater ihr die Antwort. »Wir haben jetzt Wichtigeres zu besprechen«, sagte er. Er drehte das Radio ab und wandte sich mit ernster Miene an seine Töchter. »Wenn ihr am Sonntag das neue Geld bekommt – was gedenkt ihr damit zu tun?«
7
Über der Ehrensäule des Kriegerdenkmals lachte schon die Sonne vom Himmel, als Christel die Thoméestraße hinunter zur Freiheit lief. Um möglichst wenigen Bekannten zu begegnen, hatte sie von der Nette aus, wo die Firma Wolf ihren Sitz hatte, den Weg über die Burg gewählt, weil in den Einkaufsstraßen entlang der Lenne am Samstagmorgen für gewöhnlich Hochbetrieb herrschte. Wie ein Dieb in der Nacht hatte sie sich nach dem Frühstück aus der Villa gestohlen, mit einer Tasche voller Kartoffeln, Zwiebeln und Äpfel sowie einem halben Kringel Leberwurst und einem halben Töpfchen Schmalz, die sie sorgsam unter ihrem Sommermantel verborgen hielt, aus Angst vor ihrem Mann. Mit den Lebensmitteln wollte sie Ruth beglücken, ihre älteste Tochter, die für sich und ihre kleine Familie jede Unterstützung dringend brauchte, was Eduard jedoch strikt verboten hatte.
Als sie am Totschlag die Freiheit erreichte, sah sie zu ihrer Verwunderung, dass ihre Vorsicht vollkommen überflüssig gewesen war. An diesem Samstagmorgen war die Stadt wie ausgestorben, fast alle Geschäfte hatten geschlossen – wegen »Umbau« oder »Erkrankung«, wie die Schilder an den Ladentüren behaupteten. Doch in den Schaufenstern, in denen bis gestern Abend noch gähnende Leere geherrscht hatte, hatte sich buchstäblich über Nacht eine wundersame Wandlung vollzogen. Bei Mode Vielhaber, ehemals Rosen, bei Betten-Prange, bei Metzger Schmale, Drogerie Pinkert und »Schnuckel« Prein – überall hatten sich die Auslagen wie von Geisterhand gefüllt. Angebote, auf die man seit Jahren vergeblich gewartet hatte, Anzüge und Kleider, Würste und Schokoladen, Matratzen und Zudecken, Bohnerwachs und Käse, Hemden und Blusen, auf einmal war alles wieder da, verschämt garniert mit dem Hinweis »keine gehorteten Waren«. Café Dunkel kündigte sogar an, dass es ab Montag wieder Buttercremetorte geben würde – »mit echter deutscher Markenbutter«.
Christel blieb vor dem Schaufester stehen und schloss die Augen, um sich für einen kurzen, seligen Moment den so lange vermissten Genuss in Erinnerung zu rufen. Fast glaubte sie die köstliche Creme auf der Zunge zu schmecken. Das Geheimnis war, so hatte der Konditor ihr einmal verraten, eine Spur Vanille und Zimt – »aber wirklich nur eine Spur!« Ob es dazu auch wieder echten Bohnenkaffee gab? Mit Dosensahne von Glücksklee?
Als sie die Augen öffnete, schrak sie zusammen. Auf der anderen Straßenseite, kaum einen Steinwurf entfernt, sah sie ihren Schwiegersohn, Fritz Nippert. In einer abgetragenen, mehrmals geflickten Jacke kehrte er mit einem Reisigbesen die Straße. Trotz der Schirmmütze, die seine Glatze verbarg, sah er so alt aus wie ein Greis. Für eine Sekunde begegneten sich ihre Blicke. Die Begegnung war mehr, als Christel ertragen konnte. Die Tatsache, dass Ruths Ehemann bei der städtischen Straßenreinigung arbeitete, war das eine, ihn bei der Ausübung dieser Tätigkeit aber zu sehen, womöglich unter den Blicken irgendwelcher Bekannter, die gerade in diesem Moment hinter der Gardine eines Fensters standen und sie beobachteten – nein, das war zu viel!
Ohne einen Gruß, die Augen fest zu Boden gerichtet, beschleunigte Christel ihre Schritte. Als sie Fritz passierte, spürte sie seinen Blick auf sich gerichtet, diesen finsteren Blick aus den tiefen Höhlen seiner Augen, der ihr immer solche Angst machte, und sie glaubte sogar, aus den Augenwinkeln das entsetzliche Schütteln seiner Hand zu sehen. Tapfer hielt sie aus. Immerhin hatte sie so die Gewissheit, Ruth allein in der Wohnung anzutreffen.
Trotzdem schien es ihr eine Ewigkeit, bis sie das Haus endlich erreichte, in dem ihre Tochter lebte. Der Kolonialwarenladen von Lotti Mürmann im Erdgeschoss war wie die meisten anderen Geschäfte geschlossen, »wegen Inventur«, doch die Haustür, die zu den Wohnungen führte, stand offen.
Auf dem Treppenabsatz im Dachgeschoss holte Christel einmal tief Luft. Dann drehte sie an der Schellschraube der Etagentür.
Winfried, ihr Enkel, machte auf.
»Omi! Die Omi ist da!«, rief er.
Als wolle sie der ganzen Welt demonstrieren, dass sie die Frau eines Straßenkehrers war, kam Ruth in einer ärmellosen Kittelschürze an die Tür. Unter dem billigen, mit Blümchen bedruckten Stoff trat ihr runder Bauch deutlich hervor.
»Hier, das ist für euch«, sagte Christel.
Voller Misstrauen blickte Ruth auf die Tasche mit den Lebensmitteln. »Weiß Papa davon?«
»Nein«, sagte Christel. »Die Sachen sind von Gundels Verehrer. Er hat sie gestern Abend gebracht. Ich weiß auch nicht, wo der die immer auftreibt.«
Ruth schüttelte den Kopf. »Wenn Papa nichts davon weiß, will ich nichts davon haben.«
Christel holte ein zweites Mal Luft. Ruth war schon immer die störrischste ihrer drei Töchter gewesen. Ob das wohl daran lag, dass sie als Einzige Locken und ihr braunes Haar, wie ihr eigenes in der Jugend, einen Einschuss ins Rötliche hatte? Im Gegensatz zu Ulla, der Zweitgeborenen und hübschesten, die zwar auch ihren eigenen Kopf hatte, vielleicht sogar noch mehr als ihre ältere Schwester, diesen aber stets so durchzusetzen wusste, dass sie selber nicht zu Schaden kam, vor allem aber im Gegensatz zu Nesthäkchen Gundel, die mit ihren vom Vater geerbten sanften braunen Augen selbst nur glücklich sein konnte, wenn sie andere glücklich machte, musste Ruth immer mit dem Kopf durch die Wand, egal, wie groß der Schaden war, den sie damit anrichtete. So war sie in ihrer Begeisterung für die Schreihälse im Radio und den angeblichen Endsieg als junges Mädchen an die Front durchgebrannt, um mit einem Kind nach Altena zurückzukehren – und im Schlepptau diesen Mann, für den sich nun die ganze Familie in Grund und Boden schämen musste.
»Jetzt stell dich nicht so an!« Obwohl Ruth sich sträubte, drückte Christel ihr die Tasche in die Hand. »Wenn du sie nicht willst – denk an deinen Sohn. Außerdem bist du schwanger. Da musst du für zwei essen.« Sie bückte sich zu ihrem Enkel und fasste ihn bei den Schultern. »Du darfst niemandem verraten, dass ich hier war! Versprochen? Das ist unser Geheimnis.«
Winfried kannte das schon und zog sein Verschwörergesicht. »Ja, Omimi. Versprochen. Heiliges Ehrenwort.«
Als Christel das ernste Gesichtchen sah, mit dem er die Hand zum Schwur hob, schossen ihr Tränen in die Augen.
»Du armer kleiner Wurm!«
Sie wuschelte einmal sein glattes, schwarzes Haar, dann gab sie ihm einen Kuss und verschwand.
8
Mit bösen Augen starrte Fritz auf die Leberwurst und das Töpfchen Schmalz, die Ruth ihm zum Abendbrot aufgetischt hatte.
»Von wem ist das? Wieder von deiner Mutter?«
»Nein, von Gundels Verehrer.«
»Also von deiner Familie.« Mit beiden Händen schob er die Sachen von sich.
Nur mit Mühe konnte Ruth ihre Enttäuschung verbergen. Fritz war nach der Arbeit lange ausgeblieben, wieder hatte er den Abend mit seinen Kameraden zusammengehockt, so dass sie Winfried schon vor seiner Rückkehr ins Bett gebracht hatte. Trotzdem hatte sie sich die ganze Zeit darauf gefreut, ihrem Mann die Wurst und das Schmalz vorzusetzen – er brauchte doch jedes Gramm Fett, um wieder zu Kräften zu kommen und wenigstens ein bisschen so wie früher zu werden.
Und jetzt dieses Gesicht.
»Mir wirfst du vor, ich wäre zu stolz«, sagte sie. »Dabei bist du viel stolzer als ich. Das können wir uns nicht leisten.«
Wortlos räumte sie die Sachen auf ein Tablett, um sie zurück in den Küchenschrank zu stellen. Wenn Fritz sie nicht essen wollte, würde sie Winfried damit zum Frühstück überraschen. Der Junge würde sich ein Loch in den Bauch freuen. Leberwurstbrote waren seine Lieblingsbrote, und die bekam er selten genug.
»Und ob wir uns das leisten können!«, sagte Fritz, während sie die Schranktür öffnete.
Verwundert drehte Ruth sich um. Als sie seinen Blick sah, wunderte sie sich noch mehr. Ein Lächeln huschte über sein graues, abgemagertes Gesicht, ein Lächeln, das sie schon für immer verloren geglaubt hatte.
Das Lächeln des Mannes, in den sie sich vor einer Ewigkeit verliebt hatte.
»Soll das heißen, du hast neue Arbeit gefunden?« Sie traute sich kaum, an so viel Glück zu glauben.
Tatsächlich schüttelte Fritz den Kopf. Doch schon wieder spielte das Lächeln um seinen Mund. »Besser«, sagte er. »Viel besser sogar!«
»Besser als Arbeit?« Sie stellte das Tablett auf dem Schrankbrett ab. »Was soll das sein?«
Jetzt grinste Fritz über das ganze Gesicht. »Darauf kommst du nie!«
»Willst du mich auf die Folter spannen?«
Immer noch grinsend, zuckte er die Schultern. Auch wenn sie vor Neugier fast platzte – es war eine solche Wohltat, ihn endlich mal wieder gutgelaunt zu sehen.
Brachen jetzt wirklich bessere Zeiten an?
»Bitte, Fritz! Mach doch den Mund auf!«
Offenbar genoss er ihre Neugier so sehr, dass er sie noch ein wenig zappeln ließ. Umständlich öffnete er die Flasche Bier, die sie ihm auf den Tisch gestellt hatte, und nahm einen Schluck. Während er trank, schien sich sogar seine Schüttelhand ein wenig zu beruhigen.
»Ich weiß jetzt, was wir mit dem Geld machen werden«, erklärte er schließlich.
»Mit unseren achtzig D-Mark?«
»Hundertzwanzig«, verbesserte er. »Ich habe mich erkundigt, Winfried zählt auch, genauso wie ein Erwachsener. Und wenn du dich beeilst und wir rechtzeitig zu viert sind«, er deutete mit dem Kinn auf ihren Bauch, »kommen vielleicht noch mal vierzig Mark dazu.«
Die vage, unbestimmte Hoffnung auf ein Wunder, die Ruth für einen Moment verspürt hatte, erlosch so schnell, wie sie gekommen war. Sie wusste selbst nicht, worauf sie gehofft hatte. Aber es war nichts gewesen, was mit Geld zu tun hatte.
»Und?«, fragte sie. »Was hast du dir überlegt?«
Fritz streckte seine gesunde Hand nach ihr aus. Zögernd reichte sie ihm ihre Rechte.
»Wir wandern aus«, sagte er. »Nach Argentinien.«
»Bist du verrückt geworden? Mit den paar Mark kommen wir ja nicht mal bis Hamburg.«
Sie wollte ihre Hand zurückziehen, doch er hielt sie fest.
»Weiter brauchen wir auch nicht zu kommen«, sagte er. »Zumindest nicht mit unserem eigenen Geld. Ich kenne jemand, der hat in Argentinien eine Rinderfarm. Die alten Kameraden strecken uns die Überfahrt vor. Den Vorschuss kann ich später abarbeiten, in unserer neuen Heimat.«
»In unserer neuen Heimat?«, wiederholte sie. Was er sagte, war so verrückt, dass sie nicht wusste, ob er es ernst meinte oder sich über sie lustig machte. »Aber dein Herz«, erwiderte sie unsicher. »Der Arzt sagt, du darfst nur leichte Arbeiten verrichten. Wie willst du das schaffen, auf einer Farm?«
Fritz schnaubte nur einmal verächtlich durch die Nase. »Ich habe schon ganz andere Dinge im Leben geschafft.« Plötzlich nahm seine Miene wieder jenen entschlossenen Ausdruck an, den sie früher so sehr an ihm bewundert hatte, im Krieg, an der Front, wenn er irgendwelche Befehle gab. Es war derselbe Ausdruck wie auf dem Foto von ihm an der Wand.
»Dann … dann meinst du das also wirklich im Ernst?«
Er drückte ihre Hand. »Ja, Ruth. Wir fangen noch mal von vorne an. Ein neues Leben.«
Die wenigen Worte lösten ein solches Durcheinander in ihr aus, dass es ihr die Sprache verschlug. Tausend Gedanken schossen ihr gleichzeitig durch den Kopf. Doch einer war stärker als alle anderen.
Ein neues Leben, hatte er gesagt. Ein neues Leben …
»Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich liebe?«, flüsterte sie.
Statt ihr zu antworten, sah er sie nur mit seinen großen, schwarzen Augen an, so eindringlich und lange, dass ihr ganz flau im Magen wurde. Dann zog er sie zu sich und gab ihr einen Kuss, wie er ihr keinen mehr gegeben hatte, seit er aus Russland zurück war.
9
In der Villa Wolf war der Tee kalt geworden, und die dunkelgrün glänzenden Blätter des Ficus zitterten bedrohlich. Nach einem Tag Bedenkzeit, die Eduard seinen Töchtern verordnet hatte, war die Familie am Samstagabend im Salon zusammengekommen, damit Ulla und Gundel ihren Eltern erklärten, was sie mit den vierzig neuen D-Mark zu tun beabsichtigten, die ihnen am Sonntagmorgen ausgezahlt würden.
»Studieren wollt ihr also?«, rief ihr Vater, den es vor Erregung nicht mehr auf seinem Platz hielt, und begann zwischen den Pflanzen auf und ab zu laufen. »Tja, das hätte ich auch gern getan, das könnt ihr mir glauben. Literatur! Philosophie! Mein Leben hätte ich dafür gegeben!«
»So hoch wollen die zwei ja gar nicht hinaus!«, erwiderte seine Frau. »Gundel möchte doch nur Volkschullehrerin werden, und Ulla …«
»Ich weiß, was die Damen wollen, sie haben es mir ja gerade selbst gesagt. Aber was wird aus der Firma?«
Er drehte sich um und warf seinen Töchtern einen so strengen Blick zu, dass Gundel die Augen niederschlug.
»Als Ärztin kann ich dafür sorgen, dass du die Firma noch viele Jahre selber führst«, sagte Ulla.
»Werd ja nicht frech!«, fuhr er ihr über den Mund, »Herrgott, ich verstehe ja euren Wunsch, zu studieren, und wenn euer Bruder noch am Leben wäre …«
»Was verlangst du von uns? Sollen wir dafür büßen, dass Richard gefallen ist?«
Während Gundel immer noch zu Boden starrte, als gäbe es nichts Interessanteres als das blaurote Rautenmuster des Persers zu ihren Füßen, erwiderte Ulla voller Empörung den Blick ihres Vaters. Die Vorstellung, in der Firma arbeiten zu müssen, war für sie ein Gräuel. Sollte sie mit einer Drahtzieherei ihr Leben vergeuden, anstatt wirklich wichtige Dinge zu tun? Die vierzig Mark gehörten ihr, ihr ganz allein, und sie brauchte sie für ihr Studium. Seit ihrer Kindheit wollte sie Ärztin werden – ihr ganzes Leben hatte sie diesem Traum untergeordnet, ihr ganzes Leben und noch mehr. Und jetzt wollte ihr Vater sie daran hindern, dass sie sich diesen Traum erfüllte? Obwohl sie selbst die Mittel dafür hatte?
»Ich appelliere nur an euer Pflichtgefühl!«, sagte er. »So wie mein Vater es damals bei mir getan hat!«
»Jetzt lass den Mädchen doch ihren Willen«, sprang Christel ihren Töchtern bei. »Es ist doch nun mal ihr Leben, und sie haben nur dieses eine.«
»Unsinn!«, schnitt Eduard ihr das Wort ab. »Die Firma ist unser Leben! Das war so, das ist so, das wird immer so bleiben!
10
Ruth hatte sich schon lange nicht mehr so voller Zuversicht gefühlt wie in dieser Nacht. Seit sie schwanger war, hatte Fritz zum ersten Mal wieder mit ihr geschlafen, mit solcher Leidenschaft, dass sie sich fast schon Sorgen um sein Herz gemacht hatte. Jetzt schnarchte er an ihrer Seite, und auch Winfried schlummerte so friedlich auf seiner kleinen Liege am Fußende des Ehebetts, als könne keine Sorge dieser Welt ihn je erreichen.
Statt sich zum Schlafen herumzudrehen, hatte Ruth sich im Bett aufgesetzt, um das wohlige Gefühl noch etwas länger zu genießen. Am liebsten wäre sie nackt geblieben, aber für den Fall, dass Winfried aufwachte, hatte sie sich vorsichtshalber doch das Nachthemd übergestreift. Während unter dem Fenster draußen ab und zu ein Auto die Freiheitstraße entlangfuhr und dabei die Scheinwerfer die Schlafkammer kurz erleuchteten, indem das Licht einmal an der Zimmerdecke von einer Ecke zur anderen wanderte, dachte sie über das Gespräch mit ihrem Mann nach. In den letzten Wochen und Monaten hatte sie ihren Eigensinn manches Mal bereut, vor allem ihre Entscheidung, sich freiwillig an die Front zu melden, und in vielen schlaflosen Nächten hatte sie sich gefragt, wie alles wohl gekommen wäre, wenn sie Fritz nicht geheiratet hätte. Alles war so ernst und eng und dürftig in ihrem Leben, dass sie sich fast körperlich nach jener leichtsinnigen, verschwenderischen Unbekümmertheit zurücksehnte, die ihr früheres Leben ausgemacht hatte. Auch vermisste sie die Geborgenheit in ihrem Elternhaus, den selbstverständlichen Wohlstand und das Gefühl von Sicherheit, litt unter der Armut, in der sie mit Fritz lebte. Jeden Wunsch musste sie sich verkneifen, nicht nur für sich selbst, auch für ihren Sohn, kaum konnte sie ihm mal ein Tütchen Brausepulver spendieren, so knapp war das Geld. Und ja, sie schämte sich für ihren Mann, wenn er in seiner geflickten Jacke aus dem Haus ging, den Henkelmann in seiner Schüttelhand und den Reisigbesen über der Schulter – auch wenn sie das niemals irgendeinem anderen Menschen gegenüber zugeben würde.
Sollte es damit jetzt ein Ende haben?
Argentinien. Zu Hause hätte sie jetzt im Großen Brockhaus nachgeschaut, wie das Leben dort war. Aber in ihrer Mansardenwohnung gab es natürlich kein Konversationslexikon, so dass sie auf ihre Phantasie angewiesen war. Als sie die Augen schloss, sah sie vor sich eine weite, sanft gewellte Graslandschaft, auf der eine riesige Herde von Kühen weidete, bis zum Horizont. Das Wort Pampa fiel ihr ein – mehr wusste sie nicht über das ferne, fremde Land. Aber das reichte. Im Geiste sog sie die klare, reine Luft ein, die über die Wiesen und Felder strich, ließ sie tief in ihre Lungen einströmen, genoss die kühle Frische. Nie wieder würde der käsige Gestank, der wie ein unsichtbarer Schleier in ihrer Wohnung hing, ihr Übelkeit bereiten.
Das Kind in ihrem Bauch strampelte. Ruth schlug die Augen auf und sah im Lichtschein eines vorüberfahrenden Autos ihren Mann. Sein abgemagerter Kopf sah aus wie ein Totenschädel, doch auf seinen Lippen lag ein Lächeln. Ob er wohl auch von der Pampa träumte? Sogar im Schlaf wischte seine Hand ruhelos über die Bettdecke hin und her.
Zärtlich strich Ruth mit den Fingerspitzen über ihren Rücken.
Vielleicht würde sie in Argentinien ja endlich zur Ruhe kommen.
Teil einsErstes Buch
Der große Anfang
Neues Geld, neues Glück
1948/1949
1
Noch nie seit Kriegsende waren die Altenaer Kirchen an einem Sonntagmorgen so leer gewesen wie an diesem 20. Juni des Jahres 1948. Ob in der katholischen Pfarrkirche St. Matthäus, in der evangelischen Lutherkirche oder in den Tempeln der Calvinisten, freikirchlichen Gemeinden und Zeugen Jehovas: Nur ein paar wenige Gläubige verloren sich in den Bänken der Gotteshäuser zur Messe oder Andacht, die die Priester in ungewohnter Eile hinter sich zu bringen suchten, weil auch sie an diesem Tag noch etwas Besseres vorhatten. Denn wie überall in den drei Westzonen Deutschlands warteten an diesem Morgen auch die Bürger Altenas voller Ungeduld auf die Öffnung der Umtauschstellen, um ihre vierzig frisch gedruckten D-Mark in Empfang zu nehmen.