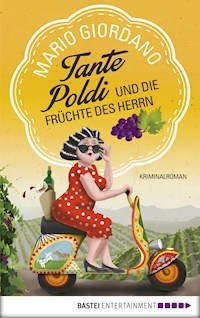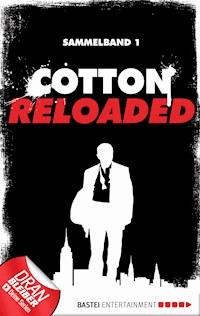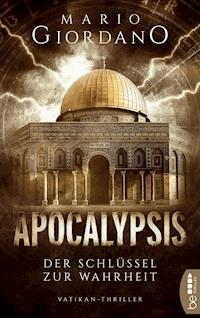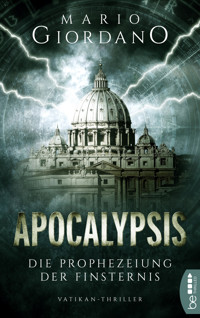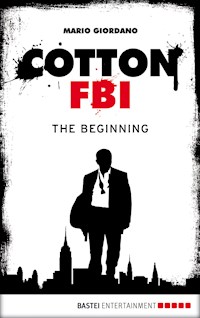4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Ein Peter-Adam-Thriller
- Sprache: Deutsch
Der ultimative Vatikanthriller für alle Fans von Dan Brown und Thomas Gifford
Der Journalist Peter Adam erwacht im Kölner Dom - ohne Erinnerung daran, was in den letzten Tagen geschehen ist. Ringsum hebt sich der Boden, die Hölle tut sich auf, Menschen stehen in Flammen. Hat die Zeit der Apokalypse begonnen?
Selbst der Papst im fernen Rom, der sich Petrus II. nennt, scheint von einem Dämon besessen zu sein und tut nichts, um das drohende Verhängnis abzuwenden. Die letzte Hoffnung der Welt liegt in der rätselhaften Tätowierung, die Peter Adams gesamten Körper bedeckt. Uralte Zeichen, die den Weg zu einem der größten Mysterien der Menschheitsgeschichte weisen: Dem Ursprung des Bösen.
"Wer eine Auszeit vom alltäglichen Wahnsinn nehmen will, kann sich mit diesem klerikalen Wahnsinn bestens unterhalten." Passauer Neue Presse
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 684
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Weitere Titel von Mario Giordano
Apocalypsis-Trilogie (auch als Hörbuch-Download erhältlich):
Band 1: Apocalypsis – Die Prophezeiung der Finsternis
Band 3: Apocalypsis - Der Schlüssel zur Wahrheit
Tante-Poldi-Reihe (auch als Hörbuch/Hörbuch-Download erhältlich):
Band 1: Tante Poldi und die sizilianischen Löwen
Band 2: Tante Poldi und die Früchte des Herrn
Band 3: Tante Poldi und der schöne Antonio
Weitere Titel in Planung.
Cotton Reloaded – Der Beginn (auch als Hörbuch-Download erhältlich)
Die Serie
Ein packender Vatikanthriller für alle Fans von Dan Brown und Thomas Gifford
»Apocalypsis« ist die erfolgreiche Vatikanthriller-Trilogie von Mario Giordano, die den Leser tief in die Verschwörungen des Vatikans und der Mächtigen dieser Welt entführt – bis hin zur alles entscheidenden Schlacht zwischen Gut und Böse.
Über dieses Buch
Der ultimative Vatikanthriller für alle Fans von Dan Brown und Thomas Gifford
Der Journalist Peter Adam erwacht im Kölner Dom – ohne Erinnerung daran, was in den letzten Tagen geschehen ist. Ringsum hebt sich der Boden, die Hölle tut sich auf, Menschen stehen in Flammen. Hat die Zeit der Apokalypse begonnen?
Selbst der Papst im fernen Rom, der sich Petrus II. nennt, scheint von einem Dämon besessen zu sein und tut nichts, um das drohende Verhängnis abzuwenden. Die letzte Hoffnung der Welt liegt in der rätselhaften Tätowierung, die Peter Adams gesamten Körper bedeckt. Uralte Zeichen, die den Weg zu einem der größten Mysterien der Menschheitsgeschichte weisen: Dem Ursprung des Bösen.
Über den Autor
Mario Giordano, geboren 1963 in München, schreibt erfolgreich Romane wie die Apocalypsis-Trilogie oder die humorvolle Krimi-Reihe um Tante Poldi, aber auch Kinder- und Jugendbücher sowie Drehbücher (u.a. Tatort, Schimanski, Polizeiruf 110, Das Experiment). Giordano lebt in Berlin.
Mario Giordano
Das Ende der Zeit
Vatikan-Thriller
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2012 Bastei Lübbe AG, Köln
Plot und Text: Mario Giordano
Redaktion: Henrike Heiland
Lektorat: Diana Rosslenbroich/Jan F. Wielpütz
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven © shutterstock: ZRyzner | agsandrew | Peangdao | Iakov Kalinin
Artwork: © Dino Franke, Hajo Müller
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-6349-4
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Bitte beachten Sie auch:
www.facebook.com/apocalypsis.de
INHALT
Episode 1 ♦ ERWACHEN
Episode 2 ♦ LÖWENMANN
Episode 3 ♦ MAPPA MUNDI
Episode 4 ♦ DZYAN
Episode 5 ♦ ENDZEIT
Episode 6 ♦ SCHWARZE MADONNA
Episode 7 ♦ OCTAGON
Episode 8 ♦ TEMPLUM
Episode 9 ♦ RÜCKKEHR
Episode 10 ♦ BEREICH 23
Episode 11 ♦ DAS TIEFE LOCH
Episode 12 ♦ ENDE DER ZEIT
I
2. Juli 2011, Nordatlantik
Zuerst noch das Gefühl, leicht zu sein, unendlich leicht, zu schweben, zu träumen. Ein schönes Gefühl. Gesichter flogen vorbei, zogen Namen hinter sich her wie die Kielspur einer Nussschale in einem endlosen Ozean. Nikolas. Maria. Don Luigi. Laurenz. Kelly. Ellen. Das helle Lachen einer Frau. Grüne Augen. Diffuse Bilder, getaucht in blaues Licht. Zeichen, Symbole, eine fremdartige Schrift. Murmelnder, monotoner Gesang von irgendwoher in einer seltsamen, unangenehm vertrauten Sprache. Oroni bajihie Oiada! Orocahe quare, Micama! Bial! Oiad! Zodacare od Zodameranu! Noco Mada, hoathahe Saitan! Männer in Mönchsroben, die im Kreis um einen großen Stein herumstehen, die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen. Eine Kinderstimme, rufend, drängend.
Wo sind Mama und Papa hin? Peter, lass mich nicht allein!
Der Duft von Weihwasser und Nelkenöl. Ein Jugendlicher auf einer Massagepritsche, unter Krämpfen fluchend in neapolitanischem Dialekt. Ti scass’ à facci hom’ e merda!
Eine Nummer: 306. Wasser, unendlich viel Wasser. Ein nächtlicher Ozean, darauf treibend ein blaues Licht. Auf und ab. Auf und ab. Ein Brunnen. Ein Spiralsymbol. Dreht sich. Immer schneller. Häschen in der Grube, saß und schlief, saß und schlief …
Jemand ruft. Nicht hinhören! Einfach weitertreiben, so leicht. Auf und ab. Für immer treiben, schwerelos.
Und dann: das Erwachen.
Schlagartig und ohne Vorwarnung kehrte Peter Adam in die Welt des Schmerzes, der Panik und der Angst zurück. Als er die Augen öffnete, sah er zunächst nur milchiges Licht, das ihn ganz und gar einhüllte, angenehm und warm. Für einen Moment gab er sich dem wohltuenden, freundlichen Licht hin, das die ganze Welt auszufüllen schien und ihn sanft und schwerelos trug. Schemenhafte Schatten irgendwo dahinter, sehr fern. Das Nächste, was Peter wahrnahm, war der Schlauch tief in seinem Hals. Einem Reflex gehorchend, versuchte Peter zu atmen. Aber unmöglich. Der Schlauch blockierte seine Luftröhre. Gleichzeitig nahm Peter zwei Dinge wahr: erstens, dass er sich unter Wasser befand, eingehüllt in eine Art Kokon aus einem farblosen Material. Zweitens, dass dieser Kokon ganz mit milchig trübem Wasser gefüllt war, in dem sein Körper schwamm wie in einer Fruchtblase. Dann traf ihn der Schock. Er schlug und trat mit Händen und Füßen um sich. Vergeblich versuchte er, das Gewebe, das ihn umschloss, zu greifen, aber es besaß eine zähe, lederartige Konsistenz. Immer noch unter Wasser, versuchte Peter, aus Leibeskräften zu schreien, was mit dem Schlauch im Hals ebenfalls unmöglich war. Der Druck auf seine Lungen nahm zu. Außer sich vor Panik, zu ertrinken und zu ersticken, krallte er seine Hände nun fester in die farblose Hülle. Bis die Finger seiner linken Hand das lederne Gewebe endlich durchstießen und aufrissen.
Grelles Licht blendete ihn, als sein Kopf aus dem Gewebe stieß. Peter spürte, wie der Druck auf die Lungen nachließ. Aber immer noch steckte der Schlauch in seinem Hals. Nackt und am ganzen Körper mit einer käsigen Schmiere bedeckt, klatschte Peter zu Boden. Der harte Aufprall, so sehr im Gegensatz zu der wohligen Schwerelosigkeit, holte ihn mit einem Schlag in die Wirklichkeit zurück. Reflexartig griff Peter nach dem Schlauch und zog ihn würgend aus seiner Kehle. Sein Bewusstsein realisierte nur am Rande, dass es sich tatsächlich um zwei Schläuche handelte, die tief in seiner Luft- und in seiner Speiseröhre steckten. Verzweifelt zerrte Peter die schier unendlich langen Schläuche ganz aus seinem Hals und erbrach danach einen Schwall heller Flüssigkeit. Und endlich, stöhnend und unter Schmerzen, konnte er Luft holen.
Das Atmen schmerzte, die Lungen brannten. Peter krümmte sich hustend am Boden in einer Lache milchiger Substanz und atmete keuchend. Zwischendurch erbrach er immer wieder weitere Flüssigkeit, verschluckte sich erneut, würgte, hustete und machte den nächsten Atemzug. Zu seiner Verwunderung bemerkte er, dass er eine Erektion hatte, die nur langsam abklang.
Als er keine Flüssigkeit mehr erbrach und sich sein Atem etwas beruhigt hatte, sah er sich hastig um. Das grelle Licht kam von einer starken Lampe über ihm an der Decke, offenbar die einzige Lichtquelle. Peter erkannte, dass er sich in einem ovalen Raum mit vollkommen weißen Wänden befand. Er lag neben einer Art metallischem Podest, von dem er offenbar heruntergefallen war. Der Raum war nicht größer als das Wohnzimmer seiner Eltern, an drei Stellen standen niedrige Apparate mit Leuchtdioden und Anzeigen, die leise summten und aus denen Schläuche und Kabel zu dem Metallpodest führten. Die flüssige Substanz und der zerrissene Kokon bedeckten den Boden und verbreiteten einen säuerlichen Geruch. Entsetzt erkannte Peter nun, dass sein Körper an verschiedenen Stellen durch knotige, blasse hautartige Tentakel mit diesem Material verbunden war wie mit einer Art zweiter Haut. Wie Nabelschnüre.
Was ist das für ein Albtraum? Wach auf! Wach doch auf!
Vielleicht erlebte er gerade einen paranoiden Schub. Er hoffte es irgendwie. Doch Albtraum oder Paranoia – es wirkte schrecklich real.
Tu endlich was! Irgendwas!
Die knotigen Tentakel, die aus seiner Haut wucherten, wirkten organisch, schienen aber nicht durch Blutgefäße oder Nerven versorgt zu werden. Peter zupfte vorsichtig an einem der Tentakel. Kein Schmerz, aber die Verbindung mit der Kokonhaut wirkte fest und stabil.
Ruhig! Ganz ruhig. Beruhig dich. Atme. Und jetzt …
Trotz des überwältigenden Ekels vor den seltsamen, tentakelartigen Auswüchsen seines Körpers packte Peter einen der Tentakel fest mit der Hand und zerrte ruckartig daran. Ein kurzer, scharfer Schmerz, dann löste sich das knotige Gebilde mit einem schmatzenden Geräusch von seiner Haut und hinterließ nur einen Fleck zarter rosa Haut wie eine frische Schürfwunde. Entschlossen befreite sich Peter auch von den restlichen Tentakeln und sah zu, wie sie sich augenblicklich zusammenrollten und dann schlaff auf den Kokon klatschten.
Peter würgte heftig, erbrach aber kaum noch Flüssigkeit.
Steh auf. Du musst aufstehen!
Leichter gesagt als getan. Peter merkte, dass seine Beine ihm kaum gehorchten. Mit aller Kraft zog er sich an dem Metallpodest hoch und versuchte zu stehen. Aber sobald er die Hände von dem Podest nahm, sackten seine Beine unter ihm zusammen, als gehörten sie ihm nicht mehr. Wieder schlug er hart auf den Boden auf und verstauchte sich dabei den Knöchel. Er griff mit der linken Hand nach seinem Fuß.
Deine Hand!
Ein Anblick, so grauenhaft, dass er den Kokon, die milchige Flüssigkeit und selbst die Tentakel in den Schatten stellte. Diese Hand …
Peter erinnerte sich nicht, wie man ihn und wer ihn hierhergebracht hatte. Er erinnerte sich auch nur bruchstückhaft an das, was davor mit ihm passiert war. Das Letzte aber, an das er sich deutlich erinnerte, war der Schmerz und der blutige Stumpf an seinem Arm, nachdem ihm die linke Hand mit einem alten arabischen Säbel abgehackt worden war. Er erinnerte sich ganz deutlich daran, wie seine Hand in einem einzigen Augenblick nicht mehr Teil seines Körpers gewesen war und plötzlich fremd und unendlich fern auf dem Boden eines Kellergewölbes unter dem Vatikan gelegen hatte. Er erinnerte sich, wie man ihn hastig fortgeschleppt, über glitschige Treppen hinauf ans Licht gezerrt hatte.
Aber genau dort, an der Stelle des blutigen Stumpfes, starrte Peter nun auf eine neue Hand. Keine menschliche Hand, das war klar. Weißlich und blass hob sie sich von seiner übrigen Haut ab. Er konnte die Narbenwulst sehen, wo sie mit seinem Unterarm verbunden war. Er konnte sie bewegen, konnte greifen und tasten, aber wenn er die Finger bewegte, überkam ihn Ekel, als ob er einen Parasiten betrachtete, der gerade dabei war, von seinem Körper Besitz zu ergreifen.
Peter verglich die beiden Hände. Sie waren in Größe und Form identisch. Die gleichen Finger, der gleiche kleine Knick im Ringfinger, der gleiche Handballen. Die linke Hand jedoch wirkte fast durchscheinend. Dunkle Strukturen zeichneten sich unter der Haut ab, wo Knochen sein müssten. Adern waren auch nicht zu sehen, dafür aber kleine, rosige Flecken, die sich unter der fremden Haut abzeichneten.
Wach auf! Wach endlich auf. Das ist nicht real!
Peter kontrollierte seinen Atem und berührte die fremdartige linke Hand vorsichtig mit seiner rechten. Zunächst spürte er nichts. Erst als er den Druck etwas verstärkte, nahm er die Berührung wahr, und die Fingerspitzen seiner rechten Hand signalisierten ihm deutlich, dass die neue Hand warm war! Sie lebte!
Was auch immer es ist – werd es los. Sofort!
Peter packte das Ding an seinem Arm, presste die Zähne aufeinander, um auf den Schmerz gefasst zu sein, und versuchte mit aller Kraft, sich den Fremdkörper vom Arm zu reißen.
»Lassen Sie das! Sie ist noch nicht ganz angewachsen. Geben Sie ihr noch etwas Zeit!«
Peter fuhr herum. Unbemerkt und lautlos hatte sich in dem gleichförmigen weißen Oval hinter ihm eine Tür geöffnet. Ein älterer Japaner von kleiner Statur in einem korrekten schwarzen Anzug mit Weste und Krawatte stand im Raum. Steife Haltung, kalte Augen, die ihn wie ein Objekt musterten. Hinter ihm drei Männer in weißen Schutzanzügen, OP-Hauben und Mundschutz. Instinktiv wich Peter zurück.
»Sie sind zu früh erwacht«, sagte der Japaner sachlich auf Englisch und trat etwas näher. »Eigentlich wollten wir Sie erst in einer Woche zurückholen.« Er drehte sich kurz um und warf den drei Männern einen strengen Blick zu. »Aber nun sind Sie eben wach. Wie geht es Ihnen, Mr. Adam?«
Misstrauisch, den Mann im Anzug und die drei anderen immer im Blick, schob er sich noch etwas weiter zurück, bis er an die Wand stieß.
»Wer sind Sie?«
Der Japaner verneigte sich steif. »Mein Name ist Satoshi Nakashima. Es besteht kein Grund, sich zu fürchten, Mr. Adam. Sie sind hier in Sicherheit.«
»Sie sind Nakashima?«
»Es tut mir leid, falls ich Sie enttäuscht habe.«
Kein Anflug eines Lächelns in seinem Gesicht. Härte beherrschte unverändert seinen ganzen Ausdruck.
»Wo bin ich?«
»Nun, sagen wir … auf einer Art Krankenstation. Sie waren in keiner guten Verfassung, als man Sie hierherbrachte.« Nakashima trat um das Metallpodest herum, sorgfältig darauf bedacht, nicht in die glitschige Lache am Boden zu treten. Dabei sah er Peter weiter unverwandt an.
»Ich weiß, was für ein Schock das Erwachen für Sie gewesen sein muss, aber seien Sie versichert, dass alles ganz optimal verlaufen ist. Sie werden sich an Ihre neue Hand gewöhnen. Sie ist ein Wunderwerk. Und dabei ganz und gar Ihre Hand. Es sind keinerlei Abstoßungsreaktionen zu erwarten. Es ist Ihre neue Hand. Geben Sie sich und ihr einfach etwas Zeit. Und vertrauen Sie mir.«
Peter schwieg. Der Japaner war einen guten Kopf kleiner als er und wirkte nicht sonderlich trainiert. Peter schätzte, dass er ihn trotz seines Zustandes leicht überwältigen konnte.
Aber schaffst du auch die anderen drei?
Nakashima schien seine Gedanken zu erraten. »Es ist verständlich, aber ebenso töricht, an Flucht zu denken. Wenn ich Sie hätte töten wollen, dann würden Sie jetzt nicht vor mir liegen wie ein frischgeborenes Baby. Denn das sind Sie nun, Mr. Adam. Sie sind gerade neu geboren worden. Und das verdanken Sie mir.«
»Was wollen Sie von mir?«, sagte Peter leise.
»Alles zu seiner Zeit. Man wird Ihnen nachher etwas zum Anziehen bringen, Mr. Adam. Zunächst sind noch einige Untersuchungen nötig.«
Peter blickte auf seine linke Hand. Ein Gedanke kondensierte aus den Tiefen seiner Erinnerung in sein Bewusstsein. »Wo ist Maria?«
»Ich erwarte Sie später«, sagte Nakashima statt einer Antwort, deutete eine leichte Verbeugung an und verließ den Raum. Die drei Männer in den Schutzanzügen halfen Peter vorsichtig auf die Beine. Sie führten ihn zu dem Metallpodest und baten ihn höflich, sich hinzulegen.
»Haben Sie Durst?«
Peter nickte. Sie reichten ihm eine Flasche Mineralwasser mit japanischem Aufdruck, die Peter in einem Zug austrank. Danach fühlte er sich etwas besser und viel weniger zittrig. Trotz seines unverminderten Misstrauens ließ Peter zu, dass sie mit sterilen Lappen die Reste der käsigen Schmiere von seinem Körper entfernten. Peter bemerkte erst jetzt, dass er keinerlei Haare am Körper hatte. Nirgendwo. Sein Schädel fühlte sich kahl und glatt an.
»Die Haare werden bald wieder wachsen«, beruhigte ihn einer der Männer. Offenbar waren sie Ärzte. Sie untersuchten die roten Flecken, an denen die Tentakel gesessen hatten, und tupften sie mit einer leicht brennenden Flüssigkeit ab. Während einer der Ärzte ihm EKG-Elektroden auf die Brust pappte, wischte ein anderer die Lache und den Rest des ledrigen Kokons zusammen.
»Was ist das für ein Material?«, fragte Peter.
»Haut«, antwortete einer.
Sein Kollege präzisierte: »Eine Art Haut.«
»Das heißt, sie ist künstlich?«
»Biologisch.«
»Wie meine Hand?«
Keine Antwort. Die Männer arbeiteten schweigend weiter, entfernten die Elektroden von seiner Brust, prüften seine Pupillenreflexe. Als einer ihm eine Spritze setzen wollte, packte Peter reflexartig seinen Arm mit der linken Hand und bog ihn zur Seite. Ein kurzer, schneller Griff nur, aber der Mann schrie vor Schmerz auf und ließ sofort die Spritze fallen. Peter ließ den Arm wieder los, aber der Mann krümmte sich immer noch vor Schmerzen und verließ keuchend den Raum. Die beiden anderen Ärzte sahen sich kurz an, unschlüssig, was sie nun tun sollten. Einer der beiden hob die Spritze vom Boden auf und warf sie weg.
»Was ist passiert?«, fragte Peter irritiert. »Ich hab doch gar nicht fest zugepackt.«
»Sie haben ihm den Arm gebrochen.«
II
Äonen vor unserer Zeitrechnung
Am Anfang war die Infektion. Die Saat des Untergangs, das schleichende Gift des Endes, die Sporen des Bösen, geboren vor vierzehn Milliarden Jahren aus Strahlung und roher Materie, als das Universum erwachte. Das Böse war bereits da, als das Universum aufplatzte wie eine überreife Frucht und sich weit in den neugeschaffenen Raum hineinblähte. Es war da, als Staub und Gas sich zu Galaxien verklumpten, als die galaktischen Nebel kollabierten, als sich die ersten Sonnen unter ihrer eigenen Schwerkraft entzündeten und erste Planeten aus dem Materiedunst um sie herum kondensierten. Das Böse war immer schon da, und es fand seinen Weg auf die Erde.
Vier Milliarden Jahre bevor je ein irdisches Lebewesen zum ersten Mal so etwas wie Gnade empfinden konnte, wurde der junge Planet von der Verdammnis getroffen. Die Erde besaß zu jener Zeit noch keine feste Oberfläche. Einem infernalischen Bombardement von Kometen und Asteroiden ausgesetzt, die von den Gasriesen Jupiter und Saturn durch das Sonnensystem geschleudert wurden, wuchs der kleine Protoplanet stetig an, verleibte sich die kosmischen Brocken genauso in seinen aufgeschmolzenen Körper ein wie den Staub um ihn herum. Nahe der Sonne bestand dieser Staub fast nur aus Eisenoxiden, Silizium, Magnesium, Aluminium und anderen Metallen. Die leichteren Elemente und Verbindungen wie Stickstoff sammelten sich am äußeren Rand des Sonnensystems. Stickstoff, Kohlenstoffverbindungen, Wasser. Die Bausteine des Lebens, herangetragen von Asteroiden und Kometen, die die junge Erde mit dem Leben infizierten. Und mit dem Bösen.
Würde man die Erdgeschichte vom Anbeginn bis heute mit einem Tag vergleichen, der um Mitternacht begonnen hatte, so stünde die Uhr nun bei 7 Uhr morgens. Um 7 Uhr kam das Böse. Mit vierzigtausend Kilometern pro Stunde aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Ein Planet von der Größe des Mars, der sich in der Nähe gebildet hatte, trug es heran und kollidierte mit der Erde. Die Wucht des Einschlags zerschmetterte diesen Planeten, dem Forscher später den Namen Theia gaben. Der Zusammenprall mit Theia erschütterte die Erde fast zum Zerbersten, gewaltige Massen von Magma, Asche und Staub detonierten in den Weltraum und bildeten einen Trümmerring rund um die Erde wie um den Saturn. Aus diesen Trümmern entstand später der Mond.
Die Erde hatte viel Wasser verloren, aber nicht alles, und nach wie vor trafen wasserhaltige Asteroiden und Kometen ein. Die Erde wuchs weiter, doch mit dem Aufprall hatte sich das Böse in den jungen Planeten gerammt und nistete sich in der allmählich abkühlenden Erdkruste ein. Es hatte so viel Zeit. Es konnte warten. Auf das Leben.
Als gegen 8 Uhr, vor drei Milliarden Jahren, die Oberflächentemperatur der Erde auf unter 100 °C abkühlte, nahm das kosmische Bombardement ab, und die Erdkruste verfestigte sich. Eine erste Atmosphäre entstand, jedoch noch ohne freien Sauerstoff. Erst nachdem die biologische Evolution einmal gezündet hatte, als die ersten Ozeane sich bildeten und das Leben unaufhaltsam Besitz von dem abkühlenden Planeten ergriff, stieg der Sauerstoffgehalt mit der Biomasse stetig an. Bis das Leben um 22 Uhr des ersten Erdtages, im Kambrium vor fünfhundert Millionen Jahren, schließlich mit einer Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten förmlich explodierte und jeden Winkel der Erde besiedelte.
Die ganze Zeit über wuchs das Böse, langsam, abartig und tödlich. Nur alle paar tausend Jahre unterbrach es sein Wachstum, streckte seine Sinne aus, um zu prüfen, ob die Zeit gekommen war, passte sich an, schlich sich ein in das Leben, infizierte es. Aber das Leben fand immer einen Weg, sich vor ihm zu schützen. Unter der Kruste des ersten Urkontinents Gondwana wartete das Böse geduldig auf den geeigneten Wirt. Das Erscheinen des Menschen.
Kontinente brachen auseinander und schoben sich wieder zusammen. Rodinia, Laurasia, Gondwana, Pangaea. Bedeckt von Eispanzern, tropischen Wäldern, Steppen und Wüsten. Gebirge falteten sich auf und tauchten wieder in den flüssigen Erdmantel ab. Das Böse verbreitete sich überall. Es überlebte das große Massenaussterben vor vierhundertneunzig Millionen Jahren. Vor zweihundertfünfzig Millionen Jahren, an der Grenze des Perms zur Trias, schlug ein Asteroid auf der Antarktis mit achtundfünfzigtausend Kilometern pro Sekunde ein. Eine seismische Druckwelle raste quer durch die Erde hindurch und löste auf der gegenüberliegenden Seite, im heutigen Sibirien, die Eruption eines gigantischen Magmafeldes aus. Die doppelte Katastrophe vernichtete fast neunundneunzig Prozent allen Lebens, und auch das Böse wäre beinahe ausgelöscht worden. Aber es überlebte wieder und wartete weiter, geduldig, primitiv und dumpf, bis in dieser Welt neues Leben entstehen würde. Denn es war eine gute Welt und zu diesem Zeitpunkt die einzige im Universum, auf der sich überhaupt Leben entwickelt hatte. Als sich Pteranodon in die Luft erhob und Herrerasaurus seine Beute jagte, hatte das Böse seine Größe annähernd verdoppelt. Um 23:48 Uhr dieses langen ersten Tages der Erdgeschichte, vor fünfundsechzig Millionen Jahren, erlebte es den Untergang der Dinosaurier und die darauf folgende rasante Evolution der Säuger. Bis sich etwa zwei Minuten vor Mitternacht, vor sieben Millionen Jahren, der erste Hominide aufrichtete, um das hohe Gras der Savanne zu überblicken. Da begann das Böse, sich zu regen. Denn die Zeit war gekommen, diese Welt endgültig in Besitz zu nehmen.
Doch das Böse übersah, dass es einen Feind hatte. Das Leben auf der Erde hatte in all den Jahrmillionen Wege und Nischen gefunden, sich gegen die Auslöschung und die Infektion zu schützen. Parallel zum Menschen war eine intelligente Art entstanden. Hochentwickelte hominide Wesen, die die Gefahr erkannten und ihre gesamte Kultur und Existenz nur darauf ausrichteten, die Infektion zu bekämpfen, einzudämmen und eines fernen Tages wieder dorthin zurückzuschleudern, wo sie einst hergekommen war: in den Abgrund des Weltalls.
Diese Wesen waren von der Natur in jahrmillionenlanger Evolution mit einer Immunisierung und einer mächtigen Waffe gegen die Infektion ausgestattet worden: Gnade und Liebe. Während der Mensch den Garten Eden in einem erloschenen Vulkan im späteren Ostafrika verließ und sich aufmachte, die Welt zu besiedeln, trafen weit entfernt jene Wesen die entscheidenden Vorbereitungen. Das Volk, das nicht mehr als einige Hunderttausend seiner Art zählte, lebte isoliert auf einem Mikrokontinent, der sich infolge der Kontinentaldrift von Südamerika abgespalten hatte und sich über den Pazifik auf die asiatische Platte zubewegte. Die Wesen, die sich und ihr Land Mh’u nannten, besaßen eine hochentwickelte Sprache und Schrift und intuitive, aber genaue Kenntnisse der Vorgänge in der Natur. In den wenigen Millionen Jahren ihrer Existenz lernten die Mh’u, die Prozesse der Natur zu verändern, ohne sie zu zerstören. Sie führten keine Kriege und töteten nicht. Sie lebten ohnehin im Durchschnitt einige hundert Jahre, den größten Teil davon in einer Art Tiefschlaf, den sie in kokonartigen Geweben zubrachten. Das Einzige, was die Mh’u schließlich je töteten, war sich selbst, als ihre Zeit gekommen war. Doch zuvor, durch viele Jahrtausende hindurch, webten sie in ihren Kokons am Schicksal der jungen Menschheit und suchten Wege, das Böse für alle Zeit von der Erde zu verbannen. Als das große Werk schließlich vollbracht war und die Infektion der Welt zurückgeschlagen werden konnte, beschloss das Volk der Mh’u, sich gemeinschaftlich aufzulösen, um mitsamt seinem Land aus der Welt zu verschwinden. Sie hinterließen kaum Spuren ihrer Existenz, gingen auf im ewigen Gedächtnis der Natur. Nur ihre Zeichen ließen sie zurück. Neun Amulette aus einem rätselhaften Material, mit denen sie das Böse versiegelten, und ihre Sprache, die in Fragmenten noch bei den Maya, den Hopi, den Ägyptern und im Sanskrit aufflackerte. Bevor die Mh’u sich und ihr Land vom Antlitz der Erde tilgten, trafen sie Vorkehrungen, programmierten die Amulette für alle Zukunft und überließen sie dann sich selbst, um den großen Plan der Gnade zu vollenden.
Wenn die Geschichte der Erde einen Tag zählte, gingen die Mh’u vier Sekunden vor Mitternacht ihrem selbst gewählten Untergang entgegen. Zwei Sekunden später wurde der Mensch sesshaft, gründete die ersten Hochkulturen und erzählte sich Mythen, die sämtlich von einem uralten Volk am Anbeginn der Zeit erzählten und von einem Bösen, das in den Tiefen der Erde lauerte, um den Menschen zu verderben und zu vernichten. Die neun Amulette der Mh’u wurden gefunden, aufbewahrt, verehrt und geraubt. Sie gingen verloren und wurden wiedergefunden, genau so, wie die Mh’u es vorhergesehen hatten.
Eingeschlossen im Schoß der Erde, auf der Glut des Erdmantels treibend, kreischte das Böse in Agonie, immer noch nicht vernichtet, aber geschwächt und gefangen. Im entscheidenden Augenblick war es ihm nicht gelungen, die Welt vollständig in Besitz zu nehmen. Doch die Mh’u hatten nicht ganz verhindern können, dass sich die noch junge Menschheit kurz infizierte und das Böse fortan in sich trug wie eine ewig schwärende Wunde, die irgendwann aufbrechen und sie vernichten würde. Das Böse zog sich zurück. Es hatte Zeit. Konnte warten. Tausend Jahre. Zehntausend Jahre. Ewig. Auf den Tag, an dem irgendwann die Saat aufgehen würde und ein Mensch die Pforten der Hölle öffnen würde.
III
2. Juli 2011, Nordatlantik
Gebrochen?« Peter starrte auf die fremde blasse Hand an seinem Arm, als sei sie ein gefährliches Tier, das ihn belauerte und nur noch auf den richtigen Augenblick wartete, um zuzuschlagen.
Wortlos halfen ihm die beiden Ärzte beim Aufrichten. Nach einigen wackeligen Schritten gehorchten auch die Beine wieder, und Peter konnte selbstständig gehen, wenn auch tapsend wie ein alter Mann.
»Machen Sie sich keine Sorgen, die Muskelatrophie wird sich legen«, erklärte der größere der beiden Ärzte.
Warum versuchen mir immer alle zu versichern, dass ich mir keine Sorgen machen müsse?
»Wie lange hab ich in diesem … Kokon gelegen?«
Wieder keine Antwort. Der kleinere Arzt reichte ihm frische, zusammengefaltete Kleidung. Unterwäsche, eine leichte Baumwollhose, T-Shirt, Socken, Sneaker. Alles in Weiß. Außerdem ein Handtuch und ein Stück rosa Seife, die irgendwie unpassend nach Rosen duftete. Peter fiel auf, dass sie der einzige Farbtupfer in diesem Raum war.
»Am Ende des Ganges ist eine Dusche«, sagte der Arzt. »Wenn Sie sich angezogen haben, wird man Sie abholen. Nakashima San erwartet Sie.«
Auf dem Weg zur Dusche begegnete Peter keinem Menschen. Im Gegensatz zu dem Hightechraum, in dem er »erwacht« war, wirkte der fensterlose Korridor viel weniger steril, ja geradezu schäbig. Ein alter, abgelaufener Linoleumboden mit schwarzen Gummistreifen, der beim Gehen metallisch nachhallte. Von irgendwo das klappernde Geräusch einer Lüftung und dahinter ein leises Vibrieren wie von einem elektrischen Aggregat. Die Wände mit billigem Holzimitat aus Kunststoff verkleidet, das an den Kanten zum Teil aufgeplatzt war. Zwei gerahmte Van-Gogh-Reproduktionen und ein Panoramafoto von Chicago im Sonnenuntergang. Als Peter probeweise gegen die Wand klopfte, klang es hohl.
Dünne Trennwände, metallischer Untergrund. Wo bin ich?
Die Duschkabine dann wieder hochmodern, eine Nasszelle aus weißem Kunststoff, mehr eine luxuriöse Beregnungsanlage. Das Wasser roch nach Chlor. Peter genoss den warmen Regen auf seiner Haut und merkte nun, wie hungrig er war. Unter der Dusche kamen Stück für Stück die Erinnerungen an die letzten Wochen vor seinem Blackout zurück, allerdings unsortiert wie ein gut gemischtes Kartenspiel. Peter erinnerte sich wieder daran, dass Nakashimas Leute ihn vor Nikolas gerettet hatten. Dass sie seine Eltern an einen unbekannten Ort in Sicherheit gebracht hatten. Seine Eltern, die er vermutlich nie wiedersehen würde. Peter erinnerte sich an das Amulett, an Lorettas Leiche in Suite 306, an den ausgemergelten Edward Kelly, und auch an das Gesicht seines Zwillingsbruders Nikolas. Seinen Bruder, den Mörder. Aber vor allem erinnerte sich Peter an Maria. An ein Paar grüner Augen und ihren Körper, der wärmer und wirklicher gewesen war als er selbst. Das alles schien unendlich lange zurückzuliegen, auch wenn Peter immer noch nicht wusste, wie viel Zeit inzwischen überhaupt vergangen war.
Geboren. Neugeboren. Arm gebrochen.
Er machte einen Test mit dem Seifenstück, packte es mit seiner neuen linken Hand und drückte zu. Ohne dass es ihn die geringste Mühe kostete, spritzte die Seife nur so zwischen seinen Fingern durch.
In der frischen weißen Kleidung fühlte sich Peter wie der Novize einer esoterischen Sekte kurz vor der abschließenden Weihe. Ein Blick in den Spiegel bestätigte ihm wenigstens, dass er sich äußerlich kaum verändert hatte. Ein leidlich gut aussehender Mann Mitte dreißig. Freundliches, norddeutsches Gesicht, trainierter Körper, aber ein kahler Kopf und helle Augen, die ihm müde vorkamen. Überhaupt dieser neue bittere Zug um die Mundwinkel.
Bist du das?
Er fand sich blasser als sonst, entdeckte aber keine Verletzungen. Bis auf die alte Narbe an seiner Schulter von einem afghanischen Granatsplitter, die ihn daran erinnerte, dass er sich mal geschworen hatte, nie mehr zu töten. Nicht aus religiösen Gründen, sondern weil es falsch war, ganz und gar falsch. Wider die Natur.
Weil es dich dein Leben lang verfolgen wird. Weil du nie wieder derselbe sein wirst.
Alles in allem war er sich selbst ein vertrauter Anblick – bis eben auf diese Hand, die sich blass und fast durchscheinend von seiner Haut abhob und die einem Mann den Arm brechen konnte. Das fremdartige neue Körperteil, das man ihm ungefragt implantiert hatte, verstärkte sein Misstrauen. Auch wenn er Nakashima sein Leben verdankte, misstraute Peter diesem Mann, der offenbar ganz eigene Pläne mit ihm hatte. Wenn Peter eines hasste, dann manipuliert zu werden. Es wurde Zeit zu verschwinden.
Probeweise versuchte er einige Kniebeugen, aber nach dem zweiten Mal knickten ihm die Beine weg, und ihm brach der Schweiß aus. Er horchte an der Tür. Schritte. Zwei Männer unterhielten sich flüsternd, dann ging einer weg.
Du bist zu schwach für eine lange Flucht. Also wirst du dich wohl auf deine neue Untermieterin verlassen müssen.
Peter wartete noch, bis er keine Schritte mehr hörte, dann riss er die Tür auf. Der Mann im Korridor trug einen blauen Overall mit einem kleinen Emblem auf der Brusttasche. Peter schätzte ihn auf Anfang zwanzig. Er gab nur einen überraschten Laut von sich, als Peter aus der Dusche stürmte, ihm mit der linken Hand die Kehle zudrückte und ihn hart an die Wand presste. »Ganz ruhig! Wo ist der Ausgang?«
Der entsetzte junge Mann gurgelte etwas Unverständliches und zeigte nach links zu einem Aufzug.
»Geh vor!« Peter lockerte den Griff um die Kehle und stieß den Mann vor sich her. »Wenn du einen Laut machst oder es Alarm gibt, dann bring ich dich um.«
Er hasste sich dafür, solche Dinge zu sagen, aber im Augenblick hatte er außer platten Sprüchen und einer schwer zu kontrollierenden Cyber-Hand nicht viel mehr aufzubieten.
Den Mann im blauen Overall schien es jedenfalls zu beeindrucken. Ohne Gegenwehr ließ er sich in den Aufzug stoßen.
»Nach oben oder unten?«, fragte Peter.
Der Mann nickte ängstlich. Peter schloss die linke Hand fester um seine Kehle.
»Was nun?«
Der Mann deutete zitternd nach oben.
Der Junge ist doch niemals von der Security! Was soll das alles hier?
Der Fahrstuhl trug sie drei Etagen aufwärts. Als sich die Tür mit einem freundlichen Bing wieder öffnete, spannte Peter sich an und erwartete ein Empfangskomitee aus Sicherheitskräften. Doch statt Knüppeln oder Elektroschocks schlug ihm nur eine salzige Windböe entgegen. Überrascht ließ Peter den Jungen los und trat auf die Plattform.
»Ach du Scheiße!«
Tiefhängende Sturmwolken sprühten ihm Regen ins Gesicht und durchnässten ihn schon nach wenigen Augenblicken bis auf die Knochen. Die Luft roch nach Salz, Rost und Altöl. Etwa dreißig Meter unter ihm brandete das Meer gegen die Stahlkonstruktion. Über sich erkannte Peter die typischen stählernen Aufbauten von Kränen, Kontrollkabinen, Lagerplätzen für die Rohre – und den Bohrturm. Er stand auf einer kleinen kreisrunden Stahlplattform mit einem leuchtend gelben »H«, die über dem Abgrund zu schweben schien und über die der Wind ungebremst hinwegfegte, bis er sich pfeifend im Gestänge und den Stahlseilen des Bohrturms verfing.
Die Verblüffung, unerwartet ausgebremst zu werden.
Die Ernüchterung darüber, dass der Weg hier endet.
Die schale Genugtuung, es immerhin geahnt zu haben.
Peter sah verwitterte Beschriftungen an den Anlagen und verrostete Warnschilder mit Sicherheitshinweisen auf Englisch. Vorsichtig machte er noch einen Schritt auf den Rand des Hubschrauberlandeplatzes zu und drehte sich einmal um sich selbst. Kein Horizont zu erkennen. Übergangslos verschmolz das Bleigrau des Meeres mit dem Wolkenbrei. Kein Land, so weit man sehen konnte, kein Schiff, kein Licht. Nur Wasser und Wolken. Peter hatte sich eine Bohrinsel immer größer vorgestellt. Tatsächlich wirkte die offenbar stillgelegte Anlage geradezu winzig und zerbrechlich in dieser See, die mit meterhohen Wellen gegen die vier Pfeiler unter ihm brandete. Endstation.
»Sind wir nicht alle Gefangene, Mr. Adam?«
Mit einem Schirm in der Hand trat Nakashima neben Peter und sah über das Meer. »Ich liebe diesen Anblick.«
»Was ist das für ein Ozean?«, fragte Peter.
»Der Nordatlantik. Vierundsechzigster Breitengrad, zwischen Island und Norwegen. Aber Sie würden diese Anlage ohnehin auf keiner Karte finden und auch auf keinem Satellitenbild. Was halten Sie jetzt von einer Tasse Tee, Mr. Adam?«
»Was sollte mich daran hindern, Sie jetzt gleich ins Meer zu werfen?«, erwiderte Peter.
Nakashima zuckte gleichgültig mit den Schultern. »Ihre Skrupel. Ihre Dankbarkeit, dass ich Ihnen einmal das Leben gerettet habe. Oder einfach nur Ihre Neugier.«
Peter wandte sich zu ihm um. »Was wollen Sie von mir?«
»Wir brauchen Ihre Hilfe.«
»Wir?«
Nakashima wandte sich ab und ging zurück zum Aufzug. »Kommen Sie. Sie müssen hungrig sein.«
Immer noch etwas wackelig auf den Beinen, folgte Peter dem alten Mann zurück in den Aufzug, der sie eine Etage tiefer brachte, direkt in einen eleganten, im traditionellen japanischen Stil gestalteten Flur mit Tuschzeichnungen an den Wänden. Nakashima führte ihn in einen großzügigen Empfangsraum, dessen Metallfenster mit Reispapierwänden verkleidet waren, und wies auf einen großen Konferenztisch, auf dem eine Auswahl von Sushi und verschiedenen Gerichten in alten, wertvollen Porzellanschälchen bereitstand. Peter griff ohne Zögern zu. Nakashima setzte sich ihm gegenüber an den Tisch.
»Es ist auch kein Wunder«, begann er wieder. »Sie haben sehr lange nichts mehr gegessen.«
»Wie lange?«, nuschelte Peter kauend.
»Sechs Wochen. Wir haben heute den 3. Juli.«
Peter betrachtete seine Hand. »So etwas ist also in sechs Wochen möglich …«
»Denken Sie nicht, dass Sie der Einzige mit einer solchen Hand sind. Aber wir hängen unsere Technologien nicht an die große Glocke. Unsere Kunden bestehen auf Diskretion.«
Peter ersparte sich die Frage nach Nakashimas Kunden.
»Was ist passiert?«
»Woran erinnern Sie sich?«
Er dachte kurz nach und begann dann stockend. »Ich bin Journalist. Ich wollte nur über den Rücktritt des Papstes berichten. Dann hatte ich eine Vision, wie der Petersdom explodiert … Meine amerikanische Kollegin Loretta Hooper wurde ermordet, und man hält mich für ihren Mörder … Ich wurde gefoltert … Eine okkulte Loge namens ›Träger des Lichts‹ hat einen Anschlag auf den Vatikan geplant. Ihr Anführer nennt sich Seth.« Er zögerte. »… Ich habe einen Zwillingsbruder. Nikolas. Er arbeitet als Killer für Seth. Er wollte auch mich töten.«
»Sehr gut. Was noch?«
»In der Wohnung des Papstes haben Maria und ich ein Relikt mit einem rätselhaften Symbol gefunden.«
Nakashima lächelte jetzt.
»Ah, ja, das blaue Amulett mit dem Kupferzeichen!«
»Wo ist es?«
»Schwester Maria hat es. Machen Sie sich keine Sorgen. Man war so freundlich, mir eine Materialprobe für eine Untersuchung in meinen Labors zu überlassen. Es ist ein ganz und gar einzigartiges Material, und wir kennen seine Eigenschaften immer noch nicht. Es ist eine Art Metall mit einer kristallinen Struktur, wie es nirgendwo in der Natur vorkommt. In jedem Fall scheint es sehr alt zu sein. Welche Hochkultur konnte so ein Material schaffen?«
»Es scheint eine Art Speicher zu sein.«
»Speicher? Für was?«
Peter zögerte. Aber Nakashima machte ohnehin nicht den Eindruck, ganz ahnungslos zu sein. »Eine Art Gedächtnis. Es kann Visionen auslösen. Aber das scheint noch nicht alles zu sein. Seth wollte es unbedingt in seinen Besitz bringen … Wir wollten die Bombe entschärfen. Maria, Laurenz und ich. Wir waren in den Katakomben … aber dann …« Er legte die Essstäbchen beiseite.
»Dann hat Mr. Laurenz Ihnen die Hand abgehackt«, fuhr Nakashima gelassen fort, »weil Sie erkannt hatten, dass sich die Bombe die ganze Zeit darin befunden hatte. Bei der Flucht aus den Katakomben wurden Sie ohnmächtig.«
»Und als ich aus der Ohnmacht aufgewacht bin, hatte ich eine neue Hand, mit der man einem Mann den Arm brechen kann.«
»Und das ist erst der Anfang!«, sagte Nakashima mit dem leisesten Anflug eines Lächelns. »Sie werden begeistert von Ihrer neuen Hand sein, Mr. Adam, glauben Sie mir. Bei diesem Modell ist es uns auch gelungen, Hautpigmente einzubringen. Sie wird mit der Zeit also etwa die Farbe Ihrer Haut annehmen. Wir sind sehr stolz darauf. Machen Sie sie bitte nicht kaputt.«
Peter ging nicht darauf ein. »Was ist passiert, nachdem ich ohnmächtig wurde?«
»Der Petersdom ist explodiert, wie Sie es vorhergesehen hatten. Die Explosion war nicht so stark wie die ›Träger des Lichts‹ ursprünglich geplant hatten, und sie vernichtete nicht den gesamten Vatikan. Dennoch: Der Petersdom und die Sixtinische Kapelle existieren nicht mehr.«
»Und die Kardinäle im Konklave?«
»Dank Ihres Freundes Don Luigi konnten die meisten rechtzeitig evakuiert werden. Vor einer Woche wurde in den Trümmern des Petersdoms ein neuer Papst gewählt.«
»Wer ist es?«, fragte Peter und versuchte, sich seine Aufregung nicht anmerken zu lassen.
Nakashima zögerte, bevor er antwortete. »Ihr Freund, der Jesuit. Don Luigi.«
»Ich glaub es nicht!«, rief Peter aus und lachte auf. »Wie hat er denn das geschafft?«
»Er gilt als Retter der katholischen Kirche. Er hat die Kardinäle aus der Sixtinischen Kapelle befreit und die größte Katastrophe verhindert. Es war eine schnelle Wahl.«
»Aber …?«, fragte Peter, als er Nakashimas Gesicht sah.
»Aber sein Pontifikat hat sofort mit einem Eklat begonnen. Ihr Freund Don Luigi … hat sich den Namen Petrus II. gegeben.«
IV
2. Juli 2011, Vatikanstadt
Papst Petrus II. hatte keine Zeit verloren. Der ehemalige Chef-Exorzist des Vatikans kannte bestens die Strukturen der Kurie, die wie ein mittelalterlicher Hofstaat organisiert war. Er wusste, dass er als neuer Papst in dieser schwierigen Zeit Zeichen setzen musste. Neu anfangen. Staub aufwirbeln. Den Weg weisen. Brücken bauen. Und dazu alte, morsche Brücken einreißen. Kaum eine Woche nach seiner Wahl hatte Petrus II. bereits die wichtigsten Posten neu besetzt. Was bei vielen kurialen Beamten und der römischen Öffentlichkeit, die wie ein Seismograph auf alle Veränderungen im Vatikan reagierte, allerdings zunehmend Unverständnis und blankes Entsetzen erregte. Wie die Ernennung von Kardinal Raymond Bleeker, des Bischofs von Chicago, zum neuen Kardinalstaatssekretär und des ugandischen Kardinals Joseph Karuhanga zum Präfekten der Apostolischen Signatur, des Obersten Gerichtshofes. Bleeker war in einen der größten Missbrauchsskandale der USA verwickelt gewesen, der zur Exkommunikation und Verurteilung von zwei amerikanischen Priestern geführt hatte. Bleeker selbst konnte eine Beteiligung nicht nachgewiesen werden, nachdem der wichtigste Belastungszeuge, ein zwanzigjähriger Theologiestudent, bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Kardinal Karuhanga hatte als Bischof von Kampala die »Lord’s Resistance Army«, die brutalste Rebellenmiliz der Welt, vor einigen Jahren noch als »Gotteskrieger« geadelt, diese Aussage jedoch kurz darauf öffentlich als Missverständnis bedauert. Außerdem ging in der Kurie das Gerücht um, dass der Kardinal mehr als zehn Kinder mit drei verschiedenen Frauen habe.
Das meiste Unbehagen erregte aber nach wie vor die Namensgebung des neuen Papstes, der mit einem jahrhundertealten Tabu gebrochen und sich den Namen Petri gegeben hatte, was als geschmacklos, anmaßend und respektlos galt – alles Todsünden der vatikanischen Hofetikette. Zwar galt der neue Papst immer noch als Retter der katholischen Kirche, aber selbst die konservative, papsttreue italienische Presse missbilligte inzwischen offen die Namensgebung. Denn natürlich dachte jeder sofort an die Prophezeiung des heiligen Malachias, nach der die Kirche einst mit einem Papst Petrus untergehen werde. Die Welt hatte schon genügend Probleme – Griechenland, Portugal und Italien waren bankrott, Spanien würde bald folgen. Die Kurse stürzten ab, Großbanken brachen zusammen, Europa stand kurz vor dem Zusammenbruch. Die USA waren pleite und lieferten sich einen Cyberkrieg mit China, während amerikanische Soldaten im Irak jeden Tag neuen Hass auf sich luden. Japan kämpfte verzweifelt mit den Strahlenfolgen der Erdbebenkatastrophe, Nordafrika versank im Bürgerkrieg, der Iran baute an einer Atombombe und drohte mit der Vernichtung Israels. Der schier grenzenlose Bauboom in China erzeugte inzwischen eine gigantische Liquiditätsblase von Billionen von Dollar, die die gesamte Weltwirtschaft bedrohte. Der afrikanische Kontinent ging an Korruption, Bürgerkriegen, Hungersnöten und Seuchen zugrunde, Bangladesch und Pakistan ertranken im Meer und in Überschwemmungen. Dazu kam der ungeklärte Absturz der Internationalen Raumstation zwei Monate zuvor und der verheerende Anschlag auf den Vatikan, dessen Symbol nun in Trümmern am Ende der Via della Conciliazione lag. Deshalb fragte sich die Welt, welche Absicht der neue Papst mit seinen gezielten Tabubrüchen verfolgte. Seriösere Zeitungen interpretierten die Namensgebung des neuen Papstes noch als mahnenden Hinweis darauf, dass die Welt am Abgrund stand. Die Zyniker und Spaßmacher sämtlicher Late-Night-Shows von Rom bis Los Angeles ulkten, dass der ehemalige Exorzist eben auch in seinem neuen Amt nicht aus der Übung kommen wolle.
Sie ahnten nicht, wie nahe sie damit der Wahrheit kamen.
»Signor Forlani vom Corriere della Sera, Signor Gianmarino von der RAI und eine Mrs. Reynolds von CNN haben erneut wegen eines Interviewtermins angefragt, Eure Heiligkeit. Und das Büro des Ministerpräsidenten drängt auf eine Audienz in der nächsten Woche.«
»Absagen«, winkte Petrus II. ungehalten ab. »Ich sagte doch, bis auf Weiteres keine Interviews.«
Monsignore Cardona, der neue Privatsekretär des Papstes, folgte Petrus II. eilig über den Damaskushof zu einer wartenden Limousine. Gleich hinter dem Hof erhob sich der Trümmerberg des zerstörten Petersdoms und der Sixtinischen Kapelle. Ein provisorisches Holzkreuz, roh geschnitten aus dem Stamm einer hundertjährigen Eiche der Vatikanischen Gärten, ragte aus den Trümmern empor, als Zeichen der Trauer für die Toten des Anschlags und zur trotzigen Mahnung, dass die Kirche nur verwundet, aber nicht zerstört sei.
»Noch nicht«, murmelte der Papst leise.
»Eure Heiligkeit?«, fragte Cardona, der den Papst nicht verstanden hatte. Der spanische Prälat, der bis vor Kurzem noch nicht öffentlich in Erscheinung getreten war, überragte den Papst um einen Kopf und wirkte wie eine jugendlichere Kopie des verstorbenen Kardinal Menendez: hager, düster, schweigsam. Hart gegen sich, brutal gegen die Feinde des rechten Glaubens. Er gehörte den »Legionären Christi« an, einer erzkonservativen Bruderschaft, papsttreu und militärisch organisiert. Die Legionäre verehrten die Heilige Maria als Mutter der Kirche, standen aber nach Drogen- und Missbrauchsskandalen ihres Gründers im Ruf einer Sekte und hatten eine apostolische Visitation über sich ergehen lassen müssen. Don Luigi hatte Cardona persönlich zum Exorzisten ausgebildet und seine kuriale Karriere im Stillen gefördert.
»Ich sagte, fühlen Sie mal in Jerusalem und Mekka vor. Ich möchte so schnell wie möglich ein Treffen mit Rabbi Kaplan und Scheich al Husseini.«
»Gegenstand der Unterredung?«
Petrus II. hielt kurz an und wandte sich zu seinem Privatsekretär um. »Ihr Tod.«
Cardona erwiderte ungerührt den Blick des Papstes.
»Möchten Sie, dass ich das in die Betreffzeile der E-Mail schreibe?«
Der schwarze Mercedes S brachte den Papst und seinen Privatsekretär die wenigen hundert Meter zum Gärtnerhäuschen, das Petrus II. noch vor seiner Wahl zum Papst bewohnt und in dem er Hunderte von Teufelsaustreibungen vorgenommen hatte. Vor dem kleinen Häuschen am westlichen Ende der vatikanischen Mauer parkte der Kleintransporter einer Tiefbaufirma mit der Aufschrift »Fratech Ingegneria civile« und einem doppelten Kreissymbol als Logo.
Ein roter Kater aus der Horde der vatikanischen Katzen hatte es irgendwie ins Haus geschafft und sich auf Don Luigis schäbigem Sofa gemütlich niedergelassen. Als der Papst und sein Privatsekretär eintraten, sprang er mit einem erschrockenen Maunzen auf und verdrückte sich beleidigt. Es hatte sich nichts verändert. Das gleiche alte Mobiliar; Bücher, Dokumente und Akten, die sich in den Regalen und überall auf dem Boden stapelten. Die Luft roch muffig nach Staub und altem Zigarettenrauch. Eine angebrochene Rotweinflasche und benutzte Gläser erinnerten noch an die letzte Zusammenkunft mit Peter Adam, Maria und Franz Laurenz. Neben der Küche stand immer noch die alte Massageliege, auf der Don Luigi mit Hilfe nervenstarker Nonnen und Diakone seine Exorzismen durchgeführt hatte. Zum ersten Mal seit seiner Wahl zum Papst betrat Petrus II. sein altes Häuschen wieder, dennoch gönnte er sich keinerlei Sentimentalität, sondern schloss umgehend eine kleine Holztür auf, die in den Keller des Hauses führte.
Ohne Licht zu machen, stiegen Petrus II. und Monsignore Cardona die morsche Holztreppe hinab in das Dunkel, aus dem von weit her ein unterdrücktes Murmeln zu hören war.
Neben den Weinregalen führte eine weitere Holztür in einen niedrigen, tunnelartigen Gang, der im 15. Jahrhundert als geheimer Fluchtweg gedient hatte und der in keinem Grundriss mehr verzeichnet war. Der Boden des Tunnels war bedeckt mit Rattenkot und mumifizierten Tierleichen, die teilweise schon seit Jahrhunderten in der kühlen, trockenen Luft lagen. Petrus II. raffte die weiße Soutane und eilte gebückt voraus bis zu einer Abbiegung, die ebenfalls an eine schwere Tür stieß. Das Murmeln war jetzt ganz deutlich zu hören.
Petrus II. stieß die Tür auf und betrat eine fast runde Krypta, grob aus dem Travertin des vatikanischen Hügels gehauen. Die Decke war so niedrig, dass der hochgewachsene Cardona kaum aufrecht stehen konnte. Vor zweitausend Jahren hatte an dieser Stelle ein gewisser Kephas aus Galiläa die erste Gemeinde nach der Lehre eines jungen Rabbiners gegründet, den man einige Jahre zuvor in Judäa gekreuzigt hatte. Kephas bedeutete im Aramäischen so viel wie »Stein« oder »Fels«, denn so hatte ihn jener Rabbiner einst bezeichnet. Den Fels, auf dem er seine Kirche bauen wollte. In diesem Gewölbe, kaum größer als der Altarraum einer Provinzkapelle, hatte Simon Petrus den ersten christlichen Gottesdienst gefeiert.
Petrus II. hatte diesen Ort vor langer Zeit per Zufall entdeckt, als er einer entlaufenen Katze gefolgt war. Er hatte sofort verstanden, um welchen Ort es sich handelte und hatte ihn trotzdem immer geheim gehalten.
Zwölf Männer in Mönchsroben, die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen, standen um einen gedrungenen, flachen Stein herum, versunken in einen murmelnden Singsang in einer unverständlichen Sprache. Als Petrus II. und Cardona eintraten, öffneten sie den Kreis ein wenig.
Auf dem Stein lag eine nackte Frau mit abgespreizten Armen und Beinen. Blasse, schweißnasse Haut, die im Licht der wenigen Fackeln an den Wänden ölig glänzte. Ihre dichten schwarzen Haare bildeten ein Nest, in dem ihr rundes Gesicht zu ruhen schien. Petrus II. registrierte, dass sie im Schambereich nicht rasiert war, was ihn erregte und zugleich anwiderte. Die Frau war jung, nicht älter als Mitte zwanzig, ein üppiger, fester Körper mit großen Brüsten, die im Rhythmus ihrer Angst bebten. Man hatte sie an Händen und Füßen mit schweren Ketten gefesselt und mit einem Lappen geknebelt. Die junge Frau wand sich mit weit aufgerissenen Augen, als sie den Papst erkannte. Petrus II. konnte ihren Schweiß riechen, ihre Todesangst. Schweigend trat er an den Stein und sah auf die Frau hinab. Mit einem Ruck riss er ihr den Knebel vom Mund. Ein unmenschlicher, gurgelnder Schrei entrang sich ihrer Kehle, den außer den vierzehn Männern um sie herum niemand hören konnte. Auf ein Zeichen des Papstes reichte ihm einer der Männer ein kleines Holzkreuz. Petrus II. reckte es der Frau entgegen und schlug ihr kurz mit der flachen Hand auf die Stirn, wie er es immer bei Exorzismen tat.
»Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sag mir die Namen.«
Die Frau hielt für einen Moment keuchend inne, starrte den Papst nur an.
»Die Namen! Sag mir die Namen!«
Die Frau schüttelte heftig den Kopf, grunzte und knurrte jetzt wie ein gefesseltes Tier.
Ungerührt trat der Papst einen Schritt zurück – und spuckte auf das Kreuz. Drei Mal. Warf es zu Boden und trat mit dem Fuß darauf. Die junge Frau wand sich in Agonie.
»Soba iisononu cahisa!«, rief der Papst laut. »Saitan bajile caosagi.« In der gleichen Sprache hoben die Männer in den Mönchsroben wieder ihren monotonen Singsang an, während Petrus II. der Frau mit dem Blut einer frisch getöteten Ratte das doppelte Kreissymbol auf den Bauch malte.
»Basajime! Micama ox cynuxire faboanu. Vaunala cahisa conusata ox Oanio ol yazoda! Ohyo! Ohyo! Noco Mada, hoathahe Saitan! Die Namen will ich hören! Sag mir die Namen!«
Wieder schlug er ihr dabei auf die Stirn. Die gefesselte Frau krümmte sich wie unter unerträglichen Schmerzen, röchelte etwas Unverständliches und spie schließlich ein Wort aus.
»URIEL!«
Der Papst nickte zufrieden. »Ja, Uriel. Ich wusste, du bist es. Das Licht Gottes. Der Engel des Jüngsten Gerichts. Hörst du mich, Uriel? Du weißt, was ich will. Sag mir die Namen. Sag sie mir!«
Da die Frau wieder schwieg, malte Petrus II. ihr Zeichen auf den Leib, die in keinem Alphabet der Welt enthalten waren, und sprach dabei weiter auf sie ein.
»Die Namen, Uriel! Babaje od cahisa ob hubaio tibibipe. Uriel yolaci! Die Namen! Aalalare ataraahe! Micama Saitan. Micama cahisa. Ohyo! ohyo! Noco Mada, hoathahe Saitan!”
Die gespenstische Zeremonie dauerte noch über zwei Stunden. Bis die Frau auf dem Stein über und über mit blutigen Symbolen und Zeichen bedeckt war und röchelnd zusammenbrach. Das Letzte, was sie flüsterte, kaum noch bei Bewusstsein und längst wahnsinnig geworden, waren die Namen.
»Shimon Kohn … Francesca Corelli … Maggie Win … Felipe Galán … Lhakpa Gyaltsen Samudri … Marina Bihari … Frank Babcock … Nafuna Matube … Peter Adam.«
Die Frau sprach nicht mehr weiter, lag jetzt nur noch leblos auf dem Stein, an dem Simon Petrus die erste Messe der Christenheit gelesen hatte. Monsignore Cardona notierte die Namen säuberlich in ein Notizbuch.
»Haben Sie alle?«, fragte Petrus II.
»Ja, Heiliger Vater.«
Petrus II. nickte. Er zog einen schweren mittelalterlichen Dolch aus der Soutane, auf dessen Klinge das doppelte Kreissymbol, das Zeichen des Lichts, eingraviert war, küsste ihn und stieß ihn der Frau ins Herz.
»Das Licht sei mit dir«, sagte der Papst, als die Frau mit einem Seufzer tiefster Erlösung starb. Die Männer in den Mönchsroben brachen ihren Singsang ab. Monsignore Cardona sah auf seine Armbanduhr.
»Sie haben in einer halben Stunde einen Termin mit dem Präfekten der Glaubenskongregation, Heiliger Vater. Gehen wir?«
V
2. Juli 2011, Nordatlantik
Don Luigi wird gute Gründe für die Namenswahl gehabt haben«, sagte Peter und goss sich Tee nach. Er hatte Nakashima bisher schweigend und essend zugehört und fühlte sich nach der leichten Mahlzeit schon viel besser. »Und auch für alle anderen Entscheidungen. Ohne ihn hätten wir die Apokalypse nicht verhindern können.«
Nakashima faltete seine gut manikürten und beinahe zarten Hände auf dem Konferenztisch. »Natürlich. Don Luigi ist eine ganz und gar außergewöhnliche Persönlichkeit. Ihre Kirche und die ganze Welt verdanken ihm sehr viel. Genauso wie Ihnen, Mr. Adam. Aber deswegen tragen Sie auch Verantwortung. Die ›Träger des Lichts‹ sind immer noch nicht besiegt.«
»Es ist nicht meine Kirche«, stellte Peter klar. »Für mich ist dieser Kampf beendet. Oder bin ich ein Faustpfand für eine angemessene Entschädigung Ihrer großzügigen Unterstützung?«
Nakashimas Gesicht blieb unbewegt. »Viele Menschen sind gestorben. Darunter einige meiner fähigsten Mitarbeiter. Menschen mit Familie. Sie haben überlebt, Mr. Adam, und Sie haben sogar eine neue Hand bekommen. Sie sollten dem Schicksal ein wenig dankbarer sein. Meine, wie Sie sagen, großzügige Unterstützung hat keinen Preis. Betrachten Sie sich als mein Gast. Und im Augenblick noch als Patient.«
»Ich würde jetzt gerne nach Hause gehen.«
»Nach Hause? Wo soll das sein? In Köln? In Hamburg? In Rom?«
»Bei meinen Eltern. Falls Sie noch in Sicherheit sind. Ich möchte zu ihnen.«
»Ihren Eltern geht es gut. Im Moment würde Ihr Auftauchen ihnen allerdings nur schaden. Vergessen Sie nicht, dass Sie immer noch mit internationalem Haftbefehl gesucht werden. Für die Weltöffentlichkeit sind Sie einer der Drahtzieher des Anschlags auf den Vatikan. Im Augenblick sind Sie hier am sichersten, glauben Sie mir.«
»Ich will sofort mit Franz Laurenz und Don Luigi sprechen. Meine Rehabilitation sollte kein Problem sein.«
Nakashima schwieg, und Peter begann zu verstehen. Dass er doch einen Preis für diese Hand zu zahlen hatte.
»Ohne mich!«, rief er. »Was auch immer Sie vorhaben. Ich will diese Hand nicht. Ich will mein Leben zurück, verstehen Sie?«
Nakashima schwieg weiter.
»Egal, welche Vereinbarung Sie mit Laurenz getroffen haben. Damit habe ich nichts zu tun. Wo ist Maria? Ich will sie sehen.«
»Bald, Mr. Adam«, sagte Nakashima leise und erhob sich. »Ich will ehrlich sein. Jede Art von Religion widert mich an. Ich bin Geschäftsmann. Ich glaube an das Hier und Jetzt, an den Wohlstand als moralischen Wert. Dafür bin ich bereit zu kämpfen. Ich weiß nicht, wofür Sie kämpfen würden, aber ob es Ihnen gefällt oder nicht – Sie spielen in diesem Spiel eine zentrale Rolle, und das wissen Sie. Also hören Sie auf zu jammern und lernen Sie, Ihre neue Hand zu benutzen. Sie werden sie noch brauchen.«
Ohne die übliche Verbeugung wandte sich Nakashima ab und verließ den Raum. Peter blieb jedoch nicht viel Zeit, sich zu überlegen, welche Optionen er in dieser Situation hatte. Eine junge Japanerin betrat der Raum. Sie trug ein strenges Businesskostüm und hochgesteckte Haare, die nicht zu ihren weichen Gesichtszügen passten. Peter schätzte sie auf Anfang dreißig, aber sie konnte auch älter sein, bei asiatischen Physiognomien war er sich nie sicher.
»Ich bin Dr. Yoko Tanaka. Wie geht es Ihnen, Mr. Adam?«
Ihr Händedruck war unerwartet kräftig.
»Den Umständen entsprechend«, erwiderte Peter und ärgerte sich sofort über die unpassende Floskel.
»Ausgezeichnet«, sagte Yoko Tanaka ebenso förmlich. »Ich zeige Ihnen jetzt Ihr Zimmer, und dann bringe ich Sie zur Physiotherapie.«
»Sie arbeiten für Mr. Nakashima?«
»Ja.«
Sie wartete ungeduldig darauf, dass Peter ihr folgte.
»Als Ärztin?«
»Nein. Ich leite die Forschungsabteilung von Nakashima Industries.«
»Dann ist das hier …«, Peter hielt seine linke Hand hoch, »… Ihre Entwicklung?«
»Ja. Wenn Sie sie kaputtmachen, bringe ich Sie um.«
Na, endlich ist mal jemand ehrlich.
Sie brachte ihn ein weiteres Stockwerk tiefer in einen Trakt, der nun deutlich belebter war. Frauen und Männer in verschiedenfarbigen Overalls kamen ihnen entgegen, manche von ihnen warfen Peter verstohlene Blicke zu.
»Die Besatzung der Anlage umfasst zweihundertdreißig Personen unterschiedlicher Qualifikation«, erklärte Dr. Tanaka steif. »Alle vier Wochen werden die Mitarbeiter abgelöst.«
»Ein Sicherheitsproblem«, wandte Peter ein.
»Nein. Kein Problem.«
Sie öffnete eine Tür und führte Peter in eine kleine, aber gemütliche Kabine.
»Ruhen Sie sich aus. In einer Stunde wird man Sie zur Physiotherapie abholen.«
Nachdem Dr. Tanaka ihn allein gelassen hatte, tigerte Peter eine Weile unruhig durch die kleine Kabine. Zwei Schritte vor, umdrehen, zwei Schritte zurück. Er spürte, wie er immer nervöser wurde. Wie die Wut über seine erzwungene Ohnmacht in ihm wuchs. Und mit der Wut wuchs ein nadelfeiner und nur allzu vertrauter Schmerz hinter seiner Stirn.
Nicht jetzt, bitte nicht jetzt!
Peter zwang sich zur Ruhe, setzte sich auf das kleine Bett und versuchte, seine Atmung zu kontrollieren. Um sich abzulenken, probierte er seine neue bionische Hand aus. Mit ein bisschen Übung gelang es ihm, alle Finger einzeln zu bewegen. Sie fühlten sich noch etwas steif und taub an, aber immerhin fühlten sie sich nach etwas an. Er konnte Druck spüren und nach einem Versuch mit einer Büroklammer, die er in einer Ritze fand, sogar Schmerz. Dr. Tanaka und Nakashima Industries hatten wirklich ganze Arbeit geleistet. Allerdings hatte die Hand auch ihre Macken, wie er schnell feststellte. Nach dem Versuch, sich mit der Büroklammer zu pieken, ließ der Schmerz nicht nach. Im Gegenteil, er flammte als unangenehmer Juckreiz rasch über die ganze Hand und strahlte bald auch auf seinen Kopf aus. Peter hielt die juckende Hand unter kaltes Wasser, schüttelte sie heftig, massierte sie, aber der Juckreiz wich nur langsam. Nicht so der Kopfschmerz, der sich mehr und mehr zu einem pulsierenden Klumpen verdichtete. Peter kauerte sich auf dem Bett zusammen. Seine Haut kribbelte jetzt am ganzen Körper, der Stoff der Kleidung schien sie bei jeder Bewegung weiter aufzuscheuern. Die bekannten Vorzeichen der Migräne. Er überlegte, ob er jemanden rufen sollte, doch in diesem Moment schlug das Raubtier zu. Die Bestie in seinem Kopf, die ihn schon seit Jahren verfolgte. Ein gleißend blaues Licht blähte sich vor seinen Augen auf wie eine explodierende Supernova und füllte alles aus, seinen Kopf, die Kabine, die ganze Welt. Wimmernd krampfte er sich auf dem Bett zusammen, als das Licht ihn von innen heraus auffraß. Als es mit einem Schlag dunkel wurde. Peter spürte, wie er aus seinem Körper herausgeschleudert wurde in große Dunkelheit und Kälte, wie sämtliche Körperzellen in einem einzigen Moment zerplatzten. Wie sein Körper von einer gewaltigen Faust zusammengepresst wurde, die ihm den Atem raubte, die Lungen zerquetschte, das Herz, überhaupt sämtliche Eingeweide. Aber die Faust drückte weiter. Unbarmherzig und knirschend quetschte sie ihn auf seine Atome zusammen, verdichtete ihn zu einem winzigen Partikel aus Schmerz und Angst, das vergessen durch die große Leere taumelte.
Angst. Leere. Schmerz.
Das Gefühl, aus der Welt zu stürzen.
Häschen in der Grube, saß und schlief, saß und schlief …
Das Nächste, was er wahrnahm, als der Schmerz plötzlich von ihm abfiel wie alter Wundschorf, war der Geruch von Weihrauch. Lichter schälten sich aus dem Dunkel, nahmen die Gestalt von Kerzen an. Immer mehr Licht floss durch hohe, bunt verglaste Fenster auf ihn herab wie ein milder Strom tröstlicher Worte. Stimmen. Fernes Verkehrsrauschen. Das Ächzen einer Kirchenorgel. Peter sah sich um: Er stand in der Nische einer Kapelle im Kapellenkranz einer prächtigen, gotischen Basilika, ganz und gar in Licht getaucht. Die Touristengruppen und Pilger, die leise schwatzend durch die Kirche streunten und die hohen gotischen Fenster bewunderten, nahmen keine Notiz von ihm. Hin und wieder perlte helles Lachen von Jugendlichen durch den Raum. Die Kapelle, in der Peter stand, war durch ein hohes, vergittertes Tor vom Altarraum abgetrennt. Gleich dahinter lag der große Hauptaltar.
Wie bist du hierhergekommen?
Die Gitterstäbe fühlten sich kühl und fest an. Ganz und gar real. Kein bisschen wie einer seiner üblichen Migräneträume.
Als er durch das Gitter in die Apsis trat, wusste Peter sofort, wo er war. So viele gotische Kathedralen dieses Ausmaßes gab es nicht auf der Welt. Überhaupt kannte er diese Kathedrale gut. Er hatte das mittelalterliche Triptychon über dem Altar der Marienkapelle gleich erkannt, das in der Mitte die Anbetung des Jesuskindes zeigte, rechts den Heiligen Gereon, links die Heilige Ursula und einige ihrer elftausend Jungfrauen, mit denen zusammen sie später niedergemetzelt worden war. Gereon und Ursula, die C-Promis unter den Heiligen. Aber die wahren Stars, die diese Kathedrale erst zu einem der vier heiligsten Orte der katholischen Kirche gemacht hatten, lagen direkt vor ihm, hinter dem Hochaltar unter einer hohen Panzerglasvitrine in einem goldenen und über und über mit Edelsteinen und Email besetzten Reliquienschrein: die Heiligen Drei Könige.
Peter wusste genau, wo er war.
Zuhause.
VI
dZYAN-agent Chat-Protocol 07072011 14:05:24 – 14:16:43 GMT+01:00
Proxy-Server: ptp.ordislux213.th.net:89
Encoding-method: AMETH10.1.01
14:05:24 Client306
status?
14:06:32 Client377
die pforte wurde geöffnet.
14:08:38 Client306
warum melden sie sich erst jetzt?
14:09:02 Client377
es gab komplikationen. ich musste improvisieren.
14:09:42 Client306
welcher art?
14:10:11 Client377
peter adam. er hatte kontakt zur zielperson und zu nikolas.
14:10:57 Client306
wo ist peter adam jetzt?
14:11:23 Client377
vor ort. er ist mir gefolgt. erbitte anweisungen.
14:12:13 Client306
ist er allein?
14:12:29 Client377
positiv.
14:13:06 Client306
nikolas?
14:13:33 Client377
tot. erbitte anweisungen wg. peter adam.
14:14:08 Client306
nicht töten.
14:14:41 Client377
bitte bestätigen: nicht töten?
14:15:17 Client306
nicht töten. ziehen sie sich zurück und konzentrieren sie sich weiter auf die liste.
14:15:52 Client377
und peter adam?
14:16:09 Client306
halten sie sich an meine befehle.
14:16:43 Client377
natürlich. vergebt mir, meister. im lichte mit euch.
/End of conversation/
7. Juli 2011, Kölner Dom
Für einen Moment rang Peter nach Luft. Er bemerkte jetzt, dass er keine weiße Krankenhauskleidung mehr trug, sondern einen grauen Anzug und ein dunkelblaues Hemd. Er durchsuchte seine Taschen und stieß auf eine Brieftasche mit vierhundert Euro in bar, einer Kreditkarte auf den Namen Paul DeFries und einem südafrikanischen Diplomatenpass auf den gleichen Namen. Und ein Handy. Der Adressspeicher war leer, aber die Anrufliste zeigte eine italienische Nummer.
Was soll das? Wie zum Teufel bist du hierhergekommen?
Ein weiterer Gedanke kämpfte sich durch die Strudel seiner Verwirrung an die Oberfläche. Peter zog das Handy noch einmal hervor und prüfte das Datum.
7. Juli 2011.
Fünf Tage? Wie hast du fünf Tage übersprungen?
Verwirrt umrundete Peter den Hochaltar und drückte die Nummer aus der Anrufliste.
»Peter?« Marias Stimme. Plötzlich war sie da, in seinem Ohr, in seinem Kopf, in ihm, ganz nah. Maria.
Die Erleichterung, dass alles gut wird.
Die Zuversicht, dass es eine einfache Erklärung gibt.
Die Freude, ihre Stimme zu hören.
»Maria! … Wo bist du?«
Die Stimme am anderen Ende der Leitung zögerte, schien zu spüren, dass etwas schiefgelaufen war. So was von schiefgelaufen.
»Das frag ich dich! Wir waren verabredet. Wo bist du?«
»Im Dom.«
»Um Himmels willen, welcher Dom?« Ihre Stimme jetzt fast panisch.
»Der Kölner Dom. Maria, was ist hier los, ich …«
Aber sie ließ ihn nicht ausreden, sondern schrie ins Telefon.
»Im Kölner Dom? Mein Gott, Peter! Du musst da raus! Sofort!«
»Maria, was …«
Er hörte eine weitere Stimme im Hintergrund. Jemand nahm Maria das Telefon aus der Hand.
»Peter, hören Sie mir gut zu.«
Peter erkannte die kräftige Stimme des ehemaligen Papstes sofort wieder. Die Stimme von Marias Vater. Dem Mann, der ihm die linke Hand abgehakt hatte. Der Mann, der ihm das Leben gerettet hatte. Franz Laurenz.
»Sie müssen den Dom sofort verlassen.«
In diesem Moment spürte er das Beben. Es begann mit einem feinen, kaum spürbaren Vibrieren des Fußbodens, was Peter zunächst nicht verwunderte, denn der Dom lag in unmittelbarer Nähe zum Kölner Hauptbahnhof. Während er mit Laurenz telefonierte und sich dafür ungnädige Blicke einiger Pilger einfing, umrundete Peter den Hochaltar.
»Erst erklären Sie mir, was hier los ist! Ich wache auf einer Bohrinsel mit einer neuen Hand auf, und kurz darauf stehe ich im Kölner Dom. Wie, zum Teufel, komme ich hierher? Was ist passiert? Wie habe ich die Bohrinsel verlassen?«