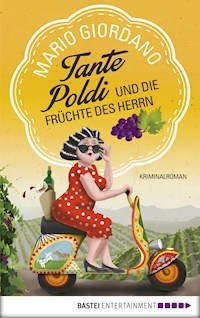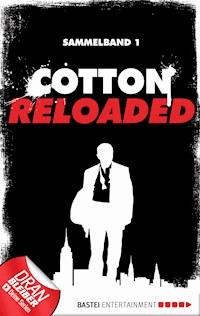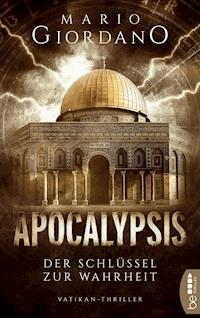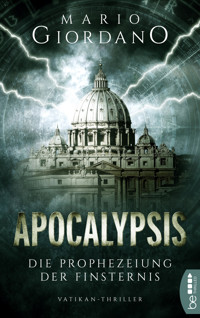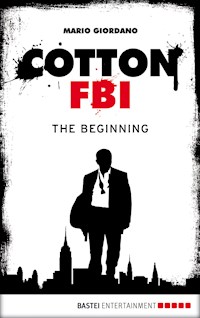6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Matthias und Alex retten einen Hund vor dem Ertrinken aus der Elbe. Das Geheimnis um den halbtoten Bullterrier reißt beide Jungen in den Sog lebensgefährlicher Abenteuer. Es geht um die Feindschaft zweier Brüder, um Liebe, Freundschaft, skurrile Typen in der Hafengegend und finstere Machenschaften in den Docks. Mario Giordano fasziniert seine Leser mit einer brillanten Milieuskizze, knallhart und zärtlich, die zugleich Krimi und Lovestory ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mario Giordano
Der aus den Docks
Abenteuer im Hafen
Über dieses Buch
Matthias und Alex retten einen Hund vor dem Ertrinken aus der Elbe. Das Geheimnis um den halbtoten Bullterrier reißt beide Jungen in den Sog lebensgefährlicher Abenteuer. Es geht um die Feindschaft zweier Brüder, um Liebe, Freundschaft, skurrile Typen in der Hafengegend und finstere Machenschaften in den Docks.
Mario Giordano fasziniert seine Leser mit einer brillanten Milieuskizze, knallhart und zärtlich, die zugleich Krimi und Lovestory ist.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischer-sauerlaender.de
Biografie
Mario Giordano, 1963 in München geboren, ist einer der vielseitigsten deutschen Autoren. Er lebt in Berlin und schreibt Kinder- und Jugendbücher, Romane, Sachbücher und Drehbücher. Bei Rowohlt erschien unter anderem sein Roman «Das Experiment», die Vorlage des gleichnamigen Kinofilms, zu dem er auch das Drehbuch schrieb.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Zuerst erschienen 1997 im Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH
Redaktion Ute Blaich
Covergestaltung: any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung: Bias/plainpicture
ISBN 978-3-7336-0703-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Für Claudia und Michael
Dieses Buch ist zum größten Teil während eines Stipendiats als «Stadtschreiber von Otterndorf» entstanden. Ein herzlicher Dank gilt also dieser Stadt an der Elbe und den Otterndorfern, die mich einen Sommer lang freundlich aufgenommen und unterstützt haben.
Ein weiterer Dank gilt Claudia Schürmann. Auf ihrem Hof, wo sie grausam misshandelte Bullterrier pflegt und resozialisiert, habe ich viel über Bullterrier erfahren und Gelegenheit gehabt, diese faszinierenden und problematischen Hunde aus nächster Nähe kennen zu lernen. Wer ein Herz für Bullis hat, fühle sich aufgefordert, Claudia Schürmann und ihre Initiative «Bullterrier in Not e.V.» zu unterstützen.
Und nicht zuletzt danke ich Gert Haucke für seinen hundesachkundigen Rat im richtigen Moment und Ute Blaich, die eine wunderbare Lektorin ist, für ihre Geduld.
Das letzte Wort über die Wunder des Hundes ist noch nicht geschrieben.
Jack London
Den Bruder zum Feind – ein Feind fürs Leben.
Jüdisches Sprichwort
Der aus den Docks
Immer wenn ich an Otto denke, denke ich auch an Alex. Und immer wenn ich an Alex denke, denke ich an Otto. Das ist so. Sie gehören zusammen, auch wenn sie jetzt beide tot sind. Und wenn ich an Otto und Alex denke, fällt mir alles wieder ein. Jeder Tag jenes Sommers, als ich schwimmen lernte. Der Sommer, in dem ich mit einem Schlag erwachsen wurde. Das ist alles lange her. Fünfzehn Jahre. Ich war damals dreizehn, als wir ihn fanden. Mit dreizehn wurde ich erwachsen.
Nierenversagen, sagte die Tierärztin. In den letzten Tagen torkelte Otto schon wie besoffen herum und stank aus dem Maul, als würde er inwendig verfaulen. Dr. Teerling gab ihm eine Spritze. Das Letzte, was wir für ihn tun konnten, der so viel für mich getan hatte. Mehr als jemals ein Mensch. Außer Alex, meine ich. Sechzehn sei unglaublich viel für einen Bullterrier, meinte die Ärztin. Ich weiß das. Ich hatte fünfzehn wunderbare Jahre mit Otto. Ich bin nicht unglücklich, nur traurig.
Vorgestern ist Otto gestorben, gestern habe ich ihn beerdigt und heute Morgen kamen die Erinnerungen. Alle. Ich frage mich, wo sie so lange steckten, doch vielleicht musste Otto erst tot sein, bevor ich mich an alles erinnern konnte.
Ich habe Rachma geschrieben, dass Otto gestorben ist. Postlagernd an die letzte Adresse, die ich von ihr habe. Ich bin fast sicher, sie weiß es schon! Rachma wusste immer, was los war. Mit Otto, mit Alex, mit Kai und mit mir. Sie nannte mich Thias. Aus ihrem Mund klang das ein bisschen wie der Name eines unglücklichen Heiligen.
Ich habe versucht zu schlafen, um die Erinnerung zu verscheuchen, aber es hilft nichts. Im Traum tritt alles nur noch deutlicher hervor. Also gut, wenn schon, dann richtig, an jede Einzelheit, an alles, was in jenem Sommer geschah. Es war die schönste Zeit meines Lebens. Ich werde alles aufschreiben, bis Rachma kommt. Ich bin sicher, dass sie kommt, wo auch immer sie jetzt steckt.
Dieser Sommer, als ich dreizehn war und schwimmen lernte, begann mit einem unauffälligen Frühling. Es regnete viel, nachdem der Winter uns die letzte Freude an Schnee gründlich ausgetrieben hatte. Acht Wochen war die Alster zugefroren – acht Wochen! Auf der Elbe türmten sich die Eisschollen im Hafenbecken zu dickem Packeis zusammen. Sogar die Eisbrecher kamen nicht mehr dagegen an. Eis überzog ganz Hamburg, die Schneeflocken schmolzen nicht mehr auf den Wangen, und die blonde Heike von nebenan, die jeden Abend im hautengen rosa Skianzug am Hans-Albers-Platz wartete, holte sich eine Lungenentzündung. Ich sehnte mich nach Löwenzahn und dem Geruch von Sonnencreme über den Stadtparkwiesen. Ich sehnte mich nach Sommer.
Es regnete auch an dem Maitag, als ich Alex zum ersten Mal sah. Ich meine, wirklich sah. Natürlich kannte ich ihn vom Schulhof. Jeder kannte ihn, aber nie hatte ich ihn richtig gesehen, vor diesem Maitag. Denn Alex konnte man eigentlich nur richtig sehen, wenn er sich bewegte, wenn er lief.
Es regnete, schiffte, kübelte aus allen Himmeln. Nicht so damenhaft feinfädig elegant, wie ich es mal in Düsseldorf erlebt habe, sondern so richtig satt, nach guter alter Hamburger Art. Eins a norddeutsches Sauwetter, sodass einem die Luft wegbleibt und man schon pures Wasser atmet. Ich hasste das. Regen war schlecht fürs Geschäft meines Vaters. Mein Vater hatte eine kleine Barkasse für Hafenrundfahrten, die Lütte Deern. Es war seine eigene, und es war alles, was wir besaßen. Die flachen Boote mit dem engen Ruderhaus legten von den St. Pauli Landungsbrücken ab, tuckerten durch den Gewürzduft aus den alten Kontoren der nahen Speicherstadt, überquerten die Elbe und kreuzten durch verschiedene Schleusen und Hafenbecken den großen Pötten hinterher, die immer einen besonderen Eindruck auf die Touristen machten. Bei schönem Wetter strömten die Menschen nur so vom Busparkplatz über die Kaibrücken in die Barkassen. Bei Regen machten immer nur die Cafés das Geschäft.
An diesem Maitag stand ich also an den Landungsbrücken und versuchte, ein paar Touristen, am besten leicht angetrunkene Kegelklubbrüder, in die Barkasse meines Vaters zu kriegen.
«Große Hafenrundfahrt mit Speicherstadt! Alle Wunder dieser Welt. Heute ausnahmsweise ohne Regenzuschlag. Der Käpt’n ist noch mit Störtebeker gefahren. Kommen Sie näher, lassen Sie ihr Geld hier, bevor wir Gewalt anwenden! Große Hafenrundfahrt!»
Ich hatte nichts Besseres zu tun. Außerdem verdiente ich auf den Touren manchmal was dazu und dudelte auf einer alten Ziehharmonika bekannte Shantys ab. Hamborger Veermaster rauf und runter. Wenn ich heute manchmal nicht schlafen kann, nehme ich mir das verstimmte alte Ungeheuer vor und quetsche und quäle gnadenlos mein ganzes Shanty-Programm von damals ab, bis wir beide vor Erschöpfung keuchen. La Paloma, ohe – einmal muss es vorbei sein!
Mein Vater war Nummer zwei in der Reihe. Vor uns machte Finke gerade seine Barkasse los, als ich das Geschrei hörte. Alex rannte oben von der U-Bahn-Station Baumwall runter die Straße lang. Selbst durch den Regenschleier erkannte ich ihn sofort an dem mühelosen Lauf, dem blassen Gesicht und den halblangen braunen Haaren, die gar nicht nass wirkten. So als sprühe der Regen respektvoll um ihn herum.
Niemand rannte so wie Alex. Ich meine, so perfekt. Den Jungen, der ihn verfolgte, konnte ich nicht genau erkennen. Alex rannte die Treppe zur Überseebrücke hinunter, übersprang drei Stufen auf einmal, sodass seine Turnschuhe laut auf den Beton patschten, und raste weiter. Er trug immer nur Turnschuhe. Nie diese schweren, ledernen Treter, wie sein Verfolger. Alex trug immer gut sitzende, bequeme Sachen. Nicht dieses überweite, dicke Zeug, das dem anderen Typ jetzt pitschnass um die Beine klatschte. Alex war klein, zierlich fast, wirkte aber nicht zerbrechlich. Er wog einfach wenig. Leichte Knochen, kein Fett, nur ein paar Sehnen und Muskeln, als sei alles an ihm auf perfekte Bewegung ausgerichtet, wie bei einem Geparden. Er lief im Zickzack, aber sein Verfolger erwischte ihn trotzdem und hielt ihn fest. Er war etwas größer, kräftiger vor allem. Sie schlugen sich, ziemlich heftig, wie es aussah, aber der andere glitt plötzlich aus, stürzte, und Alex rannte endlich weiter, auf die Landungsbrücken zu. Auf mich, und ich sah nichts anderes mehr in diesem Moment, als hätte der Regen jedes Geschehen und Treiben um mich herum verschluckt und nur Alex und seinen Verfolger zurückgelassen.
Es schien eine ernstere Sache zu sein. Das merkte ich am Gebrüll des Verfolgers und der Wut, mit der er Alex nachsetzte. Und plötzlich verstand ich überhaupt nicht mehr, was ablief. Ich erkannte nämlich Kai. Kein Zweifel, das war Kai! Die bürstenkurzen blonden Haare, die massige Gestalt, die rote Baseballjacke – Kai. Alex’ Bruder!
Und dann hörte ich Alex lachen. Er lachte! Das Lachen wehte ihm voraus wie ein Luftzug vor einer schweren Böe. Alex lachte, als sei die Hetzjagd durch den Regen ein Riesenspaß. Geschmeidig umlief er im Slalom die paar Passanten, die wie Pilze unter ihren Schirmen standen, und donnerte über eine der Holzbrücken auf die Anlegestelle. Sein Vorsprung reichte. Er konnte unten halten und sich umsehen.
Ich stand nicht weit entfernt, sah plötzlich die Bestürzung in seinen Augen, als er erkannte, dass er in eine Falle gelaufen war. Der kurze Landesteg mit den Fischbuden und Souvenirshops direkt am Wasser bot keinerlei weitere Fluchtmöglichkeit. Er hätte über eine der anderen Holzbrücken zurücklaufen können. Aber da konnte ihm Kai leicht den Weg abschneiden. In seinem Gesichtsausdruck lag keine Angst, nur Bestürzung. Wie über ein verlorenes Spiel. Hinter ihm donnerten schon die Stiefel seines Verfolgers über das Holz. Dann sah er mich. Mein Gott, an was ich mich plötzlich wieder erinnere! Zum Beispiel, dass seine Unterlippe blutete. Und daran, wie er mich in jenem Moment ansah. Als wären wir beide einmal Freunde gewesen, und ich hätte es nur vergessen. In diesem Blick lag Vorwurf! Dabei hatten wir nie ein Wort gewechselt. Ich las die Frage in seinen Augen, drehte mich kurz zu meinem Vater um, der gerade die Persenning nachzurrte, und nickte Alex zu. Im nächsten Moment war er an Bord, warf sich hinter die Bordwand, presste sich auf den nassen Boden unter die Sitzbänke und tat keinen Mucks. Ich blieb, wo ich war. Mein Vater wollte etwas rufen. Aber dann sah er Kai und verstand sofort. Mein Vater war Klasse. Wenn wir uns auch später oft bis zur Raserei angeschrien haben, wegen nichts, habe ich nie etwas anderes über ihn gedacht, als dass er ein verdammter Klassetyp ist.
Kai stürmte den Anleger und fahndete nach Alex. Mein Vater winkte mich aufs leere Boot, holte die Taue vom Poller und startete den Diesel. Als hätten wir eine Tour mit voll besetzten Bänken. Kai rannte in die Fischbuden und Andenkenläden, raste den kleinen Pier rauf und wieder zurück und glotzte in die Fenster der großen Elbfähren, während wir gemütlich ablegten. Schmute Lohmann, Nummer drei in der Reihe, rief etwas. Aber mein Vater machte ihm Zeichen, dass er eine Runde drehen wolle und Schmute nachrücken sollte. Schmute zeigte ihm einen Vogel. Kai merkte nichts.
Erst in den Kanälen der Speicherstadt rührte sich Alex aus dem Versteck. Ich hatte ihn die ganze Zeit beobachtet, wie er sich reglos unter die Sitzbank kauerte. Schlafend hätte man denken können oder tot. Wie ein Tier in großer Gefahr.
«Danke», sagte er zu meinem Vater, als er unter der Bank herauskam und sich mit einem Blick vergewissert hatte, dass er außer Gefahr war. Mich schien er gar nicht wahrzunehmen.
«Schon in Ordnung», brummte mein Vater. «Kennt ihr euch?»
Jetzt erst sah Alex mich an und nickte. «Ja», sagte er. «Du bist Matthias Rittmeier.»
Ich war verblüfft. Dass er meinen Namen kannte! Später merkte ich, dass Alex immer genau über seine Umgebung Bescheid wusste. Er kannte jeden auf dem Schulhof. Auch wenn er den meisten kaum Beachtung schenkte, wanderte sein wachsamer, unruhiger Blick beständig herum. Er beobachtete alles.
«Du bist Alex Winter», sagte ich, dämlich wie so ein verdammter Hirni. Alex schien es nicht gehört zu haben. Er hockte sich auf die Sitzbank und blickte unter der Persenning die hohen Ziegelmauern der Kontore hinauf. Das Geräusch des Diesels brach sich am hohen Backstein der alten Kaffee- und Teelager und den niedrigen Brücken. Sonst war es ruhig, als läge die Stadt weit hinter uns. Als wären wir wirklich allein. Hier auf dem Boot, unserem Boot, spürte ich wieder die seltsame Aura, die ihn auf dem Schulhof umgab. Alex war eigentlich klein, kleiner als ich. Trotzdem flößte seine ganze Erscheinung, die Gewandtheit und Geschmeidigkeit seiner Bewegungen, Respekt ein.
«Schönes Boot!», rief Alex meinem Vater zu. «Ihres?»
Mein Vater nickte wieder und schickte mir einen seltsamen Blick, der mich wohl auffordern sollte, etwas zu sagen. Aber ich schwieg, wie mit zugenähten Lippen.
«Hab noch nie ’ne Hafenrundfahrt gemacht!», rief Alex.
«Das hier wird auch keine werden, Junge!», platzte mein Vater heraus. «Eine Runde, bis dein Kumpel weg ist, und dann musterst du wieder ab, klar?»
«Klar», sagte Alex und nickte mir zu. «Klar.»
«Warum hat dich dein Bruder gejagt?», fragte ich plötzlich. «Und warum hast du gelacht?»
Er antwortete nicht, zuckte nur mit den Achseln und blickte dann achteraus auf das schlickig braune Elbwasser, das hinter uns aufschäumte. Jetzt, wo ich mich genau an alles erinnere, denke ich: Vielleicht hat er es damals schon gewusst, also alles, was passieren würde. Vielleicht hat er mich an diesem Maitag wirklich ausgesucht, weil er alles schon wusste. Seinen Verfolger ausgelacht wie einer, der den Ausgang des Spiels längst kennt und sich darüber amüsiert, wie Kai sich noch abstrampelte. Aber wer von uns hätte an seiner Stelle gelacht, wenn er schon damals gewusst hätte, wie es ausgehen würde?
Der Regen ließ nach, als wir aus der Speicherstadt herauskamen und in die Fahrrinne der Elbe einbogen. Alex fing an, mich zu nerven mit seinem Schweigen. Schließlich bewunderte ich mich für meine Kaltblütigkeit und den raschen Entschluss, die ihn gerettet hatten. Ich erwartete irgendetwas. Nicht dass er mir gleich die unendliche Gnade seiner Freundschaft erweisen sollte! Scheiße, nein. Aber wenigstens irgendeine Anerkennung, Mann, irgendein Wort, ein Danke, irgend so etwas. Aber er saß einfach nur auf dem Boot wie Prinz Achmed und schwieg. Ich hatte mich gerade entschlossen, ihn für einen Pupser zu halten. Das Schlimmste, was einer sein konnte, schlimmer noch als ein Arsch, denn als Arsch hat man schließlich noch Charakter, als er plötzlich etwas sagte. Als hätte er die ganze Zeit über meine Frage nachgegrübelt.
«Weil es nur Kai ist», sagte er. Ich verstand nicht gleich. «Darum habe ich gelacht. Ist doch nur Kai. Der ist eben manchmal so. Manchmal rastet der aus, aber das geht vorbei.»
Ich nickte und verstand nichts. Alex grinste mich an und hielt sich die Nase zu. «Kai ist ein Pupser!», näselte er. «Nur ein Pupser!»
«Und was bin ich?», fragte ich. Alex zuckte mit den Achseln.
«Du bist okay.»
Er drehte sich wieder Richtung Kielwasser, als sei das tausendmal interessanter als ich.
Ich überlegte, was ich sagen sollte. Ob ich auf dem Boot meines Vaters, auf meinem Territorium, genug Mut hatte, ihm einen Spruch zu drücken wegen seiner Scheißarroganz. Aber ich kam nicht weit mit meinen Überlegungen. Überhaupt bin ich mit Nachdenken nie weit gekommen. Ich bin eben kein Denkertyp. Kein Heiliger, nicht unglücklich, kein Denker. Aber ich bin auch kein Pupser, das habe ich bewiesen.
Während ich überlegte, kreuzten wir das Fahrwasser eines großen chinesischen Containerschiffes, das sich mit der Flut durch die schmale Fahrrinne seewärts schob. Die Lütte Deern bekam seitlich etwas Wellenschlag, ging mit der Dünung hoch, gierte leicht weg. Der Diesel stampfte leise, und nieselgraue Gischt sprühte an die seitlichen Plexiglasscheiben. Alles nicht schlimm. War ja nicht der Nordatlantik, war nur die Elbe. Obwohl ich nicht schwimmen konnte, machte es mir überhaupt nichts aus, im Gegenteil. Man brauchte sich ja bloß festzuhalten. Anders Alex. Schon als wir in die Elbe einfuhren, hatte sich seine Haltung verspannt. Jetzt wirkte er noch kleiner, verkrampfte sich richtig, klammerte sich mit beiden Händen an die Bank. Der war nicht seefest! Dem wurde beim leichtesten Seegang übel! Schadenfreude strich sich köstlich wie Erdnussbutter auf mein Herz.
«Gleich vorbei!», rief ich lässig und stieg auf die seitliche Sitzbank an der Bootswand.
Alex sah mich an und verstand. Er war ja nicht blöd.
«Danke», stöhnte er, und ich las in seinem Blick, dass er es mir heimzahlen würde. Irgendwann.
Ich glaube, dass alles zum großen Plan gehörte. Auch dieser kleine Krach, der uns zusammenführte. Uns drei, Alex, Otto und mich. Diese Auseinandersetzung schärfte unsere Sinne. Wir sagten nichts mehr, belauerten uns bloß angespannt. Nur dieser Aufmerksamkeit und dem Umstand, dass es aufhörte zu regnen, verdankte Otto sein Leben.
Ich sah ihn, als wir aus dem Fahrwasser des Containerschiffes herauskamen. Wir lagen mitten im Strom, steuerbord die Landungsbrücken, backbord das Schwimmdock von Blohm & Voss. Ich will es nicht meinen scharfen Augen zuschreiben, dass ich es war, der ihn entdeckte. Ich starrte gerade über die Elbe, folgte einem ersten Sonnenfleck, der über das bleigraue Wasser blitzte.
Ich sah Otto genau in dem Augenblick, als eine Welle ihn kurz heraushob, gerade als der Sonnenfleck ihn erreichte und für einen Sekundenbruchteil traf. An diesem Maitag hieß er noch nicht Otto. An diesem Tag war er einfach nur ein junger Bullterrier, kurz vorm Ertrinken, der sich verzweifelt gegen die Wellen abstrampelte.
«Ein Hund!», schrie ich und zeigte auf die Stelle, wo ihn im selben Moment die nächste Welle wieder verschluckte. «Da, ein Hund, Papa, ein Hund!»
Ich rannte nach vorn, starrte auf die Stelle, wo ich den Hund entdeckt hatte.
«Nix!», schrie mein Vater zurück. «Da war kein Hund.»
Alex stand plötzlich dicht neben mir. «Doch!», rief er, obwohl er den Hund gar nicht gesehen haben konnte. Trotzdem rief er: «Da war was!»
In diesem Augenblick kam der Hund weiter links wieder hoch. Er riss seinen Kopf aus dem Wasser, als hätte ihn eine gewaltige Kraft dort unten festgehalten, stemmte seinen Schädel über die Wasserlinie und kämpfte verzweifelt weiter gegen den Untergang an. Gegen jede Chance, gegen die reißende Strömung, die unerbittlich seine letzten Kräfte raubte.
«Da!», schrien wir.
«Jo!», rief mein Vater nur, als er den Hund sah, und drehte sofort bei. Sagte ich schon, dass mein Vater ein Klassetyp war? Obwohl der Hund da vor uns im Wasser schon fast am Ende war, steuerte ihn mein Vater nicht direkt an. Das hätte ihn nur gefährdet. Mein Vater fuhr vielmehr um die Stelle herum. Eiskalt. Das war einfach genial! Das Boot beschrieb einen Halbkreis, glättete die Wellen dort, wo der Hund sich zu Tode strampelte, und verschaffte ihm etwas Atem. Dann stoppte mein Vater den Diesel und ließ die Lütte Deern auf den Hund zutreiben, so als wolle er bei ihm anlegen. Immer noch gefährlich genug, das Manöver. Wenn mein Vater nicht höllisch aufpasste, konnte er den halb Ertrunkenen dort längsseits überfahren oder sogar mit der Schraube erwischen. Außerdem schipperten wir ja nicht allein auf der Elbe. Hinter uns schob ein großer Autocarrier an, flankiert von zwei Bugsierern, die wohl einen Pott elbabwärts hereinholen wollten. Vor uns lief ein rostmorscher Stückgutfrachter aus Kuba ein, und steuerbordseits kreuzte die Elbfähre von St. Pauli nach Steinwerder unseren Kurs. Und wir mittendrin.
«Matthias! Die Stange und den Reifen!», schrie mein Vater, den Hund immer noch im Blick. Der schwamm weiter geradeaus, wandte nicht mal den Kopf, so als sähe er uns gar nicht.
Während mein Vater leicht beidrehte, als wäre das in der Mitte der Elbe bei diesem mörderischen Verkehr und der Strömung eine seiner leichtesten Übungen, sprang ich nach achtern und riss den Rettungsring vom Haken. Alex reagierte blitzschnell und griff nach der langen Alustange, die unter der Sitzbank lag, wo er sich versteckt hatte.
Mag komisch klingen, einem Hund einen Rettungsring zuzuwerfen. Aber genau das taten wir. Ich zielte, so gut ich konnte. Der Ring landete direkt vor seinem Kopf, sodass er ihn nicht zu wenden brauchte. Ich fürchtete, der Hund könnte sich erschrecken und verschlucken. Aber er verhielt sich so, als ob wir die Aktion schon oft geübt hätten. Mit dem nächsten Schwimmzug legte er eine Pfote auf den Ring, versuchte gleich mit der anderen nachzulegen. Aber der Reifen drehte weg, und der entkräftete Hund verlor den Halt. Der Reifen schoss etwas vor und trieb mit der Strömung ab.
«Matthias!», schrie mein Vater. Aber Alex hatte den Ring schon mit der Stange abgefangen und schob ihn jetzt mit aller Kraft zurück, dem Hund direkt vor die Pfoten. Dabei musste sich Alex weit aus dem Boot hinauslehnen. Mir fiel in dieser Sekunde auf, dass er sich wieder total geschmeidig bewegte, ganz ohne Angst. Alex hielt den Ring mit der Stange jetzt so, dass der Hund nur in die Öffnung hineinschwimmen musste. Und genau das tat er. Er presste den Ring zwischen die Vorderläufe und seinen Brustkorb, wie einen kostbaren Schatz, hörte jedoch immer noch nicht auf, mit den Hinterläufen Wasser zu treten.
«Matthias, ans Ruder!», kommandierte mein Vater. Ich sprang hin und übernahm, während mein Vater Alex beistand, der sich abrackerte, den Reifen mit der Stange einzuholen. Ich übernahm tatsächlich das Ruder.
«Halt sie ganz locker!», rief mir mein Vater zu. «Lass sie nicht abdrehen! Ganz locker! Kein Gas!» Dann half er Alex mit der Stange und zog den Reifen dicht ans Boot.
«Ich spring rein und stütz ihn!», hörte ich Alex rufen. Schon stand er auf der Sitzbank, bereit zum Sprung.
«Nix da, Kerl!», herrschte ihn mein Vater an und zerrte ihn am Gürtel hart zurück ins Boot. «Hier geht keiner über Bord, kapiert?» Dann beugte er sich weit hinaus, hielt sich mit einer Hand an der Bootswand fest und griff sich mit der anderen den Hund. Otto war damals zwar noch jung, aber immerhin schon ausgewachsen. Und wenn er auch nie fett wurde, blieb er doch immer ein kräftiger Bursche. Er wog! So einen hievt man nicht mal eben locker mit einem Arm aus dem Wasser. Mein Vater schon. Er packte den Hund unter den Vorderläufen, so als nehme er ihn in den Schwitzkasten, umklammerte ihn wie ein Schraubstock und zog ihn aus dem Wasser ins Boot.
Er legte den zu Tode erschöpften Hund auf die Sitzbank und übernahm wieder das Ruder. Jetzt erst sah ich den Hund richtig. Musste wohl ein Bullterrier sein. Eine Rasse, die ich damals nicht besonders toll fand. Eine Rasse mit üblem Ruf, hässlich dazu. Dachte ich. Ich hatte mir schon länger einen Hund gewünscht. So einen hüfthohen, natürlich Mischling (was sonst!). Mit ordentlich Fell und Schwanz, einen, der endlos laufen konnte, einen freundlichen, coolen Filmhund zum Angeben, Toben und Dreckmachen. So ziemlich das Gegenteil von einem Bullterrier. Dachte ich.
Nur wenige kleine hellbraune Flecken sprenkelten Ottos rosig weißes Fell. Er lag auf der Bank, atmete wild, keuchte wie lungenkrank. Wohl kurz vor dem Herzklaps. Alex und ich standen nur vor ihm und trauten uns nicht, ihn zu berühren. Der Hund war um sein Leben geschwommen und blutete aus zahlreichen Wunden. Böse Schnitte oder Bisse klafften an seinen Vorderflanken und am Kopf. Zum Teil schon weißlich vereitert. Das Leben schien aus diesem geschundenen Körper zu fliehen.
«Wie durch den Fleischwolf gedreht», sagte Alex fassungslos. Ich sagte nichts.
«Rührt ihn nicht an!», rief mein Vater, gab Stoff und fuhr Vollgas so scharf zwischen dem kubanischen Frachter und dem Carrier aus der Fahrrinne auf die Landungsbrücken zu, dass die beiden Bugsierer uns böse antuteten.
Der Hund zitterte erbärmlich. Ich holte eine Decke und breitete sie leicht über ihn. Bis wir die Landungsbrücken erreichten, hockten wir Jungen vor ihm, schauten ihn an, flüsterten ihm beruhigend zu. Ich erinnere mich, dass ich furchtbare Angst hatte, der Hund könnte sterben. Ich quatschte den Armen voll, nur um den Tod von ihm fern zu halten. Genau wie vorgestern, bevor Dr. Teerling ihm die Spritze setzte. Fünfzehn Jahre später. Und wenn es ihm auch nicht helfen konnte, weiß ich doch wenigstens, dass er mich bei sich gespürt hat, bis zuletzt.
Kai war verschwunden, als wir wieder an den Landungsbrücken anlegten. Mein Vater fuhr uns mit dem Hund sofort zu Dr. Teerling, die nicht weit weg in St. Pauli eine Kleintierpraxis betrieb. Ich hatte schon einmal mit ihr zu tun, als ich benutzte Spritzen aus ihrer Mülltonne klauen wollte. Bloß diese fetten 200er Kanülen, in die ordentlich Wasser hineingeht. Dr. Teerling hatte mir die Hölle heiß gemacht, als sie mich dabei erwischte. Wegen der Medikamentenreste und der benutzten Nadeln. Vielleicht hielt sie mich für einen Junkie, der sich aus St. Georg zu ihr verirrt hatte. Jedenfalls brüllte sie mich aus dem Fenster heraus an, und ich lief weg, als ob mich drei Teufel hetzten. Mann! Mir die Hölle heiß zu machen, brauchte es damals echt nicht viel. Aber Frau Dr. Teerling war einsame Spitze im Hölleheiß-Machen. Eine große, kräftige Frau mit einem mächtigen Busen und gewaltiger Stimme. Ihre Stimme war nicht etwa ungewöhnlich laut, auch nicht besonders hoch oder tief. Sie war groß, sie füllte jeden Raum ganz aus, auch wenn sie leise sprach. Man konnte sie einfach nicht überhören, und man schwieg automatisch, wenn sie sprach. Selbst die harten Typen vom Kiez, die ihre Killerhunde anschleppten, wenn die sich gegenseitig halb totgebissen hatten. Vor dieser Frau kuschten sie alle. Nebenbei ist sie die beste Tierärztin, die ich kenne, mit dem verdammt größten Herz, das man sich vorstellen kann. Sie lebt immer noch in diesem schönen Haus in Blankenese, zusammen mit ihrem Kapitän und dreißig Katzen. Die hat man ihr über die Jahre zum Einschläfern angeschleppt, weil sie vielleicht mal ins Bett pissten oder einfach nur lästig wurden. Sie hat alle gerettet. Jetzt streunen sie in kleinen Trupps friedlich durch ihren Garten und gehen unzähligen, geheimnisvollen Beschäftigungen nach, die den Tag einer Katze ausfüllen.
Dr. Teerling reichte ein einziger Blick auf den Hund, als wir kamen. Sie ließ uns gleich vor. Ich glaube, sie erkannte mich wieder. Sie sagte aber nichts, musterte uns nur scharf und ließ den Hund in den kleinen OP tragen. Wir sollten warten. Im Wartezimmer fummelte mein Vater einen Hunderter aus seinem Portemonnaie.
«Wird was kosten», knurrte er und reichte mir den Schein. «Ich muss zurück zum Boot. Wenn’s mehr kostet, gib unsere Adresse an und sag, dass du’s morgen bringst, klar?»
«Klar», sagte ich.
«Klar», nickte Alex.
Mein Vater musterte uns beide mit einem komischen Blick, zog die Augenbrauen hoch und schüttelte den Kopf. «Wenigstens hat’s aufgehört zu regnen», brummte er. Aber ich glaube, er meinte etwas anderes.
Es dauerte ziemlich lange, bis wir Frau Dr. Teerling wieder zu sehen bekamen. Die anderen Leute im Wartezimmer, die ihre Kaninchen streichelten, mit den Katzen und Pudeln tuschelten, schickten uns schon wütende Blicke zu. Dann kam sie endlich aus ihrem Sprechzimmer und winkte uns herein. Otto, der damals noch nicht Otto hieß, lag regungslos auf einem Operationstisch aus Edelstahl mit so einem Ablauf fürs Blut. Große Druckpflaster klebten über den Wunden, als hielten nur die noch den zerschundenen Hundekörper zusammen. Aus einem Infusionstropf lief eine klare Flüssigkeit durch einen Schlauch unter sein weißes Fell und beulte es an der Einstichstelle leicht aus. Ich starrte die ganze Zeit dorthin und kriegte einen schleimigen Geschmack im Mund.
«Wem gehört der Hund?», fragte Dr. Teerling scharf. Alex und ich schauten uns kurz an und zuckten mit den Achseln.
«Wir haben ihn aus der Elbe gefischt», sagte Alex. «Gerade vorhin.»
«Aus der Elbe?», wiederholte Dr. Teerling, als hätte Alex gesagt: vom Mars.
«Er schwamm da», ergänzte ich überflüssigerweise. «Wär fast ertrunken.»
«So», sagte sie bloß.
«Was ist denn mit ihm?», traute sich jetzt Alex.
Frau Dr. Teerling überhörte die Frage. «Und ihr wisst nicht, wem der Hund gehört?», hakte sie nach. Wir schüttelten den Kopf und erklärten, wie wir ihn gefunden hatten.
«Verstehe», sagte sie, und es war klar, dass sie nicht verstand und uns auch kein Wort glaubte. «Na, wie auch immer. Ihr habt ihn in letzter Sekunde gebracht. Der Bursche ist völlig entkräftet. Er hatte Wasser in der Lunge, und nach den Bisswunden zu urteilen, ist ein ganzes Wolfsrudel über ihn hergefallen. Ein Wunder, dass er überlebt hat.»
«Und was wird jetzt mit ihm?», fragte ich.
«Er bleibt hier», erklärte sie. «Eine Woche mindestens. Falls er dann auf dem Damm ist und sich kein Besitzer gemeldet hat, könnt ihr ihn mitnehmen.»
«Und wenn wir ihn nicht nehmen?», fragte Alex.
«Kommt er ins Tierheim.»
Alex warf mir einen Blick zu, und ich schielte wieder auf die Beule unter dem Fell des Hundes. Ich dachte an meine Mutter, an ihren Husten, an die ewig geschlossenen Scheiben bei uns zu Hause und an das, was mein Vater jedes Mal zum Thema Hund sagte. Er sagte nicht viel, bloß Nein. Und wenn mein Vater Nein sagte, brauchte man es gar nicht erst weiter zu versuchen, diese Art von Nein war das. Außerdem handelte es sich hier immer noch um einen Bullterrier. Einen Kampfhund. Eine eiskalte Killermaschine, also eine Rasse, die nicht lange fackelte mit Kindern und Dackeln. Dachte ich damals. Also schüttelte ich den Kopf.
«Bei mir geht’s nicht», sagte ich.
Frau Dr. Teerling musterte uns beide sehr scharf. «Also seid ihr gar keine Brüder!»
Ich spürte den zusammengepressten Geldschein wieder in meiner Hand und hielt ihr den Hunderter hin. «Reicht das?», fragte ich.