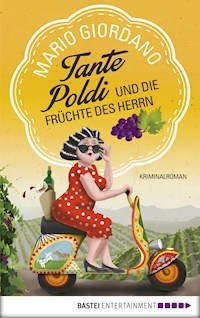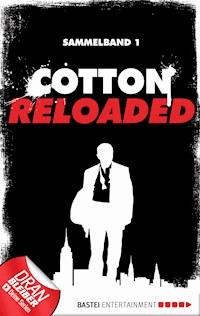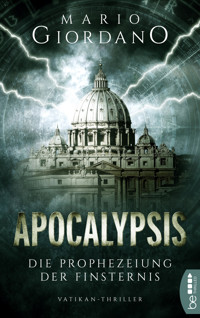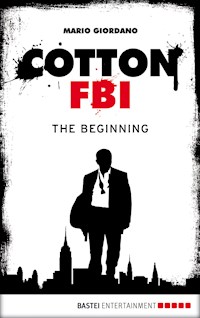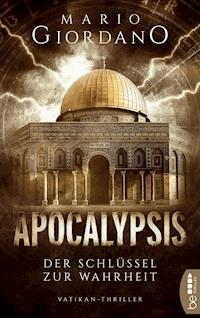
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Ein Peter-Adam-Thriller
- Sprache: Deutsch
Die Welt zwischen zwei Feuern! Rasanter Abschluss der Apocalypsis-Trilogie
Die Welt steht am Rande des Untergangs. Peter Adam hat apokalyptische Visionen. Als seine Frau und seine kleine Tochter Maya bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommen, eröffnet ihm sein Bruder Nikolas, dass ihr Tod im Zusammenhang mit den Aktivitäten eines okkulten Ordens steht. Zu spät erkennt Peter, dass er der Schlüssel zu allem ist. Dass er das Böse längst entfesselt hat. Und dass nur er das Ende der Welt noch aufhalten kann ...
"Letzter Teil einer sensationellen Trilogie, die an Spannung wohl kaum zu übertreffen ist." Frankfurter Stadtkurier
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 676
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Weitere Titel von Mario Giordano
Apocalypsis-Trilogie (auch als Hörbuch-Download erhältlich):
Band 1: Apocalypsis – Die Prophezeiung der Finsternis
Band 2: Apocalypsis – Das Ende der Zeit
Tante-Poldi-Reihe (auch als Hörbuch/Hörbuch-Download erhältlich):
Band 1: Tante Poldi und die sizilianischen Löwen
Band 2: Tante Poldi und die Früchte des Herrn
Band 3: Tante Poldi und der schöne Antonio
Weitere Titel in Planung.
Cotton Reloaded – Der Beginn (auch als Hörbuch-Download erhältlich)
Die Serie
Ein packender Vatikanthriller für alle Fans von Dan Brown und Thomas Gifford
»Apocalypsis« ist die erfolgreiche Vatikanthriller-Trilogie von Mario Giordano, die den Leser tief in die Verschwörungen des Vatikans und der Mächtigen dieser Welt entführt – bis hin zur alles entscheidenden Schlacht zwischen Gut und Böse.
Über dieses Buch
Die Welt zwischen zwei Feuern! Rasanter Abschluss der Apocalypsis-Trilogie
Die Welt steht am Rande des Untergangs. Peter Adam hat apokalyptische Visionen. Als seine Frau und seine kleine Tochter Maya bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommen, eröffnet ihm sein Bruder Nikolas, dass ihr Tod im Zusammenhang mit den Aktivitäten eines okkulten Ordens steht. Zu spät erkennt Peter, dass er der Schlüssel zu allem ist. Dass er das Böse längst entfesselt hat. Und dass nur er das Ende der Welt noch aufhalten kann …
Über den Autor
Mario Giordano, geboren 1963 in München, schreibt erfolgreich Romane wie die Apocalypsis-Trilogie oder die humorvolle Krimi-Reihe um Tante Poldi, aber auch Kinder- und Jugendbücher sowie Drehbücher (u.a. Tatort, Schimanski, Polizeiruf 110, Das Experiment). Giordano lebt in Berlin.
Mario Giordano
Der Schlüssel zur Wahrheit
Vatikan-Thriller
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2013 Bastei Lübbe AG, Köln
Plot und Text: Mario Giordano
Redaktion: Henrike Heiland
Projektmanagement/Lektorat: Diana Rosslenbroich
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven © shutterstock: ZRyzner | agsandrew | Peangdao | michelangeloop
Artwork: © Dino Franke, Hajo Müller
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-6350-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Bitte beachten Sie auch:
www.facebook.com/apocalypsis.de
INHALT
Episode 1 ♦ ENDE
Episode 2 ♦ POINT NEMO
Episode 3 ♦ DER PLAN
Episode 4 ♦ MAYA
Episode 5 ♦ KLEOPHAS
Episode 6 ♦ TESSERAKT
Episode 7 ♦ WANDLUNG
Episode 8 ♦ ORIXÁS
Episode 9 ♦ ARCHE
Episode 10 ♦ DIE REINEN ORTE
Episode 11 ♦ DIE BOTSCHAFT
Episode 12 ♦ HARMAGEDON
I
17. Juli 2011, Jerusalem
Dies war das Ende, kein Zweifel. Die Prophezeiung des Malachias hatte sich erfüllt. Dies war das Ende des Papsttums, das Ende der römisch-katholischen Kirche, möglicherweise der Anfang vom Ende des gesamten Christentums. In jedem Fall das Ende einer ganzen Weltordnung. Diese Gewissheit, drückend und dunkel wie ein Ozean, verdichtete sich mit jedem weiteren Schuss, den der Papst auf seinen Privatsekretär abfeuerte.
Auf dem Petersplatz.
Vor den Augen der Welt.
Mit jedem Schuss wurde der Riss, der durch die Welt ging, tiefer. Blieb nur die Frage, ob dieser Mord auch das Ende der Apokalypse markierte – oder ihre Vollendung.
Aber was auch immer nun alles enden würde, Franz Laurenz wandte den Kopf weder ab, noch schlug er wie seine Tochter Maria die Hände vors Gesicht. Er starrte einfach weiter auf die riesige Monitorwand vor sich, sah Edward Kelly zusammenbrechen, seinen Kopf aufplatzen und sein Blut über die Bühne und auf die Messgewänder der Diakone ringsum spritzen. Den Mann, der wer weiß wie viele Jahrhunderte gelebt hatte, die Inkarnation des Bösen, die rechte Hand Satans. Franz Laurenz sah, wie Kelly starb und wie Papst Petrus II. die Waffe anschließend in aller Ruhe auf dem Altar ablegte. Eine blasphemische und obszöne Geste, bei der Laurenz zum ersten Mal übel wurde. Er stöhnte auf, wie unter einem dumpfen Schmerz, der nie wieder vergehen würde. Dennoch wandte Laurenz den Blick nicht ab, sah weiter zu, wie sich nach dem ersten Schock nun eine Welle aus Panik und Bestürzung unter den Diakonen, Ministranten und Chorknaben um den Papst herum ausbreitete, immer größer wurde, über den Petersplatz raste und die Tausenden von Gläubigen ergriff. Laurenz hörte sie wie aus einem Mund aufschreien und stellte sich vor, dass mit ihnen gerade Millionen von Menschen an den Fernsehern ebenso aufschrien. Die ganze Welt schrie auf. Die Stimme des italienischen Kommentators überschlug sich und brach immer wieder ab. Zwei Schweizergardisten warfen sich auf den Papst und drückten ihn zu Boden.
Erst da wandte sich Franz Laurenz um. Keiner der Anwesenden in der bunkerartigen Kommunikationszentrale sprach, niemand schrie. Sie alle starrten nur fassungslos auf das Geschehen, das immer noch live übertragen wurde. Wenige Minuten zuvor hatte Laurenz Yoko Tanaka gebeten, die Liveübertragung der Messe, die der Papst auf dem Petersdom zelebrierte, auf die Monitorwand zu legen. Franz Laurenz war neugierig gewesen, mit welcher Botschaft an die Gläubigen in aller Welt der Papst sein langes Schweigen endlich brechen wollte. Nach den Ereignissen auf Oak Island hatte er sogar eine heimliche Botschaft an ihn persönlich erwartet. Alles. Nur keinen Mord.
Neben ihm riss sich auch Maria von den Fernsehbildern los und wandte sich ihm zu.
»Sag mir, dass das nicht wahr ist, Papa«, flüsterte sie voller Entsetzen. Laurenz gab ihr keine Antwort. Er wusste es selbst nicht.
»Schalten Sie auf CNN!«, rief er in den Raum. »Auf jeden Nachrichtensender, den Sie kriegen können!«
Yoko Tanaka gab das Kommando an einen der Techniker weiter. Die Monitorwand flackerte kurz, teilte sich in viele kleine Bereiche und zeigte Augenblicke später die Programme der wichtigsten internationalen Fernsehsender. Überall die gleichen Bilder. Der Papst wurde inzwischen von den beiden Schweizergardisten und zwei Bodyguards der vatikanischen Gendarmerie weggeführt. Laurenz konnte Oberst Res Steiner in der Menge erkennen, den Kommandanten der Garde und Nachfolger von Urs Bühler. Steiner versuchte zum Papst vorzudringen, geriet jedoch in eine Gruppe panischer Nonnen und kam nicht weiter, während seine Leute den Papst hastig hinter die Bühne brachten. Petrus II. hatte die Mitra verloren, ging aber aufrecht und ohne jede Gegenwehr. Kellys Leiche war in dem Getümmel nicht mehr zu sehen, das beunruhigte Laurenz. Überhaupt wirkte alles so, als versuchten die Gardisten, den Papst so schnell wie möglich aus der Gefahrenzone zu schaffen. Als sei er soeben Opfer eines Attentats geworden. Kein Wunder, dachte Laurenz, denn es gab kein Szenario für diesen Fall, die Gardisten und Gendarmen spulten nur ab, was sie immer wieder trainiert hatten.
Dann sah Laurenz, wie der Papst sich mit einem Ruck nach der Stelle umwandte, an der Kelly liegen musste. Als ob auch er sich noch einmal versichern wollte, dass er wirklich tot war.
»Geben Sie mir die Zentrale in Rom! Geben Sie mir Steiner!«, rief Laurenz, doch im selben Moment klingelte sein Handy. Eine israelische Nummer.
»Ja?«
»Kaplan hier. Haben Sie es schon gesehen?« Die Stimme des Großrabbiners von Jerusalem klang angespannt, aber erstaunlich beherrscht.
»Ja.«
»War das echt oder inszeniert?«
»Was soll die Frage, Kaplan?«
Der Großrabbiner schwieg einen Moment. »Nun, ehrlich gesagt frage ich mich gerade, ob Sie etwas damit zu tun haben. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber Sie waren mehrere Tage verschwunden. Dann fliegt in Nova Scotia eine ganze Insel in die Luft, Sie schicken mir diese junge Frau mit dem Amulett, die Frau wird kurz darauf ermordet. Wenige Tage später tauchen Sie in Jerusalem auf, ziehen sich aber sofort in einen Bunker ihres Freundes Nakashima zurück. Und nun dieser Mord oder was immer es war, der alles verändern wird, die ganze Welt. Verstehen Sie nicht, dass mich das misstrauisch macht? Es wäre nicht das erste Mal in der Geschichte, dass ein Papst nach Hegemonie strebt. Also frage ich Sie ganz konkret, Laurenz: Sind wir noch Verbündete im Kampf um den Erhalt unserer Religionen? Und damit meine ich, einschließlich des Islam.«
Laurenz zögerte kurz. Auf den Monitoren liefen immer noch die Livebilder vom Petersplatz. Die Menge der Gläubigen war in Aufruhr. Einige Sender zeigten Nahaufnahmen völlig verzweifelter Menschen, Nonnen in Schockstarre, Jugendliche, die in Schreikrämpfen am Boden zusammengebrochen waren, Tausende, die in blinder Panik vom Petersplatz flohen, Schweizergardisten und Gendarmen, die den Tatort absperrten.
»Ich war in letzter Zeit nicht ganz aufrichtig zu Ihnen, Kaplan«, sprach Laurenz leise weiter. »Dafür bitte ich Sie um Verzeihung. Ich werde Ihnen bald alles erklären. Im Augenblick aber bitte ich Sie einfach nur, mir zu vertrauen. Ohne Sie und auch ohne Mekka werde ich es nicht schaffen.«
Er hörte den Rabbiner ausatmen. »Nun gut«, sagte er schließlich. »Halten Sie mich auf dem Laufenden und passen Sie auf sich auf, mein Freund. Gott schütze Sie.«
Als Laurenz sein Handy wieder einsteckte, fühlte er sich etwas gefasster. Erst jetzt bemerkte er die Stille in dem Kommandoraum. Irgendjemand hatte den Ton der TV-Übertragungen abgeschaltet. Nur das Surren der Lüftung war noch zu hören. Maria, Yoko Tanaka, Pater Anselmo und sämtliche Mitarbeiter sahen ihn schweigend an, und Laurenz verstand in diesem Augenblick, was nun auf ihn zukam.
Dass er führen musste. Ob er wollte oder nicht.
Nakashimas Jerusalemer Lagezentrum lag abhörsicher und vor Angriffen geschützt tief im Untergeschoss einer Bank, die zum Nakashima-Konzern gehörte. Ein großer Kontrollraum aus nacktem Beton, diffus beleuchtet und an einer Seite beherrscht von der großen Monitorwand, die bis vor einer halben Stunde noch wechselnde Ausschnitte von Rom, Köln, Santiago de Compostela und Jerusalem gezeigt hatte, sowie Satellitenbilder und Drohnenaufnahmen der Laguneninsel Poveglia und der Île de Cuivre. Unter der Leitung von Yoko Tanaka filterte und analysierte hier ein Dutzend ausgesuchter Spezialisten in drei Schichten E-Mails, Tweets, Telefonate und Kurznachrichten aus der ganzen Welt. Von dem Kontrollraum zweigten ein gläserner Besprechungsraum, sanitäre Anlagen, eine kleine Kantine, ein Labor und eine medizinische Station ab. Eine private Geheimdienstzentrale mit High-Tech-Ausstattung, und alles nur, um eine Spur von Peter, Nikolas, Seth und den Trägern des Lichts zu finden. Und dem Amulett mit dem Kupferzeichen, das seit Marina Biharis Tod verschwunden war. Nakashima selbst erholte sich an einem geheimen Ort von der Schussverletzung durch Kelly auf Oak Island. Laurenz hatte ihn seit jenem Tag nicht mehr gesehen.
Im Augenblick dachte er aber nicht an Nakashima, sondern wandte sich an den blassen jungen Jesuiten in dem verwaschenen T-Shirt, der neben Maria stand.
»Pater Anselmo, nehmen Sie Kontakt mit unseren Leuten im Vatikan auf. Wir brauchen eine Bestätigung, dass es sich bei dem Toten wirklich um Kelly handelt. Haben Sie Oberst Steiner erreicht?«
»Negativ, Meister, aber ich versuche es weiter.« Pater Anselmo verwendete die Anrede »Meister« inzwischen so selbstverständlich wie jedes andere Mitglied des Ordens vom Heiligen Schwert, und zeigte damit, dass er nun Teil eines jahrhundertealten Geheimbundes innerhalb der Kirche war, hervorgegangen aus dem Templerorden und mit dem einen Ziel, das verlorene Geheimnis der Templer wiederzufinden und nicht in die Hände jener zweiten Splittergruppe fallen zu lassen, die sich »Träger des Lichts« nannte.
»Ich brauche eine Verbindung zu Nakashima San«, wandte sich Laurenz danach an Yoko Tanaka.
»Ich fürchte …«
»Versuchen Sie es«, schnitt ihr Laurenz das Wort ab. »Jetzt, sofort. Bitte.«
»Was hast du vor?«, fragte Maria.
»Uns einen Überblick über die Lage verschaffen.«
Es sollte zuversichtlich klingen. Klang es aber nicht. Laurenz spürte, wie Schock und Angst ihn nun unaufhaltsam erreichten. Maria offenbar auch, denn ohne ein weiteres Wort trat sie auf ihn zu, umarmte ihn, hielt ihn fest, als drohe er, gleich umzufallen. Laurenz spürte ihre verbundene linke Hand an seinem Rücken, erwiderte die Umarmung seiner Tochter, drückte sie mit beiden Händen fest an sich und atmete den Duft ihres Haars.
»Vergib mir«, flüsterte er. »Dass ich dich in all das hineingezogen habe. Dass ich dir kein besserer Vater war.«
»Halt die Klappe und halt mich fest, Papa«, nuschelte sie zurück. Und das tat er. Einen Moment lang. Eine Ewigkeit.
Bis Yoko Tanakas Stimme ihn in die Realität zurückrief.
»Nakashima San für Sie, Herr Laurenz.«
Laurenz löste sich von Maria und küsste sie auf die Stirn. »Du musst Shimon Kohn finden. Das ist jetzt deine einzige Aufgabe.«
»Und was ist mit Peter?«
Laurenz überlegte kurz, ob er ihr endlich von der Nachricht erzählen sollte, die er in den losen Dokumenten und Pergamenten gefunden hatte, die zusammen das Buch Dzyan bildeten. Jenes uralte hermetische Werk, geschrieben in einer unbekannten Schrift, das plötzlich vollständig übersetzt auf seinem Schreibtisch gelegen hatte, zusammen mit dieser Nachricht von Peter Adam, dessen Tod er selbst hatte mit ansehen müssen.
»Es wird nicht leichter, wenn du dir etwas vormachst, Maria.«
»Er lebt!«, widersprach Maria heftig. »Dieses Wesen in der Grube auf Oak Island hat mir versichert, dass er lebt.«
Laurenz lächelte seine Tochter an und strich ihr übers Haar wie einem Kind. »Finde Shimon Kohn. Dann wirst du auch Peter finden.«
Er wandte sich um. Die Gestalt von Satoshi Nakashima beherrschte überlebensgroß die Monitorwand. Er saß in einem Rollstuhl und trug einen schlichten grauen Pyjama. Am Hintergrund konnte Laurenz erkennen, dass Nakashima aus einem im traditionellen japanischen Stil eingerichteten Salon sprach. Die künstliche Beleuchtung des Raumes deutete auf späten Abend hin. Laurenz vermutete daher, dass sich der Multimilliardär inzwischen wieder auf der Insel Kochinoerabu im Ostchinesischen Meer befand.
»Herr Laurenz«, begrüßte ihn Nakashima. Er sprach langsam und schleppend, offenbar bereitete ihm der Lungendurchschuss immer noch Schmerzen. »Ich habe es gerade erfahren.«
»Wie geht es Ihnen, Mr. Nakashima?«
»Es könnte besser gehen. Aber danke, ich bin in guten Händen. Also, was schlagen Sie nun vor?«
»Als Erstes müssen wir Gewissheit bekommen, ob Kelly wirklich tot ist. Unsere Leute arbeiten daran, aber wir könnten Unterstützung gebrauchen.«
Nakashima nickte. »Dr. Tanaka wird alles veranlassen. Und weiter?«
Laurenz warf Maria einen kurzen Blick zu. »Ich muss zurück nach Rom.«
»Das ist lebensgefährlich.«
»Vielleicht kann ich noch retten, was zu retten ist.«
»Das heißt, Sie begrüßen die Situation?«
»Herrgott, Nakashima! Meine Kirche steht seit einer knappen halben Stunde vor dem Untergang. Was sollte ich daran wohl begrüßen?«
Nakashima schien nachzudenken.
»Was wird nun passieren? Wird man den Papst wegen Mordes anklagen? Kommt er in Haft?«
»Das ist eine sehr komplizierte Situation, die es in der Geschichte des Papsttums noch nie gegeben hat«, erklärte Laurenz. »Daher gibt es auch kein Verfahren für diesen Fall. Als Staatsoberhaupt des Vatikans genießt der Papst absolute Immunität. Gleichzeitig ist er oberster Richter des Vatikanstaates. Da der Mord auf dem Territorium des Vatikans verübt wurde, wäre er allein zuständig. Er müsste sozusagen über sich selbst richten. Das geht aber nicht, da er immun ist. Ein Prozess ist nur möglich, wenn er zurücktritt und sich freiwillig den italienischen Behörden stellt. Nur dann. Aber das allein wäre schon ein kanonischer Albtraum.«
»Wollen Sie damit sagen, dass die Unfehlbarkeit des Papstes sogar einen Mord abdeckt?«
»Natürlich nicht. Das Dogma der Unfehlbarkeit bezieht sich nur auf Äußerungen des Papstes ex cathedra, also aus seinem Amt heraus. Aber nicht auf die Person des Papstes, die natürlich genauso fehlbar ist wie jeder andere Mensch. Aber auf dem Staatsgebiet des Vatikans ist der Papst eben absoluter Souverän. Der letzte absolute Monarch, wenn Sie so wollen. Selbst bei Mord – ohne seinen Rücktritt kann nicht über ihn gerichtet werden.«
»Und wenn er sich weigert zurückzutreten?«
Laurenz atmete durch. »Dann hat Seth sein Ziel erreicht.«
Nakashima schwieg. Ließ den Blick aber nicht von Laurenz.
Laurenz ahnte, was er gleich sagen würde.
»Erinnern Sie sich noch an meinen letzten Vorschlag, Laurenz?«
»Vergessen Sie’s! Ich kann, ich will und ich werde nicht wieder Papst werden. Selbst wenn Petrus II. zurücktritt, selbst wenn ein neues Konklave mich wählen würde – falls der zurückgetretene Papst, der dann in italienischer Untersuchungshaft seinem Prozess entgegensieht, alles widerruft und sein Amt zurückfordert …«
»Das Gleiche könnten Sie tun, Laurenz!«
»… dann würde das unweigerlich zu einem Schisma führen, einer Teilung der Kirche. Ihr Vorschlag ist blanker Unsinn, so wird es nicht ablaufen.«
»Aber dieses Problem, das Sie da skizzieren, würde es mit jedem anderen neuen Papst doch ebenfalls geben.«
Laurenz nickte. »Und Petrus II. weiß das. Er kennt den Vatikan. Er hat diesen Mord offenbar geplant, also weiß er auch, was nun auf ihn zukommt. Sie werden ihm Druck machen, umgehend zurückzutreten, unglaublichen Druck, der gesamte kuriale Apparat. Aber selbst wenn er zurücktritt, kann er sich seines Lebens nicht mehr sicher sein. Wenn’s drauf ankommt, ist der Vatikan nie zimperlich.«
»Ich verstehe. Sie spielen auf Johannes Paul I. an. Den Dreißigtagepapst. Aber was wäre daran so furchtbar? Petrus II. war Seths Handlanger. Er hätte den Tod verdient. All unsere Probleme wären gelöst.«
Laurenz schüttelte heftig den Kopf. »Er war mein Freund«, sagte er fest. »Was auch immer aus ihm geworden ist, er war mein Freund, und er ist Teil der Gnade Gottes. Ich muss nach Rom, um das Leben meines Freundes zu retten.«
»Und wenn das alles nur eine Show war? Eine Falle, um Sie nach Rom zu locken und dann zu töten?«
Laurenz nickte. Er hatte die Frage erwartet. »Deswegen wollte ich Sie sprechen.«
II
Transskript der Sitzung mit P.A. vom 20.8.2013
P.A. ist 35 J., männl., weiß, Collegedozent, sportl. Ersch. Verh., 1 Kind. Deutscher, lebt aber seit 15 J. in den USA. Kein org. Befund, keine psych. Auff. in der Fam., keine regelm. Med., P.A. wirkt ruhig & orientiert, gute Ausdrucksf. Leichte Müdigkeitsersch. während der Sitzung. Gibt an, seit einigen Wochen unter Albtr. zu leiden.
»Stört es Sie, wenn ich unser Gespräch aufzeichne, Peter?«
»Nein, überhaupt nicht.«
»Ist nur für meine Notizen.«
»Wirklich kein Problem, Dr. White.«
»Nennen Sie mich Bob. Also … Wie lange haben Sie diese Träume schon?«
»Seit ein paar Wochen … Bob.«
»Was, denken Sie, könnte diese Träume ausgelöst haben?«
»Keine Ahnung. Es gab keinen Vorfall oder so, wenn Sie das meinen. Sie waren plötzlich da. Sehr plastisch und immer wieder die gleichen.«
»Sprechen Sie mit Ihrer Familie darüber?«
»Meine Frau hat mich zu Ihnen geschickt.«
»Nun, dann erzählen Sie mal.«
»Ich weiß nicht genau, wo ich anfangen soll. Es ist alles so verwirrend. Also … Ich bin Journalist, in meinen Träumen, meine ich. Ich arbeite für ein deutsches Online-Nachrichtenmagazin, aber ich lebe in Rom. Ich berichte aus dem Vatikan über den Rücktritt des Papstes.«
»Sie meinen Benedikt XVI.? Der im Februar zurückgetreten ist?«
»Nein, nicht Ratzinger. Der Papst in meinen Träumen ist jünger, zwar ebenfalls Deutscher, aber er heißt Johannes Paul III. Nach seinem Rücktritt ist er spurlos verschwunden. Also mache ich mich auf die Suche nach ihm. Danach geht alles ziemlich durcheinander.«
»Erzählen Sie mir einfach, was Ihnen einfällt.«
»Der Petersdom und die Sixtinische Kapelle fliegen in die Luft.«
»Ein Anschlag?«
»Ja. Ich renne durch irgendwelche Katakomben und entschärfe eine Bombe nach der anderen. Diese Bomben sind sehr klein und strahlen ein bläuliches Licht aus. Aber die letzte Bombe befindet sich in meiner linken Hand. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Da hackt der zurückgetretene Papst mir die linke Hand mit einem Säbel ab, um mein Leben zu retten.«
»Aha. Also haben Sie den Papst gefunden.«
»Muss wohl, die Zusammenhänge sind mir nicht klar. Der Papst hat eine Tochter, Maria. Sie begleitet mich bei meiner Suche.«
»Oh. Der Papst hat eine Tochter?«
»Ja. Nun. Im Traum.«
»Erinnert Maria Sie an jemanden aus Ihrem Leben?«
»Nein. Sie ist auch ganz anders als Ellen. Brünett, grüne Augen. Und sie ist eine Nonne.«
»Sind Sie katholisch, Peter?«
»Gewesen. Ich bin mit vierundzwanzig aus der Kirche ausgetreten. Ich bin Atheist.«
»Dennoch träumen Sie vom Papst. Und er hat auch noch eine Tochter – die auch noch Nonne ist.«
»Ich weiß, es ist grotesk. Er hat sogar eine Frau.«
»Wie lange sind Sie jetzt mit Ihrer Frau zusammen, Peter?«
»Dreizehn Jahre. Wir sind immer noch sehr glücklich, wenn Sie das meinen, Bob.«
»Hatten Sie Affären?«
»Eine kurze vor acht Jahren. Aber das haben wir überstanden.«
»Schlafen Sie mit Maria in Ihren Träumen?«
»Ja. Ein Mal. Bei meinen Eltern. Adoptiveltern.«
»Was ist mit Ihren leiblichen Eltern?«
»Ein okkulter Orden hat sie getötet, als ich klein war. Das finde ich heraus. Dieser Orden hat auch die Bomben unter dem Vatikan platziert. Er ist sehr mächtig. Sein Anführer heißt … Seth.«
»Was finden Sie noch heraus?«
»Seth hat viele Namen. Aleister Crowley, Raymond Creutzfeldt … Er plant, den Vatikan zu vernichten und eine Art Weltherrschaft zu errichten. Aber dazu sucht er nach einem uralten Geheimnis, dem Schatz der Templer. Er vermutet den Schlüssel dazu im Vatikan.«
»Das finden Sie und Maria heraus.«
»Ja. Es geht um … Amulette. Ah, verdammt …«
P.A. reibt sich die Schläfe.
»Alles in Ordnung, Peter? Haben Sie Kopfschmerzen?«
»Es geht schon, danke … Ich weiß, das klingt so unglaublich bizarr und krude.«
»Es sind Träume. So wirr sie uns manchmal erscheinen, bergen sie doch oft einen sehr einfachen Sinn.«
»Sinn? Was für ein Sinn sollte in diesen Träumen stecken, die absolut nichts mit meinem Leben zu tun haben!?«
»Wir werden sehen. Aber bitte fahren Sie fort. Sie sprachen von Amuletten. Können Sie die beschreiben?«
»Ja. Ich sehe sie immer sehr deutlich vor mir. Es sind neun. Sie sehen aus wie Perlenketten aus einem schimmernden, blauen Material. Mit einem kleinen, blauen Medaillon. Auf der Vorderseite ist immer jeweils ein Symbol eingraviert. Manchmal auch auf der Rückseite.«
»Könnten Sie die Symbole zeichnen?«
»Ja.«
P.A. zeichnet Symbole auf.
»Inzwischen kann ich sie auswendig.«
»Verstehen Sie diese Symbole?«
»Einige. Ich habe ein wenig recherchiert. Dieses da, zum Beispiel, ist das alchemistische Zeichen für Kupfer. Bedeutet aber auch Licht. Das da ist das alchemistische Zeichen für den Stein der Weisen. Die letzten, das sind henochische Schriftzeichen. Angeblich die Sprache der Engel, wie ein englischer Alchemist des 16. Jahrhunderts herausgefunden haben will. In meinen Träumen spreche ich Henochisch. Es ist die Sprache dieses okkulten Ordens.«
»Also sind Sie Teil dieses Ordens?«
»Nein, aber mein Zwillingsbruder Nikolas. Er ist ein Killer im Auftrag dieses Ordens. Wir wurden als Kinder getrennt. Als wir uns wiederbegegnen, will er mich erst töten. Aber dann kriegt er Skrupel. Er rettet mir das Leben durch einen Körpertausch. … Hören Sie, je mehr ich darüber spreche, desto absurder klingt das alles für mich!«
»Bleiben Sie einfach ganz ruhig, Peter. Haben Sie denn einen Bruder?«
»Ja, natürlich. Nikolas gibt es wirklich.«
»Und wie ist Ihr Verhältnis zueinander?«
»Sehr gut. Wir haben früher immer alles zusammen gemacht, wir waren unzertrennlich. Zwillinge eben.«
»Sie sagen: waren. Was ist passiert?«
»Nichts Besonderes. Ich ging in die USA, um zu studieren, er wurde Priester. Er lebt heute in Rom, ist aber viel unterwegs. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was er eigentlich macht.«
»Haben Sie ihm von diesen Träumen erzählt?«
P.A. antwortet nicht, starrt nur zu Boden.
»Peter?«
»Nein. Wir haben nur noch wenig Kontakt.«
»Vielleicht hätte er ja eine Erklärung.«
»Sie meinen, unsere Eltern haben uns missbraucht oder so?«
»Nein, ich meine, dass es bei Zwillingen die faszinierendsten Phänomene gibt.«
»Faszinierend, verstehe. Ich bin ein klasse Fall, was, Bob? So richtig schön kaputt. Und dann noch Zwillinge, das könnten Sie publizieren.«
P.A. massiert sich wieder die Schläfen, stöhnt.
»Beruhigen Sie sich, Peter. Ganz ruhig. Es geht hier nur um Sie. Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Möglich, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Möglich, dass Sie unter einer echten Psychose leiden. Aber das werden wir herausfinden. Vertrauen Sie mir, Peter?«
»Ja. Ja, klar, Doc … Bob. Tut mir leid, wenn ich ausfallend geworden bin.«
»Was geschieht sonst noch in Ihren Träumen?«
»Nachdem der Petersdom explodiert ist, wird der Chef-Exorzist des Vatikans neuer Papst.«
»Sie meinen Franziskus I.?«
»Nein, nein! Er nennt sich Petrus II. Er gehört zu diesem okkulten Orden. Edward Kelly wird sein Privatsekretär, aber den erschießt er später.«
»Wer ist Edward Kelly?«
»Der Assistent von John Dee, diesem englischen Alchemisten. Kelly ist über fünfhundert Jahre alt. Er tötet Ellen … meine Frau … in einer Wüste. Ich treffe ihn später auf einer kleinen Insel im Mittelmeer wieder. Er wirkt vollkommen wahnsinnig.«
»Was ist mit Ihrer Tochter? Sie haben doch eine Tochter, nicht wahr? Kommt sie auch in Ihren Träumen vor?«
»Nein. Maya sehe ich nie. Wie gesagt, Ellen wird ja von Kelly ermordet. Und Kelly versucht auch, Nikolas und mich zu töten.«
P.A. schweigt wieder, wirkt erschöpft.
»Wollen wir Schluss machen, Peter?«
»Danke, es geht schon.«
»Was passiert sonst noch?«
»Die Hölle bricht aus. Es beginnt im Kölner Dom. Die Erde reißt auf, überall ist Feuer, Menschen verbrennen bei lebendigem Leib. Aber es passiert auch noch an anderen Orten. Das Böse hat Jahrtausende geschlafen, aber nun bricht es über die Welt herein.«
»Sie sagen ›das Böse‹. Aber ist dieses Böse nicht schon längst in der Welt? Ich meine, wenn wir uns die Welt so ansehen.«
»Ich kann es Ihnen nicht erklären. In meinen Träumen ist das, was wir als ›das Böse‹ bezeichnen, nur der Atem eines großen Wesens, das tief unter der Erde lebt. Es ist uralt. Es schläft. Und nun erwacht es, und die Apokalypse beginnt. Wir haben es nicht verhindern können.«
»Wer ist wir?«
»Der ehemalige Papst, Maria und ein Schweizer namens Bühler. Und ein japanischer Milliardär namens Nakashima. Durch ihn erhalte ich eine bionische linke Hand. Es ist nicht klar, auf wessen Seite er steht. Er unterstützt den Ex-Papst, aber er macht auch Deals mit Seth.«
»Es ist sehr ungewöhnlich, dass Sie sich an Namen aus Ihren Träumen erinnern. Überhaupt ist es sehr ungewöhnlich, wie detailreich Sie sich an Ihre Träume erinnern.«
»Glauben Sie, ich denke mir das alles aus?«
»Nein, natürlich nicht. Ich will damit nur sagen, es ist, nun, ungewöhnlich. Die meisten Menschen vergessen ihre Träume gleich nach dem Aufwachen. Zurück bleibt oft nur ein diffuses Unbehagen.«
»Diese Träume sind das Schlimmste, was ich je erlebt habe! Aber vielleicht sollte ich besser gehen.«
P.A. erhebt sich.
»Nein, ich bitte Sie. Ehrlich gesagt bin ich neugierig, was Sie sonst noch träumen.«
P.A. lacht und setzt sich wieder.
»Was ist mit Gott?«
»Was soll mit ihm sein?«
»Wo ist Gott in Ihren Träumen? Ich meine, Sie träumen von einem Papst, vom Vatikan, Sie schlafen mit einer Nonne, dann gibt es dieses Böse – da frage ich mich doch, wo ist Gott?«
»Ich träume nicht von Gott … Nein, warten Sie … Doch. Aber ich würde es nicht Gott nennen. Eher einen Zustand der … Gnade.«
P.A. schließt die Augen, konzentriert sich.
»Ich bin mit Nikolas in Nepal. Ein Höhlenlabyrinth. Dort hat dieser Orden sein Zentrum. Ich suche Maria und finde sie in einer Höhle. Aber sie ist eine andere. Sie ist besessen. Seth spricht aus ihr. Neben ihr ist irgendetwas. Ein riesiger, faseriger Kokon. Etwas Furchtbares verpuppt sich darin. Der Satan. Ich weiß es genau, und er spricht aus Maria heraus. Wir schlafen wieder miteinander, aber als ich aufwache, ist sie fort. Ich will diesen Kokon zerstören. Nikolas verhindert es. Wir finden einen geheimen Bereich im Zentrum des Ordens. Dort werden Klone von Nikolas und mir gezüchtet.«
»Zu welchem Zweck?«
»Es geht um ein uraltes tödliches DNA-Virus, mit dem Seth einen Großteil der Menschheit ausrotten will. Das ist es, wonach Seth die ganze Zeit sucht: die Büchse der Pandora. Und Nikolas und ich sind der Schlüssel, um all das zu aktivieren … Aber wir zerstören dieses Labor durch eine dieser kleinen blauen Bomben und werden dabei getötet. Auch der grauenhafte Kokon, in dem Seth sich verpuppt, wird zerstört.«
»Und danach wachen Sie auf?«
»Nein. Es geht weiter. Nikolas und ich sind nicht tot. Die Zeit hat nur angehalten, wir sind gefangen in der Zeit. Und um uns herum sind die Mh’u … Sie haben die Amulette geschaffen.«
»Und diese, wie sagten Sie … Mh’u sind Gott?«
»Nein. Aber sie leben schon seit Äonen in einem Zustand der Gnade und sind bemüht, ihn zu erhalten. Nikolas und ich werden älter. Wir übersetzen einen uralten hermetischen Text und hinterlassen Laurenz und Maria die Übersetzung zusammen mit einigen der Amulette. Sie müssen die Büchse der Pandora finden, bevor Seth sie findet.«
»Entschuldigen Sie, wenn ich Sie dauernd unterbreche. Sagten Sie nicht, dass Seth in diesem Kokon ebenfalls umgekommen ist?«
»Er wird zurückkommen. Es ist noch nicht vorbei. Deswegen will ich zurück. Aber ich bin in dieser eingefrorenen Zeit gefangen.«
»Warum wollen Sie diesen ›Zustand der Gnade‹, wie Sie ihn nennen, verlassen, Peter? Ist er denn nicht sehr angenehm?«
»Ich bin alt und einsam, und ich gehöre da nicht hin. Ich muss Maria helfen, die Apokalypse aufzuhalten. Nikolas und ich verstehen, dass es nur einen Weg gibt, diesen Zustand der Gnade zu verlassen: eine Eruption des Bösen. Also töte ich meinen Bruder. Im Vatikan. Mit einem Dolch.«
P.A. wirkt sichtlich erschüttert.
»Und dann?«
»Wache ich endlich auf.«
III
17. Juli 2011, Bawley Point, Australien
Wohin sie auch sah, war Dunkelheit. Vollkommene Dunkelheit, so tief und schwer wie der Anfang der Welt. Kein Licht, nirgendwo, kein Oben und Unten mehr. Kein Laut, selbst ihren Herzschlag spürte sie kaum noch, nur die Kälte, die allmählich durch den Neoprenanzug sickerte wie ein schleichendes Gift, und den Druck auf ihren Lungen. Dabei tauchte sie gar nicht tief, trieb nur dicht unter der Wasseroberfläche und ließ sich von der Dunkelheit einsaugen. Ganz und gar aufsaugen, verschlingen, verdauen. Das wär’s, dachte sie. Sich einfach im Meer auflösen wie Salz, vergehen, endlich Ruhe, Schluss mit den Träumen.
Mit gleichmäßigen Flossenschlägen bewegte sie sich weiter durch die vollkommene Schwärze des Südpazifiks und spürte, wie das Gewicht der Welt an ihr zog. Der kleine nächtliche Ausflug war nicht ganz ungefährlich. Obwohl es seit Ewigkeiten – nach Jims Zeitrechnung hieß das seit fast drei Monaten – keine Haiattacke mehr gegeben hatte, wimmelte das Meer nur so von den Biestern in allen Größen. Ganz zu schweigen von den Bluebottle-Quallen, die nachts gerne auch ins ufernahe wärmere Wasser zogen. Nicht so tödlich wie Würfelquallen, aber die winzigste Berührung mit einer ihrer Nesselfäden bedeutete schon zwanzig Minuten Agonie und einen lebenslangen allergischen Hautausschlag. Nicht zu vergessen die Stachelrochen, die sich zu Dutzenden in den kleinen Becken zwischen den Uferfelsen tummelten. Das Meer vor der Ostküste Australiens war ein gefährlicher Ort, überhaupt der ganze verdammte Kontinent. Und wenn die Tiere einen nicht vergifteten, besorgten es die Träume. Oh ja, die Träume. Man konnte verrückt werden, einfach verrückt. Nur hier, im vollkommenen Dunkel, herrschte Ruhe, schwiegen die Stimmen, erloschen die Bilder, die Rahel quälten, sie wach hielten und allmählich um den Verstand brachten.
Sie hatte immer noch genug Luft, bewegte sich nun mit kräftigen Stößen weiter durchs Wasser, allein wie in einem Universum kurz vor dem Urknall. An den Abgrund und die Schatten der Haie unter sich dachte sie nicht mehr, sie konzentrierte sich ganz auf die Bewegung ihrer Arme und Beine, die kräftig waren vom täglichen Sportprogramm und die Jim dennoch zu dürr fand. Aber Jim hatte auch an allem und jedem etwas herumzunörgeln. Sie wusste, dass er im Grunde drauf stand. Auf ihren durchtrainierten Körper ebenso wie auf ihre kleinen Brüste, auf ihre sonnenverbrannten Schultern und auf ihre Jugend. Nur auf ihre Bilder stand er nicht. Die Malerei war für Jim nicht mehr als ein peinliches Anhängsel einer ansonsten fast perfekten Beute. Denn das war sie: Jims Beute, ein kostbarer Fang, seine schillernde Sirene, die an Land austrocknete, sich die Füße blutig tanzte und vor seinen Augen zugrunde ging. Nur allzu bereitwillig hatte sie den Köder der sicheren Existenz geschluckt. Rahel Kannai war vierunddreißig Jahre alt und stand nun mal auf deutlich ältere Männer. Sie hatte eine Reihe von gleichaltrigen Liebhabern gehabt, darunter aber keine nennenswerten Beziehungen. Seit sie achtzehn war, hatte sie keine eigene Wohnung mehr gehabt, sie reiste viel, kam bei den Jims und Hanks und Bobs unter, die sie unterwegs auflasen wie einen niedlichen Straßenköter, dem man so lange Unterschlupf gewährt, bis er anfängt zu beißen und auf die teuren Teppiche zu pissen. Oder eine Abtreibung braucht. Freunde hatte sie keine.
Im ersten Jahr hatte Rahel sich noch eingeredet, dass Jim verrückt nach ihr war und alles für sie tun würde, sich die Haut in Streifen schneiden, durch einen Ozean aus Säure waten, zurück nach Sydney ziehen, einfach alles. Sogar noch ein Kind zu kriegen. Falsch gedacht. Jim hatte sie verschlungen und wieder ausgespuckt und dann mit einem Surfbrett dekoriert in ein Regal gestellt, wo seine Kumpels und ganz Bawley Point sie bewundern konnten, bis Jim irgendwann genug haben würde von ihren kleinen Brüsten, ihrem Farbgekleckse, ihren Aboriginefreunden, ihren spontanen tagelangen Ausflügen in den Busch und den Gerüchten im Ort. Und ihrer nächtlichen Sauferei, seit sie nicht mehr schlafen konnte.
Geboren in Tel Aviv, hatte sie den größten Teil ihres Lebens in Australien verbracht, die ersten Jahre in Darwin, dann Sydney. Ihre Eltern hatten Israel Ende der Achtziger verlassen, weil sie die Schnauze voll hatten von Autobomben, Intifada und Wirtschaftskrise. Rahels Mutter sowieso. Sie gehörte zur »Zweiten Generation«, den Kindern von Holocaustüberlebenden, die unter dem Trauma ihrer Eltern litten. Eine ängstliche, misstrauische Generation ohne Identität, die die Namen ihrer ermordeten Onkel und Tanten trug und die sich schuldig fühlte und vom Lager träumte, das sie nie erlebt hatte.
Für Rahels Mutter war Australien das reine Paradies gewesen – bis Rahels Träume begannen. Verstörende Träume von kleinen alltäglichen Dingen, die kurz darauf exakt so eintrafen. Ein Brand in einem Gemüseladen, ein entlaufener Hund, der plötzlich wieder auftauchte, ein Sandsturm, der Tod einer besonders streitsüchtigen Nachbarin. Rahels Mutter empfand die Gabe ihrer Tochter als Fluch und schickte die kleine Rahel zu verschiedenen Ärzten. Aber erst in der Pubertät verließen die Träume Rahel wie eine juckende Hautflechte, die sich unter dem Einfluss des jugendlichen Hormonsturms zurückzieht – um Jahre später nur umso heftiger wieder auszubrechen. Und so war es dann auch. Vor drei Jahren, nach ihrer zweiten Abtreibung, hatten die Träume wieder eingesetzt, schlimmer als je zuvor. Und Rahel machte das, was sie schon immer mit ihren Träumen gemacht hatte: Sie malte sie, vor allem die Wesen, die ihr jede Nacht erschienen. Sie hatte damals die Wahl zwischen einer Karriere als Leistungssportlerin oder der Kunst gehabt und sich fürs Malen entschieden. Wahrscheinlich ein Fehler, denn trotz eines abgeschlossenen Studiums an der National Art School in Sydney interessierte sich niemand für die Bilder einer Weißen, die wie eine Aborigine malte und ihre Gemälde obendrein üppig mit schleierhaften Engeln überlud. Im Grunde wusste Rahel selbst, dass sie esoterischen Kitsch malte. Der Bilderzyklus dagegen, den sie in den vergangenen Monaten gemalt hatte, war völlig anders. Diese Bilder waren gut, richtig gut, zum ersten Mal. Ihre Engel hatten sich verändert, hatten ihre Flügel verloren. Durchscheinende, große Wesen, die schweigend und abwesend über die Erde wanderten wie die Mimi, jene mythischen Geister der Aborigines, die nur bei Windstille jagen konnten, weil sie sonst zerbrechen würden. Rahels Geisterwesen jedoch waren kräftige, aufrecht gehende Echsen, genau wie in ihren Träumen. Rahel bezweifelte dennoch, dass irgendwer die Bilder ansprechend finden könnte. Sie würde niemals einen Galeristen finden, niemals einen Käufer. Im Augenblick lagerten sie eingeschlossen in einer Garage im Hafen, die Roy Graham ihr vermietet hatte. Rahel hatte sie bislang niemandem gezeigt, Jim schon gar nicht. Denn sie war fest davon überzeugt, dass diese Bilder, gut oder nicht, sie geradewegs in die Psychiatrie bringen oder umbringen würden. Falls sie überhaupt so lange durchhielt, was ihr mit jeder Nacht, die sie durchtrank, um nicht träumen zu müssen, unwahrscheinlicher erschien.
Im Augenblick war sie jedoch vollkommen nüchtern, fühlte sich klar und leer und rein wie lange nicht mehr. Sie ließ die störenden Gedanken an Jim und die Bilder los wie verfilztes Treibgut, das sich an ihrem Badeanzug verhakt hatte, entließ sie in die Dunkelheit, sah sie forttreiben und sich auflösen, und konzentrierte sich nur noch auf ihre Bewegungen und den Schlag ihres Herzens. Noch ein Stoß. Rahel spürte den Widerstand des Wassers. Irgendetwas streifte ihre Füße, aber das konnte eine Täuschung sein. Dunkelheit. Kein Oben und Unten. Noch ein Stoß.
Und dann hörte sie die Stimme. Und sah ins Licht.
Als der Druck auf den Lungen sich zu einem schmerzhaften Klumpen zusammenballte, legte sie den Kopf in den Nacken und stieß mit kräftigen Schwimmbewegungen durch die Wasseroberfläche – zurück in die salzige Novemberluft, zu den nicht allzu fernen Lichtern von Bawley Point am Ufer; zurück zu Fernsehen, Barbecues, Wirtschaftskrise, Zinkpaste, marodierenden Wallabys im Garten, zu viel Weißwein, dem ewig gleichen Bawley-Tratsch, zurück zu Jim und den Jungs und der Lüge, Künstlerin zu sein. Oder Sportlerin. Oder Jims Frau. Was zum Teufel auch immer, denn all das hatte nun keine Bedeutung mehr. Erschöpft und verwirrt zog Rahel sich auf das Surfbrett, mit dem sie die ganze Zeit über durch eine Fußleine verbunden gewesen war, und paddelte langsam zum Strand zurück, im Ohr immer noch das Wispern jenes Wesens aus der Tiefe.
Rahel fuhr nicht mehr nach Hause zu Jim und seinen Jungs. Mit schweren Beinen stapfte sie aus dem flachen Wasser, streifte sich den Neoprenanzug ab und ließ ihn einfach im Sand zurück wie eine alte, abgestorbene Haut. Ein Zeichen für Jim, dass sie nicht zurückkehren würde. Der Hilux parkte hinter den Dünen. Rahel zog sich hastig die Shorts und das T-Shirt über und fuhr zu ihrem Atelier im Hafen.
Halb drei. Kein Mensch auf der Straße. Die meisten Häuser gehörten ohnehin irgendwelchen reichen Familien aus Sydney und Brisbane, die nur den Sommer hier verbrachten. In einigen Wochen würden die Straßen und Vorgärten wieder voller SUVs, Motorboote, Surfbretter, Boogie-Boards und buntem Spielzeug sein; die Strände wundgetrampelt und die Luft erfüllt von Bratfett und Kokosöl. Jetzt aber, in dieser milden australischen Winternacht um halb drei, lag der Ort dunkel, leer und erstarrt vor ihr, wie ein Patient, den man in ein künstliches Koma versetzt hatte, um ihm die Schmerzen zu ersparen. Mit einem Mal wurde Rahel bewusst, wie sehr sie Bawley Point hasste.
Rahel parkte den Hilux an der kleinen Mole, schloss die Garage auf und kontrollierte die Schlösser und das Rolltor auf Einbruchsspuren. Nichts. Ohne Licht zu machen, ging Rahel direkt zu dem wackeligen Schreibtisch, den Roy ihr gönnerhaft überlassen hatte, und kramte in einer Schublade nach ihrem Pass und ihrem Portemonnaie mit den Kreditkarten. Als sie sich umdrehte, stand Jim vor ihr. Er roch nach Zigaretten und Wodka. Aber nicht zu viel Wodka. Im Gegensatz zu ihr verlor Jim niemals die Kontrolle. Er trank, aber er soff nicht.
»Wo warst du?«
»Schwimmen.«
»Um diese Uhrzeit? Verdammte Scheiße, Rahel, es ist mitten in der Nacht.«
»Konnte nicht schlafen.«
Sie wollte an ihm vorbei ins Freie treten, doch er hielt sie fest.
»Rahel!«
»Lass mich, Jim, ich bin müde.«
»Mein Gott, Rahel, was ist los mit dir? Jede Nacht bist du neuerdings weg, einfach verschwunden. Und den Tag verbringst du nur noch … hier. Hast du dich mal im Spiegel gesehen? Du siehst aus wie ein Gespenst. Isst du eigentlich noch was? Bist du auf Koks?«
»Ich schlafe mit keinem anderen, wenn du das meinst.«
»Nein, zum Henker, das meine ich nicht.«
»Sondern?«
Er zögerte, ließ sie endlich los, deutete mit einer Handbewegung, die ungewohnt schüchtern wirkte, auf die Bilder. »Ich hab sie mir kürzlich angesehen. Roy hatte noch einen Zweitschlüssel.«
Rahel starrte ihn an. »Du mieses Stück Scheiße.«
Kein Argument für ihn. Er zuckte bloß mit den Achseln. Jim betrachtete ohnehin alles und jeden in Bawley Point als sein Eigentum, sie eingeschlossen. Der König von Bawley kam und ging und nahm und verteilte und bezahlte seine Rechnungen und hurte herum, wie es ihm beliebte. Und wehe, einer muckte auf. Rahel hatte erlebt, wie er einen der Ranger aus dem Nationalpark fast mit dem Hilux überfahren hatte, nur weil der ihm untersagt hatte, eine alte Abkürzung durch den Busch zu nehmen.
»Diese Bilder …«, fuhr er angespannt fort, und sein massiger Körper zitterte leicht unter einem Schauer des Entsetzens und des Ekels. »Mein Gott, was geht bloß in deinem Kopf vor?! Du brauchst Hilfe, Rahel. Professionelle Hilfe.«
»Willst du damit sagen, ich bin krank?«
»Sobald es hell ist, fahren wir nach Sydney zu einem Spezialisten.«
Rahel hielt ihren Pass in der einen und ihr Portemonnaie in der anderen Hand. Keine Hand frei. Irgendwie das Symbol ihres Lebens, dachte sie kurz, nie eine Hand frei.
Es ist aus, Jim, wollte sie sagen, ich verlasse dich. Stattdessen aber nickte sie nur.
»Was immer du für richtig hältst, Jim. Ich bin einfach nur müde. Gib mir noch eine Minute, ja? Dann fährst du mich nach Hause und morgen nach Sydney oder wohin auch immer.«
Jim sah sie an, nickte knapp und ging dann zurück zum Wagen. Rahel beeilte sich, ihren Plan umzusetzen. Sie roch nach Benzin, als sie das Atelier abschloss und zu dem Hilux lief, der bereits mit laufendem Motor an der Mole wartete. Noch bevor Jim den Wagen gewendet hatte, hörte sie hinter sich die Explosion. Nicht mehr als eine kurze Verpuffung aus der Garage, ein trockener Knall nur, der die kühle Nachtluft aufknackte wie eine Nuss. Sekunden später schlugen bereits Flammen aus dem einzigen Atelierfenster, beißender Rauch quoll aus allen Ritzen und trübte die Nacht ein bisschen mehr ein.
»Scheiße, was hast du gemacht?«, brüllte Jim sie an, die Augen vor Schreck weit aufgerissen. Ohne darauf zu antworten, öffnete sie die Beifahrertür, griff unter den Sitz und zog den geladenen Colt heraus, den Jim dort versteckt hatte für den Fall der Fälle.
»Raus aus dem Wagen«, sagte sie ruhig.
»Was soll diese Scheiße, Rahel? Was …?«
Sie feuerte einen Schuss ab. Die hintere Seitenscheibe zerbarst, weit genug weg von seinem Kopf, aber immer noch nah genug, dass der Knall ihm fast das Trommelfell zerriss. Jim fuhr zusammen und rief irgendwas.
»Steig aus, Jim«, sagte Rahel. »Ich verlasse dich gerade.«
Endlich gehorchte er, zum ersten Mal. Ohne den Blick von ihr zu lassen, stieg er aus und trat einen Schritt zurück. Rahel rutschte auf den Fahrersitz und legte den Gang ein.
»Wenn du mir folgst oder mir die Bullen hinterherjagst, werde ich dir die Steuerfahndung auf den Hals hetzen, und ich weiß genau, wo sie anfangen müssen.«, erklärte sie und war dabei ruhiger, als sie es je in den letzten Monaten gewesen war. »Hast du das verstanden?«
Ja, hatte er. Er nickte. »Baby, mach keinen Scheiß«, sagte er leise. »Hey, ich liebe dich.«
»Leb wohl, Jim.«
Das war’s. Beide Hände fest am Lenkrad fuhr sie los. Im Rückspiegel stand ihr Atelier in Flammen, in ihrer Hosentasche brannte das Amulett. Als sie die Straße erreichte, warf sie die Waffe aus dem Fenster und gab Gas. Drei Stunden später parkte sie den Hilux im Halteverbot vor dem Abflugterminal des Flughafens von Sydney. Der nächste Flug nach Europa ging zwei Stunden später nach Frankfurt. Rahel buchte auch gleich den ersten Anschluss nach Jerusalem. Denn dort, so hatte das Wesen aus der Tiefe ihr erklärt, musste sie hin. Nach Hause.
IV
17. Juli 2011, Vatikanstadt
Das Einzige, was er im Augenblick empfand, war quälende Unsicherheit. Der kurze letzte Blick zurück hatte ihn immer noch nicht völlig überzeugt, dass Kelly wirklich tot war. Immer wieder ging er seine Erinnerung an die letzten Momente durch. Kellys überraschtes Gesicht, als er die Waffe zog. Das Loch in seiner Stirn, sein Blut, das in alle Richtungen spritzte. Blut überall auf den blütenweißen Messgewändern der Diakone ringsum. Kellys Körper, der von der Wucht des Schusses umgerissen wurde und dann kraftlos zusammensackte. Dieser erste Schuss war vermutlich bereits tödlich gewesen. Vermutlich. Wie viele Schüsse hatte er danach überhaupt auf Kellys reglosen Körper abgegeben? Zwei in den Kopf, die anderen in den Brustkorb. Reichte das, um jemand umzubringen, der Jahrhunderte überlebt hatte?
Die Unsicherheit fraß an ihm wie eine hochkonzentrierte Säure, während die Gardisten ihn weiter von Kelly wegzerrten. Zwei kräftige Schweizer, deren Namen er nicht kannte, hielten ihn unter den Armen gepackt und drängten ihn im Laufschritt von der Bühne herunter, aus dem Fokus der Fernsehkameras heraus, die hölzernen Treppen hinter der Bühne hinunter, vorbei an entsetzten, schockierten Gesichtern, durch den Lärm des zehntausendfachen Aufschreis in den stillen Damaskushof und dann zurück in die Kühle des Apostolischen Palastes. Es wirkte wie eine Flucht. Niemand sprach ein Wort, Petrus II. hörte nur das Keuchen der jungen Schweizer und die Schritte der beiden Gendarmen dahinter. Verdammt, wo war Steiner?
Die wenigen Nonnen und kurialen Angestellten, denen sie im Palast begegneten, mussten es im Fernsehen gesehen haben, denn sie wichen sofort zur Seite, als trage der Papst immer noch die Waffe bei sich. Als hätte er eine tödliche, hochansteckende Krankheit.
Der Papst und die Gardisten erreichten den alten Fahrstuhl, der hinauf in die Büros und ins Appartamento führte. Die Schweizer hielten abrupt inne.
»Wo sollen wir ihn hinbringen?«, keuchte der eine auf Italienisch.
»Keine Ahnung.«
»Verdammt, irgendwer muss uns doch sagen, wo wir ihn hinbringen sollen! Wo ist der Kommandant?«
»Bringt ihn rüber ins Gefängnis!«, schlug einer der Gendarmen vor, ein italienisches Bürschchen mit sorgfältig gestutztem Oberlippenbart. Er sprach, als wäre der Papst selbst gar nicht mehr anwesend. Tatsächlich verfügte der Vatikan über ein Gefängnis in der Kaserne der Schweizergarde, das diese Bezeichnung allerdings kaum verdiente. Es besaß gerade einmal zwei Zellen, die als Lagerräume genutzt wurden, denn im Verlauf der Jahrhunderte waren nur vier Personen je dort eingesperrt worden.
Die Ratlosigkeit seiner Eskorte und die absurde Vorstellung des vatikanischen Gefängnisses rissen Petrus II. aus seinen Gedanken an Kelly. Mit einem Ruck befreite er sich aus dem Griff der beiden Gardisten.
»Was erlaubt ihr euch!«, herrschte er sie an. »Wie sprecht ihr eigentlich in Gegenwart des Heiligen Vaters!«
Die vier jungen Männer wirkten bestürzt und noch ratloser.
»Aber Sie haben … Sie sind …«, stammelte der zweite Schweizer.
»Ich weiß genau, was ich getan habe!«, donnerte Petrus II. sie an. »Aber ich bin immer noch Oberhaupt der Kirche und dieses Staates. Ich bin immer noch euer oberster Dienstherr! Ich bin immer noch euer Papst!«
Petrus II. blickte sich um. Außer den beiden Schweizern und den beiden Gendarmen war niemand in dem langen Korridor mit dem fünfhundert Jahre alten Steinboden zu sehen. Nicht mehr lange, wusste Petrus II., und sie würden alle kommen. Alle. Die Kardinäle, Diakone, Sekretäre, Servicekräfte, die Opus-Dei-Leute und all jene unauffälligen kurialen Beamten, die für den ein oder anderen Geheimdienst arbeiteten. Die Zeit drängte.
Die Gardisten wagten zumindest nicht mehr, ihn anzurühren, machten aber auch keinerlei Anstalten, sich zurückzuziehen. In diesem Moment sah Petrus II. erleichtert, wie Oberst Steiner, Kommandant der Schweizergarde, in den Flur stürmte.
»Hier seid Ihr, Eure Heiligkeit!« Der Kommandant salutierte vor ihm und bemühte sich, ruhig zu atmen. »Um Himmels willen! Sind Sie verletzt?«
»Warum fragen Sie?«
»Na, wegen …« Oberst Steiner deutete auf die päpstliche Soutane. Erst jetzt bemerkte Petrus II. den riesigen Blutfleck auf dem weißen Gewand und auch das Blut in seinem Gesicht. Kellys Blut. Ihm wurde übel, aber er riss sich zusammen.
»Danke, Kommandant, es geht mir so weit gut. Ich würde mich jetzt gerne ins Appartamento zurückziehen. Ich möchte, dass Sie mich begleiten. Und zwar nur Sie.«
»Zu Befehl, Eure Heiligkeit.«
Steiner wandte sich an die beiden Gardisten. »Rufen Sie sich Verstärkung und lassen Sie niemanden hinauf. Ist das klar? Niemanden. Und wenn Sie Gewalt anwenden müssen.«
»Zu Befehl, Herr Kommandant. Und was ist mit … ich meine, wenn Seine Exzellenz, der Kardinalstaatssekretär …«
»Ich sagte niemanden! Das ist ein Befehl.«
Steiner öffnete den Fahrstuhl und ließ dem Papst den Vortritt. Erst als der alte Fahrstuhl aus den vierziger Jahren gemächlich losruckelte, hinauf in die Terzia Loggia, in das päpstliche Apartment, wandte sich der Papst wieder an ihn.
»Wussten Sie, dass dieser Fahrstuhl der einzige abhörsichere Ort im ganzen Vatikan ist, Oberst Steiner?«
»Ja, das weiß ich.«
Petrus II. sah den hochgewachsenen Oberst an. Ein unauffälliger, ruhiger Schweizer, loyal wie Urs Bühler, aber ohne dessen Temperament. Und im Gegensatz zu Bühler hatte Steiner ein kleines Geheimnis.
»Haben Sie es gesehen? Ich meine, genau gesehen?«
»Ja, Eure Heiligkeit. Ich stand nur wenige Meter entfernt.«
»Haben Sie irgendeinen Zweifel, dass ich Edward Kelly getötet habe?«
»Nein, Eure Heiligkeit.«
»Dann ahnen Sie vielleicht, was nun auf uns zukommt.«
»Nicht in vollem Umfang.«
»Ja, mag sein. Steiner, ich gebe Ihnen jetzt einige Anweisungen, die ich aus Sicherheitsgründen oben nicht wiederholen werde. Erstens: Überprüfen Sie, ob der Mann, den ich erschossen habe, wirklich tot ist und ob es sich eindeutig um Edward Kelly handelt. Zweitens: Stellen Sie eine Leibwache aus Ihren besten und loyalsten Leuten zusammen, die mich rund um die Uhr schützt. Aber es muss so aussehen, als ob man aufpasst, dass ich nicht fliehe. Drittens: Kontaktieren Sie Franz Laurenz und bitten Sie ihn umgehend zu mir.«
»Mit Verlaub, Eure Heiligkeit«, wandte Steiner ein, »Franz Laurenz ist untergetaucht, und ich habe keine Ahnung, wie …«
»Machen Sie mir nichts vor, Steiner«, schnitt der Papst ihm das Wort ab. »Ich weiß, dass Sie dem Orden vom Heiligen Schwert angehören. Rufen Sie Laurenz. Das ist alles.«
Der Oberst nickte zerknirscht. »Zu Befehl, Eure Heiligkeit.«
Mit einem letzten Ruck erreichte der Fahrstuhl den dritten Stock.
»Darf ich fragen, Heiliger Vater, was Sie nun tun werden?«
Petrus II. rang sich ein dünnes Lächeln ab. »Die nächsten Tage überleben, Steiner. Dann sehen wir weiter.«
Steiner verschloss umgehend sämtliche Zugänge zur päpstlichen Wohnung und scheuchte die vier Haushälterinnen von der Gemeinschaft Comunione e Liberazione und Alfio Meli, den Kammerdiener, der bereits für Johannes Paul III. gearbeitet hatte, in den Speisesaal. Dann führte er drei kurze Telefonate per Handy und wandte sich wieder an den Papst, der in einigem Abstand aus dem Fenster der Bibliothek auf den Petersplatz blickte.
»Bitte meiden Sie die Fenster, Eure Heiligkeit.«
Petrus II. nickte und trat vom Fenster weg.
»Natürlich, Oberst Steiner. Haben Sie Laurenz erreicht?«
»Nicht persönlich, Eure Heiligkeit. Aber er wird die Nachricht in Kürze erhalten.«
»Die vatikanische Gendarmerie soll den Keller des Gärtnerhäuschens untersuchen. Sie werden dort unten Beweise für weitere Abscheulichkeiten finden, für die ich ebenfalls verantwortlich bin.« Petrus II. reichte dem Oberst eine handgeschriebene Namensliste. »Das sind einige Personen, von denen ich sicher weiß, dass sie den ›Trägern des Lichts‹ angehören. Auch darum müssten Sie sich kümmern.«
Steiner nahm die Liste entgegen und erschrak kurz, als er die Namen einiger hochrangiger Mitglieder der Kurie erkannte.
»Ich kümmere mich umgehend darum, Heiliger Vater.« Steiner sah auf seine Officina Panerai, den einzigen Luxus, den er sich gönnte. »Es ist jetzt Viertel nach zwölf. Sie haben noch etwas Zeit, um sich frisch zu machen und eine saubere Soutane anzulegen.«
»Bevor was?«
»Verzeihen Sie, Heiliger Vater. Ich wollte Ihren Anweisungen nicht vorgreifen. Wen wollen Sie als Erstes empfangen? Seine Eminenz, den Kardinalstaatssekretär? Den Präfekten der Apostolischen Signatur? Welchen Botschafter? Was ist mit dem römischen Polizeipräfekten?«
»Niemanden, Oberst Steiner. Ich werde niemanden empfangen. Und warum werde ich niemanden empfangen?«
Steiner schluckte. »Weil Sie sowieso wissen, was die alle von Ihnen wollen, Eure Heiligkeit.«
»Genau. Sie alle werden meinen unverzüglichen Rücktritt fordern, was sollten sie auch sonst tun. Sie werden mir Druck machen, allen Druck, zu dem sie fähig sind. Bis hin zu mehr oder weniger subtilen Morddrohungen. Nein, Steiner, ich werde das Appartamento bis auf unbestimmte Zeit nicht mehr verlassen und meine Amtsgeschäfte von hier aus führen. Und ich will niemanden außer Ihnen und den Haushaltskräften sehen. Und Laurenz natürlich, sobald er eintrifft.«
Steiners Gesichtszüge verhärteten sich noch mehr, als er begriff, was auf ihn zukam. »Ich verstehe, Eure Heiligkeit. Aber mit Verlaub, dann sind Sie wirklich in höchster Lebensgefahr.«
»Ich verlasse mich auf Sie, Steiner. Bringen Sie Laurenz her. Und jetzt müssen Sie zurück. Da unten wird die Hölle los sein.«
»Darf ich noch eine letzte Frage stellen, Eure Heiligkeit?«
»Bitte.«
»Warum?«
Petrus II. sah den Schweizer nachdenklich an und ließ die Frage in den Höhlen, Kavernen und Katakomben seines Gewissens verhallen. Nichts regte sich dort mehr. Kein Dämon, der dort wütete, aber auch kein Licht, das Hoffnung versprochen hätte. Wohin Petrus II. auch blickte – in diesem Labyrinth seiner ausgehöhlten und in Tausenden von Exorzismen infizierten Seele sah er nur Dunkelheit, Schmutz und die Reste von etwas unsagbar Bösem, das bis vor kurzem noch dort gehaust hatte und das jederzeit zurückkehren konnte, wenn er nicht aufpasste.
Einen Augenblick lang dachte Petrus II. zurück an seine Kindheit in den Marken, jener fruchtbaren Region Italiens, wo die Leute glücklicher waren und älter wurden als irgendwo sonst. Er, Luigi Gattuso, hätte Bauer werden können wie sein Vater, ebenso ausgeglichen, glücklich und alt. Aber sein Ehrgeiz hatte ihn aus dem Paradies vertrieben, zum Chef-Exorzisten des Vatikans, Sonderbeauftragten des Papstes und schließlich selbst zum Papst gemacht. Dieser Ehrgeiz, mehr zu wollen als das Paradies, war die eigentliche Infektion gewesen, an der seine Seele langsam verfault war, und keine Beichte, kein Exorzismus, keine Vergebung würde sie noch heilen können.
»Beten Sie für meine Seele, Oberst Steiner«, sagte der Papst leise und reichte dem Schweizer die Hand. »Und danke für alles.«
Nachdem er sich Kellys Blut abgewaschen und eilig eine frische Soutane angelegt hatte, begrüßte Petrus II. die Hausangestellten, die immer noch angstvoll im Speisesaal warteten wie auf das Jüngste Gericht. Die vier Damen hatten gerötete Gesichter vom Weinen und zuckten bei seinem Eintreten zusammen, als erwarteten sie, dass er auch sie im nächsten Moment erschießen würde. Alfio bemühte sich um Fassung, aber auch in seinem Blick las Petrus II. die Angst, und er verstand, dass er nun zu einem Fremdkörper geworden war, der nicht mehr Teil dieses Haushalts, des Apostolischen Palastes, des Vatikans und der gesamten Kirche sein konnte.
»Ich weiß, das alles muss furchtbar für Sie sein«, begann er ohne Umschweife. »Aber das kann ich Ihnen leider nicht ersparen. Die nächsten Stunden und Tage werden eine große Belastung für Sie werden. Sollten Sie sich außerstande sehen, Ihre Aufgaben mit der gewohnten Sorgfalt zu versehen, dann können Sie natürlich sofort gehen.«
Er blickte in die Runde. Keiner der fünf meldete sich. Vielleicht standen sie aber auch immer noch zu sehr unter Schock. Petrus II. fragte sich, wie sie reagieren würden, sobald der Schock nachließ. Ob sie dem Druck gewachsen waren, den man bald auf sie ausüben würde, nur um an den Papst heranzukommen. Ob sie unter diesem Druck gar zu einem Mord fähig waren.
»Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ich ziehe mich jetzt in die Bibliothek zurück. Wenn Sie mir eine Kanne grünen Tee bringen würden, Alfio?«
Allein das kostete ihn schon große Kraft. Petrus II. war vergleichsweise jung, noch keine sechzig, einer der jüngsten Päpste in der Geschichte, und er hatte sich immer viel auf seine Fitness zugute gehalten. Aber als er sich nun an seinen Schreibtisch setzte, wurde ihm schlecht vor Anspannung, Erschöpfung und Todesangst, und er merkte, dass er die ganze Zeit schon mit den Zähnen knirschte. Sobald er sich gesetzt hatte, dachte er auch wieder an Kelly. Inzwischen betrachtete er seine Erinnerungen an die Schüsse wie etwas sehr Fernes, mit dem er selbst kaum noch etwas zu tun hatte. Er empfand sie jedenfalls nicht als die Todsünde, die er selbst kaum eine Stunde zuvor begangen hatte und die er immer noch nicht bereute.
Zeit zu beten. Petrus II. zog sich in seine Privatkapelle zurück und bat Gott um Vergebung. Falls es Gott überhaupt gab. Als Chef-Exorzist des Vatikans hatte er genug Beweise für die Existenz des Bösen erlebt und war darüber selbst zum Werkzeug des Satans geworden. Gott jedoch hatte sich ihm nie offenbart. Petrus II. wusste, dass ihm nun sein persönliches Golgatha bevorstand. Er zweifelte keine Sekunde, dass der kuriale Machtapparat seinen Tod beschließen würde, sobald der erste Schock verflogen war. Selbst sein Rücktritt würde dieses Schicksal nur hinauszögern. Aber Petrus II. wollte nicht sterben. Und es gab nur einen Menschen auf der Welt, der ihn noch retten konnte.
Aber weder diese dünne Hoffnung noch die Gebete ersparten ihm die Todesangst. Er zitterte vor Furcht, krümmte sich wimmernd zusammen, am ganzen Körper nass von kaltem Schweiß.
»Brauchen Sie Hilfe, Heiliger Vater?«, hörte er die Stimme seines Kammerdieners neben sich. »Soll ich einen Arzt rufen?«
Petrus II. schrak zusammen. Mit einer heftigen Bewegung schüttelte er die helfende Hand seines Kammerdieners rüde ab und richtete sich auf.
»Es geht schon. Wie lange stehen Sie schon da?«
»Ich hörte Sie stöhnen, Heiligkeit, da …«
»Lassen Sie mich allein. Haben Sie verstanden? Lassen Sie mich allein.«
Ohne den verwirrten Alfio weiter zu beachten, schleppte sich Petrus II. in die Bibliothek zurück und schloss sich ein. Aus dem halboffenen Fenster wehte die Hitze des römischen Sommers herein, vermischt mit fernem Verkehrslärm und einem schwachen Geruch von Lavendel und Baldrian. Der Duft des Bösen, Petrus II. kannte ihn aus Tausenden von Exorzismen. Hastig schloss er das Fenster, rückte sich einen Sessel in die Mitte des Raumes mit Blick auf die beiden Türen und das Fenster und beschloss, sich nicht mehr vom Fleck zu rühren. Einsam und voller Furcht wartete er auf Laurenz. Oder den Tod.
V
20. August 2013, Grinnell, Iowa, USA
Erst als er von der Interstate 80 nach Grinnell abbog, fiel Peter ein, dass er Dr. White noch von dem schweigenden Jungen ohne Augen hatte erzählen wollen. Das beunruhigte ihn. Als habe er Dr. White damit etwas Wesentliches verschwiegen. Oder als habe sich der augenlose Junge in einem der dunkelsten Winkel seiner Träume versteckt, um nicht von Dr. White erkannt zu werden. Da er jedoch bereits den Entschluss gefasst hatte, nun einmal wöchentlich zu Dr. White nach Des Moines zu fahren, würde es noch genug Gelegenheit geben, ihm von dem augenlosen Jungen und all den anderen furchtbaren Details aus seinen Träumen zu erzählen. Peter bezweifelte zwar, dass allein das ausreichen würde, um die Träume zu vertreiben, immerhin jedoch fühlte er sich nach dieser ersten Sitzung bereits etwas leichter. Zum ersten Mal seit Wochen freute er sich wieder auf zu Hause. Er ließ sich Zeit, bog in die 5th Avenue ab, dann in die Main Street, rollte im Schritttempo durch die Broad Street, grüßte im Vorbeifahren einen Kollegen aus dem Spanish Department und fuhr eine Weile einfach ziellos durch den Ort, in dem er nun seit zehn Jahren lebte. Eine Kleinstadt im Mittleren Westen der USA, knapp zehntausend Einwohner, tausendfünfhundert davon Studenten des kleinen, aber renommierten Liberal Arts Colleges, an dem er Deutsch lehrte. Ein aufgeräumtes, etwas verschlafenes Nest mit schmucken Holzhäuschen, etliche davon noch aus der Gründerzeit des Ortes. Typische amerikanische Provinz mit einem Coffeeshop, einem Organic Restaurant, Fachgeschäften für Landmaschinen, zu vielen Kirchen und Banken, wie Peter fand, aber freundlichen Nachbarn, die Fremden nicht gleich in den Rücken schossen, wenn die auf die absurde Idee verfielen, einen Spaziergang durch den Ort zu machen. Das Land ringsum nur reine Monokultur für Soja und Industriemais. Redneck land, mit ehrlichen dumpfen Sommern, die das Land über Monate ausglühten, mit anständigen Tornados, die ungebremst die weiten Ebenen terrorisierten, und mit brutalen, Schnee erstickten Wintern, in denen einem das Herz gefror.
Aber du lebst gerne hier. Du hast einen gut bezahlten, unbefristeten Job, der dir Spaß macht, eine wundervolle Familie, Freunde. Schönes Haus, Mitgliedschaft im Country Club, Segelboot, Greencard, und in den nächsten Jahren wirst du wahrscheinlich Dekan.
Die Frage nach einer Rückkehr nach Deutschland stellte sich nicht. Er hatte Köln bereits mit Anfang Zwanzig verlassen und war mit einem Stipendium an die Brandeis University nach Boston gegangen. Seitdem hatte er die USA nur noch während der kurzen Semesterferien verlassen, hatte promoviert, Ellen kennengelernt, die Stelle in Grinnell angetreten, geheiratet, Maya bekommen. Alles schön eins nach dem anderen, ein unaufgeregter, konstanter Strom kleiner Glücks- und Erfolgsmomente, alles, wovon er immer geträumt hatte. Die kurze Affäre mit der russischen Sprachassistentin zählte er bereits nicht mehr. Es lief gut für ihn, wirklich gut.
Bis die Träume eingesetzt hatten.
Er hatte sie Ellen so lange verschwiegen, bis es nicht mehr ging. Und Ellen hatte wie immer nicht lange gefackelt und ihn nach ein paar Erkundigungen zu Dr. White nach Des Moines geschickt. Bob. Bob hatte ihm ruhig zugehört und ein leichtes Schlafmittel verschrieben, aber Peter bezweifelte, dass irgendein Mittel etwas an seinen Träumen ändern konnte. Denn – und auch das hatte er Dr. White verschwiegen – er fühlte, dass diese Träume nicht aus irgendeiner überlasteten Region seines Gehirns kamen. Nein, diese Träume kamen von irgendwo außerhalb, aus einer anderen Welt. Einer Welt, die ihn suchte, nach ihm rief, ihm düstere Warnungen zuraunte, die an ihm zerrte und ihn aufspüren würde, wo auch immer er sich versteckte. Eine ganz und gar reale Welt. Und das machte ihm furchtbare Angst. Eine Angst, die sich inzwischen auch körperlich bemerkbar machte, sich in seiner rechten Schläfe sammelte und zu einem kleinen, pochenden Klumpen verdichtete. Der aufziehende Schmerz wurde schlimmer, wenn er in die hochstehende Mittagssonne blickte. Mit jedem Pulsschlag breitete sich auch ein leichtes Prickeln auf seiner Haut aus, kroch von seinen Fingern und Zehen hinauf wie ein borstiges, juckendes Geflecht.
Trink was.
Trotz der Klimaanlage war ihm heiß. Peter schwitzte. Er spürte, dass sein Mund austrocknete, und griff unter den Beifahrersitz nach einer angebrochenen Colaflasche, die Maya dort vergessen hatte. Die lauwarme Cola schmeckte pelzig, aber für einen Moment löschte sie den bitteren Geschmack im Mund, verdrängte den Kopfschmerz und die aufziehende Übelkeit.
Fahr nach Hause. Ellen wartet mit dem Essen.