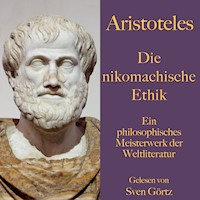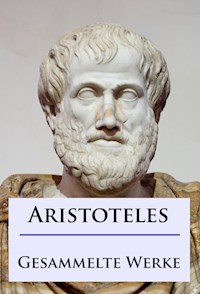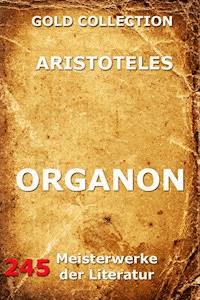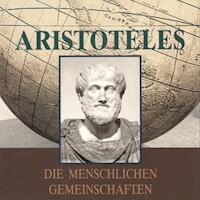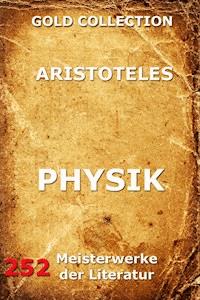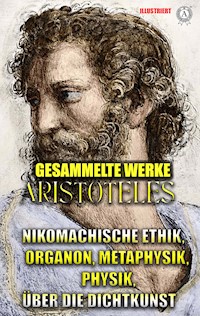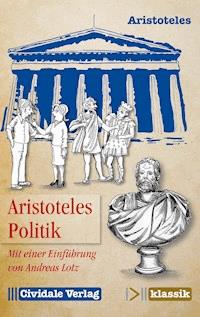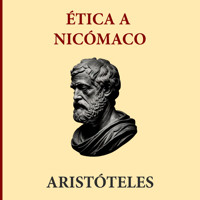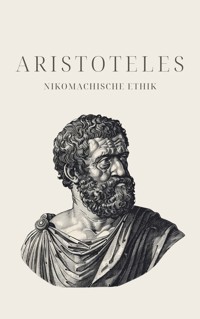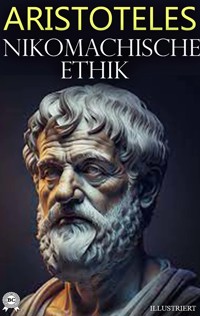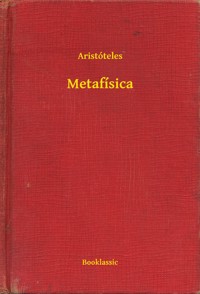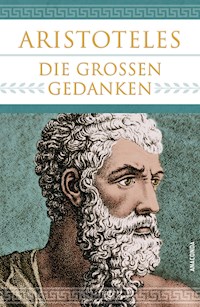
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Einstieg in das Werk des großen Philosophen
Aristoteles hat wie kein Zweiter die Geschichte der westlichen Philosophie geprägt. Die Denker des Mittelalters schrieben anstelle seines Namens schlicht »der Philosoph«. Beinahe ungläubig macht heute die schiere Vielfalt seines Werks. Von Ontologie bis Zoologie, von Ethik zu Poetik, Wissenschafts- zur Staatstheorie hat sich der Universalgelehrte beinahe jeder Wissensdisziplin gewidmet. Der Herausgeber Erich Ackermann hat grundlegende Passagen aus der ganzen Fülle dieses Werks zusammengestellt und erleichtert mit kenntnisreichen Kommentaren den Zugang zu Aristoteles großen Gedanken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Aristoteles
Die großenGedanken
Herausgegeben und kommentiert
von Erich Ackermann
Anaconda
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-641-28394-0V002
© 2021 by Anaconda Verlag,
einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: akg-images / Science Source;
Shutterstock/Ela Kwasniewski
Umschlaggestaltung: Druckfrei. Dagmar Herrmann, Bad Honnef
www.anacondaverlag.de
Inhalt
Vorwort
Logik (Organon)
Der Beweis
Der logische (dialektische) Schluss – Syllogismus
Die Kategorien
Physik
Das Wesen der Natur
Gibt es in der Natur etwas Unvergängliches?
Die vier Ursachen
Kausale und teleologische Betrachtung der Natur
Zenons Paradoxa
Zoologie
Erstaunen vor dem Leben
Allgemeines über das Leben und dessen Grundlage
Die Klassifizierung der Arten
Die Stufenleiter der Natur (scala naturae)
Der aufrechte Gang des Menschen zeugt vom Göttlichen
Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Tier
Die körperliche Überlegenheit des Menschen
Das Lebewesen ist organisiert wie ein Gemeinwesen
Von der Ursache des Todes
Kosmologie (Über den Himmel)
Was versteht Aristoteles unter Himmel?
Die Stellung der Erde im Kosmos
Sensualismus
Grundlegendes
Über die sinnliche Wahrnehmung und die Sinne
Sich selbst wahrnehmen und sich selbst erkennen
Über die Träume
Über die Traumdeutung
Über das Gedächtnis und die Erinnerung
Über die Seele
Allgemeine Definition der Seele
Geist, Verstand, Vernunft (Nous)
Seele, Materie und Form
Metaphysik (Ontologie)
Ausgangspunkt und Ziel der Wissenschaft
Entelechie – alles Seiende ist zielgerichtet
Kritik an Platons Ideenlehre
Der Satz vom Widerspruch
Das absolute Prinzip – Gott als unbewegter Beweger
Rhetorik
Die Glaubwürdigkeit des Redners
Die Affekte
Die Furcht
Das Mitleid
Die Prinzipien des Handelns der Menschen
Die drei Lebensalter
Poetik: Die Tragödie
Ethik
Das Glück (eudaimonia)
Die Tugenden und die Seelenteile
Die sittliche Tugend beruht auf der Gewöhnung
Was ist Tugend überhaupt?
Die Tugend ist die goldene Mitte (Die Mesotes-Lehre)
Beispiele für die richtige Mitte
Mäßigkeit/Besonnenheit (Sophrosyne)
Dianoetische Tugenden: Klugheit und Weisheit
Äußere Glücksgüter
Das kontemplative, theoretische Leben
Das sittlich Gute ist die vollendete Tugend – die kalokagathia
Das Schöne, das Gute und die Tugend
Politik
Ursprung und Wesen des Staates
Ökonomie und Erwerbskunde
Die verschiedenen Staatsformen
Das Wesen der Verfassung
Staatsformen (Verfassungen) und ihre Entartung
Das Recht – Grundprinzip eines Staates und seiner Verfassung
Die oberste Staatsgewalt
Die Politie
Quellen
Weiterführende Literatur
Vorwort
Aristoteles wurde 384 v. Chr. als Sohn eines Arztes in Stageira auf der nordgriechischen Halbinsel Chalkidike geboren. Sein Vater Nikomachos stand in Diensten des makedonischen Königs Amyntas III., seine Mutter Phaistis, eine Hebamme, stammte aus einer Arztfamilie aus Chalkis auf der Insel Euböa. Schon mit elf Jahren verlor Aristoteles seinen Vater und wurde daraufhin von seinem Vormund Proxenos in der kleinasiatischen Stadt Atarneus erzogen, wo er sich auch mit Hermias, dem späteren Herrscher dieser Stadt, anfreundete. 367 v. Chr. kam Aristoteles im Alter von siebzehn Jahren dann auf Vermittlung seines Vormunds nach Athen und trat in Platons Akademie ein, der er zwanzig Jahre lang bis zum Tod Platons angehörte, zunächst als Schüler, später als Forscher und Dozent. In diesem fruchtbaren Lehrer-Schüler-Verhältnis nahm Aristoteles viele Gedanken von Platon an, entwickelte aber auch eigene Ansichten, die denen seines Lehrmeisters konträr entgegenstanden, wobei er vor allem Platons Ideenlehre stark kritisierte. Auf den Idealisten Platon folgte der Realist, der Empiriker Aristoteles. In seiner Zeit an der Akademie verfasste Aristoteles vermutlich schon zahlreiche seiner Abhandlungen wie die über die Logik und naturkundliche Studien, darunter auch mehrere verloren gegangene Dialoge nach platonischer Art. Nach Platons Tod verließ er 347 v. Chr. die Akademie wohl aus politischen Gründen: Der Konflikt zwischen Athen und Makedonien verschärfte sich, der regierende König Philipp II. strebte für sein Reich Makedonien die Vorherrschaft in ganz Griechenland an und Aristoteles fühlte sich aufgrund der antimakedonischen Stimmung in Athen nicht mehr sicher. Er zog sich zunächst ins kleinasiatische Atarneus, dann auf die Insel Lesbos ins Exil zurück, wo er sich mit seinem Studienfreund Theophrast als Botaniker und Zoologe dem Studium der Meereslebewesen und Pflanzen widmete. Zu dieser Zeit heiratete er Pythias, eine Verwandte seines Freundes und Gönners Hermias, und bekam eine Tochter, die ebenfalls den Namen Pythias erhielt. Auf Lesbos erreichte ihn vom makedonischen König Philipp II. der Ruf, die Erziehung von dessen 13-jährigem Sohn Alexander zu übernehmen, dem er besonders die griechische Kultur und Literatur zu vermitteln versuchte. Der junge Alexander begeisterte sich vor allem für Homer und seinen Helden Achill, dem er Zeit seines Lebens nachzustreben versuchte. Es ist wohl auch anzunehmen, dass Aristoteles Alexander und dessen Mitschülern, darunter die späteren Heerführer Hephaistion, Ptolemaios, Seleukos und Kassander, seine Ansichten über Politik in Theorie und Praxis nahebrachte – ob mit Erfolg, darf bezweifelt werden: Denn während Alexander später das Griechentum über die damals bekannte Welt hinaus geografisch und kulturell ausweitete und damit den Hellenismus begründete, blieb Aristoteles dem kleinen Stadtstaat, der Polis, verhaftet. Er entwarf seine politischen Vorstellungen nach diesem Muster zu einer Zeit, als die klassische griechische Gesellschaftsform der selbständigen kleinen und überschaubaren Einheiten schon dem Untergang geweiht war. Das Schüler-Lehrer-Verhältnis dauerte nur drei Jahre, bis der junge Alexander die Regierungsgeschäfte übernehmen musste. Aristoteles blieb danach noch fünf Jahre am makedonischen Hof. Früh Witwer geworden, heiratete er dann Herpyllis, eine Frau aus seiner Heimatstadt Stageira, die ihm einen Sohn schenkte, Nikomachos; nach ihm benannte er später seine Hauptschrift über die Ethik.
Nachdem die Makedonier ihre Macht über ganz Griechenland ausgedehnt hatten, sah Aristoteles um 335 v. Chr. die Gelegenheit gekommen, nach Athen zurückzukehren, wo er mit Theophrast eine eigene Schule gründete. Im Lykeion, so benannt nach dem Apollon Lykeios geweihten Hain, befand sich mit dem Gymnasion zudem eine Bildungseinrichtung für körperliche und geistige Übungen. Die Anhänger dieser Schule werden auch Peripatetiker genannt nach dem griechischen Wort peripatos (Wandelhalle), in der sie beim Philosophieren auf und ab gingen. Dort entstanden während intensiver Forschungs- und Lehrtätigkeit die meisten seiner 170 Schriften, von denen heute noch 47 erhalten sind.
Nach dem Tode Alexanders des Großen entwickelte sich in Athen wiederum eine antimakedonische Strömung, die sich auch gegen Aristoteles richtete, zumal dieser kein Athener Bürger war, sondern ein Metöke, ein dauerhaft in der Stadt lebender Fremder ohne Bürgerrecht; der große Denker wurde als Freund der Makedonen wegen Gottlosigkeit angeklagt und verurteilt. Aber anders als Sokrates floh Aristoteles aus Athen, weil er, wie er selbst sagte, den Athenern nicht ein zweites Mal die Gelegenheit bieten wollte, sich an einem Philosophen zu vergreifen. Er zog sich nach Chalkis auf die Insel Euböa zurück in das Haus seiner verstorbenen Mutter, wo er 322 v. Chr. im Alter von 62 Jahren eines natürlichen Todes starb.
Die Bandbreite der Forschungen, die Aristoteles zum ersten Universalgelehrten des Abendlandes werden ließen, ist immens; sie reicht von theoretischer und praktischer Philosophie, Geschichte, Staatslehre, Biologie, Botanik, Zoologie, Psychologie, Mathematik, Medizin und Rhetorik bis hin zu Themen der Dichtkunst und umfasst geradezu alle Forschungsgebiete und alles Wissen der damaligen Zeit. Neben gesamtphilosophischen Themen gibt es auch viele einzelwissenschaftliche Werke und diese Vielfalt zeugt von einem geradezu enzyklopädischen Wissen und Forschen.
Die meisten Schriften, die Aristoteles hinterlassen hat, sind nicht für ein breites Publikum gedacht (esoterische Schriften), sondern dienten als Lehrwerke an der eigenen Schule; sie haben den Charakter von Vorlesungsmanuskripten, die in ihrer Sprache recht trocken und nüchtern sind, teils Gedankensprünge und sprachliche Ellipsen aufweisen und keineswegs so literarisch ausgearbeitet sind wie Platons Dialoge mit ihren Bildern und Mythen. Von seinen exoterischen Schriften, die für Leser außerhalb des Lykeions verfasst wurden und sich mehr um allgemeine Verständlichkeit bemühten, sind nur wenige Reste überliefert, wie z.B. Teile des Protreptikos, einer Mahnschrift zur Philosophie.
Unter dem Titel Organon sind sechs Einzelwerke zusammengefasst,* die sich mit der Logik, der Semantik und der Wissenschafts- und Argumentationstheorie befassen. In diesen Traktaten erarbeitet Aristoteles ein formallogisches System, behandelt die Kategorien – Begriffe, die keinen gemeinsamen Oberbegriff mehr haben wie z.B. Substanz, Qualität, Quantität, Wirken und Leiden – und erklärt den logischen Schluss (Syllogismus). Er ist der erste, der die Logik, die er selbst auch Analytik nennt, als eigene Wissenschaft vom reinen Denken beschrieben hat. Da sich verstandesmäßiges Denken in Begriffen vollzieht, gibt er von denen Definitionen, die den Begriff in eine Gruppe einordnen und ihn von einer anderen Gruppe unterscheiden. Danach verknüpft er Begriffe zu Urteilen; des Weiteren geht das Fortschreiten des Denkens immer in logischen Schlüssen vor sich. Dieser logische Schluss ist die Ableitung eines neuen Urteils aus anderen Urteilen und besteht aus den Voraussetzungen (Prämissen) und der Schlussfolgerung (Konklusion). Im Mittelpunkt der Schlusslehre steht der Syllogismus: Obersatz, Untersatz, Folgerung. Den Beweis definiert Aristoteles dann als die logisch zwingende Ableitung eines Satzes aus anderen Sätzen vermittels fortlaufender Schlüsse. Sätze, aus denen Beweise hergeleitet werden, müssen ihrerseits aber bewiesen sein, und so gelangt man schließlich zu Sätzen allgemeinsten Charakters, die nicht weiter bewiesen werden können. Außerdem äußert sich Aristoteles diesbezüglich über die zwei Argumentationsformen der Induktion und der Deduktion: Da man normalerweise nicht aus allgemeinen Sätzen besondere ableitet (apodiktisch, deduktiv), geht man nach Aristoteles Ansicht besser umgekehrt vor und leitet von Einzelbeobachtungen allgemeine Sätze ab (induktiv). Allerdings kann man durch Induktion niemals endgültige Sicherheit erlangen.
Ein weiterer Bereich seiner Schriften umfasst die Naturphilosophie. In seinem Werk Physik befasst sich Aristoteles mit der Prozesshaftigkeit der Naturvorgänge, mit deren Werden und Vergehen, wobei der Schwerpunkt auf den abstrakten Begriffen Veränderung, Bewegung, Zufall, Unendlichkeit, Ort/Raum, Leere, Zeit, Kontinuität und vor allem Ursache liegt. Zur Naturphilosophie gehören auch Werke über die Kosmologie (Über den Himmel), die Meteorologie, kleine naturwissenschaftliche Schriften über die Wahrnehmung, die Erinnerung, den Schlaf und den Traum und auch das große Werk Über die Seele, in dem Aristoteles die Seele nicht als das subjektive Zentrum unseres mentalen Lebens versteht, sondern als dasjenige Prinzip, dessen Vorhandensein lebendige von leblosen Körpern unterscheidet. Es umfasst alle Formen des Lebendigen, also pflanzliches, tierisches und menschliches Leben. Aristoteles legt dar, was das Lebendige für all diese Formen jeweils heißt, etwa der vegetative Selbsterhalt, die Wahrnehmung, das menschliche Denken sowie die Ortsbewegung der Lebewesen.
Ein Großteil der aristotelischen Schriften befasst sich auch mit der Biologie allgemein, insbesondere mit der Zoologie, wobei auch Physiologie, Anatomie und Medizin eine große Rolle spielen. Die Bücher über die Zoologie (Tiergeschichte, Über die Teile der Tiere, Über die Bewegung der Tiere, Über die Entstehung der Tiere) enthalten umfassende Studien des Tierverhaltens sowie detaillierte physiologische Darstellungen und Beschreibungen, da die Beobachtung der Dinge und Erscheinungen für den Forscher an erster Stelle standen. Aristoteles widmete sich besonders der Klassifizierung der Tiere und stellte zahlreiche Unterscheidungsmerkmale, etwa zwischen Wirbeltieren und Wirbellosen, Lebendiggebärenden und Eierlegenden, Einhufern und Paarhufern heraus. Er interessierte sich als einer der Ersten für den Bauplan von Meereswürmern und Kopffüßern, für die Struktur des menschlichen Herzens und des Blutkreislaufs. Aber auch die Tanzsprache von Bienen, die Paarung von Reihern oder die elterliche Fürsorge von Delfinen sowie die Entwicklung von Lebewesen aus dem Ei galten seinem Interesse. Er wollte auch wissen, warum einige Lebewesen länger leben als andere und warum wir sterben. Ausgangspunkt und Methode seiner Forschung waren neben der Beobachtung auch das Sezieren von Tieren; die sinnliche Wahrnehmung wurde für ihn zur Quelle objektiver Erkenntnis. In seinen umfangreichen Werken begründete er die wissenschaftliche Systematik der Organismen.
Das führte Aristoteles zu der Frage nach einer ersten Ursache, nach einem höchsten Seienden, das seine Ursache in sich selbst hat. Dieses höchste Seiende war für ihn Gott, der unbewegte Beweger. So hat Aristoteles am Ende seiner Metaphysik die Frage nach dem Sein verbunden mit der Frage nach dem höchsten Sein, nach Gott. Deshalb waren bei ihm Ontologie und Theologie letztendlich identisch.
In seinem Werk über die Rhetorik definiert er die Redekunst als die Fähigkeit, das Überzeugende, das jeder Sache innewohnt, zu erkennen, und das ist zunächst der Inhalt und erst in zweiter Linie Stil und Gliederung der Rede. Glaubhaft und überzeugend kann nur derjenige Redner wirken, der ebenso das Ethos wie das Pathos beherrscht, das heißt der sich einerseits genau auf Individualität und Stimmung des Hörers einzustellen weiß, dem aber andererseits zu gegebener Zeit auch Mittel zur Erregung des Affekts und der mitreißenden Leidenschaft zu Gebot stehen. Unter anderem unterscheidet Aristoteles dabei drei Redegattungen: Beratungsrede, Gerichtsrede und Festrede. Die Rhetorik gehört zum Teil auch zum Bereich der praktischen Philosophie.
Die erhaltenen Teile der Poetik handeln vor allem vom Epos und der Tragödie, wobei Aristoteles die These aufstellt, dass alle Dichtung auf Nachahmung beruht. Diese Nachahmung der Wirklichkeit erzeugt beim Zuschauer einer Tragödie die Affekte von Furcht und Schrecken, was zu einem ethischen Ziel führt, nämlich einem Effekt der Reinigung/Läuterung von eben diesen Affekten selbst, die Katharsis. Daneben entwickelt Aristoteles auch eine allgemeine Dichtungstheorie, die in der Renaissance und in der Klassik, hier vor allem im klassischen französischen Drama des 17. Jahrhunderts (Corneille, Racine), streng eingehalten wurde: Sie beschreibt die Einheiten der Zeit und der Handlung sowie den Begriff der Wahrscheinlichkeit und Glaubwürdigkeit einer Handlung. Die heute dem klassischen Drama zugehörige dritte Einheit des Orts wurde erst in der Renaissance in die Dichtungstheorie eingeführt. Der zweite Teil der Poetik, der die Komödie und das Lachen behandelt und der in Umberto Ecos Roman Der Name der Rose (1980) eine entscheidende Rolle spielt, ist verlorengegangen.
Zur praktischen Philosophie gehören neben der Rhetorik vor allem die Ethik und die Politik. Neben der Eudemischen Ethik und der Großen Ethik ist es vor allem die Nikomachische Ethik, in der Aristoteles dem Leser praktische Anweisungen für ein gutes, das heißt glückliches Leben gibt. Mit dieser systematischen Abhandlung ethischer Grundfragen, die nach seinem Sohn Nikomachos benannt ist, etablierte Aristoteles die Ethik als eigenständigen Zweig der Philosophie. Die Glückseligkeit (eudaimonia) kann ihm zufolge nur durch ein tugendhaftes Leben erreicht werden. Dabei unterscheidet Aristoteles zwei Arten von Tugenden: die ethischen Tugenden, die auf der Gewohnheit beruhen, und die verstandesmäßigen (dianoetischen) Tugenden. Ethische Tugenden, auch Charaktertugenden genannt, sind nicht bloße Fähigkeiten, sondern werden durch Gewöhnung oder Gewohnheiten zu festen Haltungen und nachhaltigen Einstellungen und Eigenschaften. Intellektuelle, dianoetische Tugenden stellen sich ein, wenn sich die Vernunft (Logos) in einem guten Zustand befindet. Das rein betrachtende, theoretische Leben hat die höchsten und ewigen Dinge zum Gegenstand, und dabei ist der Mensch dem Göttlichen am nächsten. Da der Mensch aber nur danach streben kann, an der göttlichen Tätigkeit teilzuhaben, bleibt für ihn praktisch die zweitbeste Art übrig, glücklich zu leben, nämlich die Ausübung von Charaktertugenden im zwischenmenschlichen Umgang. Der Weg zu einem tugendhaften Leben liegt in der goldenen Mitte (Mesotes) zwischen zwei Lastern, sodass eine tugendhafte Handlung immer eine Vermeidung von einem Zuviel oder Zuwenig bedeutet. Da für Aristoteles die Ethik Vorläufer und Voraussetzung für die Politik ist, gehört es auch zur Aufgabe der politischen Wissenschaft und zur Verantwortung des Staatsmanns, durch die Gesetzgebung die Tugendhaftigkeit der Gemeinschaft zu fördern.
In seinem Werk Politik definiert Aristoteles den Menschen als ein Zoon physei politikon, als ein Wesen, das von Natur her die Gemeinschaft sucht, ohne die es nicht leben kann. Davon abgesehen gewährt ihm ein soziales Leben auch einen leichteren Zugang zu den lebensnotwendigen Dingen, was ihm ein autarkes Leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft ermöglicht. Erst dieser Freiraum eröffnet dem Menschen das Streben nach einem guten, glücklichen Leben, was ja auch in der Nikomachischen Ethik als das erstrebenswerteste Ziel bezeichnet wird. Somit beruht der Staat auch nicht auf einem wie auch immer gearteten Vertrag oder einer Vereinbarung seiner Bürger, sondern er ist von Anfang an da, er existiert früher als jeder Einzelne, weil er zur Natur des Menschen gehört, dessen eigentliches Ziel das glückliche Leben ist. Jeder Mensch lebt einzig darum, um den in seiner Natur angelegten Plan zu verwirklichen, und da nur die Polis, die Gemeinschaft, es dem Menschen ermöglicht, seine eudaimonia zu erreichen, entspricht diese Auffassung vom Wesen des Staates auch voll und ganz der Entelechie-Lehre des großen Universalgelehrten. Für ihn ist ein Staat, der nicht dem Glück seiner Bürger dient und es nicht fördert, kein guter Staat. Anhand dieser Kriterien untersucht Aristoteles dann die klassischen Staatsformen (Monarchie, Aristokratie und Politie) und ihre Entartungen (Tyrannis, Oligarchie und Demokratie) und fragt danach, ob die höchste Autorität im Staat zum Wohle aller oder nur zu ihrem eigenen Wohl regiert. Für ihn ist die Politie, eine aus den Elementen der Demokratie und der Aristokratie gemischte Staatsform, die bestmögliche. Der Empiriker Aristoteles verfährt in seiner Auffassung von einer staatlichen Gemeinschaft wesentlich realitätsbezogener als Platon in seiner Staatsutopie Politeia und zielt auf den besten aller möglichen Staaten ab. Vor allem verwirft er Platons Einteilung der Bürger in die drei Stände der Philosophen, »Wächter« und erwerbstätigen Vollbürger (einprägsam: »Lehrstand, Wehrstand, Nährstand«) sowie das Prinzip der Frauen- und Kindergemeinschaft und des Güterkommunismus. Beide Philosophen aber halten an dem Ideal der Gerechtigkeit im Gemeinwesen fest.
Zu Aristoteles’ Lebzeiten war die Blütezeit der Polis, der vielen, meist kleinen Stadtstaaten bereits vorbei und verlor auch bald in der politischen Ideenwelt mehr und mehr an Bedeutung. Als nach dem Tod Alexanders des Großen sein Weltreich in drei große Dynastien zerfiel und sich der Hellenismus entfaltete, beschäftigten sich die Philosophen weniger mit dem Leben in einer staatlichen Gemeinschaft, sondern, wie die Stoiker und die Epikureer, eher mit der Gestaltung des individuellen Lebens; die Ethik wurde der Schwerpunkt der Philosophie. So stellten vor allem die Stoiker ein über die Polis weit hinausgreifendes, kosmopolitisches Bindungsbewusstsein aller Menschen untereinander heraus, was einem expandierenden politischen Gebilde eher entsprach als die überschaubare Welt der Polis.
Während Platon sich in seinem Denken der transzendenten Welt der Ideen widmet und die Sinnenwelt als bloßes Schattengebilde ansieht, zielen die Interessen des Aristoteles gerade auf diese von den Sinnen erfassbare Welt, die er empirisch erforschen will. Erst nachdem er seine Außenwelt durch Beobachten systematisch erfasst, methodisch aufgegliedert und klassifiziert hat, geht er den zweiten Weg der Erkenntnis, der mittels der Vernunft durch Abstraktionen vom Vielen zum Wesentlichen führt. Platon hat zur Erkenntnis seiner absoluten Ideen nur den Verstand benutzt, Aristoteles hingegen zuerst die Sinne, dann den Verstand. Somit glaubt Aristoteles auch nicht an eine von Platon postulierte Apriorität der Ideen, die keine Basis in der empirisch erfahrbaren Realität haben. Die Idee existiert nicht vor, sondern nach der Erfahrung.
Für Aristoteles ist die Idee immanent, sie ist schon im Stoff als Möglichkeit vorhanden. Das Unveränderliche ist für ihn die Form, das Veränderliche ist die Materie, der Stoff. Die Form erst gibt dem Stoff seine Wirklichkeit. Der Stoff selbst hat keine Wirklichkeit, trägt aber die Möglichkeit, das Vermögen in sich, unter den Kräften der Form wirklich zu werden. Die Formen, die in ihrer Funktion eine gewisse Ähnlichkeit mit Platons Ideen haben, bringen die Materie hervor und sind damit nicht nur die unveränderlichen Urbilder der Dinge, sondern auch ihr Zweck und die Kraft, die die Dinge schafft. Die Materie, die unabhängig von den Formen keine Wirklichkeit, sondern nur Möglichkeit hat, hat ein Verlangen nach den Formen. Jedes natürliche Ding ist eine Verbindung aus Form und Materie, wobei die Formen aber in der Welt existieren und nicht wie bei Platon ein eigenes transzendentes Ideenreich außerhalb von ihr bilden. Das Wesen einer Sache besteht nach Aristoteles nur aus einer Einheit von Stoff und Form.
Alles ist in der Natur auf ein Ziel (Telos) hin ausgerichtet und unterliegt einer zweckmäßigen Ordnung. So ist z.B. das Ziel des Samens die Pflanze; diese ist potenziell schon im Samen enthalten und drängt in ihm zur Verwirklichung. Es gibt also eine dem Organismus innewohnende Kraft, die diesen zur Selbstverwirklichung drängt. Diese von Aristoteles in seiner Metaphysik eingeführte Lehre bezeichnet man als Entelechie. Sein teleologisches, das heißt zweck- oder zielgerichtetes Denken hat das ganze christliche Mittelalter beeinflusst.
Nach Aristoteles’ Tod übernahm sein Schüler und Freund Theophrast die Leitung des Peripatos. Theophrast, der sich vornehmlich der Botanik widmete, aber auch ein Buch über die verschiedenen Charaktere schrieb, war ebenso wie Aristoteles ein universaler Geist; bald aber wandte sich jeder Peripatetiker einem Spezialgebiet zu, und ihre Schule verlor mehr und mehr an Bedeutung. Während Platons Akademie ihren Einfluss eigentlich nie verlor und nahtlos in den Neuplatonismus überging sowie eine starke Wirkung auf das Christentum ausübte, wurde Aristoteles ähnliche Verehrung nicht zuteil. Bei prominenten antiken Kirchenvätern wie Augustinus war Aristoteles wenig bekannt und wenn, zudem unbeliebt. Dies lag vor allem daran, dass er das Weltall als nicht von Gott geschaffen und unvergänglich hielt und dass er die Unsterblichkeit der Seele bezweifelte. So gerieten nach dem Untergang der antiken Kultur Griechenlands und Roms die Werke Aristoteles’ in Vergessenheit. Doch sie wurden im frühen Islam im arabischen Raum wiederentdeckt, ins Arabische übersetzt und durch Philosophen wie Avicenna und Averroes kommentiert und verbreitet; so gelangten sie, ins Lateinische übertragen, auf einem Umweg über das maurische Spanien ins Abendland zurück, wo sie dann vor allem durch Albertus Magnus und seinen Schüler Thomas von Aquin als fester Bestandteil der mittelalterlichen scholastischen Philosophie und der katholischen Moraltheologie etabliert wurden.
Neben der Logik und der teleologischen Weltsicht war für das christliche Mittelalter, und hier vor allem für das Mönchstum, Aristoteles’ Unterscheidung von theoretischem (vita contemplativa) und praktischem Leben (vita activa) maßgeblich. Auch der aristotelische Gottesbegriff vom unbewegten Beweger prägte die scholastische Lehre des Mittelalters. Was Aristoteles sagte, galt als unwiderruflich. Er wurde der große Lehrer des Mittelalters und galt schlichtweg als »der Philosoph«, ohne dass man dabei seinen Namen noch eigens zu nennen brauchte.
Erich Ackermann
*Das Organon beinhaltet die Schriften: Die Kategorien, Über die Interpretation (= Hermeneutik), Analytica Priora (Über den logischen Schluss), Analytica Posteriora (Lehre vom Beweis), Topik (Lehre von den allgemeinen Sätzen und der Dialektik), Sophistische Widerlegungen (Über die Trugschlüsse).
Logik (Organon)
Der Beweis
Aller Unterricht und alles Lernen geschieht, soweit beides auf dem Denken beruht, aufgrund eines schon vorher bestandenen Wissens. Dies leuchtet jedem ein, wenn man die sämtlichen Wissenschaften betrachtet; denn man erlangt die mathematischen Wissenschaften auf diese Weise und ebenso jede andere Wissenschaft. Ebenso verhält es sich mit der Argumentation durch logische Schlüsse und durch Induktion; bei beiden geschieht die Belehrung aufgrund eines schon vorher bestandenen Wissens; bei der ersteren werden Sätze angenommen, wie sie bei allen Verständigen gelten; bei der letzteren wird das Allgemeine aus der Kenntnis des Einzelnen abgeleitet. Auch die Redner überzeugen auf gleiche Weise; entweder durch Beispiele, also durch Induktion, oder durch glaubhafte allgemeine Sätze, was eine Deduktion ist.
Man muss aber in zweifacher Weise ein Vorwissen haben; bei manchen Dingen muss man voraussetzen, dass sie sind; bei anderen muss man wissen, was das Ausgesagte ist; bei manchen muss beides vorhanden sein. So muss man schon wissen, dass von jedem Ding entweder die Bejahung oder die Verneinung wahr ist; bei dem Dreieck aber, was es bedeutet; und bei der Eins muss man beides vorher wissen, sowohl dass sie ist, als was sie bedeutet. Von diesen Bestimmungen ist uns nämlich nicht jede in gleicher Weise bekannt; manches lernt man kennen, wo man schon vorher etwas davon wusste, manches auf einmal, wie z.B. das, was unter einem Allgemeinen steht, welches man schon kannte. So wusste man schon, dass die Winkel jedes Dreiecks zweien rechten gleich sind; aber dass diese in dem Halbkreis eingezeichnete Figur ein Dreieck ist, erkennt man gleichzeitig mit der Durchführung einer Induktion. Von manchem geschieht das Lernen auf diese Weise und man lernt das Besondere nicht durch einen Mittelbegriff kennen; nämlich alles, was als Einzelnes ist und sich nicht auf ein Zugrundeliegendes bezieht. Ehe es aber vorgeführt wird oder der Schluss gezogen wird, findet in einer gewissen Weise schon ein Wissen statt, in einer anderen Weise aber nicht. Denn wenn man nicht weiß, ob etwas überhaupt besteht, wie kann man da wissen, dass dessen Winkel überhaupt zweien rechten gleich sind? Vielmehr ist klar, dass man zwar so weit weiß, als man das Allgemeine kennt; dass man es aber nicht im vollen Sinne weiß. Wäre dies nicht so, so geriete man in die im Menon* dargelegte Schwierigkeit, dass man entweder nichts lernen kann oder nur das, was man schon weiß.
Diese Schwierigkeit ist also nicht so zu lösen, wie einige versucht haben, indem sie die Frage stellten: Weißt Du also, dass jede Zwei gerade ist oder weißt du es nicht? Bejaht man nun die Frage, so führen sie eine Zwei an, von welcher der Gefragte nicht glaubte, dass sie bestehe, also auch nicht, dass sie gerade sei. Sie lösen nämlich die Schwierigkeit in der Weise, dass sie behaupten, nicht von jeder Zwei zu wissen, dass sie gerade sei, sondern nur von denen, die sie als eine Zwei kennen. Allein sie wissen doch das, wovon sie den Beweis besitzen und erlangt haben, und sie haben denselben nicht so erlangt, dass jener Satz nur von denjenigen Dreiecken gelte, von denen sie wissen, dass sie Dreiecke oder dass sie Zahlen sind, sondern als von allen Zahlen oder allen Dreiecken geltend; denn keine Prämisse wird so angesetzt, dass sie nur von den dir bekannten Zahlen oder von den dir bekannten geradlinigen Figuren gilt, sondern, dass sie von allen gilt. Sonach steht dem, wie ich glaube, nichts entgegen, dass man das, was man lernt, gewissermaßen schon weiß und gewissermaßen doch nicht weiß. Widersinnig ist es nämlich nicht, wenn man das, was man lernt, gewissermaßen schon weiß, sondern nur, wenn man es in der Beziehung und in der Weise schon wusste, in der man es lernt.
Man glaubt dann eine Sache voll und nicht im sophistischen Sinne in bloß nebensächlicher Weise zu wissen, wenn man die Ursache zu kennen glaubt, durch welche die Sache ist, sodass jene die Ursache von dieser ist und dass sich dies nicht anders verhalten kann. Es ist klar, dass das Wissen solcher Art ist, denn von den Nicht-Wissenden und Wissenden glauben jene und wissen diese, dass dasjenige, was sie vollständig wissen, sich unmöglich anders verhalten kann. Ob es nun noch eine andere Art des Wissens neben dem Wissen aufgrund eines Beweises gibt, werde ich später sagen; jetzt sage ich, dass es auch ein Wissen aufgrund eines Beweises gibt. Unter Beweis verstehe ich aber einen wissenschaftlichen Schluss, und wissenschaftlich nenne ich den, gemäß dem wir dadurch, dass wir ihn besitzen, wissen. Wenn nun das Wissen so ist, wie ich hier angenommen habe, so muss notwendig die beweisbare Wissenschaft aus Sätzen hervorgehen, welche wahr sind und welche die ersten und unvermittelt und bekannter und früher sind und welche die Gründe für den Schlusssatz sind; denn so werden sich auch die eigentümlichen obersten Grundsätze für das Bewiesene verhalten. Ein (logischer, deduktiver) Schluss kann allerdings auch ohne solche Grundsätze zustande kommen, aber nicht ein Beweis; denn er wird keine Erkenntnis bewirken. Diese Bestimmungen müssen also wahr sein, weil man das Nicht-Seiende nicht wissen kann, wie z.B. die Messbarkeit der Diagonale des Quadrats durch die Seite desselben; sie müssen ferner oberste und unbeweisbare Bestimmungen sein, denn sonst müsste man die Kenntnis ihres Beweises haben, um sie zu wissen, da das Wissen der Dinge, wofür ein Beweis und zwar nicht bloß in nebensächlicher Beziehung vorhanden ist, darin besteht, dass man ihren Beweis innehat. Ferner müssen jene Bestimmungen die Gründe bilden und bekannter und früher sein; und zwar die Gründe deshalb, weil man etwas erst dann weiß, wenn man seine Ursache kennt, und sie müssen früher sein, weil sie Ursachen sind, und vorher bekannt, nicht bloß in der Weise eines Verstehens, sondern auch in der Weise des Wissens, dass sie sind. Denn das der Natur nach Frühere ist nicht dasselbe mit dem Früheren für uns und ebenso ist das der Natur nach Bekanntere nicht dasselbe mit dem für uns Bekannteren. Unter dem für uns Früheren und Bekannteren verstehe ich das, was der sinnlichen Wahrnehmung näher liegt; unter dem schlechthin Früheren und Bekannteren das davon Entferntere. Am entferntesten ist das am meisten Allgemeine; am nächsten das Einzelne; beide sind einander entgegengesetzt. Aus dem Ersten abgeleitet ist das, was aus seinen eigentümlichen obersten Grundsätzen abgeleitet ist; denn Erstes und oberster Grundsatz sind dasselbe. Ein oberster Grundsatz ist der unvermittelte Vordersatz eines Beweises und unvermittelt ist ein Vordersatz, dem kein anderer vorausgeht. Vordersatz ist die Aussage des einen von zwei entgegengesetzten Sätzen, wodurch etwas einem anderen Gegenstand beigelegt wird; er ist dialektisch, wenn von diesen beiden Sätzen der eine oder der andere beliebig angenommen wird; er ist beweisend, wenn einer von beiden bestimmt als der wahre hingestellt wird. Aussage ist der eine oder der andere von diesen entgegengesetzten Sätzen. Ein Gegensatz sind solche zwei Sätze, welche kein Drittes zwischen sich gestatten. Teile eines Gegensatzes sind jeder dieser beiden Sätze, von denen der eine etwas von einem Gegenstand bejaht und der andere es verneint. Den unvermittelten Obersatz eines Schlusses, der nicht zu beweisen ist, nenne ich These, wenn der Lernende ihn nicht innezuhaben braucht; wenn aber der, welcher irgendetwas lernen will, ihn notwendig inne haben muss, so ist es ein Axiom. Solcher Art gibt es einige und man hat sie gewöhnlich mit diesem Namen bezeichnet. Nimmt man beliebig einen von den beiden Teilen eines Gegensatzes als Obersatz, z.B. wenn ich sage, dass Etwas ist oder dass es nicht ist, so ist dies eine Hypothese; diejenige dagegen ohne dies ist eine Definition, denn die Definition ist zwar eine These, so lautet z.B. die arithmetische Definition, dass die Eins das der Größe nach Unteilbare sei; aber eine Hypothese ist dies nicht, denn die Angabe, was die Eins ist und die Angabe, dass die Eins ist, sind nicht dasselbe.
Da die Überzeugung und die Erkenntnis in Bezug auf einen Gegenstand darauf beruht, dass man dafür einen solchen logischen Schluss hat, welchen man Beweis nennt, und ein solcher Schluss es dadurch ist, dass die Sätze, aus denen er sich ableitet, wahr sind, so muss man die obersten Grundsätze entweder sämtlich oder einige vorher nicht bloß kennen, sondern auch in einem höheren Grade kennen; denn das, durch welches ein anderes ist, ist immer in höherem Grade; so liebt man dasjenige, weshalb man ein anderes liebt, in höherem Grade. Wenn also unsere Überzeugung und unser Wissen auf den obersten Grundsätzen ruht, so wissen wir diese auch in höherem Grade und vertrauen ihnen in höherem Maß, weil wir erst durch diese Grundsätze das Weitere wissen. Es ist nämlich nicht möglich, dasjenige, was man nicht weiß, und das, wozu man sich nicht besser verhält, als wenn man es wüsste, mehr zu wissen, als das, was man wirklich weiß. Dies würde aber geschehen, wenn man nicht schon ein Wissen vor demjenigen Wissen hätte, auf welches man aufgrund des Beweises vertraut. Notwendig muss also den obersten Grundsätzen, entweder den sämtlichen oder einigen, mehr vertraut werden als der Schlussfolgerung. Wer also ein Wissen mittels des Beweises erwerben will, der muss nicht bloß die obersten Grundsätze mehr kennen und ihnen mehr vertrauen als dem, was bewiesen wird, sondern es darf ihm auch das, was diesen Grundsätzen widerspricht und woraus auf das Entgegengesetzte und Falsche geschlossen werden könnte, weder glaubhafter noch bekannter sein; denn der Wissende muss schlechthin unerschütterlich in seiner Überzeugung sein.
Zweite Analytiken, Buch 1, Kap. 1–2
Der logische (dialektische) Schluss – Syllogismus
In seinen Schriften zur Logik, besonders in der Topik und in den Büchern über die Analytik befasst sich Aristoteles mit dem logischen Schluss, dem Syllogismus, einer Argumentationskette, die aus mindestens drei Thesen besteht. Zwei oder mehrere Prämissen, die allgemein als wahr angesehen werden, führen deduktiv zu einem Schluss, der Konklusion, die in sich stimmig sein muss. Ein klassisches Beispiel:
Erste Prämisse als allgemeine Behauptung:
Alle Menschen sind sterblich.
Zweite Prämisse als spezifische Behauptung:
Sokrates ist ein Mensch
Konklusion als deduktive Schlussfolgerung:
Also ist Sokrates sterblich.
Der Zweck dieser Abhandlung ist die Auffindung des Verfahrens, aufgrund dessen man in Bezug auf jeden aufgestellten Streitsatz Schlüsse aus glaubhaften Ansätzen zustande bringen kann und vermittelst dessen, wenn man selbst einen Satz verteidigt, sich nicht in Widersprüche verwickelt. Es ist deshalb zunächst anzugeben, was ein Schluss ist und welche Arten es von ihm gibt, damit man weiß, was ein dialektischer Schluss ist, denn um diesen handelt es sich in der vorliegenden Abhandlung.
Der logische Schluss ist nun eine Argumentation, bei welcher einiges vorausgesetzt wird und dann daraus etwas davon Verschiedenes sich mit Notwendigkeit aufgrund jener Vordersätze ergibt. Einen Beweis liefert der Schluss dann, wenn er aus wahren und allgemeinen obersten Sätzen gebildet wird oder aus solchen abgeleitet wird, welche auf wahre und oberste Sätze der betreffenden Wissenschaft zurückgehen. Dialektisch ist dagegen derjenige Schluss, welcher sich aus allgemein anerkannten Meinungen ableitet. Wahre und oberste Sätze sind die, welche nicht aufgrund anderer, sondern durch sich selbst überzeugend sind. Denn bei den obersten Grundsätzen der Wissenschaften darf man nicht nach nur einem Grund für dieselben verlangen, sondern jeder dieser Grundsätze muss durch sich selbst überzeugend sein. Glaubwürdig und überzeugend sind dagegen Sätze, wenn sie von allen oder von den meisten oder von den weisen Männern und zwar bei Letzteren von allen oder von den meisten oder von den erfahrensten und glaubwürdigsten anerkannt werden. Ein Trugschluss ist ein solcher, welcher aus scheinbar glaubwürdigen Sätzen, ohne dass sie es wirklich sind, abgeleitet wird oder welcher aus wirklich glaubwürdigen oder aus nur so scheinenden Sätzen bloß scheinbar abgeleitet wird. Denn nicht alles, was glaubwürdig scheint, ist es auch wirklich, und ebenso ist das, was glaubwürdig genannt wird, nicht auf den ersten Blick als falsch zu erkennen, während dies bei den Vordersätzen der Trugschlüsse der Fall ist, wo sogleich und meist selbst für Personen mit geringerer Übersicht die trügerische Natur derselben offenbar ist. Deshalb soll allein die zuerst genannte Art der Trugschlüsse als Schlüsse gelten, während die anderen zwar Trugschlüsse, aber keine Schlüsse sind, weil hier nur scheinbar, aber nicht wirklich eine logische Schlussfolgerung stattfindet.
Neben allen diesen hier genannten Schlüssen gibt es auch noch Fehlschlüsse, welche aus den eigentümlichen Annahmen bestimmter Wissenschaften abgeleitet werden, wie es solche z.B. bei der Geometrie und den damit verwandten Wissenschaften gibt. Das Verfahren ist hier ein anderes als bei den vorgenannten Schlüssen; denn der, welcher eine falsche Voraussetzung ansetzt, schließt nicht aus wahren und obersten, noch aus glaubwürdigen Sätzen. Ein solches Verfahren fällt nicht unter den Begriff von jenen Schlüssen, denn man benutzt dabei keine Sätze, welche von allen oder den meisten anerkannt werden, noch solche, welche von den weisen Männern und bei diesen von allen oder den meisten oder den glaubwürdigsten anerkannt werden, sondern man benutzt zur Ziehung des Schlusses Sätze, welche zwar in das Gebiet der betreffenden Wissenschaften fallen, aber unwahr sind; denn der Fehlschluss wird dadurch bewirkt, dass man z.B. den Halbkreis nicht so zieht, wie es sich gehört, oder gewisse Linien nicht so zieht, wie es geschehen sollte.
Dies sind, kurzgefasst, die Arten der Schlüsse. Die Unterschiede dieser genannten und der später noch zu erwähnenden Arten im Allgemeinen angedeutet zu haben, mag hier genügen, weil ich nicht beabsichtige, von allen eine genaue Darstellung zu geben, sondern sie hier nur gleichsam im Umriss durchgehen will und ich es für meine vorliegende Aufgabe für durchaus hinreichend halte, wenn man jede dieser Schlussarten irgendwie zu erkennen vermag.
Ich habe nun wohl zunächst anzugeben, für was und für wie vieles die Dialektik nützlich ist. Sie ist es für dreierlei; für die Übung des Verstandes, für die mündliche Unterhaltung und für die zur Philosophie gehörigen Wissenschaften. Dass sie zur Verstandesübung nützlich ist, ergibt sich aus ihr selbst; denn wenn man das hier gelehrte Verfahren beherrscht, so wird man leichter einen aufgestellten Satz erörtern können. Für die mündliche Unterhaltung nützt sie, weil man dadurch die Meinungen der Menge kennen lernt und deshalb nicht mittelst fremdartiger, sondern mittelst der diesen Leuten bekannten Sätze mit ihnen verhandeln wird und weil man das, was sie nicht richtig auszudrücken scheinen, dadurch richtigstellen wird. Endlich gehört diese Beschäftigung für die zur Philosophie gehörenden Wissenschaften, weil man, wenn man die Bedenken über einen Gegenstand nach den entgegengesetzten Richtungen darlegen kann, umso leichter das Wahre und das Falsche in jeder Wissenschaft erkennen wird. Auch für die obersten Grundsätze, welche für alle Wissenschaften gelten, hat sie ihren Nutzen; denn aus den einer bestimmten Wissenschaft eigentümlich angehörigen Grundsätzen kann man über jene nichts entwickeln, weil jene die obersten Grundsätze für alle Wissenschaften sind; man muss sie deshalb nach dem in dem einzelnen Falle Glaubwürdigen besprechen und erläutern, und dies ist die ausschließliche und eigentümlichste Aufgabe der Dialektik. Indem sie überhaupt forschender Natur ist, geleitet sie auch zu den obersten, allen Wissenschaften gemeinsamen Grundsätzen.
Wir werden diese Dialektik dann vollständig beherrschen, wenn wir sie ebenso beherrschen wie die Redekunst oder die Heilkunst und ähnliche Kunstfertigkeiten, und dies ist dann der Fall, wenn wir von dem überhaupt Ausführbaren das zustande bringen, was wir wollen. Denn auch der Redner wird nicht von jedem Gesichtspunkt aus überreden und der Arzt nicht durch jedes Mittel die Heilung bewirken und man wird nur dann, wenn er von den für den betreffenden Fall statthaften Mitteln keines verabsäumt, sagen, dass er seine Wissenschaft genügend beherrsche.
Topik, Buch 1, Kap. 1–3
* * *
Was nun die Prämissen anlangt, so hat man sie in so vielfacher Weise auszuwählen, als sie früher von mir unterschieden worden sind. Man hat also entweder die Meinungen aller oder die der meisten oder die der Weisen und von diesen entweder die aller Weisen oder der meisten oder der bewandertsten zu berücksichtigen, insoweit sie dem Scheinbaren nicht zuwider sind; ferner solche Meinungen über die Künste. Auch die Meinungen, welche dem Scheinbaren zuwider sind, kann man wie gesagt als verneinte zu einer Prämisse benutzen. Auch ist es zweckmäßig, wenn man die Prämissen nicht bloß aus dem der Meinung Entsprechenden, sondern auch aus dem diesem Ähnlichen entnimmt, wie z.B. die Prämisse, dass Gegenteile von ein und demselben Sinne wahrgenommen werden, weil ja auch nur eine Wissenschaft für sie besteht, und dass man bei dem Sehen etwas aufnimmt und nicht aussendet, weil es sich ja auch bei den übrigen Sinnen so verhält; denn wir hören, indem wir etwas aufnehmen und nicht etwas aussenden, und wir schmecken in gleicher Weise, und ebenso nehmen wir mit den übrigen Sinnen wahr. Auch muss man das, was in allen oder in den meisten Fällen gilt, als oberste und glaubwürdige Prämisse aufstellen; denn wer einen Gegenstand nicht überblickt, stellt die Prämissen nicht so auf. Auch aus den Schriften muss man seine Gründe auswählen, und die Beschreibungen muss man bei jeder Gattung besonders geben, wie z.B. von dem Guten oder von dem Geschöpf und zwar von dem Guten in seiner Allgemeinheit, indem man mit dem Was des Gegenstandes beginnt. Dabei muss man die Meinungen einzelner mit erwähnen, z.B. dass Empedokles vier Elemente für alles Körperliche angenommen habe, denn den Ausspruch eines so angesehenen Mannes lässt man leicht gelten.
Die Prämissen und die Streitsätze zerfallen im Allgemeinen in drei Gruppen; sie betreffen entweder den Bereich der Ethik oder den der Naturforschung oder das logische Denken. Zu der Ethik gehört z.B. der Satz, dass man seinen Eltern mehr als den Gesetzen gehorchen solle, wenn die Gebote beider einander widerstreiten. Zu den das Denken betreffenden Sätzen gehört z.B. der Satz, ob ein und dasselbe Wissen sich auch auf die Gegensätze beziehe oder nicht. Zur Naturforschung gehört etwa die Frage, ob die Welt ewig ist oder nicht. Auch die Streitsätze zerfallen in diese drei Gruppen. Die Beschaffenheit jeder dieser drei Gruppen kann man nicht leicht definieren; vielmehr muss man durch immer und immer wieder geübte Induktion versuchen, jede dieser Gruppen kennenzulernen und dabei die vorher gegebenen Beispiele beachten.
Für die Wissenschaft hat man nun diese Sätze der Wahrheit gemäß aufzustellen; für die Disputationen aber so, wie sie der Meinung entsprechen. Alle Prämissen hat man möglichst allgemein aufzustellen und mehrere in einen Satz zusammenzuziehen, wie z.B. die Sätze, dass ein und dieselbe Wissenschaft die widersprechenden Gegensätze befasse und dass dies auch für die Gegenteile gelte und auch für die Beziehungen. In gleicher Weise hat man allgemeine Sätze wieder so weit zu unterteilen, wie es möglich ist, z.B. dass es sonach nur eine Wissenschaft gibt, welche über das Gute und das Schlechte handelt, und nur eine, welche das Schwarze und das Weiße behandelt, und nur eine, welche das Kalte und das Warme behandelt.
Topik, Buch 1, Kap. 14
* * *
Ein logischer Schluss ist eine Rede, in der sich infolge der Aufstellung mehrerer Sätze etwas von diesen Verschiedenes notwendig ergibt und zwar dadurch, dass die gesetzten Sachverhalte so vorliegen. Mit den Worten »dadurch, dass diese gesetzten Sachverhalte so vorliegen« meine ich, dass sich dadurch die Folge ergibt, und unter dem »dass sich dadurch die Folge ergibt«, meine ich, dass man keines weiteren Begriffes bedarf, um die Folge zu einer notwendigen zu machen. Vollkommen nenne ich einen Schluss, wenn er neben den angenommenen Sätzen nichts weiter bedarf, um als ein notwendiger zu erscheinen; unvollkommen nenne ich aber den, welcher noch eines oder mehreres dazu bedarf, was sich zwar aus den aufgestellten Begriffen als notwendig ergibt, aber nicht in den Prämissen angenommen wird.
Wenn man sagt, dass etwas in etwas als einem Ganzen ist, oder wenn man etwas von allen Einzelnen eines Begriffes aussagt, so sind dies gleichbedeutende Ausdrücke. Etwas wird von allen ausgesagt, wenn keines von den in dem untergeordneten Begriff enthaltenen Einzelnen aufgezeigt werden kann, von dem das Ausgesagte nicht gälte; und wenn etwas von keinem ausgesagt wird, so hat dies die entsprechend gleiche Bedeutung.
Erste Analytiken, Buch 1, Kap. 1
Die Kategorien
Ausgangspunkt für Aristoteles’ Aufteilung des Seienden in zehn Kategorien ist die Sprache; er versucht, die Gesamtheit des Seienden begrifflich zu erfassen, indem er Grundtypen von Aussagen über die Erscheinungen unterscheidet und auf diese Weise die Vielfalt des vom Seienden Ausgesagten reduziert; dadurch erhält er im gleichen Zuge eine Typologie der Erscheinungen selbst. Als solche sind diese Kategorien Wörter, die in keinem syntaktischen Zusammenhang stehen und die das Seiende näher bestimmen. Aristoteles unterscheidet zwischen dem, was man in Verbindung sagt, z.B. der Mensch trinkt, der Mensch ist traurig, von dem was ohne Verbindung gesagt wird, z.B. der Mensch, trinkt, traurig. Die letzteren sind Kategorien, Glieder von Aussagen, die aber noch unverbunden sind und für sich betrachtet werden müssen. Sie sind weder wahr noch falsch, können weder bejaht noch verneint werden. Andere Bestandteile der Aussagen wie z.B. die Wörter einige, ist, nicht, und, wenn, dann und andere mehr gehören nicht in den Bereich der Kategorien. Die Kategorien sind demnach allgemeine Aussageweisen von grundlegenden Gattungsbegriffen, Grundbedeutungen des Seienden, und unter sie kann man alle anderen Begriffe subsumieren. Das Werk über die Kategorien analysiert demnach das Wort als Träger von Begriffsbestimmungen und der semantischen Funktionen. Diese zehn elementaren Aussageformen, die die gesamte Wirklichkeit in sich darstellen, lauten:
1.Substanz (ousia), Ding – ein Mensch, ein Pferd
2.Quantität (quantitas), Größe – drei Ellen groß
3.Qualität (qualitas), Beschaffenheit – weiß, sprachgelehrt
4.Relation (relatio), Beziehung – größer als, kleiner als
5.Wo (ubi), Ort – auf dem Markt, hier
6.Wann (quando), Zeit – jetzt, letztes Jahr
7.Lage (situs), Situation/Zustand – steht, liegt
8.Haben (habere), Eigenschaft/Besitz – ist bewaffnet, trägt ein Gewand
9.Wirken (actio), Aktivität – schneidet
10.Erleiden (passio), Passivität – wird geschnitten
Die Wörter werden entweder in Verbindung oder ohne Verbindung gesprochen; ersteres z.B. bei den Wörtern: der Mensch läuft; der Mensch siegt; ohne Verbindung z.B. bei den Wörtern: Mensch; Stier; läuft; siegt.
Von dem Seienden wird manches von einem Unterliegenden ausgesagt, aber ohne dass es in einem Unterliegenden ist; so wird z.B. der Mensch von einem unterliegenden einzelnen Menschen ausgesagt, aber er ist in keinem unterliegenden Menschen. Anderes ist dagegen in einem Unterliegenden, aber wird von keinem Unterliegenden ausgesagt; (mit: »in einem Unterliegenden« meine ich, was ohne Teil eines Dinges zu sein nicht getrennt von dem bestehen kann, in dem es ist); so ist diese einzelne Sprachgelehrtheit in der unterliegenden Seele, aber sie wird von keinem Unterliegenden ausgesagt, und ebenso ist dieses einzelne Weiß zwar in diesem unterliegenden Körper (denn jede Farbe ist in einem Körper), aber es wird von keinem Unterliegenden ausgesagt. Manches dagegen wird von einem Unterliegenden ausgesagt und ist auch in einem Unterliegenden; so ist die Wissenschaft in der unterliegenden Seele und wird von der unterliegenden Sprachgelehrtheit ausgesagt; manches ist endlich weder in einem Unterliegenden, noch wird es von einem Unterliegenden ausgesagt, z.B. dieser Mensch und dieses Pferd; denn keines von diesen ist in einem Unterliegenden und keines wird von einem Unterliegenden ausgesagt. Überhaupt wird das Unteilbare und der Zahl nach Eine von keinem Unterliegenden ausgesagt, indes kann manches davon in einem Unterliegenden sein; denn diese einzelne Sprachgelehrtheit gehört zu den in einem Unterliegenden Seienden, aber sie wird von keinem Unterliegenden ausgesagt.
Wenn etwas von einem anderen als von seinem Unterliegenden ausgesagt wird, so wird alles, was von dem Ausgesagten gilt, auch von seinem Unterliegenden gelten. So wird Mensch von einem bestimmten Menschen ausgesagt und Geschöpf wird vom Menschen ausgesagt; folglich wird Geschöpf auch von diesem bestimmten Menschen ausgesagt werden können; denn dieser bestimmte Mensch ist ein Mensch und auch ein Geschöpf.
Bei verschiedenartigen und einander nicht untergeordneten Gegenständen sind auch deren Unterschiede der Art nach verschieden; so z.B. die Unterschiede bei den Tieren und bei der Wissenschaft; denn die Unterschiede bei den Tieren sind das auf dem Lande Lebende und das Zweifüßige und das Flügel Habende und das im Wasser Lebende; die Wissenschaft dagegen hat keinen dieser Unterschiede; denn keine Wissenschaft unterscheidet sich von der anderen durch das Zweifüßigsein. Dagegen steht bei den einander untergeordneten Gattungen dem nichts entgegen, dass die Unterschiede bei ihnen dieselben sind; denn die oberen Gattungen werden von den unteren ausgesagt und folglich werden alle Unterschiede, die bei dem Ausgesagten bestehen, auch bei dem Unterliegenden vorhanden sein.
Von den ohne Verbindung gesprochenen Wörtern bezeichnen die einzelnen entweder ein Ding oder eine Größe oder eine Beschaffenheit oder eine Beziehung oder einen Ort oder eine Zeit oder einen Zustand oder ein Haben oder ein Tun oder ein Leiden.
Ein Ding ist, um es im Umriss anzudeuten, z.B. der Mensch, das Pferd; eine Größe ist z.B. das Zwei-Ellige, oder Drei-Ellige; eine Beschaffenheit ist z.B. weiß, sprachgelehrt; eine Beziehung ist z.B. doppelt, halb, größer; ein Ort ist z.B. im Lykeion, auf dem Markt; eine Zeit ist z.B. gestern, vor einem Jahr; ein Zustand z.B. das Liegen, Sitzen; ein Haben z.B. Schuhe anhaben, bewaffnet sein; ein Tun z.B. er schneidet, er brennt; ein Leiden z.B. er wird geschnitten, er wird gebrannt.
Jede der hier genannten Kategorien enthält an sich weder eine Bejahung noch eine Verneinung; aber durch die Verbindung derselben miteinander entsteht eine Bejahung oder Verneinung. Jede Bejahung oder Verneinung ist entweder wahr oder falsch; aber Wörter, die ohne Verbindung gesagt werden, sind weder wahr noch falsch, z.B. Mensch, weiß, läuft, siegt.
Kategorien oder Lehre von den Grundbegriffen, Kategorien 2–4
* * *
Nunmehr habe ich die Kategoriengattungen anzugeben, zu welchen die erwähnten vier Bestimmungen gehören. Der Kategorien gibt es der Zahl nach zehn, das Was, das Große, das Beschaffene, das Bezogene, das Wo, das Wann, der Zustand, das Haben, das Bewirken und das Erleiden. Zu einer dieser Kategorien wird immer das Nebensächliche und die Gattung und das Eigentümliche und die Definition eines Gegenstandes gehören; denn alle damit gebildeten Sätze bezeichnen entweder ein Was oder eine Beschaffenheit, oder eine Größe oder eine der anderen Kategorien, und es wird also aus jenen Bestimmungen selbst ersichtlich, dass ihr Inhalt bald ein Ding, bald eine Größe, bald eine andere der Kategorien betrifft. Wenn man z.B. von dem in einem Satz aufgestellten Menschen sagt, dass das Aufgestellte ein Mensch oder ein Geschöpf sei, so sagt man, was er ist, und gibt sein Wesen an; wenn man ferner von der im Satz aufgestellten weißen Farbe sagt, das Aufgestellte sei das Weiße oder eine Farbe, so gibt man an, was es ist, und bezeichnet eine Beschaffenheit. Ebenso wenn man vor der im Satz aufgestellten eine Elle langen Größe sagt, dass das Aufgestellte ein eine Elle langes Große sei, so gibt man an, was es ist, und bezeichnet eine Größe. Ebenso ist es mit den anderen Kategorien. In jedem solchen Fall wird, wenn entweder etwas von sich selbst ausgesagt oder wenn die Gattung genannt wird, dadurch das Was bezeichnet; wird aber etwas von einem anderen ausgesagt, so wird dann nicht das Was bezeichnet, sondern die Größe oder die Beschaffenheit oder eine andere dieser Kategorien.
Dieser Art und Anzahl sind also die Bestimmungen, worüber die Sätze lauten und woraus sie gebildet werden.
Topik, Buch 1, Kapitel 9
*In Platons Dialog Menon versucht Sokrates anhand eines didaktischen Gesprächs mit einem Sklaven zu beweisen, dass Lernvorgänge als Erinnerung an ein bereits vorhandenes (apriorisches) Wissen der Seele zu erklären sind. (Anamnesis-Lehre, s. u. S. 140f.)
Physik
Das Wesen der Natur
Die Physik ist das naturphilosophische Hauptwerk Aristoteles’; sie ist eine Art epistemologische Einführung in die Kunde der Natur und untersucht erkenntnistheoretisch die Bedingungen für das Wissen. Die Physik enthält naturphilosophische Grundbegriffe im Sinne einer allgemeinen Wissenschaft von der ganzen Natur (Physis) und fragt danach, was Wesen, Bedeutung und methodische Anwendung der grundlegenden Begriffe der Naturphilosophie sind; Entstehung, Bewegung und Veränderung, Ort/Raum, Zeit und Stetigkeit (Kontinuum) sind hierbei die Kernpunkte. Mit der Erläuterung dieser Begriffe und vor allem mit der Frage nach den Gründen und Ursachen (aitia) schafft Aristoteles die Voraussetzungen für eine Wissenschaft von der Natur, die über eine bloße Wahrnehmung der Sachverhalte hinausgeht. Zu Ende seines acht Bücher umfassenden Werks kommt er zu dem Schluss, dass es einen unbewegten Beweger geben muss. Mit diesem Ergebnis und mit der Frage nach der Verursachung von Per-se-Bewegungen und deren Faktoren greift er schon den ontologischen Bereich seines Werks Metaphysik auf. Hierzu gehört z.B. der Nachweis, dass das erste Bewegende der ewigen Bewegung keine Ausdehnung hat. Jedoch nimmt er in seiner Physik noch nicht die theologische Komponente der Gleichsetzung des unbewegten Bewegers mit Gott vor, wie er es in der Metaphysik (12, 6–10) tut (s. u. S. 177ff.).
Die Ordnung der Welt und die Struktur der natürlichen Prozesse haben für Aristoteles keine abgesonderte jenseitige Existenz wie bei Platon, sondern alles liegt in den Dingen selbst und fällt mit ihrem Wesen zusammen. Zur Natur gehören die Lebewesen (Menschen wie Tiere), die Pflanzen und die Elemente, wobei er Technik und Kunst, die Artefakte, also alles von Menschenhand Geschaffene, scharf von der Natur abgrenzt. Während alle Artefakte von außen angerieben werden müssen, formen und entwickeln sich die Naturdinge von selbst. Ursprung und Grundprinzip aller Natur sind Bewegung (kinesis) und Ruhe (stasis), wobei die Bewegung eine Veränderung (metabole) herbeiführt. Während bei den Artefakten, z.B. beim Bau eines Hauses, die Materialien und der Plan getrennt sind, sind bei Naturdingen Stoff und Form nie voneinander geschieden. Natürliche Stoffe sind in sich schon immer geformt und ihnen wohnt ein Streben nach neuen Formen inne. Die Naturphilosophie soll nach den verborgenen Ursachen der sich selbst bewegenden Natur fragen, wobei Aristoteles einen umfassenden Begriff kausaler Verknüpfungen voraussetzt.
Von dem, was es gibt, ist einiges von Natur aus, anderes hat andere Ursachen. Von Natur sind die Tiere und ihre Teile, die Pflanzen und die einfachen Körper wie Erde und Feuer und Luft und Wasser. Denn von diesen und ihresgleichen sagen wir, sie seien von Natur. Alles das eben Genannte aber unterscheidet sich offenbar von dem, was nicht von Natur ist. Jedes von Natur Seiende nämlich enthält in sich den Ursprung der Bewegung und des Stillstandes, teils bezüglich des Raums, teils bezüglich Vermehrung und Verminderung, teils bezüglich der Umbildung. Denn einer Liege und einem Kleidungsstück und was sonst noch dergleichen Gattungen sind, wohnt, insofern es das ist, was es genannt wird, und es sein Sein der Kunst verdankt, kein Antrieb zu einer Veränderung inne. Wenn es aber etwa zugleich steinern oder irden ist oder gemischt aus diesem ist, so hat es dennoch einen solchen Impuls, insoweit die Natur ein Ursprung und Ursache des Bewegens und Ruhens in demjenigen ist, worin sie ursprünglich auf wesentliche, nicht auf beiläufige Weise vorhanden ist. Ich sage aber darum nicht auf beiläufige Weise, weil einer wohl sich selbst heilen, also Ursache der Gesundheit werden und dabei ein Arzt sein kann, ohne doch dass dies, insofern er gesund wird, auf seine Heilkunde zurückzuführen ist; sondern es hat sich so ergeben in beiläufigem Zusammentreffen, dass der gleiche Mann Arzt und Patient ist, weshalb auch beides getrennt gefunden wird. In gleichem Falle ist jedes andere Ding, das da gemacht wird. Denn keines von diesen hat den Ursprung des Machens in sich selbst, sondern teils in anderen und außer sich, wie das Haus und jedes andere mit Händen gefertigte Ding; teils in sich selbst zwar, aber nicht insofern es dieses selbst ist, nämlich alles, was nebenbei sich selbst Ursache werden kann.
Eine Natur nun ist das, was wir angegeben haben; eine Natur aber hat alles, was einen solchen Ursprung in sich hat. Und dies alles ist Wesen. Denn die Natur ist immer ein Zugrundeliegendes und befindet sich in einem Zugrundeliegenden. Naturgemäß aber ist teils dieses, teils auch, was diesem zukommt, an sich, wie dem Feuer die Bewegung nach oben. Dies nämlich ist zwar weder eine Natur, noch hat es eine Natur; natürlich aber und naturgemäß ist es. Was also die Natur ist, ist nun erklärt und was das Natürliche und das Naturgemäße.
Beweisen zu wollen, dass die Natur ist, wäre lächerlich; denn es ist offensichtlich, dass von den Dingen viele so beschaffen sind. Das Deutliche aber durch das Undeutliche beweisen zu wollen, ist Sache eines Menschen, der nicht zu unterscheiden versteht, was durch sich verständlich ist und was nicht. Dass dies indessen gar leicht begegnen kann, ist bald ersichtlich. Denn durch Überlegen könnte wohl ein Blindgeborener die Farben erkennen wollen. Freilich werden solche Leute nur mit Worten ihren Begriff bilden, ohne eigentliche Erkenntnis.