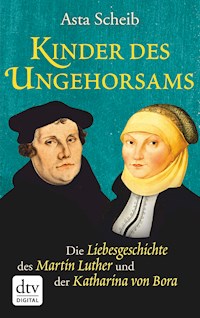3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Warum mußte sie sterben, die Malerin Ragna Juhl, die in ihrem Atelier aufgefunden wurde, erstochen mit einem ihrer Schnitzmesser? Wegen der leidenschaftlichen Liebe Valentin Sanders? Wegen seines unglücklichen Sohnes Georg? Alle sichtbaren Motive liefern keine Antwort. Bis Kommissar Stoever einem unsichtbaren Konflikt auf die Spur kommt ... Der Roman entstand nach einem Drehbuch, das Asta Scheib und Martin Walser gemeinsam für einen NDR-Tatort-Krimi – mit Manfred Krug als Kommissar Stoever – geschrieben haben. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 171
Ähnliche
Asta Scheib | Martin Walser
Armer Nanosh
Kriminalroman
FISCHER Digital
Inhalt
Kapitel I
Valentin Sander betrat sein Kaufhaus selten durch den Haupteingang. Heute hatte ihm seine Sekretärin zugerufen, er müsse sich die neue Schaufensterdekoration ansehen. Das Kaufhaus Sander hatte den Internationalen Mode-Marketing-Preis bekommen. Als Trendsetter mit eigenwilliger Philosophie, hieß es in der Begründung der Jury, der IGEDO in Düsseldorf. Effizienz. Kreation von Leitbildern. Eigenständige Angebotspolitik. Das alles war dem Kaufhaus Sander bescheinigt worden. Die Bilanzen allerdings sahen anders aus.
Schmetterlinge in riesigen Ausmaßen bildeten die Kulisse der Schaufensterdekoration. Sie schimmerten in Neonfarben wie die Blousons, Shorts, Jogginganzüge und Stirnbänder, mit deren Hilfe die Kunden des Hauses ihr Lebensgefühl steigern sollten.
Valentin beachtete nur flüchtig die Arbeit der Dekorateure, er blieb vor dem Plakat stehen, das direkt am Eingang aufgehängt war und Ragnas Ausstellung ankündigte: Heute Vernissage: KUNST IM KAUFHAUS. Und: RAGNA JUHL STELLT IM KAUFHAUS SANDER AUS.
Valentin Sander fuhr mit der Rolltreppe hoch in den fünften Stock. In der Etage für Designer-Mode war ein großer heller Raum freigemacht worden für Ragnas Bilder. Valentin war schon mehrfach hier gewesen. Aber er war bisher immer aus seinem Büro im sechsten Stock gekommen.
Diesmal, als er die Rolltreppen hochgefahren war, die Verkaufsräume mit den hochgefüllten Regalen und den Verkaufstischen durchquert hatte, vorbei an den Kunden, die sich nach magischen Gesetzen hin und her bewegten, als er die summenden, wogenden, vom Kaufrausch erhitzten Etagen hinter sich gelassen hatte, war es ihm, als schlösse sich ein Vorhang, als betrete er eine kühle, lichte Stätte. Er ging sofort auf ein Bild zu, das etwas abseits in einer Nische hing. Sein Lieblingsbild, Öl auf Karton, Ragna hatte es ›REISE IN DIE ROCKIES‹ genannt. Die Felsformationen hatten Mäuler, Sphinxaugen. Sander verstand wenig von Kunst, aber Ragnas Bilder verstand er.
Einmal hatte Ragna ihm erklären wollen, was sie male: »Meine Unruhe, meine Ungeduld, meine Zweifel, meine Halluzinationen. Meine Bilder sind wie ich. Nicht harmonisch. Schwer genießbar. Für die Hüter der Kultur, des guten Benehmens, der Moral vielleicht unannehmbar. Doch dafür« – und dabei war Ragna wieder in ihren gewohnt ruppigen Ton verfallen – »dafür bezaubern meine Bilder, wie man sieht, die Analphabeten der Kunst. Und … Zigeuner.«
Als müsse sich die Kränkung wiederholen, hörte Valentin aus dem eigentlichen Ausstellungsraum das Intonieren einer Zigeunerkapelle. Georg … das war sein Titi-Steinberger-Quartett.
Valentin lief hinüber. Auf einem Podium standen die jungen Zigeuner Holzmanno und Ziroli an den Rhythmusgitarren. Als sie Valentin sahen, schauten sie einander kurz an, griffen die Saiten und sangen: »Mare Sinte, gamle Sinte, temer tschinenna …«
»Hört auf!« Valentin schaute die beiden Sänger nicht an, ging auf seinen Sohn Georg zu, der neben Hojok stand. Hojok intonierte auf der Violine, Georg hatte die Gitarre griffbereit und blickte Hojok konzentiert an. Valentin faßte ihn am Ärmel. »Hör auf, Georg! Wer hat dir gesagt, daß ihr hier spielen sollt?«
»Vater«, sagte Georg bemüht ruhig, »Vater, du weißt, daß ich nicht Georg heiße, sondern Titi. Titi Steinberger. Der Name ist dir ja nicht ganz fremd.«
Valentin sah die jungen Sinti an, sie starrten zurück. Aufsässig? Verächtlich? Auf jeden Fall solidarisch mit Titi. Valentin bemerkte erst jetzt, daß auch Yanko da war. Und nun kam Ragna. Mit Frohwein. Wieso ist der eigentlich so heiter? Oder strahlt Ragnas Heiterkeit auf ihn ab? Frohwein sah gönnerhaft-verschwörerisch in die Runde: »Ich war das. Ich habe Ihren Sohn und seine Leute engagiert. Zu einer Ausstellungseröffnung gehört schließlich Musik.«
Valentin Sander schaute Frohwein an. Er kannte ihn seit dreißig Jahren, aber oft glaubte er, nichts von ihm zu wissen. Gefährte oder Feind – es wird sich vielleicht niemals klären. Wohl aber die Position. Daher sagte Valentin: »Wenn die hier spielen, lasse ich die Ausstellung platzen.«
Er wandte sich wieder an seinen Sohn. »Packt eure Sachen, verschwindet.«
Frohwein schaute in die Runde. Ein belustigter Verlierer, der sich seiner Sache sicher ist. Er zuckte mit den Achseln. »Dann eben keine Musik. ’tschuldigung, Chef, war gut gemeint.«
Valentin hörte nicht genau hin. Er sah, wie Ragna zu Georg ging. Er sah, wie das verkrampfte Gesicht seines Sohnes weich wurde, wie er leicht, nur für einen Sekundenbruchteil, seinen Kopf an Ragna lehnte. Valentin stellte zum erstenmal fest, daß Ragna so groß war wie Georg. Einsvierundachtzig, also vier Zentimeter größer als er selbst. Es störte ihn. Auch daß die beiden jetzt lachten. Sie schauten zu ihm herüber. Ragna strich leicht über Georgs Nasenrücken, kam dann auf Valentin zu.
Diese Zärtlichkeit für Georg konnte doch nur gegen ihn, Valentin, gerichtet sein. War Ragna raffiniert? Sie schaute Valentin an, schien belustigt, erstaunt über seine Aufregung. »Was wollen Sie, die Sinti-Musik paßt doch gut zu meinen Bildern.«
Valentin wehrte sich gegen ihr Verweigerungsspiel. Sie verbündete sich mit allen gegen ihn. Sie war nicht zu durchschauen. Warum konnte er nicht einfach nach ihr greifen, sie festhalten, ihr sagen: du gehörst zu mir. Sie hätte ihn ausgelacht. Auslachen, das gehörte zu ihrem Verführungs- und Abweisungsprogramm. In den wenigen Wochen, die sie sich kannten, war Valentin abhängig geworden von Ragnas Launen. Sie spielte mit ihm, konnte ihn mit einem Wort erledigen.
Als Frohwein jetzt auch noch fand, daß Sinti-Musik die ideale Einstimmung für die Vernissage gewesen wäre, schaute Valentin von seinem Prokuristen zu Ragna: »Ich darf das dann wohl als kleines Komplott zwischen Ihnen beiden ansehen?«
Ragnas Blick schien zu sagen: Ein Komplott mit dem? Aber wirklich nicht. Laut sagte sie: »Das ist kein Komplott. Es ist nur schade. Die Musik war doch das Tollste an der ganzen Veranstaltung hier.« Ihre Stimme klang trotzig. Sie ging zurück zu Georg, der den Arm um ihre Schulter legte, nicht ohne dabei auf seinen Vater zu schauen. Ragna und Georg verließen den Raum, Valentin wollte ihnen nach, aber Frohwein hielt ihn zurück: »Vergessen Sie nicht, Herr Sander, in fünfzehn Minuten kommen die ersten Gäste. Sie müssen die Eröffnungsrede halten.«
Valentin nickte, lief aber trotzdem hinter Ragna und Georg her, die schon an der Treppe waren. Er hielt Ragna am Arm fest: »Wohin gehen Sie, soll die Vernissage ohne Sie stattfinden?«
»Sie schmeißen die Sinti raus, ich schmeiße die Vernissage – warum eigentlich nicht?«
Valentin sah Yanko näherkommen. Hastig stieß er hervor: »Bleiben Sie, bitte, Ragna. Es ist Ihre Vernissage.«
Ragna zögerte und verabschiedete sich mit einem flüchtigen Kuß von Georg. Valentin und Yanko beobachtend, ging sie zurück zum Ausstellungsraum. Valentin wußte, daß sie ihm eine genaue Schilderung seiner Ähnlichkeit mit Yanko nicht ersparen würde.
Warum wollte er nicht aussehen wie Yanko, der Bruder seines Vaters? Yankos Haut war so braun wie die seiner indischen Vorfahren, der Sindhi. Auch Valentins Haut war braun, doch anders als Yankos Haut, die mehr als sechzig Jahre lang in der Sonne war. Im Wind. Im Regen.
Sie galten als Asoziale – es interessierte niemanden, ob sie sich Sinti, Roma, Kalderasch, Gitanos, Zeyginer oder Zigeuner nannten – sie waren Asoziale. Nach Himmlers Definition ein »auf orientalischer und vorderasiatischer Mischungsgrundlage beruhendes Durcheinander verschiedener Rassen.« Für Yanko, für seine Frau Ani, für seine vierzehn- und zwölfjährigen Töchter hatte es den Auschwitz-Erlaß gegeben. Röntgenstrahlen. Zwangssterilisierung. Dann die Festnahmeaktion. Am 21.12.1942 waren sie ins Sammellager im Hafen, Fruchtschuppen 10, Baakenbrücke 2, gekommen. Yanko und seine Sippe, 16 von 20967 Zigeunern, die nach Auschwitz-Birkenau eingeliefert wurden. Als Yanko seine Töchter zum letztenmal sah, spannte sich ihre Haut über den Knochen. Krätze, Goma-Geschwüre. Hunger, Durst, Kälte. Schreien, Weinen, Wimmern, bis der Kinderblock ins Gas ging.
Nanosh, den knapp vierjährigen Sohn des Bruders, hatten sie nicht gekriegt. Scharlach und eine Ärztin hatten ihm das Leben gerettet, und die Sanders hatten ihn großgezogen. Doch jetzt, wo Yanko jeden Tag mehr Auschwitz in sich spürte, den Tod in sich spürte, jetzt mußte Nanosh zurückkommen zu seiner Sippe. Yanko war geduldig gewesen. Sanft, ganz sanft hatte er versucht, die fremden Wurzeln auszureißen, die Verflechtungen, die aus Nanosh Steinberger Valentin Sander gemacht hatten, den Sohn des Kaufmanns Friedrich Carl Sander. Doch Valentin wollte noch nicht wissen, daß er ein Zigeuner war, ein Sinti. Vater, Mutter, Großeltern, alle waren sie Sinti. Man sah es Valentin ja auch an, jeder konnte sehen, daß Valentin ein Sinti war. Wie sein Sohn Georg. Georg war schon lange Titi, Titi Steinberger. Und je mehr Nanosh sich wehrte, je näher kam Titi der Sippe. Der Älteste, Moritz, nicht, der war ganz der Sohn seiner Mutter, einer Gadschi. Die Sanders konnten ihn behalten. Ihm, Yanko, genügten Nanosh und Titi. Und auf sie würde er nicht verzichten. Doch was war mit dieser blonden Gadschi, dieser Malerin? Was hatte Titi mit ihr zu tun? Und vor allem, was wollte Nanosh von ihr?
Valentin kannte Yankos Gedanken. Er fühlte sich Yanko nahe, manchmal. Doch zwischen ihnen lagen Jahre, in denen Valentin an einem mit Damast gedeckten Tisch gegessen hatte, in denen er die Gesetze des Lebens ablas aus dem Gesicht Friedrich Carl Sanders, der von Kaufmannstradition sprach und von humanistischem Geist. Statt des Sinti-Idioms lernte Valentin Griechisch, Latein und Englisch. Soll und Haben. Sein Jackett, das er zur Konfirmation bekam, hatte Goldknöpfe und war aus Kaschmirwolle. Und es gefiel Valentin. Es gefiel ihm auch, neben seinem Vater durch das Kaufhaus Sander zu gehen. Ihm, dem Junior, brachte man Respekt entgegen, Aufmerksamkeit. Damals wußten nur die engsten Familienmitglieder über Valentins Herkunft Bescheid. Sein dunkler Typus wurde seiner frühverstorbenen Stiefmutter, Valentina, zugeschrieben, einer geborenen Georgii aus Bozen, die in Hamburg nie heimisch geworden war und monatelang bei ihrer Familie gelebt hatte. Valentina starb früh. Valentin, fremdländisch schön und liebenswürdig, gefiel den weltoffenen Hanseaten. Er trieb sich schon als kleiner Junge im Kontor des Vaters herum, der ihn mit gespielter Strenge behandelte. Seine Schwester Henriette, Ärztin in der Eppendorfer Klinik, hatte das Kind ins Haus gebracht. Sie hatte den Jungen in der Isolierstation liegen sehen, hatte sich in das Kind verliebt, das keine Angehörigen hatte, Tag um Tag allein in seinem Bett lag. Sie hatte sich schließlich ausbedungen, den Kleinen zu pflegen. Und so war es für die Ärztin schließlich keine große Mühe, seine Papiere aus der Kartei zu entnehmen und seine Verlegung in eine Kinderklinik vorzutäuschen. Von diesem Tag an gab es Valentin Friedrich Carl Sander, den einzigen Erben des Kaufhauses Sander.
Valentin wunderte sich immer noch, daß er vor Yanko nicht weggerannt war. Er war mit seiner Klasse beim Baseball-Spiel gewesen, als ihm ein Junge sagte: »Du sollst mal zu dem da an den Zaun kommen.« Der da, das war Yanko. Valentin hatte sich geschämt, aber er war zu ihm hingegangen. Immer, wenn Yanko kam, war er zu ihm hingegangen. Auch noch als Friedrich Carl Sander schließlich davon erfahren und ihm strikt verboten hatte, mit dem Zigeuner zu reden. Auch als Tante Henriette weinte, ihn bat, Yanko doch nicht mehr zu treffen. Obwohl Valentin es eigentlich selber nicht wollte, besuchte er Yanko auch im Lager, bei den anderen. Aber er wollte nicht, daß sie ihn da besuchten, wo er zu Hause war. Und auch heute wollte Valentin nicht, daß Yanko im Haus war. Vor allen Dingen nicht bei der Vernissage.
Als Valentin Yanko endlich draußen hatte, drückte er ihm fest die Hand. Er sollte gehen. Doch Yanko war noch nicht fertig. Er schaute Valentin an, faßte ihn leicht am Jackett: »Du, laß die Gadschi, Nanosh.« »Ich heiße Valentin.« Yanko lächelte: »Nanosh Steinberger.«
Yanko schob den Ärmel seiner Jacke hoch. Er schaute Valentin an, doch der schaute weg. Er wußte ohnehin, was Yanko ihm zeigte. Die Nummer Z 2983, die auf seinem Unterarm eingraviert und deutlich zu lesen war.
»Yanko«, sagte Valentin, »in fünf Minuten muß ich die Ausstellung eröffnen.«
Yanko hielt ihm weiter den Arm hin und wiederholte, was er seinem Neffen seit Jahren erzählte: »Am Tag vor seinem Tod hat dein Vater zu mir gesagt: Yanko, nach mir führst du die Sippe. Kommt aber Nanosh davon, übergibst du an Nanosh.«
Und er setzte hinzu: »Wenn du die blonde Gadschi nicht lassen kannst, Nanosh, bist du verloren. Und sie auch.«
Was geht das dich an, dachte Valentin. Aber er wollte Yanko nicht beleidigen. Lieber vertrösten. »Auf Wiedersehen, Yanko, ich komme raus zu euch.«
Yanko drehte sich im Weggehen nochmals um. »Du kommst nicht. Leb wohl, Nanosh.«
»Ich heiße Sander. Yanko. Adieu. Ich komme trotzdem.«
Yanko ging hinaus, er erwiderte Valentins Gruß nicht.
Kapitel II
Schon acht Minuten über die Zeit. Und er mußte jetzt reden. Er, der nichts von Kunst verstand. Wahrscheinlich verstanden alle, die da in Grüppchen herumstanden, viel mehr von Kunst als er. Er sah Ragna an. Ihr Gesicht wirkte jetzt eigentümlich hilflos und hochmütig. Er dachte an das, was Yanko gesagt hatte, und begann:
»Meine Damen und Herren, es ist sicher riskant für beide, für die Künstlerin und für das Kaufhaus, aber wir wagen es, nicht wahr, Frau Juhl. Und daß Sie alle gekommen sind, zeigt mir, zeigt uns, daß wir etwas Sinnvolles getan haben. Kunst will Dauer, das Kaufhaus dient dem Augenblick …
Vielleicht tun sie einander gut, das Kaufhaus und die Kunst. Ich wünsche es uns …«
Jetzt hatte er doch genug gesagt. Warum applaudierten die denn nicht? Schließlich war doch jeder froh, wenn einer aufhörte zu reden. Warum starrten die ihn wortlos an? Er war kein Galerist. Also sagte er dann in die Gesichter hinein, daß die Ausstellung eröffnet sei, worauf auch alle klatschten. Und Frohwein filmte natürlich wieder. Valentin ging das Hobby seines Prokuristen manchmal auf die Nerven.
Frohweins Kamera war auf Karin gerichtet. Valentin sah, daß seine Frau es nicht bemerkte.
Er sah, wie Karin sozusagen darin aufging, Verachtung zu zeigen. Sie hängte sich bei Moritz ein, der sofort verstand und seine Mutter liebevoll um die Schulter faßte. Karin und Moritz, Karin und Georg. Eine Gemeinschaft aus Liebe. Valentin wußte, daß seine Söhne ihn, wenn nicht ablehnten, so doch mieden. Seit er sich von Karin entfernt hatte, hatten seine Söhne sich auch von ihm entfernt.
Zum ersten Mal waren Karin und Ragna zusammen in einem Raum. Karin, in ihrem schwarzen Hosenrock und dem kamelhaarfarbenen Jackett sah knabenhaft aus, streng. Ihr fahl blondes Haar war sorgfältig gesträhnt. Viele der Vernissage-Besucherinnen glichen Valentins Frau. Trugen Hosenröcke, Blazerjacken. Mal geblümt, mal gestreift, mal kariert. Und alle schienen eine Vorliebe für schwarze Lackslipper zu haben. Und für Täschchen, die sie an langen Riemen quer über den Körper geschnallt trugen. Vielen Gesichtern sah man die Diät an, den ständigen Kampf um die Pfunde.
Dagegen wirkte Ragna provozierend mit ihrer Größe, ihrer ungenierten Fülle unter dem enganliegenden Lurexmini. Sie war achtundzwanzig und verhielt sich wie eine Zuschauerin, lächelte spöttisch. Valentin hätte sie gern berührt. Vor allen Leuten. Ja, gerade hier vor allen Leuten. Hatte sie das in seinem Blick gelesen? Jedenfalls drehte sie sich weg, ging zu Georg, der vor einem ihrer Bilder stand.
Karin und Moritz schauten ebenfalls zu Ragna und Georg hin. Wie ähnlich die beiden einander sind, seine Frau und sein Ältester. Die Abneigung gegen Ragna schien sie einander noch ähnlicher zu machen. Valentin glaubte zu wissen, was Karin, jüngste Tochter der Reederei Feddersen, über Ragna dachte. Widerlich, dachte sie, peinlich, wie sie ihre Brüste zur Schau stellt, ihren ordinären Po. Gerade, daß ihr Kleid ihn bedeckt. In Wahrheit enthüllt so ein Schlauchkleid alles, und genau das will sie ja, diese Malerschlampe. Künstlerin will sie sein, man muß sich nur mal die Fratzen ansehen, die sie malt. Das ist, wenn es hochkommt, Symbolfetischismus, was die auf die Leinwand bringt. Weist doch geradezu auf ihren Charakter hin. Da muß man gar nicht mehr die hungrigen Blicke sehen, mit denen sie Georg ansieht. Und Valentin. Wen will sie nun eigentlich, will sie alle beide?
Karin schaute jetzt herüber. Ja, schien sie zu sagen, ja, das alles und noch mehr denke ich über deine Schlampe, über diese ordinäre Kuh, die alles zwischen uns kaputtmacht … Valentin erschrak. Er hatte Karin diesen Blick nicht zugetraut.
Ausgerechnet Bleichertz mußte ihm jetzt seinen blanken Eierschädel aufdrängen. Bleichertz, der glaubte, Valentin loben zu müssen. So wie eine Größe den absoluten Anfänger tröstet: »Herr Sander, Kompliment. Sie haben da eine Begrüßung hingelegt. Gratuliere. Sie machen das wie der routinierteste Galerist. Doch, doch, doch.«
Dieser Arsch. Wie der Ragna anschaut. Kunstsammler ist der Herr Bleichertz, Mäzen. Redet von der Sexualsymbolik in Ragnas Bildern. Natürlich, was soll Herr Bleichertz auch sonst darin sehen. Ragnas Arbeit sei von schockierender Originalität. Das geht dem bloß so von den Lippen. Dem Parfum-Grossisten. Bleichertz weiß wahrscheinlich genau, was Valentin über ihn denkt. Aber Valentin hat gelernt, Leuten wie Bleichertz zu sagen, was sie hören wollen: »Schön, daß Sie gekommen sind, Herr Bleichertz. Für die Künstlerin eine Auszeichnung, ein Sammler wie Sie …«
Bleichertz lächelte, nickte, sagte ernst: »Selten, daß die Bilder so attraktiv sind wie die Künstlerin …«
In dieser Sekunde sah Valentin, daß Moritz auf Georg und Ragna zuging, daß er sie trennen wollte. Im Auftrag von Karin? Karin konnte doch nicht wollen, daß es offenen Ärger gab. Sie konnte doch nicht so steif herumstehen.
Valentin ging zu seiner Frau hinüber. »Bitte, Karin …« sagte er und wußte nicht weiter.
Karin blickte ihn ausdruckslos an.
»Ich interessiere mich nicht für moderne Kunst«, sagte sie, »das weißt du. Und für diese Kunst schon gar nicht.«
»Warum bist du dann überhaupt hergekommen?« Valentin sah dabei nicht Karin an, sondern Frohwein, der mit seiner Kamera offenbar gar nicht mehr aufhören konnte, Ragna zu filmen. Daß er das Drama, das sich zwischen Valentins Söhnen und Ragna abspielte, förmlich anheizte mit seiner Kamera, schien ihm egal zu sein. Moritz versuchte, Georg von Ragna wegzudrängen, er redete auf ihn ein, schob sich zwischen Ragna und Georg. Valentin hörte seine Frau sagen: »Moritz wollte, daß ich mitkomme. Er sagte, wenn ich nicht mitginge, mache ich es dir zu leicht.«
Valentin konnte sich nicht mehr um Karin kümmern. »Entschuldige«, sagte er und ging so schnell, wie er hier gehen durfte, zu den Söhnen und Ragna hinüber.
Moritz konnte es kaum erwarten, seinem Vater ins Gesicht zu sagen, was er dachte: »Ich finde nicht, daß Georg hier in aller Öffentlichkeit als dein Nebenbuhler auftreten sollte. Es genügt ja, wenn du deine Begeisterung für die Künstlerin herausbrüllst.«
Moritz brüllte nicht. Moritz wurde nie laut. Valentin und Moritz standen einen langen Augenblick lang stumm voreinander.
Seinen Bruder Georg konnte Moritz zur Not noch verstehen. Der war gerade mal zwanzig und ganz berauscht von dieser Malerwalküre. Dichtete indisch. Hing bei den Sintis rum. Ihm, Moritz, konnte das egal sein. Kam er ihm wenigstens nicht in die Quere. Georg und das Kaufhaus Sander? Undenkbar. Deshalb sollte der Kleine doch machen, was er wollte. Und wenn er sie schaffte, die Juhl – auch gut. Aber sein Vater! Der war schließlich bald fünfzig. Was glaubte der denn, was er noch alles zu erwarten hatte? Mama war wohl nicht mehr genug für ihn? Mußte er sie auch noch blamieren, hier vor den Leuten? Ihm reichte es jetzt. Aber seinen Vater, den kaufte er sich noch. Und die Juhl. Die konnte was erleben.
»Komm, Mama«, sagte Moritz. »Und du, Georg, kommst auch mit.« Er überhörte, daß Valentin ihn mehr drohend als bittend anrief. Moritz mußte seine Mutter trösten, ritterlich entschädigen für die Blamage, die der Vater ihr zufügte.
Valentin schaute seiner Familie nach, die, sich hier und da verabschiedend, die Ausstellung verließ. Bedrückt suchte er Ragna. Obwohl er schon lange wußte, daß sie bei Bleichertz war. Sie standen in einem Halbkreis von Zuhörern vor Ragnas Bild ›Hafen mit Hexen‹. Bleichertz referierte so selbstvergessen, als hätte er das Bild selber gemalt: »Der Themenkreis Frau Juhls – sehen Sie, immer satirische Zeit- und Gesellschaftskritik. Ihre Bilder, welches auch immer, sind sozusagen Sozialgedichte, feministische Gerichtstage …«
War Ragna begeistert? Oder wollte sie endlich dem Geschwafel ein Ende machen? Sie ging auf Bleichertz zu, nahm seinen Kopf, zog ihn zu sich und küßte ihn auf die Glatze. Die Zuhörer klatschten. Das gefiel ihnen besser als jedes Bild. Valentin meinte, den Geschmack von Bleichertz’ Glatze auf den Lippen zu spüren. Am liebsten würde er ausspucken. Für einen Moment bildete er sich ein, er könnte Ragna ganz dieser Glatze überlassen, doch dann überwältigte ihn seine geradezu orientalische Eifersucht. Ihm wurde schwindlig, er spürte, wie das Blut in seinen Ohren sauste. Als er sich überzeugt hatte, daß seine Familie gegangen war, daß sie den Glatzenkuß nicht auch noch erlebt hatte, sah er seine Sekretärin. Sie schien in diesem Moment der einzige Mensch zu sein, den er ertragen konnte. Er nahm Frau Stoll in die Arme. »Schön, daß Sie gekommen sind, wirklich schön.«