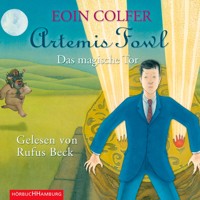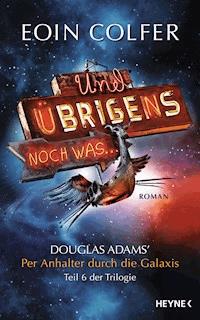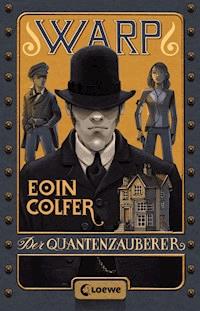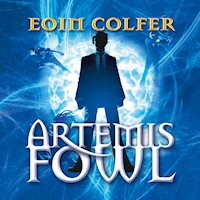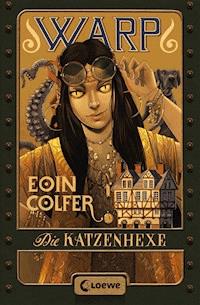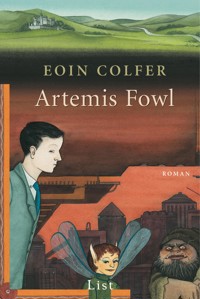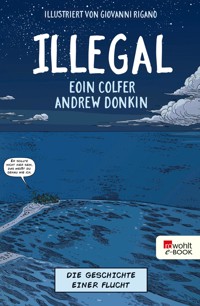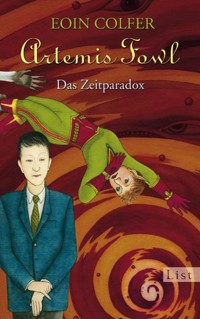
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein neues phantasievolles Abenteuer des jugendlichen Genies Artemis Fowl und seiner Freunde aus dem Erdland: Durch einen Zeittunnel reisen Artemis und Elfe Holly Short in die Vergangenheit. Um das Leben seiner Mutter zu retten, muss Artemis Fowl gegen sein jüngeres Ich kämpfen. Rasant, mitreißend und raffiniert erzählt! Die Mutter von Artemis Fowl ist an einer tödlichen Unterweltseuche erkrankt. Es gibt nur eine Möglichkeit, sie zu retten - ein Medikament, das aus einer ausgestorbenen Lemuren-Art hergestellt wird. Und es war Artemis selbst, der vor vielen Jahren dafür gesorgt hat, dass das letzte Exemplar dieser Tierart getötet wurde. In einem Zeittunnel werden Artemis und Holly Short in die Vergangenheit transportiert. Sie müssen dem zehnjährigen Artemis und seinem Diener Butler das Tier abjagen. Was sie nicht ahnen - auch die größte Verbrecherin des Erdlandes, Opal Koboi, hat es auf den Lemuren abgesehen. Das Tier kann ihr die Kräfte verleihen, die ihr noch fehlen, um endlich Herrscherin über das Erdland und die Menschen zu werden. Eine wilde und höchst gefährliche Verfolgungsjagd beginnt. Artemis Fowl ist der berühmt berüchtigte Spross einer irischen Gangsterfamilie und zählt zu den besten Dieben im Land. Er ist hochintelligent, extrem technikaffin, mit hervorragenden Manieren und stets bestens gekleidet. Wenn er nicht gerade abgefahrene Technik-Gadgets entwickelt, legt er sich mit Schwerkriminellen an, um sie zu beklauen, was diese natürlich nicht so mögen. Unterstützung bekommt Artemis – wenn er sie denn mal braucht – von der Elfe Holly Short, die vom Erdvolk unter der Erde stammt. (Und ohne sie wäre er, ehrlich gesagt, schon öfter verloren gewesen.) Die acht Bände der Artemis-Fowl-Serie: Band 1: Artemis Fowl Band 2: Artemis Fowl – Die Verschwörung Band 3: Artemis Fowl – Der Geheimcode Band 4: Artemis Fowl – Die Rache Band 5: Artemis Fowl – Die verlorene Kolonie Band 6: Artemis Fowl – Das Zeitparadox Band 7: Artemis Fowl – Der Atlantis-Komplex Band 8: Artemis Fowl – Das magische Tor
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem TitelArtemis Fowland The Time Paradox im Verlag Puffin Books, London.
Das Tennyson-Gedicht wurde zitiert nach: Englische und amerikanische Dichtung, Bd. 2, München 2000. Übersetzung: Werner v. Koppenfels
Das Zitat stammt aus: Lewis Carroll, Alice im Wunderland, Frankfurt am Main 1970, Übersetzung: Christian Enzensberger
4. Auflage 2009
List ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH
ISBN 978-3-471-92001-5
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich
© Eoin Colfer, 2008 © der deutschsprachigen Ausgabe
Für Grace, eine neue Tochter,
Fowl Manor, Dublin, Irland
Eine knappe Stunde nördlich der schönen Stadt Dublin liegt das Anwesen der Familie Fowl, dessen Grenzen sich im Lauf der letzten fünfhundert Jahre kaum verändert haben.
Das Herrenhaus ist von der Hauptstraße aus nicht zu sehen, da das Grundstück von alten Eichen und einer hohen Steinmauer umschlossen ist. Das Tor besteht aus massivem Stahl, und oben auf den Pfosten sind Überwachungskameras angebracht. Wer die Erlaubnis erhält, das unauffällig elektrifizierte Tor zu passieren, findet sich auf einer Einfahrt aus feinem Kies wieder, die in sanften Schwüngen durch eine Grünanlage führt, deren einst perfekt gepflegter Rasen sich mittlerweile in eine wilde Blumenwiese verwandelt hat.
Das Haus selbst ist dicht von Bäumen umgeben, mächtigen Eichen und Kastanien und dazwischen zierlicheren Eschen und Weiden. Die einzigen Anzeichen menschlichen Wirkens sind die von Unkraut frei gehaltene Einfahrt und die Lampen, die ohne Kabel und Befestigung in der Luft zu schweben scheinen.
Fowl Manor hat im Lauf der Jahrhunderte etliche Abenteuer erlebt. In den letzten Jahren hatten diese Abenteuer ein gewisses magisches Etwas, von dem jedoch die meisten Mitglieder der Familie Fowl nichts wissen. Sie haben keine Ahnung, dass die Eingangshalle völlig zerstört wurde, als die Unterirdischen einen Troll in die Schlacht schickten gegen den ältesten Sohn der Familie, Artemis, ein Verbrechergenie. Damals war Artemis zwölf Jahre alt. Heutzutage sind die Fowl’schen Aktivitäten im Herrenhaus jedoch vollkommen legal. Kein Sondereinsatzkommando der Unterirdischen stürmt die Zinnen. Keine Elfe der Zentralen Untergrund-Polizei wird im Keller gefangengehalten. Und kein Zentaur justiert Abhörgeräte oder führt Thermoscans durch. Artemis hat Frieden mit dem Erdvolk geschlossen, und mit einigen Unterirdischen verbindet ihn sogar eine echte Freundschaft.
Seine kriminellen Aktivitäten haben Artemis zwar einiges eingebracht, aber sie haben ihn noch mehr gekostet. Menschen, die ihm am Herzen liegen, sind durch seine hinterhältigen Pläne verängstigt, verletzt und sogar entführt worden. Die vergangenen drei Jahre über hielten seine Eltern ihn für tot, während er im Zeitmeer gegen Dämonen kämpfte. Und bei seiner Rückkehr musste er entgeistert feststellen, dass die Welt sich auch ohne ihn weitergedreht hatte und er der ältere Bruder von zweijährigen Zwillingen war, Beckett und Myles.
Kapitel 1
Artemis saß in einem ochsenblutroten Ledersessel, vor sich auf dem Boden Beckett und Myles. Seine Mutter lag mit einer leichten Grippe im Bett, sein Vater war zusammen mit dem Arzt bei ihr im Zimmer, und so hatte Artemis es übernommen, sich um die beiden Kleinen zu kümmern. Und was gab es Unterhaltsameres für Kinder als ein paar Lektionen?
Er hatte für die Gelegenheit eine lässige Kombination aus einem himmelblauen Seidenhemd, hellgrauer Wollhose und Gucci-Slippern gewählt. Sein schwarzes Haar hatte er aus der Stirn zurückgestrichen, und er hatte eigens eine fröhliche Miene aufgesetzt, was bei Kindern bekanntlich gut ankam.
»Muss Artemis Aa?«, fragte Beckett, der auf dem tunesischen Läufer hockte, nur mit einem grasfleckigen Unterhemd bekleidet, das er sich über die Knie gezogen hatte.
»Nein, Beckett«, sagte Artemis munter. »Ich versuche nur, fröhlich auszusehen. Und solltest du nicht eine Windel umhaben?«
»Windel«, schnaubte Myles verächtlich. Er hatte sich bereits mit vierzehn Monaten selbst beigebracht, aufs Töpfchen zu gehen, indem er aus mehreren Lexika eine Treppe gebaut und so die Klobrille erklommen hatte.
»Keine Windel«, schmollte Beckett und schlug nach einer summenden Fliege, die sich in seinen zerzausten blonden Locken verfangen hatte. »Beckett hasst Windel.«
Artemis, der davon ausging, dass das Kindermädchen Beckett durchaus gewindelt hatte, fragte sich flüchtig, wo seine Windel wohl geblieben war.
»Schon gut, Beckett«, sagte Artemis. »Schieben wir das Thema Windeln vorerst vom Tisch und wenden uns der heutigen Lektion zu.«
»Schokolade auf Tisch«, sagte Beckett und reckte die Arme nach der imaginären Schokolade.
»Ja, stimmt. Manchmal ist Schokolade auf dem Tisch.«
»Und Espresso«, fügte Beckett hinzu, der einige seltsame Vorlieben hatte, unter anderem für löslichen Espresso und Sirup. Vorzugsweise aus derselben Tasse. Einmal hatte Beckett es geschafft, sich mehrere Löffel dieser Mixtur einzuverleiben, bevor man sie ihm wegnehmen konnte. Danach hatte der Zweijährige achtundzwanzig Stunden lang nicht geschlafen.
»Können wir jetzt die neuen Wörter lernen, Artemis?«, fragte Myles, der zu dem Schimmelglas in seinem Zimmer zurückwollte. »Ich mache gerade Sperimente mit Professor Primat.«
Professor Primat war ein Plüschaffe und gelegentlich Myles’ Laborpartner. Der niedliche Spielkamerad steckte die meiste Zeit in einem Borosilikatglas auf dem »Speriment«-Tisch. Artemis hatte die Sprachbox des Affen so umprogrammiert, dass sie auf Myles’ Stimme mit zwölf verschiedenen Sätzen antwortete, unter anderem »Es lebt! Es lebt!« und »Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen, Professor Myles«.
»Du kannst gleich zu deinem Laboratorium zurück«, sagte Artemis wohlwollend. Myles war aus demselben Holz geschnitzt wie er selbst, ein geborener Wissenschaftler. »Also gut, Jungs. Ich habe mir gedacht, heute nehmen wir mal ein paar Begriffe rund um das Thema Restaurantbesuch durch.«
»Schnodder sieht aus wie Würmer«, sagte Beckett, der gerne das Thema wechselte.
Artemis war angenervt. Würmer standen ganz gewiss nicht auf der Karte eines Restaurants, höchstens Schnecken. »Vergiss die Würmer.«
»Vergiss Würmer?«, fragte Beckett entsetzt.
»Nur für den Moment«, beruhigte ihn Artemis. »Sobald wir mit unserem Wörterspiel fertig sind, kannst du an alles denken, was du willst. Und wenn ihr zwei richtig brav seid, nehme ich euch nachher vielleicht mit zu den Pferden.«
Reiten war die einzige Form körperlicher Ertüchtigung, an der Artemis mittlerweile Gefallen fand. Was hauptsächlich daran lag, dass das Pferd die meiste Arbeit erledigte.
Beckett deutete auf sich selbst. »Beckett«, sagte er stolz. Die Würmer waren in der Tat bereits vergessen.
Myles seufzte. »Einfalzpinsel.«
Artemis begann, seine Unterrichtspläne zu bereuen, doch da er nun einmal angefangen hatte, war er entschlossen, die Sache durchzuziehen.
»Myles, nenn deinen Bruder nicht Einfaltspinsel.«
»Keine Sorge, Artemis, er mag das. Du bist doch ein Einfalzpinsel, nicht wahr, Beckett?«
»Beckett Einfalzpinsel«, stimmte der kleine Junge strahlend zu.
Artemis rieb sich die Hände. »Gut. Fangen wir an. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Café am Montmartre.«
»In Paris«, sagte Myles und zupfte selbstgefällig an der Krawatte, die er sich aus dem Schrank seines Vaters geliehen hatte.
»Genau, in Paris. Und sosehr ihr euch auch bemüht, es gelingt euch nicht, die Aufmerksamkeit des Kellners auf euch zu lenken. Was tut ihr?«
Die beiden Kleinen starrten ihn verständnislos an, und Artemis fragte sich, ob er das Unterrichtsniveau vielleicht ein wenig zu hoch angesetzt hatte. Doch zu seiner Erleichterung – und gelinden Überraschung – entdeckte er einen Funken des Begreifens in Becketts Augen.
»Äh … Butler sagen, er soll ihn windelweich schlagen?«
Myles war beeindruckt. »Ich schließe mich Einfalzpinsel an.«
»Nein!«, sagte Artemis. »Ihr hebt einfach den Zeigefinger und sagt laut und deutlich: ›Ici, garçon.‹«
»Issikarton?«
»Was? Nein, Beckett, nicht Karton.« Artemis seufzte. Das Ganze war unmöglich. Unmöglich. Dabei hatte er noch nicht mal die elektronische Lernkartei oder seinen neuen, modifizierten Laserpointer zum Einsatz gebracht, mit dem man entweder ein Wort hervorheben oder ein Loch durch mehrere Schichten Stahl brennen konnte, je nach gewählter Einstellung.
»Wir versuchen es jetzt mal gemeinsam. Hebt den Zeigefinger und sagt: ›Ici, garçon.‹ Und alle zusammen …«
Die kleinen Jungen folgten seiner Aufforderung, bemüht, ihrem übergeschnappten großen Bruder eine Freude zu machen.
»Ici, garçon«, sagten sie im Chor, den pummeligen Zeigefinger in die Höhe gereckt. Und dann flüsterte Myles seinem Zwillingsbruder verstohlen zu: »Artemis Einfalzpinsel.«
Artemis hob die Hände. »Ich gebe auf. Ihr habt gewonnen. Schluss mit dem Unterricht. Wie wär’s, wenn wir ein paar Bilder malen?«
»Ausgezeichnet«, sagte Myles. »Ich male mein Schimmelglas.«
Beckett traute dem Frieden noch nicht. »Schluss mit Unterricht?«
»Ja«, sagte Artemis und fuhr seinem kleinen Bruder übers Haar, eine Geste, die er augenblicklich bereute. »Endgültig Schluss mit Lernen. Für heute.«
»Gut. Beckett freut sich. Siehst du?« Wieder zeigte der Junge auf sich, besonders auf das breite Lächeln auf seinem Gesicht.
Die drei Brüder lagen bäuchlings auf dem Fußboden, bis zu den Ellenbogen mit Plakatfarbe beschmiert, als ihr Vater das Zimmer betrat. Seine Pflichten als Krankenpfleger schienen ihn erschöpft zu haben, aber sonst wirkte er gesund und stark und bewegte sich wie ein durchtrainierter Sportler, trotz seines künstlichen Biohybrid-Beins. Die Prothese bestand aus verlängertem Knochen, Titan und implantierten Sensoren, die es Artemis senior ermöglichten, das Bein über Hirnsignale zu bewegen. Manchmal legte er eine in der Mikrowelle erwärmte Gelkompresse auf, um die Steifheit in den Gelenken zu lockern, doch davon abgesehen, benahm er sich, als sei das Bein sein eigenes.
Farbbeschmiert erhob sich Artemis auf die Knie.»Ich habe die französischen Vokabeln aufgegeben und mich den Zwillingen beim Spielen angeschlossen.« Grinsend wischte er sich die Hände ab. »Es ist erstaunlich befreiend. Wir versuchen uns in Fingermalerei. Ich habe versucht, einen kleinen Vortrag über Kubismus einzuschmuggeln, aber mir zum Dank nur eine Farbattacke eingefangen.«
Da bemerkte Artemis, dass sein Vater mehr als nur erschöpft war. Er war besorgt.
Artemis überließ die Zwillinge sich selbst und ging mit seinem Vater zu der deckenhohen Bücherwand.
»Was ist los? Hat sich Mutters Grippe verschlimmert?«
Artemis’ Vater stützte sich mit einer Hand auf die fahrbare Leiter, um das Gewicht von seinem künstlichen Bein zu nehmen. Auf seinem Gesicht lag ein seltsamer Ausdruck, einer, den Artemis noch nie zuvor bei ihm gesehen hatte.
Plötzlich begriff er, dass sein Vater nicht nur besorgt war. Artemis Fowl senior hatte Angst.
»Vater?«
Artemis senior packte die Sprosse der Leiter mit solcher Kraft, dass das Holz knackte. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, schien dann jedoch seine Meinung zu ändern.
Nun wurde auch Artemis unruhig. »Vater, du musst es mir sagen.«
»Natürlich.« Sein Vater zuckte zusammen, als wäre er mit den Gedanken ganz woanders gewesen. »Ich muss es dir sagen …«
Da rann eine Träne aus seinem Auge, tropfte auf sein Hemd und hinterließ einen dunklen Fleck auf dem Blau.
»Ich weiß noch, wie ich deiner Mutter zum ersten Mal begegnet bin«, sagte er. »Ich war in London, auf einer privaten Feier im Ivy Restaurant. Ein Saal voller Gangster, und ich war der größte von ihnen. Sie hat mich verwandelt, Arty. Hat mir das Herz gebrochen und es dann wieder zusammengesetzt. Angeline hat mir das Leben gerettet. Und jetzt …«
Artemis wurde ganz flau, und das Blut rauschte in seinen Ohren wie die Wogen des Atlantiks.
»Liegt Mutter im Sterben, Vater? Ist es das, was du mir zu sagen versuchst?«
Die Vorstellung erschien ihm absurd. Unmöglich.
Sein Vater blinzelte, als erwachte er aus einem Traum.
»Nicht, solange die Fowl-Männer noch ein Wörtchen mitzureden haben, was, mein Sohn? Jetzt ist es an der Zeit, deinem Ruf gerecht zu werden.« In den Augen von Artemis senior schimmerte Verzweiflung. »Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht. Alles.«
Artemis spürte, wie Panik in ihm aufstieg.
Alles, was in unserer Macht steht?
Ganz ruhig, ermahnte er sich. Du kannst das in den Griff kriegen.
Artemis verfügte zwar noch nicht über alle Informationen, aber er war zuversichtlich, dass seine Mutter, was immer sie auch für eine Krankheit haben mochte, mit einem Schuss unterirdischer Magie geheilt werden konnte. Schließlich war er das einzige Menschenwesen auf der Erde, das einen Funken Magie in seinem Körper hatte.
»Vater«, fragte er sanft, »ist der Arzt gegangen?«
Die Frage schien Artemis senior einen Moment lang zu verwirren, dann fing er sich wieder.
»Gegangen? Nein. Er ist in der Eingangshalle. Ich dachte, du könntest vielleicht mal mit ihm reden. Nur für den Fall, dass mir etwas entgangen ist …«
Artemis war nicht allzu überrascht, als er in der Halle Dr. Hans Schalke erblickte, Europas führenden Experten für seltene Krankheiten, und nicht den Hausarzt. Natürlich hatte sein Vater Schalke kommen lassen, als Angeline Fowls Zustand sich verschlechterte. Schalke wartete unter dem kunstvollen Familienwappen der Fowls, zu seinen Füßen eine Arzttasche aus festem Leder, die aussah wie ein riesiger Käfer. Er schloss gerade den Gürtel seines grauen Regenmantels und sagte mit scharfer Stimme etwas zu seiner Assistentin.
Alles an dem Arzt war scharf, vom spitzen Dreieck seines gelichteten Haaransatzes über die lange, schmale Nase bis zu den kantigen Wangenknochen. Zwei ovale Brillengläser vergrößerten Schalkes blaue Augen, und sein strichförmiger, nach unten gezogener Mund bewegte sich kaum, wenn er sprach.
»Sämtliche Symptome«, sagte er zu seiner Assistentin. »In allen Datenbanken, verstanden?«
Die Assistentin, eine zierliche junge Frau in einem schlichten, aber teuren grauen Kostüm, nickte mehrmals und tippte die Anweisungen auf den Bildschirm ihres Smartphones.
»Auch die Datenbanken der Universitäten?«, fragte sie.
»Alle«, wiederholte er mit ungeduldigem Nicken. »Habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt? Oder ist mein Akzent so stark, dass Sie mich nicht verstehen?«
»Entschuldigen Sie, Dr. Schalke«, sagte die Assistentin zerknirscht. »Alle, selbstverständlich.«
Artemis ging mit ausgestreckter Hand auf den Arzt zu. Schalke erwiderte die Geste nicht.
»Ansteckungsgefahr, Master Fowl«, sagte er regungslos. »wir wissen noch nicht, ob die Krankheit Ihrer Mutter ansteckend ist.«
Artemis ließ die Hand sinken und versteckte sie zur Faust geballt hinter dem Rücken. Der Arzt hatte natürlich recht.
»Wir sind uns noch nicht begegnet, Doktor. Wären Sie so freundlich, mir die Symptome meiner Mutter zu beschreiben?«
Dr. Schalke verzog ärgerlich das Gesicht. »Wie Sie wünschen, junger Mann, aber ich bin es nicht gewohnt, mit Kindern zu tun zu haben, ich werde Ihnen die bittere Pille also nicht versüßen.«
Artemis schluckte. Seine Kehle war plötzlich ganz trocken.
Bittere Pille.
»Der Zustand Ihrer Mutter ist vermutlich einzigartig«, sagte Schalke und schickte seine Assistentin mit einer Handbewegung an die Arbeit. »Nach allem, was ich feststellen kann, scheinen ihre Organe zu versagen.«
»Welche Organe?«
»Alle«, sagte Schalke. »Ich muss einige Geräte aus meinem Labor im Trinity College holen, da Ihre Mutter nicht transportfähig ist. Bis zu meiner Rückkehr wird meine Assistentin, Miss Book, ihren Zustand überwachen. Miss Book ist nicht nur zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch eine ausgezeichnete Krankenschwester. Eine nützliche Kombination, finden Sie nicht auch?«
Aus dem Augenwinkel sah Artemis, wie Miss Book hektisch um eine Ecke verschwand und dabei stotternd in ihr Smartphone sprach. Er hoffte, dass sie mehr Souveränität an den Tag legte, wenn sie sich um seine Mutter kümmerte.
»Wahrscheinlich. Alle Organe meiner Mutter? Wirklich alle?«
Schalke hatte offenbar keine Lust, sich zu wiederholen. »Die Symptome erinnern an eine aggressivere Form von Lupus, kombiniert mit allen drei Stadien von Borreliose. Etwas Ähnliches habe ich mal bei einem Amazonas-Stamm gesehen, aber nicht in dieser Ausprägung. Wenn sich ihr Zustand weiter in diesem Tempo verschlechtert, bleiben ihr nur noch wenige Tage. Um ehrlich zu sein, ich bezweifle, dass wir genug Zeit haben, um alle Tests durchzuführen. Was wir bräuchten, ist ein Wunderheilmittel, und nach meiner beträchtlichen Erfahrung gibt es die leider nicht.«
»Vielleicht doch«, sagte Artemis geistesabwesend.
Schalke bückte sich nach seiner Tasche. »Vertrauen Sie der Wissenschaft, junger Mann«, riet ihm der Arzt. »Die wird Ihrer Mutter eher helfen als irgendeine geheimnisvolle Macht.«
Artemis hielt Schalke die Tür auf und sah ihm nach, wie er die zwölf Stufen zu seinem alten Mercedes hinunterging. Der Oldtimer war grau, wie die düsteren Wolken am Himmel.
Für die Wissenschaft bleibt keine Zeit mehr, dachte der irische Teenager. Meine einzige Hoffnung ist die Magie.
Als Artemis in sein Arbeitszimmer zurückkehrte, saß sein Vater auf dem Fußboden, und Beckett turnte wie ein Affe auf ihm herum.
»Kann ich jetzt zu Mutter?«, fragte Artemis.
»Ja«, sagte Artemis senior. »Geh ruhig, und sieh, was du herausfinden kannst. Mach dir ein Bild von den Symptomen für deine Recherche.«
Meine Recherche? dachte Artemis. Es klingt nicht so, als hätten wir dafür noch Zeit.
Butler, Artemis’ massiger Leibwächter, wartete am Fuß der Treppe auf ihn. Er trug eine komplette Kendo-Montur, nur den Gesichtssschutz hatte er hochgeklappt, so dass die wettergegerbten Züge zu sehen waren.
»Ich war im Dojo und habe mit der Holographie gekämpft«, erklärte er. »Ihr Vater hat mich gerufen und gesagt, ich würde dringend gebraucht. Was gibt es?«
»Es ist wegen Mutter«, sagte Artemis und ging an ihm vorbei die Treppe hinauf. »Sie ist schwer krank. Ich muss sehen, was ich tun kann.«
Butler eilte mit knarzendem Brustschild hinter ihm her. »Seien Sie vorsichtig, Artemis. Magie ist keine Wissenschaft, sie ist nicht kontrollierbar. Sie könnten Mrs Fowls Zustand unbeabsichtigt noch verschlimmern.«
Artemis war am Ende der breiten Treppe angekommen und streckte zögernd die Hand nach dem Knauf der Schlafzimmertür aus, als wäre er elektrisch geladen.
»Ich fürchte, schlimmer kann ihr Zustand gar nicht mehr werden …«
Artemis ging allein in das Zimmer, während Butler sich von seinem Hon-nuri-Brustschild befreite. Darunter trug der Leibwächter einen Jogginganzug anstelle des weiter geschnittenen traditionellen Kampfanzugs. Brust und Rücken waren schweißgetränkt, doch Butler ignorierte den Drang, sich zu duschen, und hielt vor der Tür Wache. Ihm war klar, dass es ihm nicht zustand zu lauschen, aber er hätte doch gerne gewusst, was drinnen gesprochen wurde.
Butler war der einzige Mensch, der die ganze Wahrheit über Artemis’ magische Eskapaden kannte. Er hatte seinem jungen Schützling bei all diesen Abenteuern zur Seite gestanden und über sämtliche Kontinente hinweg gegen Unterirdische und Menschen gekämpft. Aber die Reise ins Zeitmeer hatte Artemis allein angetreten, und bei seiner Rückkehr war er verändert gewesen. Ein Teil von Artemis war jetzt magisch, und zwar nicht nur das Auge, das er mit Captain Holly Short getauscht hatte. Auf der Reise von der Erde ins Zeitmeer und zurück hatte er es irgendwie fertiggebracht, den Unterirdischen ein paar Funken Magie abzuluchsen, als ihre Atome im Zeittunnel durcheinandergewirbelt worden waren. Nach seiner Rückkehr hatte er seinen Eltern mit Hilfe des magischen Blicks »nahegelegt«, einfach nicht darüber nachzudenken, wo er während der letzten Jahre gewesen war. Kein sonderlich ausgefeilter Plan, zumal sein Verschwinden weltweit Schlagzeilen gemacht hatte und das Thema bei jeder gesellschaftlichen Veranstaltung, an der die Fowls teilnahmen, wieder aufs Tapet kam. Doch solange Artemis nicht an die nötige ZUP-Ausrüstung für eine Erinnerungslöschung herankam oder selbst eine entwickelte, musste die Maßnahme genügen. Er hatte seinen Eltern »nahegelegt«, auf jedwede Frage nach seinem Verbleiben einfach zu antworten, das sei eine Familienangelegenheit, und sie wollten nicht darüber sprechen.
Artemis ist ein magiebegabtes Menschenwesen, dachte Butler. Das einzige.
Und Butler war sicher, dass Artemis versuchen würde, seine Mutter mit Hilfe der Magie zu heilen. Es war ein gefährliches Spiel, denn die Magie war kein natürlicher Bestandteil seines Wesens. Es konnte gut sein, dass der Junge zwar die bestehenden Symptome kurierte, aber dafür neue hervorrief.
Langsam betrat Artemis das Schlafzimmer seiner Eltern. Die Zwillinge stürmten hier zu allen Tages- und Nachtzeiten hinein und warfen sich auf das große Himmelbett, um mit ihren protestierenden Eltern zu toben, doch Artemis hatte so etwas nie getan. Seine Kindheit war von Ordnung und Disziplin geprägt gewesen.
Klopf immer erst an, bevor du hereinkommst, Artemis, hatte sein Vater ihn ermahnt. Das ist ein Zeichen von Respekt.
Doch sein Vater hatte sich verändert. Eine nur knapp überstandene Begegnung mit dem Tod sieben Jahre zuvor hatte ihm vor Augen geführt, was wirklich wichtig war. Jetzt war er stets bereit, mit seinen geliebten Söhnen zu schmusen und herumzutoben.
Für mich ist es zu spät, dachte Artemis. Ich bin zu alt für solche Balgereien mit Vater.
Seine Mutter war anders. Sie war nie abweisend zu ihm gewesen, außer während ihrer Depression nach dem Verschwinden seines Vaters. Aber die Magie der Unterirdischen und die Rückkehr ihres geliebten Mannes hatten sie davon befreit, und nun war sie wieder ganz sie selbst. Beziehungsweise sie war es gewesen – bis jetzt.
Zögernd ging Artemis auf das Bett zu, voller Angst vor dem, was ihn dort erwartete. Noch sorgfältiger als sonst bemühte er sich, nicht auf die eingewebten Weinranken im Teppich zu treten.
Trittst du auf den Wein, zähle bis neun.
Das war eine Gewohnheit von früher, als er noch klein war, ein alter Aberglaube, den sein Vater ihm einmal zugeflüstert hatte. Artemis hatte es nie vergessen, und falls er die Weinranken auf dem Teppich auch nur mit einem Zeh berührte, zählte er immer noch bis neun, um das Unglück abzuwenden.
Das Himmelbett stand am Ende des Raums, die üppigen Stoffbahnen von Sonnenlicht durchflutet. Ein leichter Wind blähte den Seidenstoff auf wie die Segel eines Piratenschiffs.
Die eine Hand seiner Mutter hing über den Bettrand. Bleich und dünn.
Artemis war entsetzt. Gestern noch war seine Mutter gesund und guter Dinge gewesen. Ein leichtes Schniefen, aber sonst genauso munter und fröhlich wie immer.
»Mutter«, platzte es aus ihm heraus, als er ihr Gesicht erblickte. Es fühlte sich an wie ein Schlag in die Magengrube.
Das konnte nicht sein. Innerhalb von vierundzwanzig Stunden hatte sich der Zustand seiner Mutter so verschlechtert, dass von ihr kaum mehr als das Skelett übrig war. Ihre Wangenknochen stachen scharf hervor, und ihre Augen lagen tief in dunklen Höhlen.
Keine Sorge, sagte Artemis zu sich selbst. In ein paar Sekunden geht es Mutter wieder gut, und dann kann ich nachforschen, was hier passiert ist.
Angeline Fowls wunderschönes Haar war zerzaust und brüchig, ausgefallene Strähnen zogen sich wie ein Spinnennetz über das Kopfkissen. Und ihre Haut verbreitete einen merkwürdigen Geruch.
Lilien, dachte Artemis. Süß, aber mit einem Anflug von Verwesung.
Plötzlich riss Angeline die Augen auf, von Panik gezeichnet. Sie bäumte sich auf, rang verzweifelt nach Luft, krallte sich mit gekrümmten Fingern ins Nichts. Dann fiel sie ebenso plötzlich in sich zusammen, und einen entsetzlichen Moment lang dachte Artemis, sie sei tot.
Doch dann flatterten ihre Lider, und sie streckte die Hand nach ihm aus.
»Arty«, sagte sie, die Stimme kaum mehr als ein Flüstern. »Ich habe einen ganz seltsamen Traum.« Ein kurzer Satz, doch es dauerte endlos, bis sie ihn hervorgebracht hatte, mit einem gequälten Atemzug nach jedem Wort.
Artemis nahm die Hand seiner Mutter. Wie schmal sie war. Nur ein Häuflein Knochen.
»Oder vielleicht bin ich auch wach, und mein anderes Leben ist ein Traum.«
Es tat Artemis weh, seine Mutter so reden zu hören; es erinnerte ihn an die depressiven Schübe, die sie früher gehabt hatte.
»Du bist wach, Mutter, und ich bin hier. Du hast leichtes Fieber und bist ausgetrocknet, weiter nichts. Mach dir keine Sorgen.«
»Wie kann ich wach sein, Arty«, sagte Angeline mit ruhigem, schwarz umrändertem Blick, »wenn ich spüre, dass ich sterbe? Wie kann ich wach sein, wenn ich das spüre?«
Artemis’ gespielte Ruhe geriet ins Wanken.
»Das … das ist das Fieber«, stotterte er. »Du siehst die Dinge ein wenig verzerrt. Bald ist alles wieder in Ordnung, das verspreche ich dir.«
Angeline schloss die Augen. »Und ich weiß, mein Sohn hält seine Versprechen. Wo warst du die letzten Jahre über, Arty? Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Wie kommt es, dass du nicht siebzehn bist?«
In ihrem Delirium sah Angeline durch den Schleier der Magie und erkannte die Wahrheit. Sie erkannte, dass er drei Jahre fort gewesen war und dennoch dasselbe Alter hatte wie vor seinem Verschwinden.
»Ich bin vierzehn, Mutter. Fast fünfzehn, also noch für eine Weile ein Junge. Jetzt ruh dich aus, und wenn du aufwachst, ist alles wieder in Ordnung.«
»Was hast du mit meinen Gedanken angestellt, Artemis? Woher hast du diese seltsame Macht?«
Artemis begann zu schwitzen. Die Hitze im Zimmer, der seltsame Geruch, seine eigene Angst.
Sie weiß es. Mutter weiß Bescheid. Wenn ich sie heile, wird sie sich dann an alles erinnern?
Egal. Damit würde er sich befassen, wenn es so weit war. Das Wichtigste war jetzt, sie zu retten.
Artemis drückte ihre zerbrechliche Hand und spürte, wie die Knochen aneinander rieben. Zum zweiten Mal würde er seine Mutter mit Magie behandeln.
Die Magie gehörte nicht zu Artemis’ Seele, und er bekam jedes Mal üble Kopfschmerzen, wenn er sie einsetzte. Und obwohl er ein Mensch war, machten sich die Gesetze der Unterirdischen auch bei ihm bemerkbar. Er musste Tabletten gegen Reisekrankheit schlucken, wenn er unaufgefordert ein fremdes Haus betrat, und bei Vollmond verzog er sich oft in die Bibliothek und hörte mit voller Lautstärke Musik, um die Stimmen in seinem Kopf zu übertönen. Die große Zwiesprache der magischen Wesen. Die Unterirdischen verfügten über die mächtigen Erinnerungen ihrer Art, die wie eine Flutwelle ungefilterter Gefühle über ihn hereinbrachen und Migräne auslösten.
Artemis hatte sich oft gefragt, ob es ein Fehler gewesen war, die Magie zu stehlen, doch seit einer Weile schon waren die Symptome verschwunden. Keine Migräne mehr, und keine Übelkeit. Vielleicht hatte sein Gehirn sich an die Strapazen gewöhnt, die mit dem Dasein als magiebegabtes Wesen einhergingen.
Artemis umfasste sanft die Finger seiner Mutter, schloss die Augen und klärte seinen Geist.
Magie. Nichts als Magie.
Die Magie war eine ungestüme Kraft, und es war nicht einfach, sie im Zaum zu halten. Wenn Artemis seine Gedanken abschweifen ließ, würde die Magie auch abschweifen, und dann konnte es sein, dass seine Mutter, wenn er die Augen wieder öffnete, immer noch krank war, aber dafür eine andere Haarfarbe hatte.
Heile, dachte er. Werde gesund, Mutter.
Die Magie reagierte auf seinen Wunsch und strömte summend und kribbelnd durch seine Glieder. Blaue Funken umkreisten seine Handgelenke, zuckend wie ein Schwarm winziger Fische. Fast, als wären sie lebendig.
Artemis dachte an seine Mutter, wie sie in besseren Zeiten gewesen war. Er sah, wie ihre Haut schimmerte, wie ihre Augen vor Glück strahlten. Hörte sie lachen, spürte ihre Berührung an seinem Hals. Erinnerte sich daran, wie sehr seine Mutter ihre Familie geliebt hatte.
Das ist es, was ich will.
Die Funken spürten seine Wünsche und flossen in Angeline Fowls Körper, tauchten in die Haut ihrer Hand und schlängelten sich an ihrem ausgemergelten Arm hinauf. Artemis verstärkte seine Konzentration, und ein Fluss magischer Funken strömte von seinen Fingerspitzen in die Hand seiner Mutter.
Heile, dachte er. Vertreibe die Krankheit.
Artemis setzte seine Magie nicht zum ersten Mal ein, aber diesmal war es anders. Er spürte einen Widerstand, als ob der Körper seiner Mutter nicht geheilt werden wollte und sich gegen die Kraft wehrte. Die Funken begannen zu flackern, glommen noch einmal kurz auf und verloschen dann.
Mehr, dachte Artemis. Mehr.
Er legte seine ganze Kraft hinein, ohne den plötzlichen stechenden Kopfschmerz und die aufsteigende Übelkeit zu beachten.
Werde gesund, Mutter.
Die Magie umhüllte seine Mutter wie eine ägyptische Mumie, schlängelte sich unter sie und hob sie fünfzehn Zentimeter von der Matratze. Ein Beben durchlief ihren Körper, sie stöhnte, und Dampf trat aus ihren Poren, der zischte, wenn er auf die blauen Funken traf.
Sie hat Schmerzen, dachte Artemis und öffnete das Auge einen winzigen Spalt. Furchtbare Schmerzen. Aber ich kann jetzt nicht aufhören.
Artemis suchte in sämtlichen Extremitäten und holte die letzten Magiereste aus seinem Innern.
Alles. Gib ihr alles, was du hast.
Doch obwohl Artemis seine gesamte Magie in die Heilung fließen ließ, funktionierte es nicht. Schlimmer noch: Ihre Krankheit wurde immer stärker. Sie wehrte jede blaue Welle ab, raubte den Funken ihre Farbe und Kraft und schleuderte sie gegen die Zimmerdecke.
Irgendwas läuft hier falsch, dachte Artemis, ein Würgen in der Kehle und einen stechenden Schmerz über dem linken Auge. Das ist nicht normal.
Mit einem heftigen Stromschlag verließ der letzte Funke Magie seinen Körper. Artemis wurde vom Bett seiner Mutter geschleudert, überschlug sich und schlidderte über den Boden, bis er schließlich gegen eine Chaiselongue prallte. Angeline Fowl zuckte ein letztes Mal, dann fiel sie zurück auf die Matratze. Ihr Körper war von einem seltsamen zähflüssigen, durchsichtigen Gel überzogen. Zischend verloschen die noch verbliebenen Magiefunken in der Schicht, dann verdampfte sie fast ebenso schnell, wie sie ausgetreten war.
Artemis lag am Boden, den Kopf in den Händen, und wartete darauf, dass das Chaos in seinem Hirn sich beruhigte. Er war zu keiner Bewegung und keinem Gedanken fähig, und sein Atem war so laut, dass ihm der Schädel dröhnte. Nach einer Weile ließ der Schmerz nach, und die durcheinanderpurzelnden Wörter formten sich zu Sätzen.
Die Magie ist weg. Verbraucht. Ich bin wieder ganz Mensch.
Artemis registrierte, dass die Schlafzimmertür knarzte, und als er die Augen öffnete, standen sein Vater und Butler vor ihm und sahen mit besorgter Miene zu ihm hinunter.
»Wir haben etwas krachen gehört. Du musst gefallen sein«, sagte Artemis senior und half seinem Sohn auf. »Ich hätte dich nicht allein zu ihr lassen sollen, aber ich dachte, du könntest vielleicht etwas tun. Ich weiß, dass du bestimmte Fähigkeiten besitzt, und ich hatte gehofft …« Er strich seinem Sohn das Hemd glatt und klopfte ihm auf die Schulter. »Es war dumm von mir.«
Artemis schüttelte die Hand seines Vaters ab und stolperte zum Krankenbett seiner Mutter. Ein Blick genügte, um zu bestätigen, was er bereis wusste. Er hatte seine Mutter nicht geheilt. Ihre Wangen zeigten keine Farbe, und ihr Atem war nicht ruhiger geworden.
Es geht ihr sogar noch schlechter. Was habe ich getan?
»Was ist das nur?«, fragte sein Vater. »Was zum Teufel ist los mit ihr? Wenn das so weitergeht, ist meine Angeline in weniger als einer Woche –«
Butler unterbrach ihn energisch. »Aufgeben kommt nicht in Frage, meine Herren. Wir alle haben Kontakte aus unserer Vergangenheit, die vielleicht ein wenig Licht in das Dunkel um Mrs Fowls Zustand bringen können. Darunter Leute, mit denen wir uns unter anderen Umständen lieber nicht abgeben würden. Lassen Sie uns diese Leute so schnell wie möglich hierher bringen. Für lästige Formalitäten wie Pässe oder Visa ist keine Zeit, wir müssen handeln.«
Artemis senior nickte, erst zögernd, dann energischer.
»Ja. Ja, verdammt noch mal. Noch ist nicht aller Tage Abend. Meine Angeline ist eine Kämpfernatur – das bist du doch, Liebling, oder?«
Vorsichtig nahm er ihre Hand, als wäre sie aus feinstem Kristall. Sie reagierte weder auf seine Berührung noch auf seine Stimme. »Wir haben mit sämtlichen Heilpraktikern in Europa über meine Phantomschmerzen gesprochen. Vielleicht kann uns einer von ihnen hierbei helfen.«
»Ich kenne einen Mann in China«, sagte Butler. »Er hat bei Madame Ko in der Leibwächter-Akademie gearbeitet. Mit seinen Kräutern hat er wahre Wunder vollbracht. Lebt oben in den Bergen. Er hat die Gegend noch nie verlassen, aber für mich würde er kommen.«
»Gut«, sagte Artemis senior. »Wir müssen alles versuchen. Einfach alles.« Er wandte sich zu seinem Sohn. »Überleg mal, Arty, ob dir auch jemand einfällt, der helfen könnte. Egal wer. Hast du vielleicht ein paar Kontakte zur Unterwelt?«
Artemis drehte den protzigen Ring, den er am Mittelfinger trug, so herum, dass die Oberseite in seiner Handfläche lag. Dieser »Ring« war in Wirklichkeit ein getarntes Funkgerät der Unterirdischen.
»Ja«, sagte er. »Ich habe in der Tat Kontakte zur Unterwelt.«
Kapitel 2
Hafen von Helsinki, Ostsee
Der riesige Krake streckte die flossenbesetzten Tentakel aus und pumpte seinen massigen Körper mit weit ausholenden Bewegungen Richtung Meeresoberfläche. Sein eines Auge rollte wie besessen in der Höhle, und sein gebogener Schnabel, so groß wie der Bug eines Schoners, war weit aufgerissen.
Der Krake war hungrig, und in seinem winzigen Hirn war nur Platz für einen einzigen Gedanken, während er auf die Urlauberfähre über ihm zusteuerte.
Töte sie … TÖTE SIE …
»Was für ein Zwergenmist«, schimpfte Captain Holly Short und schaltete die Sounddatei in ihrem Helm ab. »Zunächst mal haben Kraken keine Tentakel, und dann dieser Quatsch von wegen Töte sie …«
»Ich weiß«, erwiderte Foaly über ihren Helmlautsprecher. »Aber ich dachte, die Stelle würde dir gefallen. Du weißt schon, mal was zum Lachen. Weißt du überhaupt noch, wie das geht?«
Holly fand das gar nicht komisch. »Es ist so typisch für die Menschen, ein vollkommen harmloses Wesen zu nehmen und ihm dämonische Eigenschaften zuzuschreiben. Kraken sind sanfte Geschöpfe, und die Menschen machen aus ihnen blutrünstige Ungeheuer. Töte sie … Töte sie … So ein gequirlter Blödsinn!«
»Holly, das ist bloß eine reißerische Geschichte. Du kennst doch die Menschenwesen und ihre Phantasie. Kein Grund, gleich auszuflippen.«
Der Zentaur hatte recht. Wenn sie sich jedes Mal so aufregte, sobald die Medien der Oberirdischen ein »mythisches« Wesen verdreht darstellten, würde sie ihr halbes Leben als Rumpelstilzchen verbringen. Im Lauf der Jahrhunderte hatten die Menschen immer wieder mal Angehörige des Erdvolks zu Gesicht bekommen und das Gesehene dann fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt.
Lass gut sein. Es gibt auch anständige Menschenwesen. Zum Beispiel Artemis und Butler.
»Hast du diesen Menschenfilm mit den Zentauren gesehen?«, fragte sie Foaly über Helmfunk. »Mann, was waren die edelmütig und sportlich. Ein Schwertstreich für Euch, Majestät, und dann ab auf die Jagd. Fitte Zentauren – das war nun wirklich ein Lacher.«
Tausende von Meilen entfernt, irgendwo im Erdmantel unterhalb von Irland, strich Foaly, der technische Leiter der Zentralen Untergrund-Polizei, sich über den nicht unbeträchtlichen Bauch.
»Holly, das tut weh. Caballine mag meinen Bauch.«
Foaly hatte geheiratet, oder »angespannt«, wie die Zentauren die Zeremonie nannten, während Holly zusammen mit Artemis im Zeitmeer unterwegs gewesen war, um die Dämonen zu retten. In den drei Jahren ihrer Abwesenheit hatte sich vieles verändert, und manchmal fiel es Holly schwer, mit allem Schritt zu halten. Foaly hatte eine Ehefrau, mit der er seine Zeit verbrachte. Ihr alter Freund Trouble Kelp war zum Commander befördert worden, und sie war wieder bei der Aufklärung und arbeitete in der Sonderkommission für Krakenüberwachung.
»Entschuldige, alter Freund. Das war gemein«, sagte Holly. »Außerdem mag ich deinen Bauch auch. Wirklich schade, dass ich nicht da war, um das Anspanngeschirr darum zu bewundern.«
»Ja, finde ich auch. Na ja, beim nächsten Mal.«
Holly lächelte. »Klar. In einem unserer nächsten Leben.«
Traditionell war es üblich, dass Zentauren sich mehr als eine Braut nahmen, aber Caballine war eine moderne Zentaurin, und Holly hatte ihre Zweifel, ob sie ein junges Füllen in ihrem Haushalt dulden würde.
»Keine Sorge, war nur ein Scherz.«
»Das hoffe ich doch, ich treffe mich nämlich am Wochenende mit Caballine im Spa.«
»Wie findest du die neue Ausrüstung?« Foaly wechselte hastig das Thema.
Holly breitete die Arme aus, ließ den Wind durch ihre Finger streichen und blickte hinunter auf die blaue, mit weißen Wellenkämmen gesprenkelte Ostsee.
»Wunderbar«, sagte sie. »Einfach wunderbar.«
Captain Holly Short von der ZUP-Aufklärung flog in weiten, entspannten Kreisen über Helsinki und genoss die frische skandinavische Luft, die durch ihren Helmfilter hereindrang. Es war kurz nach fünf Uhr morgens Ortszeit, und die aufgehende Sonne ließ die goldenen Turmspitzen der Uspenski-Kathedrale aufleuchten. Auf dem berühmten Marktplatz der Stadt stellten erste Händler bereits ihre Stände auf.
Hollys Zielpunkt lag ein Stück entfernt vom erwachenden Zentrum der Stadt. Sie bewegte ihre Finger, und die Sensoren in ihren Spezialhandschuhen übersetzten die Bewegungen in Befehle für die mechanischen Flügel auf ihrem Rücken, so dass sie in einer Spirale auf die kleine Insel Uunisaari hinabflog, die einen knappen Kilometer vor dem Hafen lag.
»Die Körpersensoren sind klasse«, sagte sie. »Sehr bedienerfreundlich.«
»Näher kann man dem Flug eines Vogels nicht kommen«, sagte Foaly. »Es sei denn, du lässt dich operieren.«
»Nein, danke«, erwiderte Holly mit Nachdruck. Sie liebte das Fliegen, aber nicht genug, um sich von einem ZUP-Chirurgen ein paar Implantate ins Kleinhirn setzen zu lassen.
»Gut, Captain Short«, sagte Foaly und wechselte auf Dienstmodus. »Einsatzcheck. Gib mir die Basisdaten.«
Die Überprüfung der Basisfunktionen hatte für jeden Officer der Aufklärung oberste Priorität, bevor er sich der Einsatzzone näherte: Flügel, Waffe und Akku.
Holly kontrollierte die transparenten Anzeigen auf ihrem Helmvisier.
»Akku voll geladen. Waffe auf Grün. Flügel und Anzug voll funktionsfähig. Keine roten Lämpchen.«
»Sehr gut«, sagte Foaly. »Alle Daten bestätigt. Unsere Anzeigen stimmen überein.«
Holly hörte die Tasten klicken, als Foaly sein Einsatzprotokoll ergänzte. Der Zentaur hatte eine Schwäche für altmodische Tastaturen, obwohl er selbst eine außerordentlich leistungsfähige virtuelle Tastatur entwickelt hatte, das V-Board.
»Denk dran, Holly, das hier ist nur ein Aufklärungseinsatz. Geh runter und kontrolliere den Sensor. Die Dinger sind zweihundert Jahre alt, und wahrscheinlich hat bloß ein durchgeschmortes Kabel den Alarm ausgelöst. Du folgst einfach nur meinen Anweisungen und reparierst, was ich dir sage. Keine wilden Schießereien. Verstanden?«
Holly schnaubte. »Jetzt begreife ich, warum Caballine sich in dich verliebt hat, Foaly. Du bist ein wahrer Charmeur.«
Foaly kicherte. »Damit kannst du mich nicht mehr aus der Reserve locken, Holly. Die Ehe hat mich gelassener gemacht.«
»Gelassen? Das glaube ich erst, wenn du es zehn Minuten in einem Raum mit Mulch aushältst, ohne auszuschlagen.«
Der Zwerg, Mulch Diggums, war erst Hollys und Foalys Feind gewesen, dann ihr Partner, und mittlerweile war er ein guter Freund geworden. Seine Lieblingsbeschäftigung bestand darin, sich mit allem Essbaren vollzustopfen, was ihm in die Finger kam, und nicht weit danach kam das Ärgern seiner diversen Feinde, Partner und Freunde.
»Hm, bis ich so gelassen werde, brauche ich wohl noch ein paar Jahre Ehe. Oder eher ein paar Jahrhunderte.«
Die Insel nahm jetzt fast ganz Hollys Helmvisier ein, umgeben von einem Kreis aus Brandungsschaum. Zeit, mit dem Geplauder aufzuhören und sich um ihren Auftrag zu kümmern, obwohl Holly am liebsten noch eine Weile in der Warteschleife geflogen wäre, um sich länger mit ihrem alten Freund unterhalten zu können. Es war das erste Mal seit ihrer Rückkehr aus dem Zeitmeer, dass sie mehr als nur einen kurzen Gruß wechselten. Foalys Leben war während der letzten drei Jahre weitergegangen, aber für Holly hatte die Abwesenheit nur ein paar Stunden gedauert, und obwohl sie nicht älter geworden war, fühlte sie sich um diese Jahre betrogen. Der ZUP-Psychologe hätte ihr erklärt, sie leide an einer zeitreisenbedingten Reorientierungsdepression, und ihr eine nette kleine Spritze verschrieben, um sie wieder aufzumuntern. Doch Holly traute Glücksspritzen ebenso wenig wie Hirnimplantaten.
»Ich gehe jetzt runter«, sagte sie knapp. Dies war ihr erster Einsatz seit dem Abschluss der Zeitmeer-Mission, und sie wollte ihn perfekt über die Bühne bringen, auch wenn es nur um etwas so Läppisches ging wie die Überwachung eines Kraken.
»Hier sind die Daten«, sagte Foaly. »Siehst du den Sensor?«
Auf der Insel befanden sich vier Biosensoren, die Informationen an das Polizeipräsidium in Erdland sendeten. Drei von ihnen pulsierten auf der Anzeige in Hollys Helmvisier in sanftem Grün. Der vierte leuchtete rot. Das konnte alles Mögliche bedeuten. In diesem Fall jedoch waren sämtliche Parameter über das normale Niveau gestiegen: Temperatur, Pulsschlag, Gehirnaktivität. Alle befanden sich im Gefahrenbereich.
»Es wird wohl eine Fehlfunktion sein«, hatte Foaly ihr erklärt. »Sonst würden auch die anderen Sensoren etwas anzeigen.«
»Ja, ich habe ihn, klar und deutlich.«
»Okay. Sichtschild ein und Anflug.«
Holly drehte ihr Kinn scharf nach links, bis ihr Halswirbel knackte. Das war ihre Art, die Magie zu aktivieren. Die Bewegung war eigentlich nicht nötig, da die Magie in erster Linie vom Gehirn geleitet wurde, aber auch Unterirdische hatten ihre Ticks. Sie schickte einen kleinen Schuss Magie durch ihren Körper und vibrierte ins unsichtbare Spektrum. Ihr Vibrationsanzug passte sich der Frequenz an und verstärkte sie, was den Magieverbrauch enorm reduzierte.
»Sichtschild eingeschaltet. Ich gehe jetzt rein«, meldete sie.
»Verstanden«, sagte der Zentaur. »Sei vorsichtig, Holly. Commander Kelp wird sich hinterher das Video ansehen, also halte dich an deine Befehle.«
»Willst du damit etwa andeuten, dass ich bisweilen gegen Befehle verstoße?«, fragte Holly in gespieltem Entsetzen.
Foaly kicherte. »Nein, ich will damit nur andeuten, dass du in diesem Bereich entweder schwerhörig oder extrem vergesslich bist.«
Treffer – versenkt, dachte Holly und setzte zum Landeanflug auf Uunisaari an.
Wale gelten als die größten Säugetiere der Erde. Doch das sind sie nicht. Kraken können bis auf eine Länge von fünf Kilometern anwachsen. Sie nehmen nicht umsonst einen zentralen Platz in den skandinavischen Sagen ein, seit im dreizehnten Jahrhundert in der Örvar-Odd-Saga erstmals ein Krake in Gestalt des furchteinflößenden lyngbakr auftauchte. Frühe Beschreibungen des Kraken sind sehr viel zutreffender als moderne, denn in ihnen wird das Meeresgeschöpf als ein Tier in der Größe einer Insel geschildert, dessen wahre Gefahr für die Schiffe nicht in seiner Angriffslust bestand, sondern in dem Strudel, der sich bildete, wenn es untertauchte. Doch bereits im Mittelalter hatte sich die Legende vom Kraken mit dem des Riesenkalmars vermischt, und jedem von ihnen wurden die abschreckendsten Eigenschaften des jeweils anderen zugeschrieben. Der Kalmar war plötzlich groß wie ein Berg, während der friedfertige Krake Tentakel bekam und blutrünstiger wurde als der tödlichste Hai.
Nichts war weiter von der Wahrheit entfernt. Der Krake ist ein sanftes Wesen, dessen »Hauptwaffe« seine gewaltige Größe ist. In dem massigen Körper aus Panzer, Gas und Fettzellen befindet sich ein Gehirn von der Größe einer Melone, das ihm gerade genug Intelligenz verleiht, um sich zu ernähren und seinen Panzer zu erneuern. Wenn man sich die Kruste aus Felsen, Algen und Korallen wegdenkt, ähnelt der Krake im Grunde einer Seepocke – wenn auch einer Seepocke von der Größe eines Olympiastadions.
Dank eines unglaublich langsamen Stoffwechsels und eines riesigen Netzwerks aus Versorgungssystemen rund um ihren weichen Kern können Kraken mehrere tausend Jahre alt werden. Sie suchen sich eine nahrungsreiche oder magische Umgebung und bleiben dort, bis die Vorräte aufgezehrt sind. Eine Ansammlung von Inseln in der Nähe eines menschlichen Hafens bietet nicht nur eine hervorragende Tarnung, sondern auch eine schier unerschöpfliche Nahrungsquelle. Und so findet man die Kraken oft genau dort. Am Meeresboden verankert wie eine gigantische Napfschnecke, saugen sie die Abfälle der Stadt durch ihre Kiemen und fermentieren sie in ihrem riesigen Magen zu Methangas. Doch der Menschenmüll ist nicht nur ihre Rettung, sondern zugleich ihr Untergang, denn der immer größere Giftgehalt hat die Kraken unfruchtbar gemacht, und heute gibt es in den Meeren nur noch etwa ein halbes Dutzend dieser Geschöpfe.
Dieser spezielle Krake war der älteste von ihnen. Nach den Panzerproben war der alte Shelly, wie die kleine, aber engagierte Kraken-Sonderkommission ihn nannte, über zehntausend Jahre alt und lebte schon seit dem sechzehnten Jahrhundert als vermeintliche Insel im Hafen von Helsinki, das damals noch Helsingfors hieß.
Die ganze Zeit über hatte Shelly kaum mehr getan, als zu essen und zu schlafen, da er keinen Drang verspürte, sich einen neuen Platz zu suchen. Jegliche Impulse weiterzuziehen wurden von den Abwässern einer Farbenfabrik im Keim erstickt, die vor über hundert Jahren hinter ihm gebaut worden war. Shelly war also quasi katatonisch, er hatte in den letzten fünfzig Jahren lediglich ein paar Methangassalven abgegeben, und so gab es keinen Grund zu der Annahme, dass das rote Lämpchen an dem Sensor eine andere Ursache hatte als einen Kurzschluss. Und es war Hollys Aufgabe, diesen Kurzschluss zu beheben. Ein typischer Erster-Tag-wieder-im-Einsatz-Job. Keine Gefahr, kein Zeitdruck und kaum ein Risiko, entdeckt zu werden.
Holly drehte die Handflächen gegen den Wind und ging tiefer, bis ihre Stiefel das Dach des kleinen Inselrestaurants streiften. Genau genommen bestand Uunisaari aus zwei Inseln, die durch eine schmale Brücke verbunden waren. Die eine war eine echte Insel, die andere Shelly unter seiner Felskruste. Holly führte einen kurzen Thermoscan durch, sah jedoch nichts außer ein paar Nagetieren und dem Wärmefleck einer Sauna, die vermutlich über eine Zeitschaltuhr vorgeheizt wurde.
Sie blickte auf ihr Helmvisier, um die exakte Position des Sensors ausfindig zu machen. Er befand sich vier Meter unterhalb der Wasseroberfläche, versteckt unter einem Felsvorsprung.
Unter Wasser. Natürlich.
Mitten in der Luft klappte sie die Flügel ein und ließ sich mit den Füßen voran in die Ostsee fallen, die Arme eng an den Körper gelegt, um möglichst wenig Spritzer zu verursachen. Nicht dass irgendwer in der Nähe gewesen wäre, der den Aufprall hätte hören oder sehen können. Die Sauna und das Restaurant öffneten erst abends um acht, und die nächsten Menschenwesen waren ein paar Angler auf dem Festland, deren Ruten sanft im Wind hin und her schaukelten.
Holly leerte die Gaspolster ihres Helms, um den Auftrieb zu reduzieren, und ließ sich sinken. Die Anzeige auf ihrem Visier informierte sie, dass die Wassertemperatur knapp über zehn Grad lag, aber der Vibrationsanzug isolierte sie gegen die Kälte und dehnte sich sogar aus, um den stärkeren Druck auszugleichen.
»Benutz die Critters«, sagte Foaly, dessen Stimme glasklar durch die Vibrationsknoten über ihrem Ohr drang.
»Verschwinde aus meinem Kopf, Zentaur.«
»Komm schon. Benutz die Critters.«
»Ich brauche keinen Sucher. Das Ding ist direkt vor meiner Nase.«
Foaly seufzte. »Dann sterben sie, ohne ihren Zweck erfüllt zu haben.«
Critters waren Mikroorganismen, die mit einer Strahlung derselben Frequenz getränkt wurden wie das Objekt, das sie aufspüren sollten. Wenn man wusste, wonach man suchte, bevor man Foalys Labor verließ, führten die Critters einen zielsicher dorthin. Allerdings waren sie ziemlich überflüssig, wenn das Gesuchte nur wenige Meter entfernt war und unübersehbar auf dem Helmvisier blinkte.
»Also gut, meinetwegen«, stöhnte Holly. »Aber ich hab’s langsam satt, immer dein Versuchskaninchen zu spielen.«
Sie öffnete einen wasserdichten Verschluss an ihrem Handschuh und entließ eine Wolke orange glühender Würmchen ins Wasser. Sie sammelten sich kurz und schossen dann wie ein Pfeil auf den Sensor zu.
»Sie schwimmen, sie fliegen und sie graben«, sagte Foaly, hingerissen von seiner eigenen Schöpfung. »Mögen die Götter ihre kleinen Herzen segnen.«
Die Critters hinterließen eine orange glühende Spur für Holly. Sie folgte ihnen unter einen scharfkantigen Felsvorsprung, wo die Critters bereits dabei waren, den Sensor von seiner dicken Kruste zu befreien.
»Komm schon, das ist doch praktisch für einen Officer im Einsatz, oder etwa nicht?«
Es war sogar sehr praktisch, denn Holly hatte nur noch Sauerstoff für zehn Minuten, aber das würde sie Foaly nicht unter die lange Nase reiben. Er war so schon eingebildet genug.
»Ein Helm mit Kiemen wäre nützlicher gewesen. Du wusstest doch, dass der Sensor unter Wasser liegt.«
»Du hast mehr als genug Sauerstoff«, wandte Foaly ein. »Zumal die Critters alles für dich saubermachen.«
Die Critters fraßen die Muscheln und Algen ab, die sich auf dem Sensor festgesetzt hatten, bis er wieder glänzte wie an dem Tag, als er vom Band gelaufen war. Sobald ihre Mission erfüllt war, verloschen die Critters und lösten sich leise zischend im Wasser auf. Holly schaltete ihre Helmscheinwerfer ein und richtete beide Strahler auf den Sensor. Er hatte die Größe und Form einer Banane und war mit einem Elektrolytgel bedeckt.
»Dank Shelly ist das Wasser ziemlich klar. Ich kriege ein ganz gutes Bild.«
Holly verstärkte den Auftrieb ihres Anzugs ein wenig, bis sie im neutralen Bereich war, und schwebte so reglos wie möglich im Wasser.
»Und, was siehst du?«
»Dasselbe wie du«, erwiderte der Zentaur. »Einen Sensor mit einem blinkenden roten Lämpchen. Ich brauche ein paar Daten, sofern du dich dazu durchringen kannst, den Bildschirm zu berühren.«
Holly legte die Handfläche auf das Gel, so dass der Omnisensor in ihrem Handschuh sich mit dem alten Gerät synchronisieren konnte.
»Neuneinhalb Minuten, Foaly, vergiss das nicht.«
»Ich bitte dich«, schnaubte Foaly. »In neuneinhalb Minuten könnte ich eine ganze Satellitenflotte rekalibrieren.«
Wahrscheinlich stimmte das sogar, dachte Holly, während ihr Helm den Sensor einem Systemcheck unterzog.
»Hmm«, machte Foaly dreißig Sekunden später.
»Hmm?«, wiederholte Holly beunruhigt. »Was soll das heißen? Verwirr mich mit wissenschaftlichen Details, aber komm mir nicht mit Hmm.«
»Der Sensor ist nicht beschädigt. Er funktioniert sogar erstaunlich gut. Das kann nur bedeuten …«
»Dass die anderen drei Sensoren nicht in Ordnung sind«, schloss Holly. »So viel zu deiner Genialität.«
»Ich habe die Sensoren nicht entwickelt«, sagte Foaly verletzt. »Die sind noch aus Koboi-Zeiten.«
Holly überlief ein Schauder. Ihre alte Feindin Opal Koboi war eine der führenden Erfinderinnen von Erdland gewesen, bis sie beschlossen hatte, sich mittels aller erdenklichen kriminellen Machenschaften zur Königin der Welt zu krönen. Jetzt hockte sie in einem speziell angefertigten Isolationszellenwürfel in Atlantis und verbrachte ihre Zeit damit, Mails an Politiker zu schicken und um vorzeitige Haftentlassung zu betteln.
»Verzeih mir, alter Freund, dass ich deine Unfehlbarkeit angezweifelt habe. Dann sehe ich mir jetzt am besten mal die anderen Sensoren an. Und die sind hoffentlich über Wasser.«
»Hmm«, machte Foaly erneut.
»Lass das bitte. Soll ich die anderen Sensoren nun überprüfen, wo ich schon mal hier bin, oder nicht?«
Eine Weile herrschte Schweigen. Foaly öffnete einige Dateien, dann begann er stockend zu sprechen, während er die Informationen aufnahm. »Die anderen Sensoren … sind jetzt nicht so wichtig. Was wir herausfinden müssen, ist … warum Shelly ausgerechnet an diesem Sensor eine Warnmeldung ausgelöst hat. Warte, ich schau mal nach, … ob wir so eine Situation schon mal hatten.«
Holly blieb nichts anderes übrig, als weiter Kontakt mit dem Sensor zu halten, während sie im Wasser schwebte und zusah, wie die Sauerstoffuhr in ihrem Helmvisier ablief.
»Okay«, sagte Foaly schließlich. »Es gibt zwei mögliche Gründe für diese Warnmeldung. Erstens: Shelly kriegt einen Baby-Kraken, was nicht sein kann, da er ein unfruchtbares Männchen ist.«