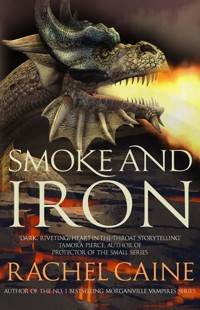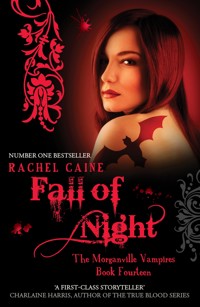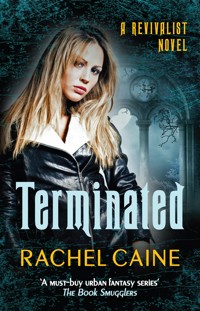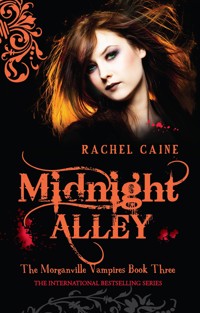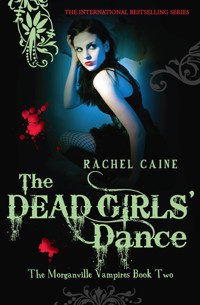9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Magische Bibliothek-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Die Dark-Academia-Sensation
Die Bibliothek von Alexandria ist die mächtigste Organisation der Welt. Sie herrscht über das gesamte Wissen der Menschheit, denn der private Besitz von Büchern ist streng verboten. Jess Brightwell und seine Freunde mussten London verlassen und sind in die einzige Stadt geflohen, die der Bibliothek die Stirn bietet: Philadelphia. Sie wird von den Brandschatzern regiert, die lieber Bücher verbrennen, als sich von der Bibliothek vorschreiben zu lassen, was sie lesen dürfen. Sie wollen Jess und die anderen sofort töten, doch Jess hat einen Trumpf in der Hand: Eine Maschine, die in der Lage ist, die Macht der Bibliothek endgültig zu brechen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Ähnliche
Das Buch
Die Bibliothek von Alexandria ist die mächtigste Organisation der Welt. Sie herrscht über das gesamte Wissen der Menschheit, denn der private Besitz von Büchern ist streng verboten. Wer sich gegen sie stellt, ist nirgendwo mehr sicher, denn die Bibliothekare und ihre Soldaten können in Sekundenschnelle selbst an die entlegendsten Orte der Welt reisen. Jess Brightwell und seine Freunde mussten London verlassen und sind in die einzige Stadt geflohen, die der Bibliothek die Stirn bietet: Philadelphia. Sie wird von den Brandschatzern regiert, die lieber Bücher verbrennen, als sich von der Bibliothek vorschreiben zu lassen, was sie lesen dürfen. Sie wollen Jess und die anderen sofort töten, doch Jess hat einen Trumpf in der Hand: Eine Maschine, die in der Lage ist, die Macht der Bibliothek endgültig zu brechen …
Rachel Caines Saga um DIEMAGISCHEBIBLIOTHEK:
Band 1: Tinte und Knochen
Band 2: Papier und Feuer
Band 3: Asche und Feder
Die Autorin
Rachel Caine, New York Times- und internationale Bestsellerautorin, hat als Buchhalterin, professionelle Musikerin und Schadensermittlerin gearbeitet und war Geschäftsführerin in einem großen Unternehmen, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete und mit zahlreichen Fantasy- und Mysteryserien große Erfolge feierte. Sie lebte mit ihrem Mann, dem Künstler R. Cat Conrad, in Texas. Rachel Caine verstarb 2020.
RACHEL CAINE
DIE MAGISCHE BIBLIOTHEK
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Beate Brammertz
Titel der Originalausgabe:
THEGREATLIBRARY – ASHANDQUILL
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe 08/2024
Redaktion: Sabine Kranzow
Copyright © 2017 by Rachel Caine LLC
Copyright © 2024 dieser Ausgabe und der Übersetzungby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München,unter Verwendung des Originalmotivs von Jacobus van Meer
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-31608-2V001
Für all jene, die Veränderungen ohne Furcht die Stirn bieten. Weiter so!
Für den sich stets wandelnden Schatz der öffentlichen Bibliotheken, ohne den wir alle verloren wären.
Selbst in den dunkelsten Momenten ist niemand mit einem Buch jemals allein.
Wir sind alle Bücherfreunde.
Und wir jagen alle der Großen Bibliothek von Alexandria hinterher, einem Buch nach dem anderen.
Ephemera
Text eines Briefs des Archivar Magister, Leiter der Großen Bibliothek von Alexandria, an den Oberkommandanten der Hohen Garda der Großen Bibliothek. Nicht verfügbar im Kodex. Zugriff beschränkt.
Die walisische Armee hat den Vertrag mit der Bibliothek gebrochen und dreist die kostbaren Bücher aus unserer Tochterbibliothek in London geplündert. Das Serapeum von St. Paul’s stellte seit vielen Jahrhunderten ein bedeutendes Bauwerk und einen heiligen Ort des Wissens dar, und nun beanspruchen sie es für sich.
Die Zerstörung unseres Oxforder Serapeums haben wir als Kollateralschaden des Krieges entschuldigt. Aber das? Das ist zu viel. Der walisische König ist zu weit gegangen und muss für seine Fehler zur Rechenschaft gezogen werden.
Der König von Wales und England muss für unseren Schaden sofortige Wiedergutmachung leisten oder mit bitteren Konsequenzen rechnen. An allen Fronten keimt Rebellion auf, und wir müssen Königreiche und Länder, die sich unserer Autorität widersetzen, in ihre Grenzen weisen und wieder unter unsere Kontrolle bringen.
Ich werde keinen weiteren Ungehorsam dulden, egal, ob von ausländischen Königen oder unseren eigenen Gelehrten.
Die Strafe für Verräter ist der Tod.
Handschriftliche Anmerkung des Archivars an den Artifex Magnus
Provinzielle Königreiche und ihre Kabbeleien sind mir einerlei, aber London ist der letzte Ort, an dem unser unliebsames Grüppchen von verräterischen Gelehrten gesichtet wurde … und noch dazu in der Nähe von St. Paul’s. Ich weiß, die Waliser sind uns nicht wohlgesonnen, doch unter Androhung des totalen Kriegs mit der Hohen Garda wird man sie uns aushändigen. Falls sie denn immer noch am Leben sein sollten.
Handschriftliche Antwort des Artifex Magnus
Sie wurden von einem der letzten Bibliothekare, dem die Flucht gelang, innerhalb der Mauern von St. Paul’s gesehen, weshalb wir wissen, dass sie zumindest zu jenem Zeitpunkt am Leben waren. Ob sie nun in dem Chaos untergetaucht oder in einem von den Walisern ausgegrabenen Massengrab gelandet sind, wird sich zeigen. Ich würde sie noch nicht für tot erklären. Christopher Wolfe hätte schon vor Jahren sterben müssen, und niemandem von uns ist es bisher geglückt, ihn ins Jenseits zu befördern.
Bezüglich Ihrer früheren Anfrage muss ich Ihnen bedauerlicherweise ans Herz legen, Gregory für den Posten des Obskurist Magnus zu ernennen. Ich weiß, er ist ein boshaftes Geschöpf, aber der einzige andere Kandidat ist Eskander. Ich habe ihn mit Gewalt aus seinem selbst auferlegten Gefängnis zu mir bringen lassen, um in Ihrem Namen sicherzustellen, dass er immer noch gesund und munter ist. In ihm steckt weiterhin jede Menge Kampfgeist, so viel ist sicher, aber er wird, wie er uns vor vielen Jahren geschworen hat, nichts verraten. Kein Sterbenswörtchen. Vor Jahrzehnten hat er die Entscheidung getroffen, für uns nutzlos zu sein, und ich glaube, dies ist ihm nur allzu gut gelungen. Setzen Sie Ihre Hoffnung lieber nicht auf ihn.
Er hat eine Nachricht für Sie verfasst. Ich habe mir erlaubt, sie zu lesen, und lassen Sie mich nur so viel sagen: Am liebsten sähe er Sie tot. Wahrscheinlich gibt er Ihnen die Schuld an Keria Mornings Tod, genau wie ihr Sohn. Wenn ich es mir recht überlege, liegen die beiden mit ihrer Vermutung wohl nicht sonderlich falsch.
Machen Sie sich keine Sorge wegen Ihrer abtrünnigen Gelehrten. Wir haben ein hohes Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Selbst ihre eigenen Familien werden bald in Versuchung geraten, sie an uns zu verkaufen.
Ephemera
Text eines Briefs auf Papier vom Anführer der Londoner Brandschatzer an Willinger Beck, Rädelsführer der Brandschatzerstadt Philadelphia. Nach Erhalt vernichtet.
Ich schicke dir ein Geschenk aus den Trümmern von London: vier ausgebildete Gelehrte der Bibliothek – einen hochdekorierten Kommandanten der Hohen Garda, zwei seiner Soldaten und … am allerbesten … eine Obskuristin! Keine halbwilde Naturhexe, sondern eine echte, im Eisenturm ausgebildete Obskuristin, die über ein Können verfügt, wie es selbst mir noch nicht untergekommen ist.
Nicht nur das – sie bringen sogar ihre eigenen Gaben. Es wird gemunkelt, dass diese Gelehrten ein Geheimnis kennen, das der Macht der Großen Bibliothek unwiderruflich ein Ende setzen könnte. Ich schätze, es liegt an dir, einen Weg zu finden, es ihnen zu entlocken.
Mögen Kraft und Mut mit dir sein, mein Bruder.
1
Bücher brannten so leicht.
Papier verfärbte sich in der gleißenden Hitze bräunlich, dann entzündeten sich die Ecken leuchtend rot. Flammen hinterließen zarte Ascheringe. Ledereinbände rauchten und verschrumpelten und wurden schwarz, genau wie verbranntes Fleisch.
Jess Brightwell beobachtete, wie das Feuer die Bücherpyramide emporkletterte, und zwang sich mit aller Gewalt, nicht zusammenzuzucken, als eine Schicht nach der anderen in Brand geriet. Sein Verstand raste vor ungewollten Berechnungen. Einhundert Bücher in fünf Lagen. Die unterste brennende Ebene: vierundvierzig. Die zweite bestand aus weiteren zweiunddreißig Bänden, und bleierner Rauch quoll bereits aus ihnen hervor. In der nächsten gab es achtzehn weitere Folianten, dann fünf darüber. Die Spitze der Pyramide bildete ein einziges Buch, das zu packen eine geradezu verlockende Versuchung darstellte. Es zu retten, wäre ein Kinderspiel, während die Flammen sich durch den Stapel fraßen, eine Lage nach der anderen verzehrten und etwas in ihm verbrannten, das immer schwärzer und kälter wurde.
Wenn ich nur ein Buch retten könnte …
Doch er könnte rein gar nichts retten. In diesem Moment nicht einmal sich selbst.
In der blendenden Sonne hämmerte es schmerzhaft in Jess’ Kopf. Alles war immer noch ein verschwommenes Durcheinander. Er erinnerte sich an das Chaos in London, als die walisische Armee eingefallen war, eine Schlacht, von der nicht einmal er sich jemals hätte vorstellen können, dass die Engländer sie verlieren könnten. Dann an den faszinierenden Anblick der Kuppel von St. Paul’s, die über ihnen Feuer fing, während die Bibliothekare so viel wie möglich retteten.
Er erinnerte sich an seinen Vater und seinen Bruder, die ihm, als es darauf ankam, den Rücken gekehrt und sich aus dem Staub gemacht hatten.
Vor allem erinnerte er sich, wie man ihn in die Translationskammer gezwungen hatte, und an das widerlich reißende Gefühl, in sämtliche Bestandteile seiner selbst aufgelöst und an einem Ort, weit entfernt von London, wieder zusammengesetzt zu werden … hier in der von Brandschatzern besetzten Stadt Philadelphia.
In den aufständischen Kolonien von Amerika.
Jess und seinen Freunden war keine Verschnaufpause vergönnt gewesen. Stattdessen waren sie, immer noch benommen und geschwächt, zu einem freien Platz gezerrt worden, der früher einmal ein Sportstadion gewesen sein musste. In seinen besseren Zeiten war es vielleicht mit jubelnden Zuschauern gefüllt gewesen, jetzt aber lag es halb in Ruinen da – auf der einen Seite waren die Betonränge zu einem unförmigen Klumpen geschmolzen und anstatt eines grasbewachsenen Felds in der Mitte gab es dort einen kahlen Boden und einen Scheiterhaufen aus Büchern.
Jess konnte den Blick nicht von ihnen abwenden, während sie lichterloh brannten, denn in ihm hatte sich ein makabrer Gedanke festgesetzt: Wir sind die Nächsten.
»Jess«, sagte der Gelehrte Christopher Wolfe, der neben ihm auf der Erde kniete. »Es sind keine Originale. Nur Blankobücher.« Das entsprach der Wahrheit. Doch Jess bemerkte ebenfalls das unkontrollierte Zittern, das den Mann durchlief. Das Funkeln in Wolfes dunklen Augen war reiner, ruchloser Wut geschuldet. Er hatte zwar recht: Blankobücher waren nichts weiter als unbeschriebenes Papier und Einbände, zur Verfügung gestellt von der Großen Bibliothek von Alexandria, nichtssagende Hüllen, in die auf Befehl Wörter aus sicher in den Archiven der Bibliothek verwahrten Originalen kopiert wurden. Dies waren nur leere Symbole, die brannten. Im Hoheitsgebiet der Bibliothek könnten sie günstig und leicht ersetzt werden, und nichts wäre verloren.
Der Anblick ihrer Zerstörung schmerzte dennoch. Jess war in dem Bewusstsein großgezogen worden, Bücher zu lieben, auch wenn seine Familie sie geschmuggelt, verkauft und aus ihnen Profit geschlagen hatte.
Worte waren heilige Dinge, und dies war eine besonders grässliche Art der Ketzerei.
Während Jess gebannt in die Flammen starrte, zuckte das letzte Buch in der anschwellenden Hitze zusammen, als wollte es sich gleich losreißen und vor dem Feuer fliehen. Doch dann rollten sich seine Ecken ein, Papier rauchte, und es verkohlte in einem sich aufbäumenden Ascheregen.
Die Gelehrte Khalila Seif kniete zu seiner Linken, so gerade und still wie eine Statue. Sie wirkte vollkommen ruhig. Ihre Hände ruhten matt auf ihren Hüften, ihr Kopf war hoch erhoben, und der Stoff ihres Hidschabs flatterte sanft in der heißen Brise. Unter dem schwarzen seidenen Gelehrtenumhang trug sie ein überraschend sauberes Kleid, das von ihren Strapazen in London nur am Saum etwas mit Schlamm bespritzt und von Glut gesprenkelt war. Neben Khalila sah Glain Wathen aus, als wäre sie mitten im Aufstehen erstarrt – eine geschmeidige Kriegerin, bei der jeder Muskel ihres Körpers vor Anspannung vibrierte. Als Nächstes kamen Thomas Schreiber, dann Morgan Hault und schließlich – buchstäblich der Letzte in Jess’ Gedanken – Dario Santiago. Ausgestoßen, selbst aus ihrem kleinen Grüppchen an Vertriebenen.
Zu Jess’ Rechten saß der Gelehrte Wolfe und daneben Kommandant Santi. Das war der gesamte Kreis an Gefangenen, allerdings ohne eine einzige nützliche Waffe, mit der sie irgendetwas hätten ausrichten können. Ihnen war auch keine Zeit geblieben, einen Plan zu schmieden. Jess konnte sich nicht vorstellen, dass irgendeiner von ihnen in diesem Moment etwas Sinnvolles zu sagen hätte.
Auf den halb eingestürzten Rängen war Publikum zu sehen: die braven Bürger von Philadelphia. Eine zerlumpte, zusammengewürfelte Meute aus hartgesottenen Männern, Frauen und Kindern, die den Hungertod, schreckliche Entbehrungen und ständige Angriffe überlebt hatten. Die Leute hatten kein Mitleid mit den verhätschelten Dienern der Großen Bibliothek.
Was würde Wolfe ihnen sagen, wäre ihm die Chance vergönnt? Dass die Große Bibliothek immer noch bedeutsam und wertvoll war, eine Institution, die es zu retten und nicht zu zerstören galt? Dass der Krebs, der sie von innen zerfressen hatte, immer noch geheilt werden konnte? Sie würden es niemals glauben. Jess holte tief Luft und erstickte fast am Gestank brennender Bücher. Wolfe hielt in seiner Vorstellung dazu miese Reden.
Ein Mann in einem gut geschnittenen schwarzen Wollanzug trat vor und versperrte ihm die Sicht auf den Scheiterhaufen. Es war ein großer Kerl mit Brille, der das Selbstbewusstsein eines wohlhabenden Menschen zur Schau stellte. Dem Aussehen nach hätte er an einem weniger sonderbaren Ort Bankier oder Anwalt sein können. Der Rauch, der sich schwarz gegen den blassblauen Morgenhimmel abzeichnete, schien direkt aus seinem Schädel zu wabern. Seine schulterlangen Haare wiesen denselben Grauton auf wie die Asche.
Willinger Beck. Gewählter Anführer der Brandschatzer von Philadelphia – und im weiteren Sinne von allen Brandschatzern auf der ganzen Welt, da dieser Ort das Symbol ihrer fanatischen Bewegung war. Der größte Fanatiker einer Bewegung, die ausnahmslos aus Fanatikern bestand.
Wortlos musterte er eingehend ihre Gesichter. Er schien ihren Anblick zu genießen.
»Eine sehr beeindruckende Verschwendung von Ressourcen«, sagte der Gelehrte Wolfe. Sein Tonfall war säuerlich und munterte Jess auf. Wolfe klingt immer genau gleich, egal, was passiert. »Ist das ein Vorspiel, um als Nächstes uns zu verbrennen?«
»Machen Sie sich nicht lächerlich«, erwiderte Beck. »Gewiss verstehen unsere gelehrten Gäste die Macht der Symbolkraft.«
»Das ist barbarisch«, sagte Khalila von Jess’ anderer Seite. »Eine schreckliche Vergeudung, geradezu sträflich.«
»Meine liebe Gelehrte, wir hier schreiben unsere Bücher per Hand. Auf Papier, das wir retten, indem wir die Blankobücher der Bibliothek auseinandernehmen und ihre alchemistischen Einbände zerstören. Wir sollen Barbaren sein? Wissen Sie, wessen Symbole Sie tragen? Einen solchen Tonfall uns gegenüber verbitte ich mir.« Gegen Ende hatte seine freundliche Stimme einen dunklen Unterton angenommen.
»Wenn Sie noch einmal so mit ihr reden«, fauchte Jess, »zertrümmere ich Ihnen die Kniescheiben.« Seine Hände waren nicht gefesselt. Er hätte sich frei bewegen können, so wie sie alle. Was bedeutete, dass sie als Gruppe ernsthaften Schaden anrichten könnten, bevor die Wachen der Brandschatzer, die hinter ihnen postiert waren, sie überwältigten.
Zumindest der Theorie nach. Jess wusste, dass der Mann genau hinter ihm einen Gewehrlauf auf seinen Nacken richtete und mit der Waffe ein Loch in ihn reißen könnte, das sein Leben mit einem Schlag beenden würde.
Doch zumindest hatte er Becks Aufmerksamkeit und seinen Blick auf sich gelenkt. Gut.
»Immer langsam mit den jungen Pferden«, sagte Beck, dessen Stimme wieder sanftmütig und tadelnd geworden war. »Im Grunde sollten wir Freunde sein. Immerhin vereint uns das gesunde Empfinden, dass sich die Große Bibliothek von Alexandria in einen schädlichen Parasiten verwandelt hat. Sie ist nicht länger ein großartiges, unantastbares Sinnbild. Wut hat zwischen uns nichts zu suchen.«
»Mir sind amerikanische Umgangsformen nicht vertraut«, sagte Kommandant Santi auf der anderen Seite von Wolfe. Er klang freundlich und seelenruhig. Jess glaubte, dass er weder das eine noch das andere war. »Aber behandelt man hier so seine Freunde?«
»Angesichts dessen, dass Sie bei Ihrer Ankunft in der Krankenstation allein drei meiner Männer niedergeschlagen haben, obwohl Sie geschwächt waren? Ja«, erklärte Beck. »Kommandant Santi, wir leisten echten Widerstand gegen die Bibliothek, genau wie mir gesagt wurde, dass Sie es tun. Wie wir es alle tun sollten. Die Bibliothek gewährt den Menschen erbärmliche Tropfen an Wissen, während sie selbst einen Ozean hortet. Gewiss sehen auch Sie die Art und Weise, wie die Bibliothek die Welt zu ihrem eigenen Nutzen manipuliert.« Er nickte zur schwarzen Robe, die Wolfe trug. »Der gewöhnliche Sterbliche hat für Sie Gelehrte einen anderen Namen: Sturmkrähen. Dieser schwarze Umhang ist kein Zeichen Ihrer Gelehrsamkeit mehr und kein Objekt der Ehrfurcht. Er ist ein Zeichen des Chaos und der Zerstörung, die Sie unweigerlich mit sich bringen.«
»Nein«, entgegnete Wolfe. »Er steht immer noch für das, wofür er immer gestanden hat: dass ich mein Leben geben würde, um das Wissen dieser Welt zu beschützen. Ich mag den Archivar hassen, ich mag wünschen, er würde mitsamt seiner Gier und Grausamkeit verschwinden, aber ich halte dennoch unerschütterlich an den Idealen der Bibliothek fest. Die Robe ist ein Symbol dafür.« Er hielt inne, und seine Stimme nahm einen seidigen, düsteren Ton der Verachtung an. »Gerade Sie wissen um die Symbolkraft von Dingen.«
»Oh, das tue ich«, sagte Beck. »Ziehen Sie die Robe aus!«
Wolfes Kinn zuckte leicht nach oben, ohne dass er den starren Blick, mit dem er Beck geradewegs ansah, auch nur eine Sekunde abwandte. Seine ergrauenden Haare flatterten in der heißen Brise des Scheiterhaufens, und dennoch blinzelte er nicht einmal, als er schlicht »Nein« sagte.
»Letzte Chance, Gelehrter Wolfe. Wenn Sie der Bibliothek jetzt entsagen, wird es Ihnen allen besser ergehen. Die Bibliothek wird Ihnen gewiss nicht beistehen.«
»Nein.«
Beck nickte jemandem hinter ihm zu, und aus den Augenwinkeln sah Jess das Aufblitzen eines Messers, das gezückt wurde. Er wollte sich schon umdrehen, da krallte sich eine Hand fest um seine Schulter, und ein Gewehrlauf presste sich schmerzhaft hinten in seinen Schädel.
Er war längst zu spät für jede Art von Rettung.
Eine von Becks Wachen packte Wolfes schwarze Robe am Ärmel und schlitzte die Seide bis zum Hals auf – erst den linken Ärmel, dann den rechten – rasche und unbarmherzig präzise Schnitte. Mit dem Geschick eines billigen Straßenzauberers riss der Mann Wolfe die Robe vom Körper und ließ den Gelehrten in schlichter dunkler Straßenkleidung auf der Erde knien. Dann hielt er sich den malträtierten Stoff hoch über den Kopf. Eine Brise, erhitzt durch die brennenden Bücher, erfasste die Seide und ließ sie wie eine zerfetzte Flagge flattern.
Wolfes Gesichtsausdruck blieb die ganze Zeit über unverändert, aber neben ihm stieß Niccolo Santi ein mordlustiges Knurren aus und war schon halb aufgesprungen, bevor die Wache, die hinter ihm stand, ihm einen schweren metallenen Schlagstock in den Nacken rammte. Bei der Wucht des Schlags sackte der Kommandant in sich zusammen. Er wirkte benommen, aber immer noch gefährlich.
Der Mann, der Wolfes Robe an sich genommen hatte, stolzierte mit ihr wedelnd herum, und von der Tribüne schwollen Applaus und Jubelrufe zu einem lautstarken Gebrüll an. Fast hätte es das knisternde Prasseln der brennenden Bücher überdeckt. Beck ignorierte es und zeigte auf Khalila. »Jetzt sie.« Eine weitere Wache trat auf die junge Frau zu, doch bevor er sein Messer benutzen konnte, streckte Khalila beide Hände in die Höhe. Die Geste wirkte wie ein Befehl, nicht wie eine Kapitulation, und der Mann hielt mitten in der Bewegung inne.
»Ich werde jetzt aufstehen«, sagte Khalila. »Ich leiste keinen Widerstand.«
Die Wache blickte verunsichert zu Beck, der die Augenbrauen hob und nickte.
Aus den Augenwinkeln beobachtete Jess angespannt, wie Khalila sich mit geschmeidigen, ruhigen Bewegungen erhob, während auf ihrer anderen Seite Glain dasselbe tat, eine offene Drohung, jederzeit zu kämpfen, sollte Khalila das Zeichen geben, sie bräuchte Hilfe.
Doch Khalila hielt voll gelassener Eleganz die Hände hoch, um die Schnalle zu öffnen, die den schwarzen Seidenumhang an ihrer Kehle zusammenhielt. Sie schlüpfte aus der Robe, fing sie auf, bevor sie zu Boden flatterte, und faltete sie mit einstudierten, akkuraten Handbewegungen zu einem ordentlichen, glatten Quadrat.
Dann trat sie einen Schritt vor und streckte die gefaltete Seide aus, eine Hand zur Stütze darunter, die andere auf dem Stoff, wie eine Königin, die einem Untertan ein Geschenk überreicht. Mit einem wohlkalkulierten Kniff hatte sie Willinger Beck sein Symbol abspenstig gemacht. Beim Anblick von Becks Miene durchfuhr Jess eine erbitterte Woge köstlichster Freude. Der Anführer der Brandschatzer war gerade von einem Mädchen düpiert worden, das nicht einmal halb so alt war wie er, und es schien ihm sauer aufzustoßen.
Doch er steckte den Schlag nicht ein, ohne selbst auszuteilen, und Jess erkannte es in der Millisekunde, bevor Beck die säuberlich gefaltete Robe an sich riss und sie in den Scheiterhaufen aus brennenden Büchern schleuderte. Kleinkarierte Verachtung, aber sie traf Jess wie ein Hieb in die Magengrube. Er sah, dass Khalila ebenfalls ein Schauder den Rücken hinabrann … auch wenn es nur der Hauch eines Zuckens war. Wie Wolfe reckte auch sie das Kinn. Aufsässig.
»Nur Feiglinge fürchten sich vor einem Stück Stoff«, sagte sie mit klarer Stimme, die bis zu den Rängen trug. Da war ein Schimmern in ihren Augen: Wut, nicht Tränen. »Wir mögen mit dem Archivar nicht einer Meinung sein, wir mögen seine Abdankung herbeisehnen und ihn durch einen besseren Gelehrten ersetzen wollen. Doch wir stehen für Wissen. Sie stehen für nichts.«
Beck spähte an ihr vorbei und nickte der Wache einmal knapp zu. Im nächsten Moment wurde Khalila gepackt, zurückgerissen und gewaltsam auf die Knie gezwungen. Fast wäre sie gestürzt und kippte taumelnd in Jess’ Richtung. Instinktiv streckte er den Arm aus, um sie zu stützen, und ihre Finger schlangen sich um seine.
In diesem Augenblick erkannte er jäh, was Khalilas wirkliches Ziel gewesen war. Die Robe selbst auszuziehen, war nicht nur ein Akt des Trotzes gewesen, sondern ein geschicktes Ablenkungsmanöver. Verborgen zwischen den Fingern, hielt sie eine metallene Haarnadel – die sie zuvor unter ihrem Hidschab herausgezogen hatte.
In Jess’ Händen, das wusste sie, wäre eine Haarnadel eine mächtige Waffe.
Ein riesiges, beruhigendes Gefühl der Erleichterung schwappte durch seine Brust, und er warf Khalila einen verstohlenen Blick zu, während er die Klammer zwischen seine eigenen Finger presste. Sie hat recht. Früher oder später wird es Schlösser geben, die es zu öffnen gilt. Falls wir denn so lang überleben.
Er ließ Khalila los und steckte das Metall in seinen Hemdsärmel. Später müsste er ein besseres Versteck finden, aber fürs Erste würde es genügen.
Beck schenkte ihnen keinerlei Aufmerksamkeit, viel zu beschäftigt war er damit, Wolfes Robe in die Flammen zu werfen. Weiter unten in der Reihe hatten sie Thomas’ und auch Darios Robe an sich gerissen. Vier Umhänge landeten auf dem Scheiterhaufen, einer nach dem anderen, während die Menschenmenge laut johlend ihre Zustimmung kundtat. Eigentlich erwartete Jess, die Seide würde blitzschnell Feuer fangen, aber stattdessen schwelten die Kleidungsstücke rauchend und zogen sich zusammen, verfärbten sich schließlich grau und zerfielen am Rand zu Asche. Wohl kaum das dramatische Ende, das Beck sich erhofft haben musste und das für seine Zwecke nun eine herbe Enttäuschung war. Der widerliche Geruch brennender Haare gesellte sich zum Fleischgestank der Ledereinbände, und einen kurzen Moment drängte sich Jess das Bild eines Leichnams auf, der in diesen Flammen verbrannte.
Eine ihrer Leichen.
»Jetzt können wir noch mal ganz von vorne anfangen«, sagte Beck, nachdem die Seide nichts weiter als ein Häufchen Asche war. »Sie sind nicht länger ein Teil der Bibliothek. Schon bald werden Sie einsehen, dass wir Ihre Brüder und Schwestern sind.«
»Wenn Sie uns davon überzeugen wollen, dann lassen Sie uns stehen«, erwiderte Santi, und Jess hörte den abgehackten Unterton in seiner Stimme. Er hatte sich den Kopf angeschlagen, denn ein dünner leuchtend roter Blutsfaden rann ihm vom Haaransatz den scharf geschnittenen Wangenknochen hinab, doch seine Augen waren gestochen klar und fest auf Beck gerichtet. »Lassen Sie uns aufstehen, dann werden Sie erleben, wie brüderlich wir sein können.«
»Bald«, sagte Beck. »Zu gegebener Zeit, Kommandant.«
Jess schluckte und schmeckte Asche. Brüderlich. Er wollte nicht glauben, dass er und seine Freunde – für die das hier mit persönlicher Loyalität und einem entsprechenden Risiko begonnen hatte, ohne dass etwas absichtlich geplant gewesen wäre – irgendetwas mit Brandschatzern gemein hatten. Er verachtete sie, obwohl sie ebenfalls wollten, dass Bücher frei zugänglich waren und in jedermanns Besitz sein durften. Er war als Buchschmuggler aufgewachsen, weshalb er per Definition an dasselbe Ideal glaubte.
Doch andererseits hielt er nichts von willkürlichem Mord, und die Brandschatzer waren dafür bekannt, die Schuldigen und Unschuldigen gleichermaßen zu verbrennen, nur um ihren Standpunkt zu verdeutlichen.
Die Große Bibliothek hatte trotz ihrer glänzenden Vergangenheit und hehren Ideale ein ebenso niederträchtiges Herz – vielleicht sogar noch dunkler. Der Archivar Magister liebte Bücher vielleicht genauso wie er, aber Macht liebte dieser boshafte alte Mann noch viel mehr. Er und die Kurie waren Teil eines Systems, das vor vielen hundert Jahren toxisch geworden war, als ein vor langer Zeit verstorbener Archivar die Entscheidung gefällt hatte, eine Erfindung zu zerstören und einen Gelehrten zu opfern, nur um die Kontrolle über seine Macht zu behalten. Seither hatte jeder Archivar denselben dunklen Pfad eingeschlagen. Vielleicht glaubten sie heutzutage, keine andere Wahl zu haben.
Doch es musste einen Weg geben. Die Bibliothek war viel zu wertvoll, als dass sie tatenlos ihrem Untergang beiwohnen konnten, ohne den Versuch zu unternehmen, das zu retten, was im Kern gut war. Und wenn es auch nur sie acht waren, die für dieses Unterfangen kämpften … es war immerhin ein Anfang.
Irgendetwas zu retten, wirkte in diesem Moment jedoch nicht sehr aussichtsreich. Jess kniete in einer zerstörten Arena in einer von Brandschatzern besetzten Stadt, mit nichts als einer Haarnadel als Waffe. Aber für einen Kleinkriminellen wie ihn war eine Haarnadel mehr als genug.
»Ich frage euch jetzt«, rief Beck und erhob die Stimme, damit sie bis in der obersten Tribüne gehört wurde. Das Echo hallte kalt wider. »Werdet ihr schwören, euch unserer Stadt anzuschließen? Und für den Untergang der Großen Bibliothek kämpfen, die uns den Fuß in den Nacken presst, und zwar in den Nacken von jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind auf der ganzen Welt? Und das tun, was getan werden muss, im Namen unserer Sache?«
Er schritt die Reihe an Gefangenen ab. Dann blieb er vor Dario Santiago stehen.
Jess stockte der Atem, denn wenn es in ihrer Kette ein schwaches Glied gab, hatte Beck den Finger direkt in die Wunde gelegt. Dario würde tun, was für Dario gut war. Ausnahmslos. Zu diesem Zeitpunkt erwartete niemand von ihnen etwas anderes.
Dario sah erschöpft aus. In London hatte er sich Verbrennungen zugezogen – genau wie Jess –, und seine übliche großspurige Vornehmheit war wie weggeblasen. Er wirkte gebrochen.
Weshalb es sie alle wie der Schlag traf, als er sich auf die Beine rappelte, um Beck die Stirn zu bieten, und sehr deutlich mit äußerst fester Stimme sprach, wie Jess es noch nie an ihm erlebt hatte: »Wirklich? Sehe ich etwa wie ein einfältiger Brandschatzer aus? Allein Ihre Frage ist eine Beleidigung.« Er ließ seinen Worten einen Schwall Spanisch folgen, den Jess nicht verstand, aber das vereinzelte Gelächter in den Rängen bewies, dass es eine schneidende Erwiderung gewesen sein musste.
Becks Miene veränderte sich nicht. Er trat einen Schritt vor. Morgan Hault war die Nächste, und genau wie Dario erhob sie sich. Weder war sie besonders groß noch besonders stark. Ihr Haar wehte ihr wild ums Gesicht, und wenn Morgan Angst hatte, ließ sie sich nichts anmerken, als sie »Nein« sagte. Eine klare, entschlossene, unerschütterliche Absage.
Thomas wurde von den Wachen am Aufstehen gehindert, wahrscheinlich aus Sorge, er könnte echten Schaden anrichten, wenn er nicht am Boden kniete. Der Deutsche antwortete mit einem süßen, breiten Lächeln: »Natürlich nicht.« Er wirkte fast amüsiert.
Glain war es definitiv nicht, und da sie ebenfalls zu Boden gedrückt wurde, begnügte sie sich mit einer unflätigen Geste und einem langen Kauderwelsch an walisischen Silben. Zumindest verstand Jess die Quintessenz ihrer Aussage: Verpiss dich! Typisch Glain.
Khalila wiederum erhob sich. Wie Thomas lächelte auch sie. »Auf keinen Fall«, sagte sie. »Wie töricht von Ihnen, auch nur zu fragen.«
Jess blieb knien. Im Grunde hatte er keine andere Wahl, da ihm die Wache, die hinter ihm stand, ins Ohr flüsterte: »Steh auf, und ich puste dir das Gehirn aus dem Schädel.« Doch Beck wartete kaum ab, sein knappes Nein anzuhören, bevor er weiter zu Wolfe schritt.
Der Gelehrte war die ganze Zeit über still und ruhig geblieben, doch es war eine angespannte Art von Schweigen. Seine Antwort kam rasch und deutlich: »Niemals.«
Neben ihm hatte Santi die Zähne zu einem wilden Grinsen gefletscht. »Unser aller Antwort.«
Beck starrte sie so lang und ohne ein weiteres Wort an, dass bei Jess der kalte Schweiß ausbrach. Dieser Scheiterhaufen loderte immer noch heiß, und Beck wirkte wie ein Mann, der gerne Exempel statuierte. Schließlich schüttelte der Brandschatzer jedoch den Kopf und winkte eine Schwarze Frau zu sich, die Glain an Können und Gefährlichkeit in nichts nachzustehen schien. Die Frau bewegte sich wie eine perfekt ausgebildete Soldatin, obwohl sie keine Uniform trug, nur ein schlicht gewebtes Hemd samt Hose und schwere Stiefel.
»Na schön. Sperr sie ein …«
»Das ist die warmherzige Brandschatzerbegrüßung, auf die ich gewartet habe«, sagte Wolfe säuerlich.
»… und sorg dafür, dass sie anständig behandelt werden«, fuhr Beck fort. Doch dann blickte er zu Wolfe, und hinter seiner aufgesetzt guten Laune lauerte etwas viel Dunkleres. Er war der Anführer einer Stadt, die Krieg führte, und schlimmer als das, er war ein wahrer Gläubiger. Ein Fanatiker, der, ohne mit der Wimper zu zucken, Menschen tötete, verstümmelte oder quälte, allein in dem Versuch, die Welt nach seinem Gutdünken zu formen. »Aber durchsuch sie gründlich. Ich dulde keine Fehler.«
Jess’ Finger verkrampften sich um die zarte Metallnadel, die er in den Stoff seines Hemdsärmels gesteckt hatte. Er musste ein gutes Versteck finden. Und zwar rasch.
Als er aus seiner knienden Position aufstehen durfte, zitterten seine Beine nicht mehr, und auch sein Magen hatte sich beruhigt. Diese grässliche Farce hatte ihnen allen zumindest die Zeit verschafft, um sich von den Nachwehen der Translation zu erholen, und ihre Gehirne funktionierten endlich wieder.
Philadelphia würde auf seine ganz eigene Art genauso gefährlich sein wie London, Rom oder Alexandria. Sie hatten immer noch keine Ahnung, was die Brandschatzer von ihnen wollten oder was sie für ihr Überleben tun müssten.
Doch es spielte keine Rolle. Die Vorstellung, hinter Gitter zu kommen, heiterte Jess im Grunde sogar auf.
Immerhin waren Gefängnisse – ähnlich wie Schlösser – dafür gemacht, geknackt zu werden.
Die Wachen waren leider nicht dumm. Sie teilten die Gefangenen in Zweiergruppen auf und schubsten sie in einem langen, flachen Gebäude aus schwerem Stein in vergitterte Zellen. Niedrige Decken und einfache Toiletten, aber es war bei Weitem nicht das Schlimmste, das Jess bisher zu Gesicht bekommen hatte. Im Grunde hielt sich selbst der Gestank in Grenzen. Vielleicht war die Verbrecherrate in der Brandschatzerstadt nicht sonderlich hoch.
Noch wichtiger war jedoch der Umstand, dass die Schlösser an den Zellentüren groß, grobschlächtig und alt waren.
Durch ein gewisses geschicktes Taktieren seiner Freunde, ohne dass es zu offensichtlich gewesen wäre, gelang es ihnen, in die gewünschten Paare aufgeteilt zu werden: Wolfe und Santi, Glain und Khalila, Thomas und Jess. Dario und Morgan ergatterten jeweils eine eigene Zelle, was Jess etwas neidisch machte. Aber nur ein bisschen, denn er musste in Thomas’ Nähe bleiben. Der Deutsche war gerade erst aus einem Gefängnis geflohen. Vielleicht brauchte er Hilfe, sich in einem anderen einzugewöhnen.
»Durchsucht sie gründlich! Ihr müsst sie auch nicht mit Samthandschuhen anfassen«, sagte die große Frau – wahrscheinlich Becks Kommandantin, dachte Jess – und verschwand, ohne die Ausführung des Befehls zu überwachen. Drei Männer blieben zurück, um die Aufgabe zu erledigen, eine angemessene Anzahl an Wachen, denn immerhin waren die Gefängnistüren geschlossen und abgesperrt.
»Na schön«, sagte einer der Männer – der Truppführer, schätzte Jess –, dessen Wange eine eindrucksvolle Narbe zierte: ein Stück geschmolzene Haut, ein Andenken von griechischem Feuer. Er wirkte nicht besonders freundlich, und nachdem er die Ausbeute an Gefangenen gemustert hatte, sperrte er zuerst die Zelle auf, die sich Glain und Khalila teilten. »Du. Lulatsch. Raus.«
Damit war natürlich Glain gemeint. Für den Laien schien sie die größere Bedrohung darzustellen, auch wenn der Schein je nach Situation trog. Glain zuckte mit den Schultern, trat heraus und legte die Hände flach auf die andere Steinwand des Gangs. Mit einem raschen Blick zu Wolfe stellte sie lautlos eine Frage: Kooperieren wir? Von seinem Platz aus konnte Jess die Antwort nicht sehen – zwischen seiner Zelle und der nächsten, wo Wolfe und Santi gefangen gehalten wurden, gab es eine Steinmauer –, aber die Waliserin entspannte sich sichtlich, weshalb die Antwort wohl ein Ja gewesen war.
Glain nahm die Hände der Wache, die ihren Körper betastete, mit derselben Gleichgültigkeit hin, die sie den meisten Aspekten der Sittsamkeit entgegenbrachte. Abgesehen von: »Sie haben da eine Stelle vergessen. Grober Schnitzer« an den Mann, der sie durchsuchte, machte sie ihm keinerlei Scherereien.
»Alles klar. Wieder rein. Jetzt du mit dem Schleier. Raus!«
»Das ist kein Schleier«, erklärte Khalila, während sie sich in die Mitte des Gangs stellte. »Es wird Hidschab genannt. Oder Schal, wenn Ihnen das lieber ist.«
Die Wache beäugte sie verunsichert von Kopf bis Fuß. Offensichtlich kannte er das traditionelle Gewand nicht, das Khalila immer trug. Glain in ihrer ramponierten Hose hatte ihn nicht gestört, das bauschige Kleid hingegen beunruhigte ihn. »An die Wand«, befahl er. Bereitwillig beugte Khalila sich vor, und obwohl es ihr sichtlich missfiel, berührt zu werden – insbesondere so ungeniert –, sagte sie nichts, als der Mann sie abtastete. »In Ordnung. Umdrehen.«
Sie kam seiner Aufforderung nach und wollte schon zurück in ihre Zelle gehen, da legte er ihr die Hand auf die Schulter. »Nein. Der Schal kommt ab.«
»Das verstößt gegen meine Religion. Verehrt denn hier niemand den Propheten, Friede und Segen sei mit ihm? Na gut. Ich habe sämtliche Haarnadeln entfernt«, sagte Khalila und streckte ihm den Arm entgegen, um ihm eine Handvoll Klammern zu reichen. »Darunter habe ich nichts versteckt. Das schwöre ich.«
»Deinem Ehrenwort traue ich nicht, Gelehrte«, feixte der Mann und trat ohne Vorwarnung hinter sie, packte den Stoff ihres Hidschabs und zog ruckartig daran. Khalilas Kopf wurde nach hinten gerissen, und sie stieß einen leisen Schrei der Entrüstung aus, bevor sie nach dem Schal griff. Mit der Hand an ihrem Nacken schubste die Wache sie fest gegen die Gitterstäbe ihrer Zelle. »Keine Bewegung!«
»He! Hände weg!«, rief Jess, in dem sich plötzlich Zorn wie griechisches Feuer entzündete. Er umklammerte die Gitterstäbe und rüttelte heftig an ihnen. Dario schwor, dem Mann im Schlaf die Kehle aufzuschlitzen.
Khalila gab keinen weiteren Laut von sich.
Die Wache zog den Hidschab weg, der locker um Khalilas Hals hing, und ein Wasserfall aus weichem basaltschwarzem Haar ergoss sich über ihre Schultern. Frohlockend zerknüllte er den Stoff in der Hand und stopfte ihn sich in den Gürtel. »Schon besser«, sagte er zu ihr. »Hier gibt’s keine Sonderbehandlung für dich und welchen Gott auch immer du anbetest, Gelehrte. Es wäre klüger, wenn du das rasch lernst.«
Blitzschnell wirbelte Khalila herum, packte den Mann am Handgelenk und verrenkte ihm den gesamten Arm. Sie drehte erbarmungslos weiter und presste ihm die Handfläche fest auf den gebeugten Ellbogen, bis sein Knochen zu knacksen begann, dann hielt sie den Mann, der erbärmlich jaulend aufheulte, in dieser Position gefangen. In dem verzweifelten Versuch, den Druck von seinem Gelenk zu nehmen, rührte er sich leicht, doch da drückte Khalila noch brutaler zu. Diesmal wurde sie mit einem schrillen Kreischen belohnt. Die Knie des Mannes gaben unter ihm nach.
Die beiden anderen Wachen stürzten vor, doch Glain glitt aus der Zelle und stellte sich ihnen in den Weg. Khalila würdigte es mit einem hastigen Blick zur Seite, ansonsten blieb ihre Aufmerksamkeit fest auf den Mann gerichtet, den sie in einem schmerzhaften Schraubstockgriff hielt.
»Zwingen Sie mich nicht, ihn zu brechen«, sagte sie. »Und tun Sie das nie mehr. Nie wieder. Es ist beleidigend und respektlos. Verstanden?«
»Loslassen!«, keuchte er. Khalila holte ihr Kopftuch aus seinem Gürtel und schubste den Brandschatzer beiseite. Taumelnd fand er sein Gleichgewicht wieder, senkte das Kinn, und Jess sah, wie er nach einem Messer an seinem Gürtel griff.
Wortlos drehte sich Glain zu ihm um und verpasste ihm einen raschen, kraftvollen Aufwärtshaken, der den Kopf des Mannes nach oben riss. Seine Augen rollten nach hinten in seinen Schädel, bis nur noch das Weiße zu sehen war. Ihr Einschreiten sorgte bei Glain natürlich für eine Blöße, und die anderen beiden Wachen packten sie und stießen sie zurück gegen die Wand. Einer von ihnen rammte ihr die Faust mit voller Wucht in den Magen. Sie grinste nur, die feuchten Zähne gefletscht. »Das war schwach, Brandschatzer«, sagte sie mit einem leisen Säuseln. »Probier’s noch mal.«
Er ließ einen zweiten Schlag folgen, diesmal härter. Doch es war sinnlos, und Jess wusste ein Lied davon zu singen, denn Glain hatte mit diesem Trick in der Kaserne der Hohen Garda viel Geld verdient. Solange sie Zeit hatte, ihre Brustmuskeln anzuspannen, würde die Wache ihr keinen Schaden zufügen, und sie würde sich niemals anmerken lassen, dass es wehtat. Ein verdammt brutales Spiel, aber es entsprach Glains Naturell.
»Genug«, sagte die letzte Wache und schubste seinen Freund zurück, als dieser sich anschickte, Glain wieder in den Magen zu boxen. »Du, zurück in die Zelle und keinen weiteren Ärger«, sagte er zu Khalila. »Ich werde dich nicht anfassen, wenn du mir keinen Anlass gibst. In Ordnung? Du kannst den Schal behalten. Das alles ist doch unnötig.«
Khalila nickte. »Vielen Dank«, entgegnete sie. »Vielleicht kümmern Sie sich jetzt lieber um Ihren Freund. Ich glaube, er braucht einen Medica.« Sie trat über den Mann hinweg, den Glain bewusstlos geschlagen hatte, wickelte sich im Gehen das Tuch wieder um den Kopf und steckte es geschickt fest.
»Du auch, Soldatin. Wieder rein mit dir«, sagte die dritte Wache zu Glain und wich ihr aus. Ihr Lächeln war wie festgefroren – ein erschreckend wildes Grinsen –, und sie spazierte gemächlich und völlig unbekümmert in die Zelle, wobei sie absichtlich auf den Soldaten trat, der reglos am Boden lag. Der Mann gab nicht einmal ein Stöhnen von sich.
»Danke für deine Hilfe.« Khalila hielt die Handfläche hoch, und Glain schlug beiläufig ein.
»Oh, das habe ich nur zum Spaß gemacht«, erwiderte sie und knallte mit übertrieben theatralischem Gebaren, über das Jess schmunzeln musste, die Zellentür hinter sich zu. Es erinnerte ihn an Khalila, die ihre Gelehrtenrobe freiwillig ausgezogen hatte, bevor sie ihr vom Leib gerissen werden konnte. »Nun? Wollt ihr denn nicht abschließen, y twpsyn?« Jess kannte das walisische Wort nicht, konnte sich jedoch lebhaft ausmalen, dass es nichts Schmeichelhaftes bedeutete.
Die Wache, die Glain in den Magen geboxt hatte, trat vor, um den Schlüssel umzudrehen. »Beim nächsten Mal …«, fauchte er Glain an.
»Süßer, beim nächsten Mal werde ich nicht einfach nur dastehen«, erwiderte sie. »Und anschließend schicke ich Blumen.«
Jess lachte. »Glain, kannst du dir vorstellen, dass es eine Zeit gab, als ich dich nicht gemocht habe? Ich war wirklich ein Dummkopf.«
Glain bedachte ihn mit ihrem halbwilden Grinsen. »Halt die Klappe. Das bist du immer noch.«
Von nun an legten die Wachen größere Vorsicht an den Tag und wählten als Nächstes Morgan. Während die Männer sich voll auf sie konzentrierten, lehnte Jess sich mit verschränkten Armen gegen die Gitterstäbe, bis er an der Reihe war. Diese Position brachte seine rechte Hand praktischerweise nah genug an die metallene Haarnadel, um sie aus seinem Ärmel zu befreien und einen langen Zwirn aus dem ausgefransten Stoff zu ziehen. Der Faden war nicht so lang, wie es ihm lieb gewesen wäre, doch seine Möglichkeiten waren begrenzt. Einhändig knotete er das Garn an die Haarnadel, band eine Schlaufe ans andere Ende und hob, als die Wachen mit Morgan fertig waren und ihre Tür hinter ihr abgesperrt hatten, die Hand, um ein Husten zu verbergen. Geschickt schob er die Schlinge über seinen Backenzahn, schluckte und fürchtete eine erschrockene Sekunde lang, die Nadel könnte sich in seine Kehle bohren, bevor sie hinabrutschte und auf der Hälfte der Speiseröhre am Ende des Fadens baumelte.
Es war kein angenehmes Gefühl.
»Jetzt du«, raunzte die Wache und schloss die Tür zu seiner Zelle auf. »Der Schrank. Keine Gegenwehr, oder ich schwöre, du wirst es bereuen.« Diesmal zog er eine Schusswaffe und richtete sie auf Thomas, der langsam vortrat. »Mit dem Gesicht zur Wand. Hände hoch und flach auf den Stein. Keine plötzlichen Bewegungen.«
Thomas schien es nicht das Geringste auszumachen, durchsucht zu werden, was bei allen für Erleichterung sorgte. Seit seiner Befreiung aus dem geheimen Gefängnis der Bibliothek haftete seinen Reaktionen etwas Unberechenbares an, das Jess in Momenten wie diesen mit Nervosität erfüllte. Doch sein Freund blieb sanft wie ein Lamm, bei ihm wurde nichts gefunden, und er wurde ohne jeden Zwischenfall zurück in die Zelle geschickt.
Jess’ Durchsuchung ging schnell über die Bühne, aber für ihn nicht schnell genug. Bei diesem Zaubertrick stellte er sich nicht so geschickt an wie sein Bruder Brendan, und Schweiß brach ihm auf der Stirn aus, während er den unwiderstehlichen Drang niederkämpfte, den Faden samt Haarnadel wieder hochzuwürgen. Jede einzelne unerträgliche Sekunde spürte er in seiner Kehle den Fremdkörper, der gegen die empfindliche Haut seiner Speiseröhre drückte, und selbst das schnellste Abtasten der Wache fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Doch es war unerlässlich, nicht in Panik zu geraten. Er hatte Schmuggler erlebt, die an hinuntergeschluckten Schlüsseln erstickt waren.
»Na schön«, sagte die Wache und schubste ihn zurück in die Zelle. »Nächste Zelle. Du. Spanier.«
Jess setzte sich und verlangsamte Atmung und Puls so gut wie möglich, während die Durchsuchung der Gefangenen fortgeführt wurde. Sein Magen bäumte sich rebellierend auf, aber glücklicherweise gelang es ihm, auch den zu beruhigen. Dario wurde abgetastet und in seine Zelle geschickt. Allmählich erlangte der dritte Mann das Bewusstsein wieder, murmelte benommen etwas über Rache und wurde weggeschickt, damit er einen Arzt aufsuchte.
Selbst Wolfe und Santi gaben sich ohne jegliche Gegenwehr geschlagen, als wüssten sie instinktiv, wie wichtig es war, die Wachen rasch loszuwerden.
Schließlich schloss sich die Tür ins Freie mit einem metallenen Klirren hinter den beiden Wachen, und Jess kniff die Augen zu, während er auf das Geräusch von Schlüsseln lauschte. Im nächsten Moment vernahm er es. Auf ihn warteten demnach nicht nur die jeweiligen Zellenschlösser, sondern noch dazu eine Außentür. Und er hatte dafür nur eine einzige kleine Haarnadel.
»Sie sind fort«, sagte Thomas zu ihm, und Jess schlug die Augen auf. »Dein Gesicht hat die Farbe von geronnener Milch angenommen. Ist dir schlecht?«
Jess hielt einen Finger hoch, um ihm zu signalisieren, dass er einen Moment warten sollte, dann griff er in seinen Mund und versuchte, das rutschige Stück Faden zu fassen zu bekommen. Entspann dich, ermahnte er sich und zog einmal fest an dem Zwirn. Das widerlich würgende Husten, als die Haarnadel endlich aus seiner Kehle rutschte, konnte er nicht unterdrücken, doch der vorübergehende Brechreiz war ein kleiner Preis, den er für den Triumph zahlte, die Klammer stolz Thomas präsentieren zu können. »Ein alter Straßenzaubertrick«, erklärte Jess und zog die Schlinge von seinem Zahn. »Runterschlucken, dann hochwürgen. Vorzugsweise, ohne sich zu übergeben.«
»Das«, sagte Thomas voll aufrichtiger Bewunderung, »ist ekelerregend.«
»Stimmt.« Jess wischte die Haarnadel ab und bog sie behutsam in der Mitte hin und her, bis sie in zwei Hälften brach. »Man lernt so viele nützliche Dinge, wenn man sich mit Ganoven umgibt.«
»Ich lerne also einiges«, sagte Dario von der Zelle gegenüber. »Und was hilft uns das?«
»Funktioniert wie ein Dietrich.«
»Na und? Du sperrst unsere Zellen auf. Dann sind wir doch immer noch in Philadelphia gefangen.«
»Dann sperre ich deine halt nicht auf.«
»Ich nehme alles zurück, lieber Engländer!«
Jess ignorierte ihn, während er eine der Hälften zu einer Art Spanner formte und die andere zu einem behelfsmäßigen Dietrich. Thomas beugte sich vor, um ihm bei der Arbeit zuzusehen. »Brauchst du Hilfe?«, fragte er, aber Jess schüttelte den Kopf. »Dario hat im Grunde recht. Ein Schloss zu knacken, ist keine Flucht.«
»Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, und Dario hat niemals recht.«
»Ihr wisst schon, dass ich euch hören kann, oder?«, seufzte der Spanier. »Denn ihr redet ganz schön laut.«
»Was meinst du, warum ich das gesagt habe?« Jess benutzte eine Gitterstange als Hebel, um die Haarnadel leicht zu biegen, dann kniete er sich an die Tür, um ein Gefühl für den Dietrich zu bekommen. Es erforderte mehrere kleine Anpassungen, die Jess geduldig vollführte, während er das Schloss austestete und ihm seine Besonderheiten entlockte.
»Khalila, geht’s dir gut?«, fragte Dario. Seine Stimme hatte sich verändert, war warm und leise geworden. »Es tut mir leid, was er dir angetan hat. Das war abscheulich.«
»Alles in Ordnung«, sagte sie. Von ihrer Seite der Zelle konnte sie Dario nicht sehen. Eine Wand war zwischen ihnen. »Nichts passiert. Jeder von euch ist für mich eingetreten. Das zählt viel mehr.« Ihr Tonfall war ruhig, aber Jess konnte ihr Gesicht sehen. Sie zitterte immer noch vor Wut.
»Nun«, sagte er, da er an nichts weiter als das Offensichtliche denken konnte, »wir sind hier doch alle eine große Familie, nicht wahr? Und genau das tut eine Familie füreinander.«
Khalila holte tief Luft und atmete langsam aus. »Ja«, sagte sie, »ich schätze, das sind wir. Und es bedeutet mir viel.«
Jess machte sich wieder an die Arbeit mit dem Schloss. »Hm, wenn ich dich als Familie bezeichne, ist das für mich eine echte Verbesserung, während es für dich einen Riesenrückschritt bedeutet«, grübelte er laut nach. »Ich habe es euch nie gesagt, Leute, aber … es tut mir leid, dass mein Dad uns im Stich gelassen hat. Er ist schon immer ein mieser Vater gewesen. Ich dachte nur, er wäre als Geschäftsmann gut genug, um sich nicht von Brandschatzern über den Tisch ziehen zu lassen.« Und mich dabei zu verkaufen, dachte er, ohne es laut auszusprechen. Doch es tat immer noch weh.
»Das ist nicht deine Schuld«, sagte Morgan. »Und mein Vater hat versucht, mich umzubringen, nur für den Fall, dass du das vergessen hast. Im Gegensatz zu meinem ist deiner der Inbegriff eines perfekten Familienmenschen.« Sie ließ sich auf die Pritsche in ihrer Zelle sinken und zog die Füße hoch, um sich im Schneidersitz hinzusetzen. »Oh, na gut, ich schätze, für mich seid ihr auch meine Familie.«
»Du musst nicht gleich so übertrieben enthusiastisch klingen«, sagte Glain. »Und nichts für ungut, aber ich habe tolle Eltern und viele wunderbare Brüder, also behalte ich die lieber. Trotzdem seid ihr alle ganz annehmbare Freunde – das muss ich zugeben.«
Khalila streckte sich seufzend. »Unsere Zeit wird nur sehr langsam verstreichen, wenn mir keine andere Zerstreuung bleibt, als euch allen zuzuhören, wie ihr euch beleidigt, und sie uns keine Bücher geben.«
»Ich kann ein paar auswendig aufsagen«, erklärte Thomas, »sollte dir jetzt schon langweilig sein.« Mit eintöniger, sonorer Stimme begann er, einen staubtrockenen Text über Getriebeübersetzungen aufzusagen, den er sich irgendwann eingeprägt hatte, während die anderen ihn anflehten, damit aufzuhören. Jess fluchte leise, als er das widerspenstige Schloss, den eingerosteten Mechanismus und die nervtötende Zerbrechlichkeit seines Dietrichs spürte. Komm schon, beschwor er ihn. Na los! Er konnte den Druck spüren, der auf dem Dietrich lag, und schob den Spanner zurecht, um eine größere Hebelwirkung zu erreichen. Angesichts des Gewichts dieses Schlosses waren Haarnadeln nicht das richtige Material, und seine Fingerspitzen wussten, dass das Metall sich gleich biegen würde. Ich brauche einen besseren Winkel. Er unterdrückte ein Seufzen, holte die Haarnadel wieder heraus und betrachtete den angerichteten Schaden. Dann machte er sich behutsam an die Arbeit, um den provisorischen Dietrich noch rechteckiger zu biegen. Erneut steckte er ihn ins Loch, und schlagartig kam es ihm vor, als wäre der gesamte Schließmechanismus vor ihm offengelegt, leuchtend weiße Linien, die vor seinem geistigen Auge schimmerten. Ein kleiner Dreh hier, ein bisschen Druck dort …
Mit einem jähen Klicken rastete der Dietrich ein, verhakte sich und ließ sich endlich drehen.
Thomas schoss in die Höhe und brach seinen Vortrag ab, als Jess gegen die Tür drückte. Ganz langsam schwang sie auf.
»Dios mío«, hauchte Dario, stürzte zu seiner eigenen Zellentür und schlang die Hände um die Gitterstäbe. »Dann mach mal, du wunderbarer Krimineller! Lass uns raus!«
»Auf einmal ziehst du andere Saiten auf, hm?«, sagte Santi. »Jess. Das reicht.«
»Ja, Sir.« Es war verlockend, in den Gang zu treten, und noch verlockender, sein Glück bei der Tür ins Freie zu versuchen, doch er wusste, dass der Kommandant recht hatte. Widerwillig griff er nach der geöffneten Tür, schwang sie zurück und hielt sie, den Fuß durch die Gitterstäbe geklemmt, fest zu, während er mit dem Dietrich wieder abschloss. Das ging leichter.
»Nein, nein, nein!« Mit dem Handballen hämmerte Dario gegen die Stäbe, ein klirrender Lärm, auf den Jess gut und gern verzichtet hätte. »Du Narr, was tust du da?«
»Er vertreibt sich die Zeit, was ihr alle ebenfalls tun werdet, wenn auch leise«, sagte Santi. »Wir brauchen eine Pause, um uns zu erholen und wieder zu Kräften zu kommen. Außerdem müssen wir ihr Misstrauen zerstreuen, die Stadt auskundschaften und einen anständigen Fluchtplan aushecken. Dafür brauchen wir Zeit und ein gewisses Maß an Vertrauen von unseren Geiselnehmern. Wir erreichen nichts davon, wenn wir jetzt einen nutzlosen Fluchtversuch starten.«
Dario wusste sicher, dass der Kommandant recht hatte, aber seine Enttäuschung war spürbar, und er hämmerte ein letztes Mal auf die Gitterstäbe ein, bevor er sich auf seine Pritsche fallen ließ. Allerdings ohne Widerworte zu geben. Nicht einmal Dario war so töricht, ohne einen Plan vorzupreschen.
Bei Santi klang es schrecklich einfach, dachte Jess, doch das wäre es nicht. Nichts davon. Und ihm kam der unangenehme Gedanke, dass sie nach ihrer Flucht – falls sie es denn aus der Stadt schaffen würden – immer noch in Amerika wären, weit weg von jeglicher Hilfe.
Dennoch sorgten das kleine Stück Metall in seiner Hand und das bisschen Kontrolle dafür, dass der Hurrikan in seinem Kopf zu einem grollenden Sturm abflaute. Das Gewitter murmelte ihm zu: Es ist sinnlos. Das Metall wird nicht ewig halten. Der Dietrich wird brechen. Was dann?
Aus dem Nichts erinnerte er sich an etwas, das sein Vater ihm einmal in seiner Kindheit gesagt hatte. Wenn die ganze Welt ein Schloss ist, Junge, schmiedest du keinen Schlüssel. Du wirst zum Schlüssel.
Eine Brightwell’sche Weisheit. Scharfsinnig, unsentimental und in diesem Moment etwas, das den letzten Rest seiner Sorgen wegwischte. Zumindest fürs Erste.
Ephemera
Text aus dem Band Liber de Potentia, der sich mit den Gefahren durch abtrünnige Obskuristen befasst. Das gesamte Buch steht allein der Kurie und dem Archivar Magister zur Verfügung. Gewisse Abschnitte sind auch für die Medica-Abteilung frei zugänglich.
… die toxische Wirkung beim übermäßigen Gebrauch der Fähigkeiten von Obskuristen. Dies zeigt sich am deutlichsten und grausamsten am Beispiel des französischen Obskuristen Gilles de Rais. Während er im Eisenturm seine Ausbildung genoss, verließ er ihn auf eigenen Wunsch, um in sein Heimatland zurückzureisen (notabene – deshalb unser Vorschlag, keine weiteren Genehmigungen für das Verlassen des Eisenturms zu erteilen, selbst aus dringenden familiären Gründen). Anschließend setzte er seine beträchtlichen Talente nicht, wie er es einst geschworen hatte, zum Wohle der Bibliothek ein, sondern um eine französische Kriegerin zu ertüchtigen, die als Widerstandskämpferin gegen die Engländer in die Schlacht zog.
De Rais nutzte seine gottgegebene Begabung in leichtfertigem und verschwenderischem Exzess, um Jeanne d’Arc am Leben zu halten und zu beschützen: Es besteht kein Zweifel, dass die Frau eine begnadete Kämpferin war, die der Hohen Garda, hätte sie in ihren Diensten gestanden, alle Ehre gemacht hätte. Doch die ständige Beanspruchung seiner Macht, um ihre Rüstung zu verstärken und ihre Wunden zu heilen, forderte schlussendlich von ihnen beiden ihren unabdingbaren Tribut.
De Rais’ Kräfte wuchsen an, wie es für Obskuristen charakteristisch ist, denen erlaubt wird, ihre Fähigkeiten ohne Einschränkung zu verbessern, doch wie Aristoteles höchstpersönlich anmerkte, wird das, was mit Verunreinigungen in Kontakt kommt, nie wieder sauber. Anfangs war sein Heilen von Erfolg gekrönt, aber während die Fäulnis in ihm die Oberhand gewann, brachte seine Berührung Wahnsinn, Fieber und letzten Endes den Untergang seines eigenen, ihm zur Treue verpflichteten Champions mit sich.
Zurück in seiner Burg, gelobte er, die gefallene Jeanne wiederauferstehen zu lassen. Innerlich zerfressen und längst verrückt geworden, führte er innerhalb dieser Mauern ein Grauen durch, das zur grässlichen Legende wurde. Dass er schließlich von seinen eigenen Landsleuten durch den Scheiterhaufen gereinigt wurde, kann nur als Akt der Gerechtigkeit angesehen werden.
Sein Fall ist demnach eine deutliche Warnung für all jene, die dem Irrglauben nachhängen, Obskuristen könnten ihren Pflichten unbewacht nachkommen und ihre Kräfte ohne Kontrolle nutzen. Im Innern des Eisenturms setzen sie ihre Macht mit Bedacht und konstruktiv ein: das bloße Metall des Turms begrenzt bereits ihre Fähigkeiten. Zu diesem Zwecke und mit dem dunklen Beispiel von Gilles de Rais vor Augen schlagen wir dringend vor, sämtliche Obskuristen für immer im Eisenturm einzusperren, abgesehen von gezielten Aufträgen, bei denen sie unter wachsame Beobachtung gestellt werden. Beim geringsten Anzeichen von Gefahr muss der Obskurist sofort und entschieden von jeglichem Gebrauch seiner Macht abgehalten werden, bis seine natürliche Heilung – wenn möglich – eintritt.
Während die Fäulnis im Anfangsstadium womöglich noch rückgängig gemacht werden kann, stellt sie dennoch nicht nur für den Obskuristen selbst, der sie in sich trägt, sondern auch für jeden in seiner Umgebung eine ernste Bedrohung dar.
Macht birgt immer auch das verborgene Risiko einer Bedrohung.
2
Am nächsten Morgen kurz vor Sonnenaufgang erwachte Jess und begann eine systematische Bestandsaufnahme seiner Zelle, einschließlich der Steine, des Mörtels und der Gitterstäbe.
Thomas, die Hände auf der Brust verschränkt, ragte weit über seine schmale Pritsche heraus. Sein Atem wirkte gleichmäßig und ruhig, doch im trüben Licht, das durch das hohe Fenster sickerte, bemerkte Jess, dass sein Freund nicht schlief. Seine blauen Augen waren geöffnet und starrten zur Decke – sein Blick hingegen war nicht leer. Sein Verstand raste offenbar.
»Woran denkst du?«, fragte Jess leise, während er sich auf seine Pritsche stellte und an den Eisenstäben vor dem Zellenfenster rüttelte. Der Tonfall seiner Frage klang gleichgültig, da es durchaus möglich war, dass die Gedanken seines Freundes in die Vergangenheit abgedriftet waren. Diese Zellen waren sauberer als die der Bibliothek und bisher erfrischend frei von Folterinstrumenten, aber die Ähnlichkeit jagte ihm dennoch einen Schauder den Rücken hinab, und er mochte sich nicht vorstellen, was die Inhaftierung für Thomas, der Monate in dieser Hölle erduldet hatte, an die Oberfläche zerrte.
Thomas ließ zwei Atemzüge verstreichen, bevor er sagte: »Ich nehme an, sie werden versuchen, zuerst Morgan zu holen.«
Das war weit entfernt von dem, was Jess erwartet hatte, und er sprang beinahe lautlos auf den Boden hinunter. »Wie kommst du darauf?«
»Die Brandschatzer mögen die Bibliothek hassen, aber sie sind nicht dumm – zumindest dieses Nest hier nicht. Ihr Widerstand dauert nun schon seit mehr als hundert Jahren an, und dank ihnen ist die amerikanische Kolonie für die Bibliothek in jeglicher Hinsicht ein Pulverfass. Beck wird den Vorteil gewiss zu schätzen wissen, eine eigene kleine Obskuristin in seinen Fängen zu haben. Sie könnte ihnen bei ihren terroristischen Anschlägen helfen, ihre Translationskammer reparieren, ihren eigenen Kodex erschaffen … Womöglich bauen sie hier in Philadelphia ihre eigene Splittergruppe der Großen Bibliothek auf, aber unter ihrer Kontrolle. Sie sind bestimmt im Besitz von Originalbüchern. Was ihnen fehlt, ist eine Obskuristin. Der Rest von uns …« Thomas zuckte mit den Schultern. »Wir sind nur ein netter Bonus.«
Eine neue Stimme sagte: »Wir müssen unsere Fähigkeiten zu unserem Vorteil einsetzen.« Es war Khalila, die am Rand ihrer Pritsche in der Nähe der Zellentür saß. »Unser Wissen ist unsere Macht. Wir müssen dafür sorgen, dass sie das verstehen.«
»Hast du den Teil nicht mitbekommen, dass sie Morgan höchstwahrscheinlich mit Gewalt holen werden?«
»Morgan ist direkt neben euch und hat es satt, dass über sie gesprochen wird, als wäre sie ein zerbrechlicher Schatz«, machte sich Morgan bemerkbar. »Im Gegensatz zu euch schwebe ich am allerwenigsten in Gefahr, wie Thomas eben so eloquent ausgeführt hat.«
»Schläft denn hier niemand mehr?«, fragte Jess genervt.
Seine Worte sorgten in Darios Zelle für ein trockenes Lachen, obwohl der Spanier sich nicht einmal die Mühe machte, sich von seiner Pritsche zu erheben. »Habt ihr versucht, in diesem erbärmlich schlechten Witz von einem Bett eine bequeme Position zu finden? Khalila hat recht. Entweder müssen wir mit den Brandschatzern zusammenarbeiten oder fliehen. Das sind unsere einzigen Optionen.«
»Eine Zusammenarbeit scheidet aus«, sagte der Gelehrte Wolfe. Jess konnte ihn nicht sehen, er befand sich auf der anderen Seite der Mauer zu seiner Linken. »Es gäbe die Möglichkeit einer scheinbaren Zusammenarbeit mit ihnen, und das ist ein Mittel zu einem höheren Zweck als nur dem bloßen Überleben. Wir brauchen ein Ziel, um nicht nur aus den Zellen oder dem Gebäude, sondern auch aus der Stadt zu fliehen. Selbst danach brauchen wir einen Plan für das, was dann kommt. Unternehmt nichts, ohne zumindest drei Schritte im Voraus zu kennen.«
»Ich habe einen Plan. Meine mechanische Druckerpresse bauen«, sagte Thomas. »Und sie zu benutzen, um die Herrschaft der Bibliothek über das Wissen zu brechen. Das ist ein guter Plan.«
»Das ist kein Plan, mein armer Ingenieur. Das ist ein Ziel«, entgegnete Dario. »Ein Plan sind die Schritte, die wir unternehmen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Du weißt schon, der langweilige Teil davon, clever zu sein.«
»Ich weiß zumindest, wie ich meinen Teil baue«, erwiderte Thomas. »Was mehr ist, als ich von dir behaupten kann, Dario.«
»Gentlemen, hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass wir eine Familie sind?«, rügte Khalila sie alle.
»Ich streite mich auch mit meiner Familie«, meinte Dario. »Aber ja, Wüstenblume. Ich gelobe Besserung.«
»Einverstanden«, sagte Thomas. »Ich entschuldige mich. Sicherlich verfügt Dario über eine Fähigkeit, von der ich bisher nichts weiß.«
Khalila hätte fast laut gelacht. »Dann lasst uns fortfahren. Beck ist weder dumm noch ein übereifriger Fanatiker, andernfalls hätte er nicht so lange als ihr Anführer überlebt. Also …«
»Also bieten wir ihm etwas, das er in den beschlagnahmten Büchern nicht findet«, unterbrach Jess sie. »Wie Thomas gesagt hat. Die Druckerpresse.«
Dario schnaubte verächtlich. »Blöde Idee. Sobald er die Pläne hat, besitzen wir keinen Wert mehr für ihn.«
»Ihr vergesst, dass wir auch jetzt keinen Wert für ihn haben«, erklärte Wolfe. Sein Tonfall war so schwer und scharf wie die Klinge einer Guillotine. »Die Einzige, die er wirklich braucht, ist Morgan. Der Rest von uns ist – wie Thomas es korrekt ausgedrückt hat – ein netter Bonus. Er muss wollen, dass wir am Leben bleiben.«
Thomas hatte sich aus seiner totengleichen Reglosigkeit auf der Pritsche immer noch nicht gerührt. Sein Blick war fest auf die in Schatten gehüllte Decke geheftet. »Dann gebe ich ihm die Pläne einfach nicht. Ich fertige die Presse zuerst selbst an und zeige ihm, dass sie funktioniert«, sagte er. »Und Jess hilft mir beim Bauen. Zusammen mit Morgan, das sind dann drei, die er nicht töten kann, und es verschafft uns Zeit.«
»Das könnte für dich klappen. Jess hingegen ist nur ein weiteres Paar Hände.«
»Ich sage das äußerst ungern, aber Beck braucht mich«, erwiderte Jess. »Nicht so sehr wegen meines brillanten Verstandes, sondern um selbst zu überleben. Habt ihr euch diese sogenannte Stadt überhaupt mal angeschaut? Sie lebt nicht mehr aus eigener Kraft. Die Hälfte der Gebäude liegt in Schutt und Asche, die Menschen stehen kurz vor dem Hungertod.«
»Hundert Jahre unerbittliche Belagerung bringt das nun mal mit sich«, sagte Santi.
»Und sie überleben nicht dank der mageren Ernte an Feldfrüchten, die sie hier anbauen. Zumindest nicht vollständig.«
Santis Stimme nahm einen nachdenklichen Ton an. »Ich verstehe, worauf du hinauswillst. Diese Stadt überlebt wegen der Schmuggler, die ihnen zusätzliche Nahrung und Baumaterialien bringen.«
»Genau. Und diese Schmuggler haben Beziehungen, die auf die eine oder andere Art zurück zu meiner Familie führen. Sobald Beck meine Identität kennt, steigt mein Wert durch das, was ich repräsentiere. Ich kann ihm bessere Konditionen und mehr Rohstoffe sichern. Oder das Gegenteil, denn wenn er mich tötet, verliert er seinen Nachschub an Vorräten.«
»Schön für dich«, schnaubte Dario. »Dieser letzte Teil klingt besonders gut. Ich meine, es bestünde natürlich eine bessere Chance für uns, im Chaos zu fliehen, wenn du dich freiwillig als Opferlamm anbieten würdest.«
Jess’ Antwort kam ohne Worte. Mit einer Geste.
»Jenseits dieser Mauern zu gelangen, stellt die viel größere Herausforderung dar«, erklärte Santi. »Sie stehen seit hundert Jahren – höchstwahrscheinlich verstärkt durch einen Obskuristen, um griechischem Feuer und anderem, konventionellerem Beschuss standzuhalten. Außerdem sind nicht weniger als vier volle Kompanien der Hohen Garda vor den Mauern von Philadelphia stationiert, und der Zugang wird rund um die Uhr bewacht. Meine eigene Kompanie …« Seine Stimme geriet leicht ins Zaudern, als wäre ihm erst jetzt klar geworden, dass er für Thomas’ Rettung alle Brücken hinter sich abgebrochen hatte, einschließlich seiner Position als Kommandant der Hohen Garda und demzufolge seiner Soldaten. »Meine eigene Kompanie hat vor ungefähr fünf Jahren zwölf Monate dort verbracht.«
»Apropos«, sagte Dario. »Ich hätte angenommen, dass die beeindruckend bewaffnete Hohe Garda ein paar hundert Brandschatzer in weniger als einer Woche, ganz zu schweigen einem Jahrhundert, innerhalb einer halb zerstörten Stadt bezwingen könnte.«
»Stehender Befehl des vorletzten Archivars«, antwortete Santi. »Die amerikanischen Kolonien waren schon immer eine Keimzelle des Widerstands. Das vollständige Niederbrennen von Philadelphia könnte für einen Flächenbrand sorgen. Die Brandschatzer in Schach zu halten, ist die vorherrschende Maxime, und nur ein gelegentliches Bombardement ist gestattet, damit ihnen ins Gedächtnis gerufen wird, dass wir dort draußen sind.«
»Und ich nehme an, Ihnen sind auch Schmuggler begegnet.«