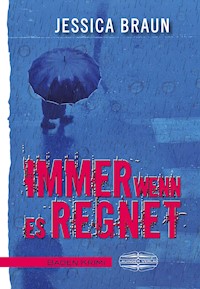16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Jeder Mensch, der auf die Welt kommt, holt in der ersten Minute Luft. Ab dann arbeitet die Lunge normalerweise von ganz alleine. Aber chronische Lungenkrankheiten, Asthma oder Schlafapnoe sind heute zu Volkskrankheiten geworden, und auch all jene, die nicht krank sind, japsen, keuchen, schnauben und schnaufen.
Die Autorin Jessica Braun, die selbst leicht aus dem Atemtakt zu bringen ist, macht sich auf den Weg, das Luftholen neu zu lernen. Sie begleitet eine Gebärende beim Hecheln, besucht ein Schlaflabor, lässt eine Atemdiagnose durchführen, meditiert mit einem indischen Guru, taucht mit Apnoetauchern ab und schaut einer Domina dabei zu, wie diese ihrem Kunden die Luft abdrückt. Ihre Recherche führt sie zu Forschern und Schauspielern, Biathleten und Yogalehrern.
Sie zeigt, wie der Atem Körper und Seele verbindet. Und dass jeder die Kunst des Atmens erlernen und sein Leben verändern kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
INHALT
» Über die Autorin
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks der Autorin
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DIE AUTORIN
Jessica Braun, geboren 1975, ist Journalistin und erfolgreiche Buchautorin und lebt in Berlin. Ihre Texte erscheinen in der Zeit, Süddeutschen Zeitung, Salon, Feinschmecker und Glamour. Sie hat unter anderem die Bücher Your Home is my Castle. Als Wohnungstauscher um die Welt und Träum schön. Reisetagebuch für die Nacht veröffentlicht.
ÜBER DAS BUCH
Etwa 20000 Mal atmet ein gesunder Mensch pro Tag. Doch Atmen ist nicht nur etwas, das nebenbei passiert. Wir können den Atem ausdehnen, synchronisieren, anhalten. Das macht ihn zu einer grandiosen Fähigkeit, über die viele von uns jedoch zu wenig wissen.
Jessica Braun lässt ihren Atem analysieren, meditiert mit einem Guru, besucht ein Schlaflabor, trainiert mit Apnoetauchern und Biathleten und spürt dem ersten und dem letzten Atemzug nach. Sie zeigt, wie wir mit den richtigen Atemtechniken Körper und Geist beeinflussen und so unser Leben verändern können.
INHALTSVERZEICHNIS:
1. Einleitung
TEIL I: ALLES IST ATEM
2. Die schnaufende Maschine: So atmet der Mensch
3. Dampf über der Ursuppe: Wie der Atem auf die Erde kam
4. Es liegt was in der Luft: Was wir einatmen
TEIL II: AUS VOLLER LUNGE
5. Außer Puste: Warum Sportler die besseren Atmer sind
6. In Extremis: Atmen in Tiefe und Höhe
7. Gib mir ein Haaaa: Wie der Atem die Stimme macht
8. Tief durchatmen: Was Atmen mit Gefühlen zu tun hat
TEIL III: DIE LUFT WIRD DÜNN
9. Bitte kräftig pusten: Verräterisches in der Atemluft
10. Hier kommt keiner durch: Was die Atemwege krank macht
11. Atemlos durch die Nacht: Schlafapnoe
TEIL IV: SCHÖNSTE UND LETZTE ATEMZÜGE
12. Lechz, hechel, stöhn: Liebe, Sex und Atemlosigkeit
13. Das Leben aushauchen: Der letzte Atemzug
TEIL V: ANHANG
14. Atemübungen
15. Danksagung
16. Ausgewählte Literatur
Für Christoph,bis zum letzten Atemzug
1. EINLEITUNG
Ich bekomme keine Luft. Gleich wird mein Chef mich auffordern, meine Themen vorzustellen. Vor knapp fünfzig Kollegen. Der Gedanke daran drückt mir den Hals zu. Findet er meine Vorschläge nicht gut, wird er sie abmoderieren. Akzeptiert er sie, stellt sicher jemand aus der Runde eine kritische Frage. Dann muss ich meine Entscheidungen verteidigen. Ich spüre den Schweißfilm, der meine Handflächen klebrig macht. Versuche, tief zu atmen. Aber mein Brustkorb scheint sich nicht zu weiten. Für die Luft ist kein Platz. Sie bleibt im Kehlkopf stecken. Früher suchte ich mir in Meetings immer einen Stuhl mit guter Deckung. Mit der Wand im Rücken und einem großen Kollegen vor mir fühlte ich mich sicher. Aber seit der Beförderung geht das nicht mehr. Mein Platz ist nun am großen Tisch in der Mitte. Dort, wo sich die Aufmerksamkeit zentriert. Wie soll ich souverän wirken, während mein Kopf glüht? Und warum fällt mir eine simple Sache wie Atmen plötzlich so verdammt schwer?
Atmen bedeutet Leben. Ameisen tun es, indem sie den Kopf einziehen und die Brust breit machen. Elefanten saugen Luft durch die Länge ihres Rüssels. Manche Schildkröten atmen während der Winterstarre rückwärtig, über ihre Kloake. Auch Pflanzen atmen. Sie lassen Sauerstoff durch winzige elastische Öffnungen in ihren Blättern entströmen, die sogenannten Stomata. Was diese absondern, atmet der Mensch ein: durch Nase und Mund, die Luftröhre hinab in die Bronchien. Unsere Atmung setzt mit der Geburt ein und begleitet uns in schöner Regelmäßigkeit bis zum Lebensende. Ein, aus. Ein, aus. So gelangt Sauerstoff aus der Umgebung in die Zellen, transportiert der Körper Kohlendioxid nach außen. Atem ist eine Vitalfunktion. Lebenserhaltend, so wie die Verdauung oder der Herzschlag. Und doch so viel mehr: Wir können unser Herz nicht willentlich dazu bewegen, langsamer zu schlagen oder unseren Darm gedanklich dazu bringen, schneller zu verdauen. Aber wir können den Atem ausdehnen, synchronisieren, anhalten. Das macht ihn zu einer grandiosen Fähigkeit: beim Sport, im Berufsleben, ja sogar in der Liebe. Keine sportliche Höchstleistung ohne tiefes Ein-, kein Orgasmus ohne ekstatisches Ausatmen. »Im Atemholen sind zweierlei Gnaden: Die Luft einziehn, sich ihrer entladen. Jenes bedrängt, dieses erfrischt; So wunderbar ist das Leben gemischt«, lobte Goethe. Über das Schwitzen oder den Puls, ebenfalls Vitalfunktionen, verlor Deutschlands größter Dichter dagegen kein Wort. Vielleicht, weil ihnen das Ätherische fehlt?
»So, wie unsere Seele […] uns zusammenhält, umspannen Atem und Luft die ganze Welt«, schrieb der griechische Philosoph Anaximenes. Atmen versorgt nicht nur den Körper mit Sauerstoff. Er verbindet unsere Innen- mit der Außenwelt. Spirare – das Atmen – und Spiritus – der Geist – sind im Lateinischen enge Verwandte. Ärzte sprechen von Inspiration, wenn sie die Einatmung meinen. Umgangssprachlich steht diese aber für einen produktiven Einfall, die unerwartete Erkenntnis. Vom hebräischen neshamah bis zum Hindi-Wort atma – etwa »unzerstörbares Selbst« –, von dem sich das deutsche Wort »atmen« ableitet: Atem und Seele sind schwer zu trennen.
Ich war zehn Jahre alt, als ich zum ersten Mal begriff, dass ich mir den Atem zunutze machen kann. Nass und frierend stand ich mit anderen Kindern aus meiner Klasse im Hallenbad am Beckenrand. Wir trainierten für den Jugendschwimmer: das Schwimmabzeichen in Gold. Nach dem Sprung vom Dreimeterturm kratzte mir noch das Wasser in der Nase. Als Nächstes waren fünfzehn Meter Streckentauchen dran. Fünfzehn Meter! Eine ganze Beckenlänge. Mein Sportlehrer stand neben dem Startblock. »Bist du bereit?« Ich bibberte. »Versuch mal ganz ruhig mit mir ein- und auszuatmen«, sagte er. »Ein …«, er wedelte mit der Hand, als wolle er sich die Schwimmbadluft zufächeln. Sein Brustkorb mit der Goldkette schien breiter und breiter zu werden. »Und aus. Fffffff.« Er schnurrte zusammen wie ein Ballon. Wir wiederholten die Übung noch zweimal. Dann nahm ich einen letzten, tiefen Atemzug und sprang. Das kalte Wasser verschluckte mich. Ich wollte japsen, aber hielt die Lippen fest zusammengepresst. Spürte die Weite in meinem Brustkorb. Wie die Luft von innen dagegen drückte. Soviel, dass ich bestimmt drei Schwimmbäder hätte durchqueren können! Ich öffnete die Augen. Schwamm durch das leuchtend helle Blau. Ich war ein Delfin! Wenn auch einer mit brennenden Augen. Euphorisch tauchte ich dem Ende der Bahn entgegen. Berührte mit der Hand die Kacheln. Streckte den Kopf aus dem Wasser. Schnappte nach Luft. Geschafft!
Atmen ist eben nicht nur etwas, das nebenbei passiert. Die richtige Technik verbessert die Versorgung der Muskulatur, beruhigt den Geist oder putscht ihn auf. Man könnte fast sagen: Atmen ist eine Superkraft. Instinktiv wissen Menschen das schon sehr lange. Eine Mutter, die ihr Kind beruhigend an die Brust drückt; ein Yogi, der in Meditation versinkt; ein Umzugshelfer, der eine Waschmaschine hochwuchtet; eine Scharfschützin, die ihr Ziel ins Visier nimmt oder ein Tenor, der auf der Bühne zum hohen C ansetzt – sie alle lassen sich von ihrem Atem helfen. Etwa 20000 Atemzüge macht ein gesunder Mensch pro Tag: etwa zwei Sekunden ein, etwa drei Sekunden aus. Laut- und mühelos hebt und senkt sich dabei der Brustkorb. Eine unbemerkte Meisterleistung – bei der gleichen Zahl an Kniebeugen wäre das Gejammer groß. Atmen fühlt sich ungefähr so selbstverständlich an wie Blinzeln.
Das ändert sich, wenn die Luft knapp wird – zum Beispiel durch Krankheit oder Smog. Atemwegserkrankungen breiten sich immer weiter aus: Bis 2020 rechnet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit einer Steigerung um fünfundzwanzig Prozent. Weltweit kommen immer mehr Kinder mit Asthma auf die Welt. In Deutschland leidet jeder zwanzigste daran, jeder zehnte hat die chronisch-obstruktive Lungenkrankheit, kurz COPD. Experten warnen davor, dass die in Deutschland gültigen Grenzwerte für Luftschadstoffe die Bevölkerung nicht genügend vor Stickoxiden und Feinstaub schützen. Selbst bei sauberer Luft kann unsere Atmung nicht immer frei fließen: Etwa die Hälfte der Männer und ein Viertel der Frauen schnarcht, bis zu sechs Prozent mit bedrohlichen Atemaussetzern, den sogenannten Schlafapnoen. Wie es sich anfühlt, mit Atemnot zu leben, lässt sich einfach simulieren: dreißig Sekunden mit zugehaltener Nase durch einen Strohhalm zu atmen, löst Beklemmung oder sogar Angst aus.
Der Mensch kann zwar mehrere Wochen ohne Nahrung durchhalten und ohne Flüssigkeit immerhin noch einige Tage. Setzt der Atem aus, bleiben jedoch nur Minuten. Wir müssen atmen, um zu überleben – und können es dennoch verlernen. »Viele von uns haben ein Problem damit, tief zu atmen«, heißt es in einem Aufsatz der Harvard Medical School: »Der Körperkult in unserem Kulturkreis wirkt sich negativ auf die Respiration aus. Ein flacher Bauch gilt als attraktiv, weshalb Frauen und Männer dazu tendieren, den Bauch einzuziehen.« Enge Kleidung, schlechte Haltung und Stress können uns aus dem Takt bringen. Jahrelange Übung im Atmen hilft da offensichtlich nicht. Eine überfüllte U-Bahn oder ein wichtiger Kundentermin – schon macht verschluckte Luft Bauchschmerzen, presst Angst die Stimme zusammen, führt innere Anspannung zu Schluckauf, lässt aufgeregtes Luftholen das Herz rasen. Alles, was uns nervös werden lässt, setzt auch die Atmung unter Druck. Warum ist das so?
Mein Chef nickt mir zu. »Also …«, setze ich an. Meine Stimme klingt flach, gepresst. Das Falsett der Angst. Es gibt nichts, wovor ich mich fürchten müsste. Auf mich ist keine Waffe gerichtet. Nur die Blicke der Kollegen. Aber mein Körper spult längst den Notfallplan ab: Die Amygdala, verantwortlich für das Verarbeiten von Gefühlen, alarmiert den Hypothalamus. Von dort geht ein Signal an die Nebenniere, ein kleines Organ, das beidseits jeweils oberhalb der Nieren liegt. Es ist eine der Haupthormondrüsen im Körper und produziert unter anderem das Stresshormon Adrenalin. Das zirkuliert nun in erhöhter Konzentration zusammen mit anderen Hormonen als Paniksuppe durch meinen Körper. Die Pupillen weiten sich, damit ich den Angreifer (in diesem Fall: meinen Chef) besser sehen kann. Herzfrequenz und Blutdruck steigen. Atemmuskulatur und Arbeitsmuskulatur konkurrieren nun um die Versorgung mit Sauerstoff: Das Herz pumpt auf Hochtouren Blut durch die erweiterten Gefäße, um die Muskeln aufs Loslaufen oder Zuschlagen vorzubereiten. Ein Riesenzirkus, so eine Fight-or-flight-Reaktion. Völlig überzogen. Natürlich bleibe ich sitzen. Versuche, mich zu beruhigen. Aber meine Stimme lässt mich hängen. »Mir egal, was du machst«, scheint sie zu sagen, »Ich haue ab.« Und verkrümelt sich. Das passiert nicht nur, wenn ich mich in Meetings äußern muss. Auch in Honorarverhandlungen klinge ich jämmerlich. Als ich neulich anlässlich des Geburtstags meiner besten Freundin eine Rede halten wollte, konnte ich nur kieksen. Kein Atem, kein Volumen, kein Roarrrr! Nur ein kümmerliches Fähnchen ohne Wind. Man könnte auch sagen: eine Atemschwäche.
Gegen diese Flaute muss ich etwas tun. Mir fehlt eine Anleitung fürs Durchatmen. Ich brauche Erklärungen. Hilfestellung. Denn mein Atem und ich haben uns auseinandergelebt. Seit Jahren bekomme ich durch die Nase schlecht Luft. Wenn ich vor anderen sprechen soll, scheint sich mein Atem regelrecht gegen mich zu richten. Ich möchte das Atmen von Grund auf neu lernen. Wissen, wie es auf die Erde kam. Verstehen, was unseren Atmungsapparat antreibt und was unsere Stimmung damit zu tun. Warum es manchmal schön ist, außer Atem zu sein – beim Sport oder beim Sex – aber bei Asthma oder Lungenkrankheiten lebensbedrohlich. Ich will mit Ärzten darüber sprechen, was die Atemluft über den Gesundheitszustand verrät, und mit Patienten über das Ringen um jeden Atemzug. Mir von einem Schauspieler erklären lassen, wie man ohne Pause spricht. Von einem Guru, wie man in einem Saal mit 1500 Menschen Ruhe findet. Ich möchte von einem Biathlonweltmeister lernen, wie man den Atem beruhigt und mit Apnoetauchern trainieren, die Leere zwischen zwei Atemzügen zu lieben. Ich will Laborluft schnuppern – und in der Sommerfrische aufatmen. Darum soll es in diesem Buch gehen. Ich denke, dass die Beschäftigung mit dem Atem uns den Ausweg aus der atemlosen Gesellschaft zeigen kann, zu der wir geworden sind. Mit Hilfe von über Jahrtausende erprobten Techniken und neuesten Erkenntnissen aus den Labors können wir uns Luft verschaffen. Der Boom von Meditations-Apps und Fitness-Trackern zeigt, dass viele Menschen achtsamer mit sich umgehen. Sie wollen ihren Körper, diesen erstklassig orchestrierten Organismus, besser verstehen. Die Betroffenen und Experten in diesem Buch können mit ihren Erfahrungen und Beobachtungen dazu beitragen.
»The trick is to keep breathing«, singt Shirley Manson, Frontfrau der Band Garbage. Aber wie? In der Schule lernen wir, uns auf eine Sache zu konzentrieren und neue Inhalte zu verinnerlichen. Im Job, wie wir mit anderen zusammenarbeiten und kreative Lösungen finden. Was uns niemand beibringt: dafür unseren Atem zu nutzen. So wie der Künstler Marcel Duchamp, der sich auf die Frage nach seinem Beruf gerne als »Atmer« bezeichnete: »Jede gelebte Sekunde, jeder Atemzug ist ein Kunstwerk«, sagte Duchamp. Sich das bewusst zu machen, ist der erste Schritt.
TEIL I: ALLES IST ATEM
2. DIE SCHNAUFENDE MASCHINE: SO ATMET DER MENSCH
Die Frauenklinik Taxisstraße liegt gerahmt von Bäumen in einer ruhigen Seitenstraße im Münchner Stadtteil Gern. Vor über hundert Jahren als Mütterheim gegründet, hat sie sich zu einer Spezialklinik für Gynäkologie und Geburtshilfe entwickelt, in der jährlich mehr als 3700 Kinder geboren werden. Dr. Nikolaus von Obernitz, Chefarzt der Abteilung für Geburtshilfe, empfängt mich in seinem Büro. Die Geburt, obwohl ein schönes Ereignis, ist für viele Frauen ein körperlicher, oft auch seelischer Kraftakt. Ich denke: Wenn einem jemand dieses Erlebnis leichter machen kann, dann von Obernitz. Mit seinem geduldigen Lächeln und den wie aus Marmor gemeißelten Locken ist er das Idealbild eines Geburtshelfers. Die Fotos seiner Kinder an der Wand wirken auf werdende Mütter sicher ebenfalls beruhigend.
Als ich von Obernitz zum Gespräch treffe, habe ich bereits drei Kaiserschnitte hinter mir – als Zuschauerin. Wir atmen unser ganzes Leben lang, aber kein Atemzug ist so entscheidend wie der erste. Wo, wenn nicht im Kreißsaal, kann ich etwas darüber lernen, wie die Atmung funktioniert? Und dabei geht es nicht nur um die Atmung der Neugeborenen. In den letzten Wochen der Schwangerschaft drückt die Gebärmutter zunehmend auf die untere Hohlvene, die dahinter verläuft. Es fließt weniger Blut zurück zum Herzen, was zu Sauerstoffmangel und Herzrasen führen kann. Für die Mutter fühlt sich das an wie eine Panikattacke. Dazu kommt der Stress, falls ein Kaiserschnitt nötig wird. Geburt ist immer eine Grenzerfahrung, sagt Nikolaus von Obernitz: »Während der Schwangerschaft verbindet Mutter und Kind eine symbiotische Beziehung. Sie atmen miteinander, sind eins. Durch die Geburt werden sie getrennt. Das ist in jeder Hinsicht schmerzhaft.« Während einer Spontangeburt – die auch mal vierzehn Stunden dauern kann – helfen Hormone und Wehen dabei, die Lunge auf den ersten Atemzug vorzubereiten. Ein Kaiserschnitt dauert nicht mal fünf Minuten. »Die Quote an Kindern, die nach der Geburt Atemunterstützung brauchen, ist dadurch etwas höher als bei denen, die durch Spontangeburt auf die Welt kommen«, sagt von Obernitz. Manche haben eine wet lung – ihre Lunge ist noch mit Resten des Fruchtwassers gefüllt. Das beeinträchtigt den Gasaustausch. Ihr Leben an der Luft beginnt mit Atemnot.
RAUS ZUM LUFTSCHNAPPEN
Spontangeburt – ein absurder Name für einen Vorgang, der auch mal vierzehn Stunden dauern kann. Ayas Mutter kämpft sich seit Stunden durch die Wehen. Das Entbindungszimmer, in dem sie liegt, ist ein heller, freundlicher Raum. Hinge nicht die große OP-Lampe über der Liege, könnte man ihn für ein geräumiges Krankenzimmer halten. Draußen scheint die Sonne, aber die Heizung bullert. Neugeborene sind nicht gut darin, ihre Körpertemperatur zu halten. Deshalb ist es in vielen Räumen der Klinik so warm wie im Ruhebereich einer Sauna. Die werdende Mutter liegt auf dem Rücken, hat die Füße aufgestellt, die Hände in die Kniekehlen geklemmt. So kann sie sich hochziehen, wenn die nächste Kontraktion kommt. Diese lassen ihr gerade nicht viel Zeit zum Durchatmen. Ihre Lippen sind blass vor Anstrengung, die Wangen rot, ihre Stirn feucht. Sie seufzt gequält. Kristina Langer, die Hebamme, legt ihr beruhigend die Hand auf den Oberschenkel: »Pressen, pressen« ermutigt sie. »Sehr gut. Jetzt atmen.« Ayas Mutter sinkt zurück auf die Liege, öffnet die Augen. Versucht, tief ein- und auszuatmen. Doch der Schmerz hält dagegen. Sie kann nur nach Luft schnappen. Ihr Mann atmet besorgt mit ihr. Seine Hand ruht auf ihrer Schulter, die Lippen dicht an ihrem Ohr. »Noch nicht«, bremst die Hebamme den nächsten Schub. »Atmen Sie in den Schmerz hinein.« In nordafrikanischen Ländern heißt es, die Gebärende stehe mit einem Fuß im Leben und mit dem anderen im Jenseits. Ayas Mutter sieht aus, als würde sie jetzt lieber sterben, als sich durch noch eine Wehe zu atmen. Aber sie holt gehorsam Luft. »Der Atem hilft der Mutter, nicht nur sich zu entspannen«, hat mir die Hebamme vor Betreten des Entbindungszimmers erklärt. »Wenn sie gleichmäßig und tief atmet, versorgt sie ihr Kind auch besser mit Sauerstoff.«
Die Schmerzen während der Geburt sind extrem. In einer schwedischen Studie gaben über vierzig Prozent der Frauen an, die Geburt sei das schlimmste Erlebnis gewesen, das sie je hatten. Kein Wunder, wenn einem dabei der Atem stockt. Oder man Angst oder sogar Panik bekommt. Der Körper befindet sich schließlich im Ausnahmezustand. Zu flach darf die Atmung der Mutter jedoch nicht werden. Beim Kind kommt sonst nicht mehr genug an. Im Geburtsvorbereitungskurs – oft als »Hechelkurs« verspottet – üben werdende Mütter deshalb Atemtechniken. Diese sollen ihnen helfen, sich trotz der heftigen Kontraktionen zu entspannen. »Schmerz lässt sich durch bewusste Atmung lindern«, ist die Hebamme überzeugt.
Im Entbindungszimmer ist es jetzt so weit: Die kleine Aya ist kurz davor, auf die Welt zu kommen. Eine Fachärztin für Geburtshilfe betritt den Raum. Sie befühlt den Bauch, streicht sacht darüber. »Sie können Ihre Tochter schon berühren«, sagt die Hebamme. Ayas Mutter beugt sich vor, tastet verzückt über den Scheitel in ihrem Schoß. Dann zwingt die nächste Wehe sie wieder zurück auf die Liege. Für ihre Tochter ist Atmung etwas völlig Neues. Vierzig Wochen lang wuchs sie im Bauch ihrer Mutter heran. Schon in der dritten – sie sah da eigentlich noch aus wie ein Zellball – stülpte sich aus ihrem Vorderdarm das heraus, was sie heute zum ersten Mal benutzen wird: ihre Lunge. Noch ist diese mit Flüssigkeit gefüllt. Eine Schutzvorrichtung, damit das fein verästelte Organ nicht kollabiert. Aya hat trotzdem schon das Atmen geübt. Ihre Trainingsmethode: Schluckauf. Dabei zieht sich das Zwerchfell zusammen, Fruchtwasser flutet die Lunge, diese vergrößert sich. Ihre Mutter konnte das als Minibeben spüren. In ihrem Bauch bekommt das Ungeborene Sauerstoff durch die Nabelschnur. In der Plazenta befindet sich eine Membran, die Gase und Nährstoffe durchlässt, ohne dass sich das Blut von Mutter und Kind vermischt. Mit den Wehen wird nun aber zunehmend Flüssigkeit aus der Lunge gepresst. Aya muss sich von ihrer feuchten, warmen Umgebung verabschieden.
Dass sie nun raus soll, kommt für sie sicher überraschend. Wahrscheinlich ist der Vorgang auch schmerzhaft. Das weiß niemand so genau. Wir waren zwar alle schon mal an diesem Punkt, aber keiner erinnert sich daran. »Jetzt. Pressen Sie! Pressen!« Ayas Mutter zittert vor Anstrengung. Von ihrer Tochter sind erst Stirn, dann die geschlossenen Augen, die Nase zu sehen. Noch ein Schub und sie dreht sich. Die Hebamme befreit, begleitet von einem Schwall Wasser und Blut, ihre Schultern aus dem Körper, der neun Monate lang ihr Zuhause war. Langer greift ihr unter die Achseln, hebt sie hoch. Das Mädchen liegt bäuchlings auf ihrem Unterarm. Es hat die Augen fest geschlossen. Seine Haare kleben nass und schwarz am Kopf, seine Hautfarbe ist von einem wächsernen Blau. Den Po bedeckt eine Schicht gelblicher Käseschmiere. Von seinem Bauch hängt die Nabelschnur, ein dickes, in sich gedrehtes blauweißes Kabel. »Sie haben es geschafft!«, verkündet Langer. Die Kleine noch nicht ganz. Innerhalb von sechzig Sekunden soll sie ihren ersten Atemzug tun. Nur der erste von mehreren hundert Millionen. Aber so lange dieser auf sich warten lässt, halten alle anderen im Raum ebenfalls den Atem an.
DER ERSTE ATEMZUG
Ayas neue Umgebung ist kalt und fremd. Sie liegt auf dem Unterarm der Ärztin. Ihre Mutter schluchzt vor Freude – oder Erleichterung. Die Kleine hat die Augen zugekniffen. Beim Durchtritt durch den engen Geburtskanal fährt durch den Körper des Babys ein Hormonstoß, der stärker ist als bei einem Herzinfarkt. Dieser sorgt dafür, dass die Lunge das restliche Fruchtwasser abbaut. Aya knautscht ihr Gesicht zusammen. Keucht. Ihr erster Atemzug. Dann krächzt sie wie eine schlecht gelaunte Katze.
Von nun an rauscht mit jedem Heben des Brustkorbs Luft in die Luftröhre. Folgt man diesem Luftstrom für etwa zwölf Zentimeter nach unten, gelangt man an die erste Verzweigung des Bronchialsystems, die Hauptbronchien. Diese teilen sich in immer kleinere Äste, insgesamt über zwanzig Mal. In Kunststoff gegossen würde dieser untere Bereich von Ayas Atemtrakt aussehen wie ein Baum ohne Blätter. Daher auch die Bezeichnung Bronchialbaum. Seine Äste enden in mikroskopisch feinen Kanälen: den Bronchioli respiratorii – ein Name wie eine italienische Nudelsorte. An diesen respiratorischen Bronchiolen bündeln sich winzige Lungenbläschen, die Alveolen.
Die Lungenbläschen sind das eigentliche »atmende Gewebe« in der Lunge. Ohne sie ist kein Gasaustausch möglich. Weil sie sich erst ab der 20. Schwangerschaftswoche entwickeln, könnte einem Kind, das vorher auf die Welt kommt, auch keine Beatmungsmaschine helfen. Damit sie beweglich bleiben, sind ihre Wände mit einem Film namens Surfactant ausgekleidet. Dieser macht es einfacher, die Lunge zu dehnen und verhindert, dass die kleinen Knubbel mit der Ausatmung in sich zusammenfallen. »Der Film entwickelt sich erst um die 24. Woche«, hat mir Nikolaus von Obernitz erklärt. Droht eine Frühgeburt, spritzen die Ärzte der Mutter deshalb oft Kortison, um die Reifung der Lungen des Kindes voranzutreiben.
Noch ist Ayas Lunge im Wachstum, zählt geschätzt erst zwischen 50 bis 100 Millionen Lungenbläschen. Wenn das Organ um das fünfzehnte Lebensjahr herum voll ausgebildet ist, werden es etwa 300 bis 400 Millionen sein. Bei Erwachsenen haben diese – abhängig von Geschlecht, Alter, Körpergröße und Trainingszustand – ausgebreitet ungefähr die Fläche einer großen Wohnung: 70 bis 140 Quadratmeter. Diesen Platz brauchen sie, um ausreichend Sauerstoff aus der Atemluft ins Blut abzugeben – und das Kohlendioxid daraus aufzunehmen. Jedes einzelne Bläschen ist von haarfeinen Blutgefäßen überzogen. Etwa 2400 Kilometer dieser Kapillaren verzweigen sich hier, so engmaschig wie nirgendwo sonst im Körper. Durch dieses fragile Röhrensystem rauschen täglich etwa 7000 Liter Blut. Das klingt nach einer ganzen Menge. Effektiv ist aber immer nur ein Rotweinglas davon am Gasaustausch beteiligt.
Der findet an der Blut-Luft-Schranke statt. Diese Membran, ein Achtzigstel so breit wie ein Blatt Papier, trennt die Lungenbläschen von den blutgefüllten Gefäßen. Sie muss so fein sein, damit Gase frei passieren können – ein Prozess, den man Diffusion nennt. Den Anstoß dazu liefert der Partialdruck der ein- und ausgeatmeten Gase. Luft ist ein Gasgemisch. Der Partial- oder auch Teildruck seiner Gase entspricht deren Anteil am Gesamtdruck. Entdeckt hat dies der englische Naturforscher John Dalton gegen Anfang des 19. Jahrhunderts. Dalton, ein Sohn armer Weber, verließ mit elf Jahren die Schule und begann mit zwölf selbst zu unterrichten. Sein bevorzugtes Forschungsobjekt war das Wetter, dem er mit selbst gebautem Barometer und Thermometer auf der Spur war. Aufgrund seiner Beobachtungen formulierte er das Daltonsche Gesetz, das er 1805 veröffentlichte. Weil Sauerstoff einen anderen Partialdruck hat als zum Beispiel Stickstoff oder Kohlendioxid, kann er sich unabhängig von diesen bewegen – nämlich durch die zarte Wand der Lungenbläschen hinüber ins Blut.
Diffusion ist die physikalische Grundlage der Atmung: Die Evolution hat sie vor etwa zwei Milliarden Jahren entwickelt und seitdem nicht wesentlich verändert. Warum auch? Sie ermöglicht die Energiegewinnung, ohne selbst welche zu verbrauchen. Diffusion ist ein passiver Prozess, läuft in den Körpern aller hochentwickelten Lebewesen ähnlich ab – bei Ameise und Rotkehlchen genau wie bei Forelle oder Frosch. Man kann sich das Verhalten der Sauerstoff- und Kohlendioxid-Teilchen dabei vorstellen wie das von Touristen an einem Hotelpool: Nach dem Frühstück sucht sich jeder eine Liege, die so weit wie möglich von jeder anderen entfernt ist. Im Lauf des Vormittags werden die Liegen so lange hin- und hergerückt, bis alle das Gefühl haben, genügend Abstand zu den Nachbarn zu haben. Auch Gasteilchen folgen dem Drang, sich optimal zu verteilen – weg vom Ort höherer Konzentration hin zu einem mit möglichst wenig Gedränge. Für den Sauerstoff aus der eingeatmeten Luft bedeutet das den Übertritt ins vorbeirauschende Blut, denn das ist sauerstoffarm. Dort keschert ihn der in den roten Blutkörperchen enthaltene Blutfarbstoff Hämoglobin, schleppt ihn erst zur linken Herzkammer und danach über die Arterien zu den Zellen. Das Kohlendioxid will dagegen raus aus dem Blut, wo alle anderen Kohlendioxid-Teilchen gerade Pool-Gymnastik machen. Es hievt sich rüber in die Lungenbläschen. So ist jeder zufrieden – auch, wenn die angestrebte gleichmäßige Sättigung nie perfekt erreicht wird.
Organismen können verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen. Am Prinzip der Diffusion ändert sich dadurch nichts. So atmen Lurche als Larven noch durch Kiemen, später dann mit ihrer Lunge und durch die Haut. Auch Ayas Atmung war vor der Geburt eine andere. Sie wurde von ihrer Mutter »beatmet«. Durch die Nabelschnur kam bei ihr jedoch sehr viel weniger Sauerstoff an, als ihre Mutter im Blut hatte. Ausgeglichen hat sie das mit fast doppelt so viel Hämoglobin, also extra Transportmöglichkeiten für das lebenswichtige Gas. So niedrig ist dessen Partialdruck im Körper von Ungeborenen, dass Experten die Lebensbedingungen in der Gebärmutter gern mit denen auf dem Gipfel des Mount Everest vergleichen. Der erste Atemzug des Neugeborenen – er ist auch der letzte des sterbenden Fötus, heißt es.
Ayas bisherige Sauerstoffversorgung liegt nun zwischen den Schenkeln ihrer Mutter: die Plazenta. Es ist ein rundes Stück Gewebe, schwarzrot und fleischig wie ein Stück Leber. Vorsichtig dreht die Hebamme es um. Die Rückseite, die im Mutterleib dem Baby zugewandt war, sieht aus wie graviert: Eine baumartige Struktur ist zu sehen, mit einem Stamm und weitverzweigten Ästen. »Wir nennen das den Lebensbaum«, sagt die Hebamme. Die Plazenta, die Bronchien, eine Birke: Auf ihre besten Blaupausen greift die Natur immer wieder zurück und skaliert sie nach Belieben. Die Form ist dieselbe, der Atem die Verbindung.
Manchmal will sich der erste Atemzug nicht einstellen. Das ist die Hölle für die Eltern. Hebammen haben für diesen Fall etliche Tricks auf Lager: Trockenreiben, Popo rubbeln, aufwärmen, Füße kneten. Früher schwangen Ärzte das Neugeborene über ihren Kopf und wieder zurück, in der Hoffnung, dass sich die Lungen füllen wie eine in den Wind gehaltene Plastiktüte. Eine ziemlich rabiate Begrüßung. Die Hebamme zeigt der Mutter die sauber geriebene Aya. »Wollen Sie die Nabelschnur durchschneiden?«, fragt sie den Vater. Sie dirigiert seine Hand mit der Schere an die richtige Stelle. »Fest zudrücken!« Er knipst die Verbindung durch, die Aya in den vergangenen Monaten versorgt hat. Aus einem atmenden Wesen sind zwei geworden. Doch so richtig klappt es mit Ayas Atmung noch nicht. Die Hebamme hat bereits über Funk einen Kinderarzt hinzugerufen. »Es ist alles okay. Ich muss ihre Tochter nur kurz untersuchen«, entschuldigt der sich. Er trägt das Mädchen in seinem weißen Tuchumschlag zum Tisch. Sie schnurchelt. Mit einem streichholzdünnen Schlauch, den er dem leise quengelnden Kind in den Rachen schiebt, saugt der Kinderarzt den dort sitzenden Schleim ab. »Alles in Ordnung«, versichert er der Mutter, als er ihr das nun freier atmende Kind zurückreicht. »Sie ist nur recht klein.«
Seit acht Monaten schlägt Ayas walnussgroßes Herz schon selbstständig. Noch hat es jedoch ein Loch, ein Überbleibsel des mütterlichen Versorgungssystems, an das Aya bis eben noch angeschlossen war. »Solange die Lunge nicht in Betrieb ist, darf sie nicht zu stark durchblutet werden«, hat Nikolaus von Obernitz gesagt. Durch die Öffnung namens Foramen ovale konnte das Blut direkt vom rechten Vorhof des Herzens in den linken fließen – der Lungenkreislauf wurde überbrückt. Nun hat die Atmung des Babys aber den Druck dort verändert. Die Öffnung schließt sich. Nutzlos geworden, wächst sie in drei von vier Fällen zu. Das dauert nur einige Tage. Bliebe Ayas Foramen ovale offen, wäre das auch kein Problem – immerhin lebt ein Viertel der Bevölkerung damit. Jüngeren Studien zufolge ist diese Gruppe jedoch häufiger von Migräne betroffen. Ob ein Zusammenhang besteht, ist unklar. Auch eine Verbindung zu Dekompressionsunfällen bei Gerätetauchern wird vermutet. Nachgewiesen ist sie nicht. Ein weiteres der vielen Rätsel, die unsere Atmung trotz jahrzehntelanger Forschung umgeben.
BIS IN DIE ZELLEN
Die Atmung kommt uns vor wie die einfachste Sache der Welt. Jeder weiß, wie sie funktioniert. Sie einem Außerirdischen zu erklären wäre kein Problem, zumindest nicht in der Kurzfassung: Sauerstoff wird in den Körper hineingesaugt. Kohlendioxid strömt heraus. Dazu braucht es kein Vorwissen. Neben der Ventilation, der Belüftung der Lunge, laufen im Gewebe jedoch komplizierte Stoffwechselvorgänge ab: die innere Atmung. Unser Körper ist ein System, das am besten funktioniert, wenn alles im Gleichgewicht ist. Der Prozess, der diesen Zustand aufrechterhält, heißt Homöostase. Und für den ist Energie nötig. Sie entsteht, wenn in den Zellen Nährstoffe oxidieren. Das Gewebe kann den dafür notwendigen Sauerstoff nicht speichern und verlangt deshalb kontinuierlich danach. Wie effektiv dieser verarbeitet wird, bestimmt unsere Leistungsfähigkeit. Die äußere Atmung trägt unsere Stimme und kann unsere Gefühle regulieren. Es schadet also nicht, Aufbau und Funktion des Atemapparats zu verstehen.
Aya atmet schnell und unregelmäßig. Ihr Brustkorb pumpt, sie grunzt, stoppt kurz, setzt dann wieder an. So wie alle Neugeborenen muss sie ihren Rhythmus erst noch finden. Eltern kann dieses Atemholterdipolter der ersten Tage nervös machen, wenn sie nicht darauf vorbereitet sind. Vor allem, wenn das Baby so zart ist wie Aya. Ihre Nase ist gerade mal so breit wie mein kleiner Finger. Kommt sie nach ihrer Mutter, werden ihre Nasenflügel mit der Zeit weiter werden, der Nasenrücken aber eher flach bleiben. Niemand weiß, warum sich im Lauf der Evolution ein derart auffälliges knorpelig-knöchernes Gerüst in der Gesichtsmitte entwickelt hat. Es ist zwar nicht ganz so überflüssig wie ein Fuchsschwanz am Rückspiegel. Aber doch ziemlich extravagant. Immerhin hält es die Brille am Platz und ist dabei beweglich genug, um zu schnüffeln.
Für die Atmung entscheidend ist die Passage, die von den Nasenlöchern bis fast in die Mitte des Schädels reicht. Die Nasenscheidewand trennt diese in eine rechte und linke Hälfte. Besonders die Nasenklappe – hier endet der Bereich, in den man noch mit dem Finger kommt – ist eng und gekrümmt und macht das Luftholen schwerer. Im Vergleich zur Atmung durch den Mund ist der Widerstand bei der Nasenatmung doppelt so groß. Jeweils drei knöcherne Nasenmuscheln hängen in eine Nasenhöhle, teilen den Hohlraum in drei Gänge. Eingeatmete Luft strömt überwiegend durch den mittleren, die Ausatmungsluft nimmt dagegen den unteren Nasengang. In den engen und gekrümmten Passagen entstehen dabei Wirbel. Die sind durchaus erwünscht: Wie ein Fliegenfänger erhascht die Nasenschleimhaut alles, was ihr zu nahekommt. Ihre 45000 Drüsen produzieren am Tag mehr als einen halben Liter Sekret (in den ersten Jahren wird Ayas Mutter mit dem Abwischen und Putzen der Nase ihrer Tochter deshalb kaum hinterherkommen). Die Zilien, feine, bewegliche Zellfortsätze, transportieren die in Schleim eingepackten Schadstoffe dann ab. Große Staubpartikel und Pollen erwischen sie direkt im Eingangsbereich. Kleinere passen sie in den Nasenhöhlen ab. So filtert die Nase bis zu fünfzig Prozent der Bakterien und Partikel aus der Luft. Nur Feinstaub schafft es unbemerkt in die unteren Atemwege.
Die Nase schützt unsere sensible Innenwelt vor der unkontrollierbaren äußeren. Nicht nur als Filter, sondern auch als Klimaanlage und Luftbefeuchter. Die atmosphärischen Bedingungen in der Umgebung ändern sich kontinuierlich: Die Sonne treibt die Temperaturen hoch oder es beginnt zu schneien. Jetzt schnell in die Sauna! Im Schlafzimmer hängt feuchte Kleidung auf dem Wäscheständer, im Wohnzimmer ist die Heizungsluft trocken. Das alles kümmert unsere Atemwege nicht, denn diese sind durch Schleusen geschützt: Auf einer Strecke von etwa sieben Zentimetern durch unsere Nase erwärmt sich die Luft dank eines dichten Netzes feinster Blutgefäße auf über dreißig Grad – selbst wenn draußen minus acht herrschen –, und die Luftfeuchtigkeit steigt auf über neunzig Prozent. In nicht mal einer Zehntelsekunde. Wie jede Klimaanlage verbraucht auch die in unserem Atemtrakt massig Energie. Etwas davon holt sich der Körper aber beim Ausatmen zurück: Die Luft aus der Lunge erwärmt und befeuchtet die Schleimhaut – und die steifen Hände, wenn man im Winter hineinhaucht. Der Tropfen an der Nase? Oft nur Kondenswasser. Bis zu vierzig Prozent der Energie kann dieser Austausch einsparen. Tiere, die in der Wüste leben, so wie Kamele oder Rennmäuse, sind darin noch viel besser als der Mensch. Ihre Nasen lassen so gut wie kein Wasser verloren gehen. Hunde dagegen kühlen sich in der Sommerhitze ab, indem sie schnell und flach atmen und dabei die Zunge zum Verdunsten heraushängen.
Obwohl ein echtes Hochleistungssystem ist die Nase störanfällig. Scharfes Essen oder ein hoher Östrogenspiegel? Die Schleimhaut schlägt Alarm – und lässt die Nase zuschwellen. Wie dicht diese macht, messen Rezeptoren, die auf Luftströmung und Temperaturwechsel reagieren. Doch dabei liegen sie nicht immer richtig. Menthol zum Beispiel kann die Nase bei Schnupfen »befreien«, ohne wirklich abschwellend zu wirken. Die Rezeptoren registrieren zwar einen »frischen Wind« – ein Gefühl, das jeder kennt. Objektiv kommt aber gar nicht mehr Luft durch. Gerade im Winter macht die Nase oft zu, weil sich die kalte Außenluft auf kleinem Raum besser aufheizen lässt. Manchmal bewirkt dies aber das genaue Gegenteil: Weil nicht mehr genug Luft durch die Nase kommt, ist dann nur noch Mundatmung möglich.
Mundatmung ist Aushilfsatmung. Das wussten schon die Verfasser der Bibel: »Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase.« (1. Mose 2, 7). In die Nase, nicht in den Mund. Denn die eine gehört zum Atem-, der andere zum Verdauungstrakt. Der Mund wärmt die Luft zwar auch vor und befeuchtet sie. Aber er trocknet aus, wenn er ständig offen steht. Das verändert die Lebensbedingungen der Mikroorganismen, die in der Mundhöhle leben, und begünstigt Zahnkaries. Außerdem regt das Einatmen (aber nicht das Ausatmen) durch die Nase die Aktivität in den Hirnregionen Amygdala und Hippocampus an, wie Neurologen der Northwestern University im US-Bundesstaat Illinois nachweisen konnten. Während sie einatmeten, erkannten ihre Probanden Gesichter schneller und konnten sich Gegenstände besser merken. In einem anderen Versuch fiel es ihnen einatmend leichter, ängstliche und überraschte Gesichter auseinanderzuhalten. Die Forscher sehen darin einen möglichen biologischen Vorteil: Angst führt dazu, dass sich die Atmung beschleunigt, wir also häufiger einatmen und das Gehirn anregen. Das könnte unsere Reaktionszeit verbessern. Verblüffend: Atmen wir durch den Mund, tritt dieser Effekt nicht ein. Die meisten Menschen atmen automatisch durch die Nase, sofern sie nicht gerade dem Bus hinterherrennen oder mit dem Fahrrad einen Berg hochstrampeln. Ein Dauerschnupfen kann deshalb ähnlich quälend sein wie ein Leben mit Asthma.
Neugeborene sind überzeugte Nasenatmer und reagieren panisch, wenn diese verstopft ist. Für sie ist die Filterfunktion lebenswichtig. Anfangs haben Kinder noch Nestschutz. Sie tragen Antikörper ihrer Mutter in sich. Ihr eigenes Immunsystem entwickelt sich erst nach der Geburt vollständig. Das macht sie anfällig für Infekte. Was da gerade in Ayas Lunge rauscht, ist für das eben erst zum Dienst angetretene Organ eine ganz ordentliche Herausforderung: Vom keimfreien Fruchtwasser muss es sich auf Umgebungsluft umstellen, auf Mikroorganismen, Staub, und Chemikalien. Ihre Nase fängt so viele Allergene und Krankheitserreger wie möglich ab, um die Lunge zu entlasten.
Vielleicht ist bei Aya deshalb auch das Phänomen noch nicht so stark ausgeprägt, das man Nasenzyklus nennt. Die Mehrheit der Erwachsenen atmet im Wechsel mal stärker durch das eine, dann durch das andere Nasenloch, weil diese nacheinander zuschwellen. Bekannt ist das schon lange – erstmals erwähnt ist der Nasenzyklus 1895 in Die exacte Messung der Luftdurchgängigkeit der Nase des Breslauer Arztes Dr. Richard Kayser – aber obwohl es viele Studien zum Thema gibt, ist nicht klar, warum die Nasengänge im Wechselbetrieb arbeiten. Oder wie lange die Phasen genau dauern. Die Angaben variieren zwischen einer und sieben Stunden. Wenn die Zuständigkeit wechselt, lässt der Körper mehr Blut in das Gewebe des Kanals fließen, der Pause machen soll. Luft – und damit auch Schadstoffe und Erreger – strömt nun verstärkt durch den freien Kanal. Vielleicht ruhen sich die Nasengänge auf diese Weise abwechselnd von ihrer Arbeit aus. In der Nase sitzt auch das Riechorgan. Mit diesem kann ein gesunder Mensch mehr als 10000 verschiedene Duftnoten unterscheiden – und damit wichtige Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, ob die Person, die sich im Zug gerade neben einen gesetzt hat, jemand ist, neben dem man gerne morgens aufwachen möchte. Oder ob die Milch aus dem Kühlschrank in den Kaffee oder in den Mülleimer gehört. Der Wechsel der Nasengänge könnte helfen, die Aufmerksamkeit für solche olfaktorischen Informationen aufrecht zu erhalten. Einige Studien ziehen auch eine Verbindung zu den zwei Gegenspielern unseres Nervensystems: dem Sympathikus, der die Aktionsbereitschaft steigert, und dem »Ruhenerv« Parasympathikus. Demnach hätte, so lange das rechte Nasenloch dominiert, die linke Hirnhälfte und damit der Sympathikus die Oberhand – Herzfrequenz und Blutdruck steigen. Dominiert das linke Nasenloch, wäre die rechte Hirnhälfte und der Parasympathikus am Zug, was beruhigend wirkt.
Die Studienergebnisse dazu sind aber sehr widersprüchlich. Wer trotzdem ausprobieren will, welche Nasenseite bei ihm gerade aktiver ist, hält sich einen Spiegel unter die Nasenlöcher und schaut, wo dieser stärker beschlägt.
In ihrem Buch What happened, das sie nach der Wahlniederlage gegen Donald Trump veröffentlichte, beschreibt Hillary Clinton, wie Wechselatmung ihr half, im Wahlkampf die Nerven zu behalten. Bei dieser Übung aus dem Yoga übernimmt man quasi die Kontrolle über den Nasenzyklus: Atmet, das sagt schon der Name, rechts ein und links aus, dann links ein und rechts aus, indem man sich abwechselnd die Nasenlöcher zuhält. Periodische Vorgänge im Gehirn lassen sich so wohl nicht steuern. Aber ruhiges, kontrolliertes Atmen kann, unabhängig von der Übung, gelassener machen, wie etliche Studien zeigen.
»Sie können sie nun an ihre Brust legen«, sagt die Hebamme zu Ayas Mutter. Diese birgt das Baby in ihrem Arm. Ayas Augen sind zugeknittert. Sie schnüffelt. Trinken will sie noch nicht. Dabei bin ich so neugierig, wie sie sich dabei anstellt. Neugeborene haben eine Fähigkeit, um die sie mancher Oktoberfestbesucher beneiden mag: Sie müssen beim Trinken nie absetzen, weil sie gleichzeitig schlucken und durch die Nase atmen können. Beim Erwachsenen funktioniert das nicht. Der Mund-und-Rachen-Raum endet in zwei Röhren: Die Speiseröhre liegt hinten im Hals, vor der Wirbelsäule. Die Luftröhre vorne, unter dem Kehlkopf. Sie müssen sich einen Zugang teilen, was zu Komplikationen führen kann. Wenn der Wiesn-Besucher aus seiner Maß trinkt, läuft das Bier dirigiert von der Zunge Richtung Speiseröhre. Unterwegs trifft es auf das Gaumensegel, das nun nach oben gedrängt den Eingang zur Nase verschließt. So rinnt das Getränk nicht unbeabsichtigt aus den Nasenlöchern. Gleichzeit heben starke Muskeln den Kehlkopf an, wodurch der Kehldeckel, der beim Atmen nach oben zeigt, herunterklappt und den Eingang zur Luftröhre verschließt. Schützend liegt er nun über dem Kehlkopf, während das Bier um ihn herum schäumt. Zur Sicherheit machen die darunter liegenden Stimmlippen, auch als Stimmbänder bekannt, ebenfalls dicht. Ein beachtlicher Mechanismus, der nur selten versagt. Wenn doch, dann aktivieren Nerven in der Luftröhre einen sehr starken Hustenreflex: Flüssigkeit in der Lunge kann tödlich sein. Also, öff-öff: raus damit! Bei Neugeborenen liegt der Kehlkopf jedoch so weit oben, dass die Milch in die Speiseröhre laufen kann, ohne dass etwas davon in der Luftröhre landet. Nach einigen Monaten senkt sich der Kehlkopf ab, was das Sprechen erleichtert, beim Essen aber Atempausen erzwingt. Ist für alle anderen am Tisch sicher angenehmer.
Während die Flüssigkeitskanäle des menschlichen Körpers Einbahnstraßen sind – Anfälle von Übelkeit ausgenommen –, transportiert der Körper Gase im Wechselverkehr. »Frische« und »verbrauchte« Luft begegnen und vermischen sich. Das ist nicht sonderlich effizient: Etwa ein Viertel der eingeatmeten Luft erreicht die Lungen gar nicht erst. Dafür erlaubt das Röhrensystem einen kontrollierten Ablauf: Schadstoffe lassen sich besser abfangen und die Luft bleibt feucht. Zusammengeknautscht im Brustkorb verpackt ist die Lunge in vieler Hinsicht ein Kompromiss der Natur. Wie viel mehr Luft bekämen wir, wenn wir ohne Umwege in ihre komplette Fläche hineinatmen könnten? Die Lungenbläschen auszubreiten und nach außen zu verlagern würde jedoch bedeuten, einen Fleischlappen in der Größe einer Wohnung hinter uns herzuziehen. Unpraktisch. Stattdessen hat die Natur die Lungenbläschen nahezu ideal in dem zur Verfügung stehenden Raum verteilt. Und der Körper arbeitet hart, um genügend Sauerstoff in die Tiefen zu ziehen, in denen diese residieren. Wie der Wind bei sich ändernden Wetterlagen bewegt die Atmungsmuskulatur die Atemgase hin- und her, erzeugt abwechselnd höheren und niedrigeren Luftdruck. Die Lunge ist dabei durch und durch passiv. Ihre wenigen Muskeln ziehen nur die Bronchien zusammen, wenn etwas hineingeraten ist oder diese gereizt reagieren.
Die Lunge selbst tendiert dazu, sich zusammenzuziehen. Wenn sie es sich aussuchen könnte, wäre sie immer nur so klein wie sie ist, wenn man bis zum Gehtnichtmehr ausgeatmet hat. In ihren Fasern steckt Elastin, ein Eiweiß, das – der Name verrät es – sie dehnbar macht. Nicht die Haut, die Lunge hat das elastischste Gewebe aller Organe. Deshalb leiert sie trotz der ungefähr 20000 Atemzüge pro Tag nicht aus. Anders als die Lunge neigt der Brustkorb hingegen dazu, sich ein bisschen breiter zu machen: Vor allem im Sommer im Freibad, aber auch sonst zieht er beständig ein wenig nach außen. In der Ruhe zwischen zwei Atemzügen sind ihre gegeneinander wirkenden Kräfte jedoch perfekt ausbalanciert.
Auch, wenn wir gemeinhin von der Lunge sprechen: Wir haben zwei, die – getrennt vom Mittelfellraum – jede in ihren eigenen Brustfellhöhlen untergebracht sind. Der Brustkorb, der sie umgibt, besteht aus zwölf Rippen, Brustwirbelsäule und Brustbein. Er lässt sich nur mit großer Kraft zusammendrücken: Bis zu 400 Kilogramm hält das statische Wunderwerk aus. Die beiden Lungen sind darin ziemlich gut geschützt. Genau wie das Herz, das sich unter sie schmiegt, und die Speiseröhre. Darüber spannt sich die Atemmuskulatur wie Fischgräten. Beim Einatmen heben die Zwischenrippenmuskeln die Rippen an, wodurch sich die Lunge ausdehnt: die Brustatmung. Bei der Ausatmung senken sich die Rippen. So tragen die Muskeln mit etwa zwanzig Prozent zur Atmung bei. Wer sie dafür belohnen will, massiert sie sacht der Länge nach, durch leichten Duck zwischen die Rippen. Unterstützt werden sie von den Hilfsatemmuskeln im Hals und Rücken. Diese zu trainieren bringt nicht nur Ausdauersportlern den entscheidenden Vorteil, wenn es um Medaillen geht, sagte Prof. Christina Spengler Walder, Sportphysiologin am Institut für Bewegungs- und Sportwissenschaften der ETH Zürich in einem Interview. »Es ist für jeden zu empfehlen, der das Gefühl hat, zu schnell außer Atem zu geraten.«
Die Bauchmuskeln arbeiten bei der Atmung erst mit, wenn es anstrengend wird. Oder um, wie beim Husten oder Erbrechen, Druck aufzubauen. Der größte Malocher ist jedoch das Zwerchfell. Dieser flache, kräftige Muskel trennt die Brust- von der Bauchhöhle. Wie eine Kuppel wölbt er sich den Lungen entgegen, mit einer kleinen Ausbuchtung für das Herz. Mit einer starken Kontraktion kann sich das Zwerchfell bis zu zehn Zentimeter nach unten ziehen – und die Lunge dabei mitnehmen. Das durchschnittliche Atemzugvolumen – etwa ein halber Liter Luft rein, ein halber Liter raus – vergrößert sich so auf bis zu drei Liter Einatmung. Über 10000 Liter bewegt das Zwerchfell täglich. Und ist dabei wirklich zäh! Von oben hält die Lunge dagegen, unten hängt der – oft genug volle – Magen dran. Leber, Milz und Nieren sind im Weg. Nicht mal im Liegen hat der wichtigste Atemmuskel seine Ruhe. Die Baucheingeweide schieben ihn nach oben. Große Anstrengung ist in dieser Position deshalb nicht möglich. In der Muskulatur kommt nicht genug Luft an.
Muckt das Zwerchfell doch mal, nervt das fürchterlich. Für fünfhundert Millisekunden kontrahieren Zwerchfell- und Zwischenrippenmuskulatur gleichzeitig, die Stimmlippen dichten die Luftröhre ab. Plötzlich: eine Einatmung. Hüpp! Singultus heißen diese Reizungen: Schluckauf. Zu viel Essen im Magen, Alkohol, Zigaretten oder Medikamente, aber auch Stress – viele Dinge können das Zwerchfell zucken lassen. Warum es den Schluckauf gibt, welche Funktion er bei Erwachsenen hat? Da ist sich die Wissenschaft nicht sicher. Immerhin geht er meist so plötzlich, wie er gekommen ist. Für Ärzte gilt er erst ab achtundvierzig Stunden als chronisch. In so epischer Länge tritt er zum Glück jedoch nur selten auf. Zwei Tage lang hicksen – was für eine Tortur. Zu den von Ärzten empfohlenen Hausmitteln zählen das Valsalva-Manöver – Nase zuhalten, Backen aufblasen –, benannt nach dem italienischen Anatom Antonio Valsalva, der es im Jahr 1704 erstmals beschrieb. Außerdem Hyperventilation, in eine Tüte rückatmen (nicht alleine zu Hause!), Akupressur der Nasenwurzel oder Oberlippe, Gurgeln, schnell Eiswasser trinken, Niesen, sanfter Druck durch geschlossene Lider auf den Augapfel, Massage des Oberbauches. Da ist für wirklich jeden etwas dabei – und bis man alle durchprobiert hat, ist im Zweifel auch der hartnäckigste Schluckauf von selbst wieder vergangen. Mir persönlich hilft das supra-supramaximale Einatmen: Alles, alles ausatmen, dann so viel es geht einatmen. Zehn Sekunden halten. Noch ein bisschen (supramaximal) einatmen. Weitere fünf Sekunden halten. Ein winziges bisschen (supra-supramaximal) obendrauf atmen. Jetzt noch fünf Sekunden durchhalten. Und – Pffffffff – endlich wieder ausatmen. Der Trick ist, einerseits durch das Luftanhalten den Kohlendioxidpartialdruck zu erhöhen und gleichzeitig das Zwerchfell still zu halten. Entweder ist der Schluckauf dann weg. Oder ich bin zu erschöpft, um mich über ihn aufzuregen. Auch wenn es manchmal nervt: Das Zwerchfell ist lebenswichtig. Neugeborene, die ohne diesen Muskel auf die Welt kommen, sterben meist gleich nach der Geburt. Mit ihren Atemübungen im Fruchtwasser signalisieren die ungeborenen Kinder also auch: alles okay. Zumal mit den von außen spürbaren kleinen Hicksern Serotonin ihre Körper flutet. Sie üben also nicht nur das Atmen, sondern auch das Glücklichsein.
Die Griechen nannten das Zwerchfell phrén, hielten es für den Sitz der Seele. »Was sinnst du in deinem zottigen Zwerchfell?«, will Achilleus von Odysseus wissen. So gelangte das phrén in die Schizophrenie, die Geistes- oder Seelenspaltung. Auch die Phrenologie, eine zu Beginn des 19. Jahrhunderts vom deutschen Arzt Franz Joseph Gall begründete Pseudowissenschaft, die versuchte, jeder geistigen Verfassung ein eigenes Hirnareal zuzuordnen, hat ihren Namen daher.
Die Zwerchfell- oder Bauchatmung hat den Ruf der »guten« oder »richtigen« Atmung – im Gegensatz zur Brustatmung, bei der sich der Oberkörper verstärkt hebt und senkt. Aber Brust- und Bauchatmung sind keine Alternativen, sondern die gleiche Atmung mit unterschiedlichem Fokus. Im Liegen, wenn die Rippen sich nicht so leicht heben können, überwiegt automatisch die Zwerchfellatmung. Enge Jeans, die Rinderroulade aus der Kantine, eine Schwangerschaft oder der Weg vom Beckenrand zur Liegewiese animieren dagegen zur Brustatmung. Stress oder Asthma kann diese sogar noch eine Etage höher verschieben. Die sogenannte Klavikularatmung, auch Schulter- oder Schlüsselbeinatmung, ist nicht nur anstrengend, sie hört sich oft auch so an. Kinder dagegen atmen automatisch mit stolz geschwelltem Bauch. So lange die Atmung auch beim Tennis oder lauten Singen mitmacht, ist es nicht entscheidend, ob Brust oder Bauch mehr gefordert werden. Wer sich die Bauchatmung dauerhaft verkneift, riskiert jedoch, die Vollatmung zu verlernen – und damit das Gefühl, entspannt zu atmen. Außerdem wundern sich die Bauchorgane, wenn das Zwerchfell nur noch im Schlaf vorbeischaut. Bauchatmung ist für sie wie eine Massage.
Manchmal kapern auch die Gefühle unsere Atmung: Lachen ist ein Stakkato-Ausatmen, mit tiefem Luftholen dazwischen; der Seufzer ein dramatisches Ein-, gefolgt von einem resignierenden Ausatmen und einer bedeutungsschwangeren Pause am Ende. Großes Drama. Ein Hustender keucht ausatmend durch den Mund. Seine Stimmritze bleibt dabei geschlossen. Der breite Rückenmuskel presst den Brustkorb mehr und mehr zusammen, bis der Druck zu hoch wird und eine explosionsartige Ausatmung den ganzen Körper schüttelt. Alle Umstehenden gehen in Deckung. Welche Gewalten beim Husten wirken, zeigt sich, wenn Gewichtheber Pressatmung einsetzen. Diese basiert auf demselben Mechanismus und hilft den Top-Athleten, weit über vierhundert Kilogramm zu heben – so viel wie zwei ausgewachsene Löwen auf die Waage bringen. Das – oft ebenfalls gewaltige – Niesen kündigt sich höflich mit einer tiefen Einatmung an, entlädt sich als kurzer Stoß. Aya beherrscht das schon. Babys niesen sehr häufig, weil sie so ihre Nasenwege säubern.
Ohne Sauerstoff kein Leben. Erstaunlicherweise ist es für den Atemantrieb eines gesunden Menschen aber nicht so entscheidend, ob genug davon eingeatmet wird. Auf steigende Konzentrationen von Kohlendioxid im Blut (und die damit verbundene Veränderung des pH-Werts) reagiert das Atemzentrum dagegen hochgradig sensibel. Wenn wir beim Luftanhalten also den Drang verspüren, weiterzuatmen, dann nicht, weil es den Körper nach Sauerstoff hungert, sondern weil er das sich ansammelnde Kohlendioxid loswerden will. Ein Überschuss an Kohlendioxid lässt das Blut »sauer« werden. Sein pH-Wert, der normalerweise bei 7,4 liegt, sinkt. Solche Schwankungen bringen die Stoffwechselvorgänge aus dem Gleichgewicht. Die Chemorezeptoren im Körper registrieren es deshalb sofort, wenn die Konzentration von Kohlendioxid im Blut steigt. Das Atemzentrum, ein Verbund von Nervenzellen am untersten Ende des Gehirns, beschleunigt und vertieft dann die Atmung, um einer Übersäuerung vorzubeugen. Kommt zu wenig Sauerstoff im Gewebe an, reagieren die Rezeptoren dagegen gelassen.
Zu viel Kohlendioxid kurbelt die Atmung an. Umgekehrt kann eine übermäßige Atmung den Kohlendioxidgehalt beeinflussen. Stress oder Angst lassen manche Menschen hyperventilieren – einer der wenigen Fälle von »falscher« Atmung. Die Betroffenen atmen schneller als nötig und geben dadurch zu viel Kohlendioxid ab. Ihr Atemanreiz sinkt. Die Muskeln verkrampfen. Ihnen wird schwindelig, was die Angst noch verstärkt. Hyperventilation fühlt sich an, als bekäme man zu wenig Luft, obwohl mehr als genug Sauerstoff im Blut ist. Atemanhalten durchbricht den Kreislauf. Aber jemandem, der hyperventiliert, ist das schwer zu vermitteln. Deshalb der Trick mit der Tüte: Sie fängt das abgeatmete Kohlendioxid auf, welches dann wieder eingeatmet wird. So kann sich der Kohlendioxidspiegel im Blut stabilisieren – egal, wie hoch die Atemfrequenz ist.
Das Blut, das die Gase in Ayas Gewebe transportiert, kennt keine Endstation. Es zirkuliert ununterbrochen und bis zur entlegensten Zelle. Jedes Organ kann sich so jederzeit des Kohlendioxids entledigen und bekommt Sauerstoff zugeführt. Die Kraft hinter diesem Kreislauf ist das Herz. Es zieht sich rhythmisch zusammen, presst das Blut in die Gefäße. Die Herzklappen sorgen dafür, dass dieses in die gewünschte Richtung läuft. Der Weg des sauerstoffarmen Bluts von der rechten Herzhälfte bis zur Lunge ist nur kurz, deswegen spricht man hier vom »kleinen Kreislauf«. Der »große Kreislauf« transportiert sauerstoffreiches Blut von der linken Hälfte durch die Arterien zu den Organen. Und das fix: Etwa eine Minute dauert die Rundfahrt eines roten Blutkörperchens durch den gesamten menschlichen Körper.
Die ersten Fassungen heutiger Medizinbücher wurden im alten Ägypten geschrieben. Schon der auf 1500 vor Christus datierte Papyrus Ebers, einer der ältesten erhaltenen Texte, beschreibt die Verbindung der Blutgefäße mit dem Herzen. Auch, dass die eingeatmete Luft die Lunge versorgt, hatte man dank Einbalsamierung wohl verstanden. Nur bedingt einzuordnen wussten die Ägypter aber die Beziehung von Ohren und Nasenrachenraum: »Der Hauch des Lebens dringt durch das rechte Ohr ein und der des Todes durch das linke« (vielleicht ist der Übersetzer aber auch in der Hieroglyphe verrutscht). Der Legende nach war es der chinesische Kaiser Hoamti, der um 2599 vor Christus mit seinen Büchern über den Puls die noch heute in der traditionellen chinesischen Medizin angewandte Pulsdiagnostik begründete. Deren frühe Erkenntnis: In Ruhe schlägt das Herz eines Erwachsenen während eines Atemzugs in der Regel viermal, das sind sechzig- bis achtzigmal pro Minute. Ayas Herzfrequenz ist mit hundertzwanzigmal noch deutlich höher.
In ihrem Brustkorb warten die Moleküle der Atemluft darauf, ins Blut überzutreten. Nicht allen gelingt das. Ungefähr ein Viertel des Volumens jedes ruhigen Atemzugs versickert im Atemtrakt: Es bleibt irgendwo zwischen Mund, Kehlkopf, Luftröhre und Bronchien »hängen«. Weil er nicht am Gasaustausch teilnimmt, haben Mediziner diesem Anteil der Atemluft den wenig netten Namen »Totraum« verpasst. Auch in den Lungenbläschen verbleibt ein Teil der Luft. Der Stickstoff zum Beispiel fungiert als Platzhalter: Er sorgt dafür, dass die Lungenbläschen nicht in sich zusammenfallen. So können Sauerstoff und Kohlendioxid jederzeit passieren. Einige Sauerstoffmoleküle in Ayas Lunge haben das gerade geschafft. Nun trägt das Blut sie dorthin, wo sie benötigt werden: ins Gewebe. Dieses kann nur bedingt Sauerstoff speichern. Irgendwo gibt es also immer Zellen, die danach hungern. Der Sauerstoff schlüpft durch ihre Membran wie zuvor durch die Blut-Luft-Schranke. Von ihrer Sauerstofflast befreit greifen die roten Blutkörperchen noch schnell das Kohlendioxid auf, welches die Zellen abgeben. Dann machen sie sich auf die Rückreise. Was die Sauerstoffmoleküle nicht wissen: Mit dem Eintritt in die Zelle gehen sie ihrem Ende entgegen.
Ich lasse Aya mit ihren Eltern allein, damit ihre Mutter sie in Ruhe stillen kann. In den ersten Wochen benötigt ein Baby im Durchschnitt 650 Kilokalorien am Tag. Bereitgestellt wird diese Energie von der Sonne. Anders als Pflanzen können Menschen sie aber nicht direkt nutzen. Denn Pflanzen wandeln das Kohlendioxid aus der Luft und das Wasser aus dem Boden mit Hilfe des Sonnenlichts in Nährstoffe um: Kohlenhydrate, Fette oder Proteine. Aya ist darauf angewiesen, dass ihre Mutter diese Stoffe mit der Nahrung aufnimmt und mit der Muttermilch an sie weitergibt. Die Mitochondrien, die Kraftwerke in ihren Zellen, bilden daraus dann mit Hilfe des eingeatmeten Sauerstoffs die Phosphatbindung Adenosintriphosphat (ATP). Diesen Vorgang nennt man innere oder Gewebeatmung. ATP ist die Universalwährung des Körpers, liefert die Energie für alle lebensnotwendigen Prozesse, vom Schreiben einer Klausur bis zum Anruf beim Pizzaservice. Bei vollständiger Oxidation von Kohlenhydraten entsteht für jedes in den Zellen verbrauchte Sauerstoffmolekül ein Molekül Kohlendioxid, das Aya dann abatmen muss. Ein weiterer Stoff, der bei der ATP-Synthese abfällt, ist Wasser. In diesem körpereigenen Wasser werden die Atome aus den eingeatmeten Sauerstoffmolekülen wiedergeboren. Jede Träne, die Aya in Zukunft im Kino weinen wird, und jeder Schweißtropfen, den sie auf dem Fußballplatz verliert, wird deshalb Spuren ihrer Atemluft enthalten.