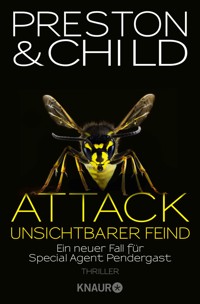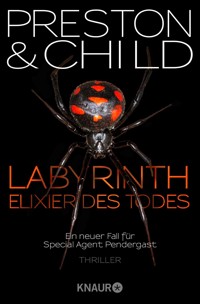9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Special Agent Pendergast
- Sprache: Deutsch
Brutale Morde an Obdachlosen und ein mörderisches Geheimnis in den U-Bahn-Tunneln von New York: Teil 2 der Thriller-Reihe um Special Agent Pendergast von Douglas Preston und Lincoln Child Aus dem stinkenden Schlamm des Hudson River in New York ziehen Polizei-Taucher zwei Skelette, denen der Kopf abgetrennt wurde. Weil eines davon grotesk deformiert ist, bitten Lieutenant Vincent D'Agosta und Special Agent Aloysius Pendergast Margo Green vom Labor des Naturhistorischen Museums um Unterstützung bei den Untersuchungen. Zur gleichen Zeit wird New York von einer Mord-Serie an Obdachlosen heimgesucht: Die Leichen der Opfer werden in den Tunneln tief unter den Straßen Manhattans abgelegt, meist wurde ihnen der Kopf abgetrennt. Special Agent Pendergast und Lieutenant D'Agosta vermuten einen Zusammenhang zwischen den enthaupteten Obdachlosen und den beiden kopflosen Skeletten. Kann es sein, dass die Mord-Serie viel weiter zurückreicht, als man bislang annahm? Die grauenvolle Wahrheit verbirgt sich unter den U-Bahn-Tunneln New Yorks, in einem finsteren, auf keiner Karte verzeichneten Tunnel-System namens »The Devilʼs Attic« – »Dachboden des Teufels« … Special Agent Aloysius Pendergast, der Kult-Ermittler der Bestseller-Autoren Preston & Child, löst seinen zweiten Fall: »Spannung und Horror pur bis zur letzten Seite!« Berliner Morgenpost Die Thriller-Reihe um Agent Pendergast umfasst 17 Bände, die in folgender Reihenfolge erschienen sind: 1.Relic – Museum der Angst 2.Attic – Gefahr aus der Tiefe 3.Formula – Tunnel des Grauens 4.Ritual – Höhle des Schreckens 5.Burn Case – Geruch des Teufels 6.Dark Secret – Mörderische Jagd 7.Maniac – Fluch der Vergangenheit 8.Darkness – Wettlauf mit der Zeit 9.Cult –Spiel der Toten 10.Fever – Schatten der Vergangenheit 11.Revenge – Eiskalte Täuschung 12.Fear – Grab des Schreckens 13.Attack – Unsichtbarer Feind 14.Labyrinth – Elixier des Todes 15.Demon – Sumpf der Toten 16.Obsidian – Kammer des Bösen 17.Headhunt – Feldzug der Rache
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 717
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Douglas Preston / Lincoln Child
Attic
Gefahr aus der TiefeThriller
Aus dem Amerikanischen übersetztvon Thomas A. Merk
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Widmung
Begriffserklärung
Motto
Teil Eins
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Teil Zwei
Aus naheliegenden Gründen gibt [...]
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
Teil Drei
Betrachtet man die verschiedenen [...]
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
Epilog
Anmerkung der Autoren
Lincoln Child widmet dieses Buchseiner Tochter Veronica
Douglas Preston widmet dieses BuchDr. med. James Mortimer Gibbons
at-tic1 [’ætık] s.1. Dachstube f. Man’sarde f; pl. Dachgeschoß n: 2. F fig. ›Oberstübchen‹ n. Kopf m.
Wir lauschen dem Unausgesprochenen,wir schauen das Unsichtbare.
Kakuzo Okakura:»Das Buch vom Tee«
Teil Eins
ALTE KNOCHEN
1
Snow testete seinen Lungenautomaten, überprüfte die beiden Flaschenventile und ließ die Hände über das Neopren seines Taucheranzugs gleiten. Alles war in Ordnung, genau wie vor sechzig Sekunden, als er seine Ausrüstung das letztemal durchgecheckt hatte.
»Gleich sind wir da«, meinte der Sergeant und drosselte die Geschwindigkeit des Bootes.
»Super«, ließ sich die sarkastische Stimme von Fernandez durch das Röhren der starken Dieselmotoren vernehmen. »Ich kann’s kaum erwarten.«
Nach Fernandez sagte niemand mehr ein Wort. Snow fiel auf, daß die Unterhaltung immer spärlicher wurde, je näher das Team dem Ziel seines Einsatzes kam.
Er warf einen Blick über die Schulter und sah, wie die Schraube des Bootes eine keilförmige Schaumspur im bräunlichen Wasser des Harlem River hinterließ, der an diesem warmen, dunstigen Augustmorgen breit und träge dahinfloß. Snow drehte den Kopf in Richtung Ufer und verzog das Gesicht, als ihn dabei das Gummimaterial seiner Kapuze am Hals kniff. Er sah hoch aufragende Wohngebäude ohne Fensterscheiben, geisterhafte Gerippe von Lagerhäusern und Fabriken und einen verlassenen Spielplatz. Nein, so ganz verlassen wohl doch nicht. Ein einsames Kind schwang auf einer rostigen Schaukel hin und her.
»He, Herr Tauchlehrer«, wandte sich Fernandez an Snow. »Hast du dir auch deine Trainingswindeln angezogen?«
Snow zupfte an den Fingern seiner Handschuhe herum und würdigte Fernandez keiner Antwort.
»Das letztemal, als wir einen Frischling mit auf so einen Einsatz genommen haben, hat er sich vor lauter Angst in den Anzug geschissen«, fuhr Fernandez fort. »Mein Gott, war das eine Sauerei! Er mußte die ganze Heimfahrt über am Heck sitzen, so sehr hat er gestunken. Und das war vor Liberty Island, wo das Wasser im Vergleich mit der Kloake praktisch ein Kinderplanschbecken ist.«
»Das reicht, Fernandez«, wies ihn der Sergeant ohne viel Strenge zurecht.
Snow wandte den Blick nicht vom Ufer. Kurz nachdem er vom normalen Streifendienst bei der New Yorker Polizei zur Taucherabteilung versetzt worden war, hatte er einen Fehler gemacht und seinen neuen Kollegen erzählt, daß er in der Karibik in einer Schule für Sporttaucher als Tauchlehrer gearbeitet hatte. Erst danach hatte er erfahren, daß die meisten seiner Kollegen vor ihrem Job bei der Polizei Berufstaucher gewesen waren und entweder Kabel verlegt oder Schweißarbeiten an Pipelines und Ölplattformen durchgeführt hatten. Für sie waren Tauchlehrer wie er verwöhnte, schlecht ausgebildete Weichlinge, die durchdrehten, sobald das Wasser mal nicht ganz klar und der Gewässerboden nicht makellos sauber war. Besonders Fernandez ließ ihn das immer wieder spüren.
Das Boot neigte sich nach Steuerbord, als es der Sergeant in einer scharfen Kurve näher ans Ufer heranbrachte. Mit stark gedrosselter Maschine ließ er es auf eine Reihe von direkt ans Wasser gebauten Häusern zutuckern. Auf einmal kam zwischen den kahlen nackten Betonmauern eine schmale, aus Ziegeln gemauerte Durchfahrt in Sicht. Geschickt steuerte der Sergeant das Boot hindurch in das Zwielicht dahinter. Sofort fiel Snow der unbeschreibliche Gestank auf, der aus dem von der Bootsschraube aufgewühlten Wasser stieg. Seine Augen fingen an zu tränen, und er mußte einen starken Hustenreiz unterdrücken. Fernandez, der ihn nicht aus den Augen ließ, kicherte zufrieden vor sich hin. Unter Fernandez’ noch nicht ganz geschlossenem Taucheranzug konnte Snow ein T-Shirt mit dem inoffiziellen Motto der New Yorker Polizeitaucher sehen: WIR WÜHLEN FÜR SIE IN DER SCHEISSE. Stimmt, dachte Snow, und diesmal lag in der Scheiße ein großes Paket Heroin, das ein Dealer in der Nacht zuvor nach einem Feuergefecht mit der Polizei von der Humboldt Eisenbahnbrücke geworfen hatte.
Langsam schob sich das Boot mit den Tauchern einen schmalen, an beiden Seiten von hohen Betonmauern begrenzten Kanal entlang. Im Schatten der Eisenbahnbrücke wartete bereits ein weiteres Polizeiboot, das mit ausgeschaltetem Motor sanft auf den Wellen schaukelte. An Bord des Bootes standen zwei Männer: der Bootsführer und ein Typ mit merklich gelichteten Haaren, der einen schlechtsitzenden Polyesteranzug trug und eine Zigarre im Mund hatte. Der Mann zog sich die Hose hoch, spuckte in weitem Bogen ins Wasser und hob eine Hand zum Gruß.
Der Sergeant nickte in Richtung auf das andere Boot. »Seht mal, wer da drüben ist.«
»Lieutenant D’Agosta«, erwiderte einer der Taucher am Bug. »Dann muß es ziemlich übel sein.«
»Es ist immer übel, wenn ein Polizist erschossen wird«, meinte der Sergeant.
Er schaltete den Motor aus und brachte das Boot längs an das andere heran. Lieutenant D’Agosta kam an Bord, um den Tauchern genauere Instruktionen zu geben, und Snow bemerkte, wie das Boot unter dem Gewicht des Mannes tiefer in den Fluß gedrückt wurde. Auf dem Rumpf des anderen Fahrzeugs, das dafür ein paar Zentimeter höher stieg, hinterließ das Wasser einen ölig-grünen Film.
»Guten Morgen«, sagte D’Agosta. Im Dämmerdunkel unterhalb der Brücke sah selbst der sonst so rotgesichtige Lieutenant noch wie ein bleicher Höhlenbewohner aus. »Wer hat hier das Kommando?«
»Ich, Sir«, erwiderte der Sergeant und befestigte einen Tiefenmesser an seinem Handgelenk. »Worum geht’s?«
»Die Festnahme gestern war ein Debakel«, informierte ihn D’Agosta. »Dabei war der Bursche wohl nichts weiter als ein Bote. Als er aber bemerkte, daß ihm die Jungs vom Drogendezernat auf den Fersen waren, da hat er das Heroin von der Brücke da oben ins Wasser geworfen und wie wild um sich geballert. Einen Polizisten hat er erschossen, bevor er selbst eine Kugel abbekam. Täter tot, Fall geklärt. Jetzt müssen wir nur noch das Rauschgift finden, dann können wir die ganze Scheiße zu den Akten legen.«
»Und für so was hetzt ihr uns in diese Brühe da?« seufzte der Sergeant.
D’Agosta schüttelte den Kopf. »Sollen wir etwa Heroin im Wert von sechshundert Riesen da unten herumliegen lassen?«
Snow sah sich um. Hinter den düsteren Brückenbogen konnte er ausgebrannte Häuser sehen, deren rußgeschwärzte Fenster wie leere Augenhöhlen herab auf den toten Fluß blickten. Zu dumm, daß der Drogenbote das Heroin ausgerechnet in den Humboldt Kill werfen mußte, dachte Snow. Nicht umsonst wurde das stinkende Gewässer in Anlehnung an das Entwässerungssystem im alten Rom auch die cloaca maxima genannt. Im Lauf der Jahrhunderte hatten sich hier tonnenweise Fäkalien, tote Tiere und Giftstoffe abgelagert. Hoch über den Tauchern rumpelte klappernd und kreischend eine U-Bahn über die Brücke. Das Boot unter Snows Füßen begann zu schwanken, und das dickflüssige Wasser waberte wie Gelatine, die gerade fest zu werden beginnt.
»Okay, Männer«, sagte der Sergeant. »Dann wollen wir mal hinein ins kühle Naß.«
Snow zog den Reißverschluß seines Anzugs hoch und unterdrückte seine Angst. Er wußte, daß er ein erstklassiger Taucher war. Schon als Jugendlicher hatte er zu Hause in Portsmouth mehrere Ertrinkende aus dem Picataqua River gerettet, und später, in der Karibik, hatte er Jagd auf Haie gemacht und in Tiefen über siebzig Metern Unterwasserarbeiten verrichtet. Trotzdem war ihm beim Gedanken an den bevorstehenden Tauchgang alles andere als wohl in seiner Haut.
Obwohl Snow noch nie im Humboldt Kill getaucht war, hatte er von seinen Kollegen schon viel darüber gehört. Von all den ekelhaften Gewässern, von denen es in New York wahrlich mehr als genug gab, war er das widerwärtigste. Der Humboldt Kill war übler als der Arthur Kill und das Hell Gate und sogar noch schlimmer als der Gowanus Canal. Früher einmal war der Humboldt Kill ein Nebenfluß des Hudson gewesen, der am Sugar Hill in Harlem vorbei und quer durch Manhattan geflossen war. Jetzt aber, nachdem er verbaut, vernachlässigt und als Abwasserkanal mißbraucht worden war, hatte sich der Humboldt Kill in ein stehendes, unglaublich verdrecktes Gewässer verwandelt, in das man im Laufe mehrerer Jahrhunderte alle nur erdenklichen Abfälle gekippt hatte.
Snow nahm seine Preßluftflaschen von dem Gestell aus rostfreiem Stahl in der Mitte des Bootes, ging damit ans Heck und schnallte sie sich auf den Rücken. Noch immer hatte er sich nicht so richtig an den schweren Trockentaucheranzug gewöhnt, dessen dickes Material seine Beweglichkeit empfindlich beeinträchtigte. Aus dem Augenwinkel bemerkte er, wie der Sergeant auf ihn zukam. »Alles in Ordnung?« fragte er mit seiner tiefen, ruhigen Stimme.
»Ich glaube schon, Sir«, antwortete Snow. »Aber eine Frage hätte ich doch noch an Sie: Warum tragen wir heute eigentlich keine Stirnlampen?«
Der Sergeant sah ihn nur an und sagte nichts.
»Bei all den Häusern ringsum fällt doch kein Sonnenstrahl hier herunter«, meinte Snow. »Wenn wir im Wasser was sehen wollen, brauchen wir doch Lampen, oder nicht?«
Der Sergeant grinste. »Die können wir uns sparen. Sehen Sie, das Wasser der cloaca ist etwa vier Meter tief, aber darunter befinden sich noch mal drei bis fünf Meter Schlick. Sobald man ihn mit den Flossen aufwirbelt, kann man die Hand nicht mehr vor den Augen sehen. Aber der Schlick ist nicht das schlimmste, denn darunter kommen noch einmal zehn Meter breiiger, zäher Schlamm. In dem muß irgendwo das Heroin liegen. Dort unten sieht man nicht mit den Augen, sondern mit den Händen.«
Der Sergeant musterte Snow mit einem prüfenden Blick und zögerte einen Augenblick. »Hören Sie, Snow«, sagte er dann, »das hier ist etwas ganz anderes als unser Tauchtraining im Hudson. Ich habe Sie auf diesen Einsatz nur mitgenommen, weil Cooney und Schultz noch immer im Krankenhaus liegen.«
Snow nickte. Die beiden Taucher hatten sich eine Infektion mit Blastomykose eingefangen, als sie vor einer Woche im North River eine von Kugeln durchsiebte Leiche aus einem versunkenen Auto geholt hatten. Diese Pilzerkrankung, von den Tauchern kurz »Blasto« genannt, konnte sich auf die Lunge und andere Organe schlagen und war nur eine der vielen bizarren Krankheiten, mit denen die New Yorker Polizeitaucher sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen immer wieder herumschlagen mußten.
»Wenn Sie also lieber hier oben im Boot bleiben wollen, ist das schon okay«, fuhr der Sergeant fort. »Sie könnten mir mit den Sicherungsleinen helfen.«
Snow blickte hinüber zu den anderen Tauchern, die sich gerade ihre Bleigürtel umschnallten, die Reißverschlüsse ihrer Trockentaucheranzüge zuzogen und die Sicherungsleinen über die Bordwand hängten, und dachte an die goldene Regel für alle Taucherteams: Alle tauchen gemeinsam. Fernandez, der gerade seine Leine an einer Klampe festmachte, grinste provozierend zu ihm herüber.
»Ich tauche, Sir«, sagte Snow.
Der Sergeant sah ihm noch eine Weile ins Gesicht. »Wenn Sie da unten im Schlamm sind, denken Sie an die Taucherregel Nummer eins: Ruhe bewahren! Viele Taucher halten in solchen Situationen die Luft an. Tun Sie das nicht, denn das ist die sicherste Methode, um eine Embolie zu bekommen. Und blasen Sie Ihren Anzug nicht zu sehr auf, sonst bekommen Sie zuviel Auftrieb. Am wichtigsten aber ist, daß Sie niemals die Leine loslassen. Im Schlamm verliert man schnell die Orientierung und weiß dann nicht mehr, wo oben und unten ist. Wenn Sie die Leine verlieren, sind Sie womöglich die nächste Leiche, die wir aus dem Wasser fischen müssen.«
Der Sergeant deutete auf die Sicherungsleine, die dem Heck des Bootes am nächsten war. »Das ist die Ihre.«
Snow blieb stehen und versuchte, möglichst gleichmäßig zu atmen, während einer seiner Kollegen ihm die Haube seines Trockentaucheranzugs über den Kopf zog. Nachdem er seine Taucherbrille aufgesetzt und auf korrekten Sitz überprüft hatte, öffnete er die Ventile der Preßluftflaschen und ließ sich über die Seite des Bootes in den Fluß gleiten.
Selbst durch das dicke Material des Trockentaucheranzugs fühlte sich das Wasser seltsam zäh und sirupartig an. Es gurgelte nicht um seine Ohren und glitt ihm nicht durch die Finger wie normales Wasser, sondern setzte jeder Bewegung einen Widerstand entgegen wie dickflüssiges Motorenöl.
Mit der Hand am Sicherungsseil ließ sich Snow ein, zwei Meter nach unten sinken. Schon nach wenigen Zentimetern konnte er den Kiel des Bootes nicht mehr erkennen. Rings um ihn schwebten Myriaden von winzigen Partikeln im Wasser und schluckten das düster grünliche Licht. Seine eigene Hand, die unmittelbar vor der Taucherbrille das Sicherungsseil fest umklammert hielt, konnte Snow gerade noch sehen, aber schon die andere, mit der er sich durch das trübe Wasser tastete, war nur noch schemenhaft auszumachen. Obwohl er unter sich nichts als Dunkelheit wahrnahm, wußte er, daß ihn in sieben Metern Tiefe eine gänzlich andere Welt erwartete: die Welt des dicken, alles umschließenden Schlamms.
Zum erstenmal in seiner Taucherkarriere erkannte Snow, wie sehr sein Sicherheitsgefühl von klarem Wasser und Sonnenlicht abhängig war. In der Karibik war das Wasser selbst in fünfzig Metern Tiefe noch durchsichtig gewesen, so daß ihm das Licht seiner Taschenlampe dort das Gefühl eines offenen Raumes vermittelt hatte. Hier aber war alles anders, hier fühlte er sich durch die mangelnde Sicht richtiggehend eingesperrt. Vorsichtig ließ sich Snow weiter hinunter in die Dunkelheit sinken, wobei er angestrengt durch die trübe Brühe spähte.
Auf einmal tauchte er in eine dickflüssige Masse ein, deren Oberfläche von der Strömung in wellenförmige Bewegungen versetzt wurde. Das muß die Schlickschicht sein, dachte Snow, während sich sein Magen zusammenkrampfte. Der Sergeant hatte ihm gesagt, daß Taucher in diesen trüben Gewässern, wo es schwer war, Wirklichkeit und Einbildung auseinanderzuhalten, oft die sonderbarsten Dinge zu sehen glaubten.
Während Snow in die seltsam wabernde Masse hineinglitt, stieg rings um ihn eine dichte Wolke von Schwebeteilchen auf, die ihn vollkommen einhüllte und ihm auch die letzte Sicht raubte. Einen Augenblick lang machte sich Panik in ihm breit, und er klammerte sich noch kräftiger an der Sicherungsleine fest. Dann dachte er an Fernandez und sein hämisches Grinsen und ließ sich wieder ein Stück nach unten gleiten. Jede Bewegung schickte dicke schwarze Schlickwolken vor seine Taucherbrille. Snow bemerkte, daß er instinktiv die Luft anhielt, und zwang sich, lange, ruhige Atemzüge zu machen. Bloß nicht auf dem ersten Einsatz schon durchdrehen, dachte er. Dann hielt er einen Moment inne, bis sein Atem wieder normal und regelmäßig ging.
Danach ließ er sich langsam weiter nach unten sinken und versuchte, sich dabei so weit wie möglich zu entspannen. Zu seinem eigenen Erstaunen bemerkte er, daß es inzwischen keinen Unterschied mehr machte, ob er die Augen offen oder geschlossen hielt. Ständig mußte er an die dicke Schlammschicht denken, der er sich unaufhaltsam näherte und in der, wie Insekten im Bernstein, die absonderlichsten Dinge eingeschlossen waren …
Plötzlich hatte er das Gefühl, als würden seine Füße den Grund des Flusses berühren, doch so einen Boden hatte Snow noch nie in seinem Leben gespürt. Die Masse gab seltsam gummiartig unter seinem Gewicht nach und umschloß nach und nach seine Knöchel, seine Knie und schließlich seine Hüften, so daß er glaubte, in nassem Treibsand zu versinken. Auch als der Schlamm sich über seinem Kopf geschlossen hatte, sank Snow noch nach unten, wenn auch nicht mehr so schnell wie am Anfang. Er spürte, wie sich der Morast gegen das Neopren seines Taucheranzugs drückte, und hörte, wie sich die Luftblasen aus seinem Lungenautomaten mühevoll den Weg nach oben bahnten. Das Geräusch, das sonst leicht und perlend klang, war jetzt eher ein schmatzendes Blubbern. Je tiefer Snow sank, desto mehr Widerstand schien ihm der Schlamm entgegenzubringen. Wie weit, so fragte er sich, sollte er sich eigentlich in diese Scheiße hineinbegeben?
So, wie er es in seiner Ausbildung gelernt hatte, schwang er prüfend seine freie Hand durch den Morast, und manchmal bekam er auch etwas zu fassen. Wegen der dicken Handschuhe war es oft nicht leicht, die Gegenstände durch Tasten zu erkennen. Von Ästen über weggeworfene Kurbelwellen bis hin zu heimtückischen Drahtbündeln, in denen man sich heillos verheddern konnte, hatte sich hier in diesem Schlammgrab der Unrat vieler Generationen angesammelt.
Drei Meter noch, sagte sich Snow, dann würde er wieder nach oben steigen. Und wehe, dieser Bastard Fernandez wagte es danach noch einmal, ihn so unverschämt anzugrinsen.
Als Snow gerade kehrtmachen wollte, berührte sein hin und her pendelnder Arm einen festen Gegenstand. Er zog daran, und das Ding kam ganz langsam auf ihn zugedriftet. Snow schloß daraus, daß es sich dabei um etwas Größeres und Schwereres als nur einen alten Ast handeln mußte. Er klemmte die Sicherungsleine in seinen rechten Ellenbogen und befühlte das Ding mit beiden Händen. Was immer es auch sein mochte, das Bündel Heroin war es nicht. Also stieß er den Gegenstand wieder von sich und schlug mit den Flossen, um wieder aufzutauchen.
Die Strömung, die dadurch in den sirupzähen Schlamm kam, versetzte das Ding in plötzliche Bewegung. Snow erschrak fürchterlich, als es gegen die Taucherbrille schlug und ihm fast das Mundstück des Lungenautomaten aus dem Mund riß. Nachdem er wieder ruhiger geworden war, griff er nach dem Ding, um es aber erneut von sich zu stoßen. Es fühlte sich an wie ein Geflecht aus Zweigen. Vielleicht war es ja doch ein vor langer Zeit ins Wasser gestürzter Baum. Aber dann spürte Snow glatte Stellen, rundliche Knoten und nachgiebige Klumpen einer weichen Masse, die nicht so recht zu einem Baum passen wollten. Erst nach längerem Herumtasten wurde Snow bewußt, daß er Knochen in der Hand hielt. Und zwar nicht nur einen, sondern mehrere, die offenbar noch immer von Bändern und Sehnen zusammengehalten wurden. Zuerst kam Snow der Gedanke, daß es sich um die halb skelettierten Überreste eines größeren Tieres handeln könnte, möglicherweise eines Pferdes, aber je länger er tastete, desto deutlicher erkannte er, daß er es mit der Leiche eines Menschen zu tun hatte.
Snow hielt inne und versuchte, seinen rasenden Atem in Zaum zu halten und einen klaren Kopf zu bewahren. Sein Training wie sein gesunder Menschenverstand sagten ihm gleichermaßen, daß er den Leichnam nicht einfach hier unten lassen durfte. Er mußte ihn irgendwie nach oben bringen.
So gut es in dem zähen Schlamm ging, wand Snow seine Sicherungsleine um das Becken und die Oberschenkelknochen des Skelettes und hoffte, daß noch genügend Gewebe daran war, um es beim Aufstieg nicht auseinanderfallen zu lassen. In der Dunkelheit einen Knoten zu machen war alles andere als einfach, zumal man ihm diese Fertigkeit während seiner Ausbildung zum Polizeitaucher nicht beigebracht hatte.
Snow hatte zwar nicht das Heroin gefunden, dennoch hatte er bei seinem ersten Tauchgang Glück gehabt: Leichen waren immer spektakuläre Funde, die häufig zur Aufklärung eines bislang ungelösten Mordfalls führten. Snow freute sich schon darauf, was der blöde Muskelprotz Fernandez wohl für ein entgeistertes Gesicht machen würde, wenn das Skelett erst einmal oben war. Und das würde hoffentlich bald der Fall sein, denn Snow wollte nun so rasch wie möglich diesen widerlichen Schlamm verlassen.
Sein Atem ging jetzt in raschen kurzen Stößen. Snow bemühte sich gar nicht mehr, ihn unter Kontrolle zu bekommen. In seinem Anzug war ihm auf einmal bitter kalt, aber er hatte jetzt keine Zeit, mehr isolierende Luft hineinzublasen. Er mußte jetzt unbedingt diesen Knoten binden, doch das glatte Seil rutschte ihm immer wieder aus den Händen. Je verzweifelter er sich abmühte, das Ende der Leine zu einer Schlaufe zu formen, desto mehr mußte er an den meterdicken Schlamm über seinem Kopf, den wirbelnden Schlick und das ölige Wasser darüber denken, das kein Sonnenstrahl zu durchdringen vermochte …
Erst nach mehreren Fehlversuchen gelang es Snow schließlich, den Knoten zu schlingen und das Seil zu spannen. Gott sei Dank, das war geschafft. Nun mußte er sich nur noch vergewissern, ob der Knoten auch wirklich hielt, und dann dreimal an der Leine ziehen zum Zeichen, daß er etwas gefunden hatte. Dann würde er an der Leine nach oben schwimmen und den grauenvollen schwarzen Schlamm hinter sich lassen. Wenn er dann erst einmal wieder festen Boden unter den Füßen hatte, würde er eine halbe Stunde lang duschen, sich besaufen und darüber nachdenken, ob er nicht doch lieber wieder Tauchlehrer werden sollte. In einem Monat begann in der Karibik die Hochsaison.
Snow überprüfte das Seil und schlang es noch einmal um die Knochen des Skeletts. Er führte es dabei durch die Rippen und um die Wirbelsäule, damit sich der Zug gleichmäßiger verteilte und das Knochengerüst beim Hochholen nicht auseinanderbrach. Vielleicht sollte er den Kopf ja noch besonders befestigen, denn der war wichtig, wenn man ein eventuelles Mordopfer identifizieren wollte. Snow tastete sich mit den Händen an den Halswirbeln entlang nach oben und griff mit einemmal ins Leere. Die Leiche hatte keinen Kopf! Instinktiv zog Snow seine Hand zurück und merkte einen Augenblick später mit einem Anflug von Panik, daß er dabei auch die Sicherungsleine losgelassen hatte. Mit beiden Armen ruderte er im Schlamm herum, bis er auf etwas Solides stieß: das Skelett. Vor lauter Erleichterung hätte er es am liebsten umarmt. Als er aber an den Knochen entlang nach dem Seil tastete, konnte er es nicht finden.
Wo war es? Hatte es sich von selbst vom Skelett gelöst? Aber das war unmöglich. Er hatte es doch festgebunden, hatte einen Knoten gemacht und ihn zweimal überprüft. Er drehte das Skelett herum und tastete auf der anderen Seite nach dem Seil, als sich sein Luftschlauch in etwas verfing. Snow drehte den Kopf zur Seite, wußte plötzlich nicht mehr, wo er war, und spürte, wie ihm langsam die Taucherbrille vom Gesicht gedrückt wurde und etwas Warmes, Feuchtes an sein Gesicht drang. Auf einmal verklebte ihm zäher Schlamm die Augen und die Nase, und dann wurde Snow schlagartig klar, daß er sich in einer makabren Umarmung mit einem zweiten Skelett befand. Was danach kam, war nichts als blinde, hirnlose, kreischende Panik.
An Bord des Polizeibootes beobachtete Lieutenant D’Agosta ohne allzu große Anteilnahme, wie der neue Taucher aus dem Wasser gezogen wurde. Der Mann schlug wild um sich, während ihm schwarzer Schlamm aus dem Mund quoll und seine Schreie zu einem unverständlichen Gurgeln verstümmelten. Teils ockerfarbene, teils dunkelbraune Brühe tropfte von seinem Taucheranzug. Vermutlich hatte der arme Kerl da unten das Seil verloren und war dann in Panik geraten. Er konnte von Glück sagen, daß er es doch noch irgendwie an die Oberfläche geschafft hatte. D’Agosta wartete, bis man den Taucher an Bord gehievt, seinen Anzug mit einem Schlauch abgespritzt und den hysterischen Mann wenigstens halbwegs beruhigt hatte. Schließlich hockte er sich ans Heck und erbrach sich ins Wasser. Wenigstens nicht ins Boot, dachte D’Agosta anerkennend. Nach dem, was er der wirren Erzählung des hysterischen Mannes entnehmen konnte, hatte der im Schlamm offenbar ein, nein, zwei Skelette gefunden. Das war zwar nicht gerade das, wofür man ihn da hinuntergeschickt hatte, aber trotzdem nicht schlecht für seinen ersten Taucheinsatz. D’Agosta beschloß, dem armen Kerl eine Empfehlung zu schreiben. Wenn ihm nichts von dem Morast, der ihm an Mund und Nase geklebt hatte, in die Lunge gekommen war, dann würde er vermutlich in ein paar Stunden wieder okay sein. Und wenn nicht … nun, mit ein paar Antibiotika konnte man heutzutage wahre Wunder vollbringen.
Als das erste Skelett aus dem schäumenden Wasser auftauchte, war es noch völlig mit Schlamm bedeckt. Ein auf der Seite schwimmender Taucher zog es herüber zu D’Agostas Boot, schlang ein Netz darum und kletterte an Bord. Dann hievte er das Netz vorsichtig aus dem Wasser und legte das schlammtriefende Knochengebilde wie einen grausigen Fang auf eine zu D’Agostas Füßen ausgebreitete Plane.
»Großer Gott, ihr hättet es wirklich vorher abspritzen können«, knurrte D’Agosta, als ihm der scharfe Geruch von Ammoniak in die Nase stieg. Sobald das Skelett aus dem Wasser war, fiel es in seinen Zuständigkeitsbereich, doch insgeheim wünschte D’Agosta sehnlichst, es wäre unten im Schlamm geblieben. Daß es keinen Kopf mehr hatte, hatte er nämlich schon auf den ersten Blick bemerkt.
»Soll ich es abspritzen, Sir?« fragte der Taucher und griff nach dem Schlauch.
»Machen Sie lieber zuerst sich selber sauber«, sagte D’Agosta und rümpfte die Nase. Der Taucher, dem ein gebrauchtes Kondom links am Kopf klebte, sah ebenso unappetitlich wie lächerlich aus. Dann erschienen zwei weitere Taucher neben dem Boot und kletterten an Bord, wo sie langsam an einem Seil zu ziehen begannen, während ein dritter Froschmann das zweite Skelett vorsichtig in Richtung Bordwand bugsierte. Als es neben dem anderen auf der Plane lag und alle sahen, daß es ebenfalls keinen Kopf mehr hatte, machte sich auf den beiden Booten eine betretene Stille breit. Auch das Päckchen Heroin hatten die Taucher gefunden und, verpackt in einen Beweismittelbeutel aus Gummi, aufs Deck des Polizeibootes gelegt. D’Agosta jedoch interessierte das Rauschgift nur noch am Rande.
Der Lieutenant zog nachdenklich an seiner Zigarre und ließ den Blick über das schmutzige Wasser des Humboldt Kill schweifen, bis er auf der Öffnung eines großen Abwasserrohrs innehielt. Ein paar bräunlich-weiße Stalaktiten ragten wie Zähne von der Decke des Rohres, dem Ende des riesigen Entwässerungssystems der Upper West Side. Wann immer es in Manhattan stark regnete und das Klärwerk am Lower Hudson mit den Wassermassen nicht mehr fertig wurde, rauschten durch dieses Rohr Hunderttausende von Litern ungeklärten Abwassers in den Humboldt Kill.
Kein Wunder, daß dieses Gewässer cloaca genannt wird, dachte D’Agosta und warf den Stummel seiner Zigarre ins Wasser. »Ich schätze, ihr müßt noch mal da runter, Leute«, sagte er zu den Tauchern. »Ich brauche die beiden Schädel.«
2
Louis Padelsky sah auf die Uhr und spürte plötzlich, wie sein Magen knurrte. Padelsky war Pathologe am Gerichtsmedizinischen Institut der Stadt New York und buchstäblich kurz vor dem Verhungern. Seit drei Tagen hatte er nichts anderes zu sich genommen als SlimCurve-Schlankheitsdrinks, und heute war der einzige Tag in der Woche, an dem er sich ein normales Mittagessen gönnen durfte. Popeye’s Fried Chicken. Padelsky fuhr sich mit der Hand über seinen dicken Bauch und kniff prüfend hinein, um festzustellen, ob er schon etwas abgenommen hatte. Ja, dachte er. Er war eindeutig dünner geworden.
Der Pathologe nahm einen Schluck aus seiner Tasse mit schwarzem Kaffee – es war die fünfte an diesem Vormittag – und blickte auf das Formular auf seinem Klemmbrett. Aha, endlich mal was Interessantes, dachte er. Nicht wieder einer von diesen unzähligen Erstochenen, Erschossenen oder Drogentoten, mit denen er es sonst immer zu tun hatte.
Die Türen am anderen Ende des Autopsieraumes flogen auf, und Sheila Rocco, eine der Assistentinnen, schob eine Rollbahre herein. Padelsky warf einen raschen Blick auf die Leiche, sah weg und gleich wieder hin. Leiche war wohl das falsche Wort für das, was da vor ihm lag. Das braune Ding auf der Bahre war nicht viel mehr als ein Skelett, an dem nur noch wenige Fetzen Gewebe hingen. Padelsky rümpfte die Nase.
Die Assistentin schob die Rollbahre unter die von der Decke hängenden Arbeitslampen und bückte sich, um den Schlauch am Ablaufstutzen der Bahre einzuhängen.
»Die Mühe können Sie sich sparen, Sheila«, meinte Padelsky. Das einzig Flüssige in diesem Raum war der Kaffee in seiner Styroportasse. Er nahm sie, leerte sie mit einem langen Zug und warf sie in den Abfalleimer. Nachdem er die Zahlen auf dem am Skelett befestigten Zettel mit denen auf seinem Formular verglichen hatte, schrieb er seine Initialen in das dafür vorgesehene Kästchen und zog sich ein Paar grüne Latex-Handschuhe an. »Na, wen haben Sie mir denn da gebracht?« fragte er Sheila. »Den Neandertaler höchstpersönlich?«
Rocco grinste schief und richtete die Lampen auf das Skelett.
»Riecht so, als wäre er jahrhundertelang begraben gewesen«, fuhr Padelsky fort. »Und zwar in reiner Scheiße. He, vielleicht ist es ja gar kein Neandertaler, sondern König Schitt-anch-Amun aus dem alten Ägypten.«
Rocco verdrehte die Augen und wartete, bis Padelskys lautes Gelächter verklungen war. Dann drückte sie ihm sein Klemmbrett in die Hand, auf dem sie ein neues Formular befestigt hatte.
Padelskys Lippen bewegten sich, während er sich die Informationen über die Leiche durchlas. Schon bei den ersten Zeilen stutzte er. »Aus dem Humboldt Kill«, murmelte er leise. »Na großartig!« Er warf einen Blick auf den Handschuhspender an der Wand und überlegte kurz, ob er sich nicht ein zusätzliches Paar überziehen sollte, entschied sich dann aber dagegen. »Hm. Enthauptet. Kopf wird immer noch vermißt … keine Kleidung, aber ein Metallgürtel um die Hüften.« Padelsky sah hinüber zu der Rollbahre und bemerkte, daß an der Seite ein durchsichtiger Plastikbeutel hing.
»Schauen wir uns doch mal den Gürtel an«, sagte er. Der Beutel enthielt ein dünnes goldenes Band mit einer aufwendig gearbeiteten Schnalle, die ein großer Topas zierte. Padelsky wußte, daß der Gürtel bereits im Labor untersucht worden war, und er wußte auch, daß er ihn trotzdem nicht aus der Verpackung nehmen durfte.
»Teures Stück«, erklärte Padelsky. »Scheint sich wohl eher um Frau Neandertaler zu handeln. Oder um einen prähistorischen Transvestiten.« Abermals brach er in schallendes Gelächter über seinen eigenen Witz aus.
Rocco runzelte die Stirn. »Meinen Sie nicht, wir sollten dem oder der Toten ein wenig mehr Respekt zollen, Doktor Padelsky?«
»Ja, natürlich«, murmelte Padelsky und hängte das Klemmbrett an einen Haken an der Wand. Dann brachte er das Mikrophon, das über der Rollbahre von der Decke hing, in die Höhe seines Mundes. »Wären Sie so freundlich und würden das Tonbandgerät einschalten, mein Engel?« fragte er zuckersüß.
Als das Band lief, nahm Padelskys Stimme einen knappen professionellen Ton an. »Hier spricht Doktor Louis Padelsky. Es ist der zweite August, die Zeit ist 11.55 Uhr am Vormittag. Meine Assistentin ist Sheila Rocco, und wir führen nun die Obduktion von« – er warf rasch einen Blick auf den an dem Skelett befestigten Zettel – »Leiche Nummer A-1430 durch. Vor uns liegt ein Torso ohne Kopf, der praktisch vollständig skelettiert ist. Seine Länge beträgt – Sheila, würden Sie die Leiche bitte gerade hinlegen – einhundertzweiundvierzig Zentimeter. Zusammen mit dem noch fehlenden Kopf dürfte die Leiche etwa einhundertsiebenundsechzig bis einhundertsiebzig Zentimeter groß gewesen sein. Versuchen wir nun, das Geschlecht der Leiche zu bestimmen. Ein breiter Beckenkamm deutet darauf hin, daß wir es mit einer Frau zu tun haben. Keine knöchernen Ausziehungen an den seitlichen Lendenwirbeln, sie war also nicht älter als vierzig Jahre. Schwer zu sagen, wie lange die Leiche im Wasser war. Die Knochen riechen stark nach … äh … Kanalisation, und ihre bräunlich-orange Farbe läßt darauf schließen, daß sie lange im Schlamm gelegen sind. Andererseits ist noch genügend Bindegewebe vorhanden, um das Skelett zusammenzuhalten, und an den medialen und lateralen Kondylen des Oberschenkelknochens sowie an Kreuzbein und Steißbein hängen noch Fetzen von Muskelgewebe. Mehr als genug, um eine Blutgruppenbestimmung und genetische Tests durchführen zu können. Schere, bitte!«
Sheila reichte ihm das Instrument, und Padelsky schnitt damit ein Stück Muskelgewebe ab und steckte es in einen kleinen Beutel. »Könnten Sie die Leiche bitte so drehen, daß das Becken seitlich zu liegen kommt, Sheila? Vielen Dank. Jetzt lassen Sie uns mal sehen … Vom Kopf abgesehen, ist das Skelett auf den ersten Blick fast komplett. Der zweite Halswirbel fehlt ebenfalls, die restlichen sind aber vorhanden.«
Nachdem Padelsky das Skelett beschrieben hatte, trat er vom Mikrophon zurück. »Die Knochenzange, bitte.«
Sheila Rocco gab ihm das kleine Instrument, und Padelsky kniff damit die Bänder zwischen Elle und Oberarmknochen durch.
»Den Knochenhautschaber, bitte«, sagte er. Er nahm das Instrument und hobelte damit eine Gewebeprobe von einem der Wirbel ab. Dann setzte er sich eine Schutzbrille aus Plastik auf.
»Säge, bitte.«
Sheila reichte ihm eine kleine, preßluftbetriebene Knochensäge. Padelsky schaltete sie ein und wartete einen Augenblick, bis sie die richtige Drehzahl erreicht hatte. Als sich das diamantbesetzte Sägeblatt durch die Knochen fraß, erzeugte es ein hohes, heulendes Geräusch, das Padelsky immer an einen wütenden Moskito erinnerte. Im Autopsieraum verbreitete sich ein nur schwer erträglicher Geruch von Knochenstaub, Kloake, verwestem Knochenmark – und Tod.
Padelsky schnitt aus dem Oberarmknochen mehrere dünne Scheiben heraus, die er dann von Sheila in Plastikbeutel verpacken ließ. »Ich möchte, daß diese Proben unter dem optischen und dem Rasterelektronenmikroskop untersucht werden«, sagte Padelsky, während er von der Rollbahre zurücktrat, seine Handschuhe auszog und das Tonbandgerät ausschaltete.
Rocco schrieb seine Anweisungen mit einem dicken schwarzen Marker auf die Plastikbeutel. Kurz darauf klopfte es an der Tür. Sheila öffnete und sprach mit jemandem, der draußen auf dem Gang stand.
»Sie haben den Gürtel identifiziert«, erklärte sie, als sie wieder hereinkam. »Er gehörte Pamela Wisher.«
»Ist das nicht diese junge Frau aus der besseren Gesellschaft, nach der seit Monaten gesucht wird?« fragte Padelsky, während er die Schutzbrille abnahm. »Puh!«
»Und außerdem haben wir noch ein zweites Skelett aus dem Humboldt Kill hereinbekommen.«
»Wie? Noch eines?« fragte Padelsky, der sich bereits die Hände wusch. »Wieso haben sie es denn nicht zusammen mit dem ersten hereingebracht, verdammt noch mal? Dann hätte ich beide in einem Aufwasch untersuchen können.« Padelsky sah auf die Uhr. Es war schon Viertel nach eins. Mist. Jetzt würde es mindestens drei Uhr werden, bevor er etwas in den Magen bekam. Er fühlte sich schon ganz flau vor Hunger.
Die Türen flogen auf, und ein zweites Skelett wurde neben das erste geschoben. Padelsky ging hinüber zu seinem Tisch und goß sich noch eine Tasse Kaffee ein, während Sheila alles für die neue Obduktion herrichtete.
»Wieder kein Kopf«, sagte Sheila.
»Machen Sie keine Witze«, entgegnete Padelsky. Er nahm seinen Kaffee und trat an das Skelett heran. Mit der Tasse an den Lippen starrte er ungläubig auf die Rollbahre.
»Was, zum Teufel, ist denn das?« Er stellte die Tasse ab und zog sich ein frisches Paar Latex-Handschuhe an. Dann beugte er sich über das Skelett und fuhr mit dem Finger über eine der Rippen.
»Was ist?« wollte Sheila wissen.
Padelsky richtete sich auf und streckte sich. »Decken Sie es ab, und rufen Sie Dr. Brambell. Und sagen Sie niemandem auch nur ein Sterbenswörtchen über« – er deutete mit dem Kinn in Richtung des Skeletts – »über das da.«
Sheila zögerte und starrte mit weit geöffneten Augen auf die Rollbahre.
»Tun Sie, was ich sage, Schätzchen. Und zwar sofort.«
3
Das Klingeln des Telefons durchschnitt die Stille des kleinen Büros im dritten Stock des Museumsgebäudes. Margo Green, die schon wieder viel zu nahe vor dem Bildschirm des Computers gesessen hatte, lehnte sich schuldbewußt in ihrem Stuhl zurück und strich sich ihre kurzen braunen Haare aus der Stirn.
Das Telefon klingelte ein zweites Mal. Margo griff nach dem Hörer, überlegte es sich dann aber doch anders. Bestimmt wollte sich wieder jemand aus der EDV-Abteilung darüber beschweren, daß Margo mit ihrem Programm zur Berechnung der kladistischen Regression zuviel Rechnerzeit auf dem Zentralcomputer verbrauchte. Also verschränkte sie die Arme vor der Brust und wartete darauf, daß das Klingeln aufhörte. Während sie so dasaß, spürte sie den leichten Muskelkater, der von ihrem gestrigen Besuch im Fitneß-Studio herrührte, und nahm den Handtrainer vom Schreibtisch. Sie drückte das kleine Gerät in ihrem gewohnten Rhythmus und blickte hinüber zum Bildschirm. In fünf Minuten würde ihr Programm durchgelaufen sein, dann konnte sich beschweren, wer wollte.
Margo wußte natürlich, daß nach den jüngst erlassenen Sparvorschriften rechenzeitverschlingende Vorhaben wie das ihre einer gesonderten Genehmigung bedurften, aber das hätte bedeutet, daß sie erst einmal endlose E-Mails hätte hin- und herschicken müssen, bevor sie ihr Programm hätte laufen lassen dürfen. Das aber konnte sie nicht, denn sie brauchte die Ergebnisse sofort.
Langsam gingen Margo die ständigen Sparbeschlüsse der Museumsleitung auf die Nerven. Hätte sie gewußt, was sie erwartet, hätte sie wohl nicht ihre Stelle als Lehrbeauftragte an der Columbia Universität aufgegeben, um den Posten als Stellvertretende Kuratorin am Naturgeschichtlichen Museum der Stadt New York anzunehmen. Je mehr das Museum in finanzielle Schwierigkeiten geriet, desto offener spekulierte es auf den Massengeschmack und vernachlässigte dabei die ernsthafte wissenschaftliche Arbeit zunehmend. Margo hatte bemerkt, wie schon jetzt die Vorbereitungen für die Sensationsausstellung im nächsten Jahr getroffen wurden, die »Seuchen des 21. Jahrhunderts« heißen sollte.
Während das Programm immer noch rechnete, legte Margo den Handtrainer weg und holte sich die New York Post aus ihrer Handtasche. Mittlerweile gehörte die Lektüre der Post ebenso zu ihrem vormittäglichen Ritual wie die Tasse Kaffee, denn Margos Freund Bill Smithback hätte es ihr nie verziehen, wenn sie auch nur einen seiner reißerischen Artikel versäumt hätte. Und mit der Zeit hatte sie zu ihrem eigenen Erstaunen sogar Gefallen an dem blutrünstigen Stil des Blattes gefunden.
Als Margo die Zeitung entfaltete und die Schlagzeile las, mußte sie ungewollt grinsen. Das ist mal wieder typisch Post, dachte sie. Drei Viertel der ersten Seite nahm eine Überschrift in gigantisch großen Lettern ein:
VERSCHWUNDENE MILLIONÄRSTOCHTER LAG TOT IN KLOAKE
Schon am ersten Absatz erkannte sie, daß kein anderer als Smithback den Artikel geschrieben haben konnte. Das war schon seine zweite Titelseiten-Story in diesem Monat, und Smithback würde vor lauter Stolz darauf nun noch schwerer zu ertragen sein als sonst.
Margo überflog rasch den Artikel. Er war so sensationslüstern, makaber und versessen auf grausige Details, wie es von Smithback zu erwarten war. Am Anfang faßte er in knappen Worten zusammen, was die Bürger von New York ohnehin schon wußten. Die »schöne Millionärstochter Pamela Wisher, bekannt für ihre nächtlichen Vergnügungsmarathons«, war vor zwei Wochen nach dem Besuch einer Kellerdisco am Central Park South spurlos verschwunden. Bald darauf waren an den Häuserwänden zwischen der 57th und 96th Street Farbkopien der verschwundenen jungen Frau aufgetaucht. Auch Margo hatte das lächelnde Gesicht mit seinen, laut Smithback, »makellosen Zähnen, leicht abwesend blickenden Augen und von einem teuren Friseur gestylten blonden Haaren« häufig gesehen, wenn sie von ihrer Wohnung in der West End Avenue ins Museum gejoggt war.
Jetzt hatte man die sterblichen Überreste von Pamela Wisher im Schlamm des Humboldt Kill gefunden, und zwar, wie der Artikel genüßlich ausführte, »in einer grausigen Umarmung mit einem weiteren Skelett«. Während Pamela Wisher zweifelsfrei identifiziert worden war, konnte noch niemand sagen, um wen es sich bei dem zweiten Toten handelte. Ein Foto unterhalb der Schlagzeile zeigte Pamelas Verlobten, den jungen Viscount Adair, wie er in der Lounge des Platypus Hotels das leidgeprüfte Gesicht in den Händen vergrub. Die Polizei hatte, so der Artikel, natürlich sofort mit der »energischen« Untersuchung des Falles begonnen. Am Schluß des Artikels zitierte Smithback noch ein paar Meinungen von Passanten, die den »Kerl, der das getan hat«, allesamt auf den elektrischen Stuhl wünschten.
Margo ließ die Zeitung sinken und dachte an Pamela Wisher, deren Gesicht sie in den letzten Wochen so oft angesehen hatte. Die junge Frau hatte etwas Besseres verdient, als New Yorks Sensationsgeschichte dieses Sommers zu werden.
Das schrille Klingeln des Telefons riß Margo abermals aus ihren Gedanken. Sie blickte auf den Monitor, der anzeigte, daß ihr Programm inzwischen durchgelaufen war. Jetzt kann ich ja drangehen, dachte sie und hob den Hörer ab.
»Ja?« fragte sie in Erwartung eines Anpfiffs aus der Computerzentrale.
»Na endlich, Dr. Green. Wurde aber auch langsam Zeit.«
Die ruppige, autoritär klingende Stimme mit ihrem starken Queens-Akzent kam Margo irgendwie vertraut vor, auf Anhieb einordnen konnte sie sie jedoch nicht. So durchforstete sie ihr Gedächtnis nach dem passenden Gesicht.
Natürlich. Gestern, im Fernsehen, als von dem Leichenfund berichtet wurde! »Ich kann Ihnen nur sagen, daß wir weitere Untersuchungen anstellen lassen, bis die Identität der Toten eindeutig geklärt ist …«
»Lieutenant D’Agosta, sind Sie’s?« fragte Margo.
»Wer sonst? Wir brauchen Sie im Labor der Forensischen Anthropologie«, raunzte D’Agosta. »Und zwar sofort.«
»Darf ich fragen, was Sie …«
»Nein, dürfen Sie nicht. Tut mir leid. Lassen Sie alles stehen und liegen, und kommen Sie nach unten.« Margo hörte ein Klicken, und die Leitung war unterbrochen.
Margo hielt den Hörer noch eine Weile in der Hand und starrte auf ihn, als erwarte sie eine weitere Erklärung. Dann nahm sie ihre Tasche und steckte die Post wieder hinein, wobei sie darauf achtete, daß die Zeitung eine kleine halbautomatische Pistole verbarg, die sie seit einigen Monaten immer bei sich hatte. Sie stand auf und verließ raschen Schrittes ihr Büro.
4
Bill Smithback schritt unbekümmert an der mit roten Sandsteinskulpturen verzierten Ziegelfassade des Hauses Nummer neun Central Park South entlang. Gleich zwei Türsteher standen unter der goldverzierten Markise auf dem Gehsteig, und durch die großen Fenster sah er, wie in der imposanten Eingangshalle des Gebäudes eine ganze Reihe weiterer dienstbarer Geister wartete. Genau so hatte Smithback es sich vorgestellt; schließlich war das für die meisten dieser herrschaftlichen Wohnhäuser in der Nähe des Parks typisch. Diese Geschichte würde hart werden. Verdammt hart.
Smithback ging um die Ecke zur Sixth Avenue und blieb stehen. Er griff in eine Außentasche seines Jacketts und tastete nach dem Aufnahmeknopf seines kleinen Diktiergeräts. Wenn sich eine Gelegenheit dazu ergab, wollte er es unbemerkt einschalten und das Gespräch mitschneiden. Im Schaufenster eines großen Schuhgeschäfts überprüfte Smithback sein Spiegelbild: Dafür, daß seine Garderobe ihm in dieser Hinsicht nur wenig Auswahl bot, kam sein Aussehen dem eines jungen Mannes aus gutem Hause doch relativ nahe. Er holte tief Luft und ging mit frischem Mut wieder zurück um die Ecke und auf die cremefarbene Markise zu. Der nähere der beiden Türsteher, der seine in einem weißen Handschuh steckende Hand am Messingtürknopf hatte, sah ihm gelassen ins Gesicht.
»Ich möchte zu Mrs. Wisher«, sagte Smithback.
»Wie heißen Sie, Sir?« fragte der Türsteher mit monotoner Stimme.
»Ich bin ein Freund von Pamela.«
»Tut mir leid, Sir«, erwiderte der Mann und bewegte sich nicht von der Stelle, »aber Mrs. Wisher empfängt keine Besucher.«
Smithback dachte fieberhaft nach. Der Mann hatte ihm die abschlägige Auskunft erst dann gegeben, nachdem er sich nach seinem Namen erkundigt hatte. Das bedeutete möglicherweise, daß Mrs. Wisher jemanden erwartete.
»Wenn Sie es unbedingt wissen wollen: Es geht um den Termin heute vormittag«, bluffte Smithback. »Leider hat es da eine Änderung gegeben. Wären Sie doch bitte so freundlich und würden Mrs. Wisher für mich anrufen?«
Der Türsteher zögerte einen Augenblick, dann öffnete er die Tür und führte Smithback in die Halle mit ihrem blitzblanken Marmorfußboden. Der Journalist sah sich um. Der Portier, ein sehr hagerer alter Mann, stand hinter einer Bronzekonstruktion, die eher einer Festung als einer Rezeption glich. Weiter hinten in der Halle saß ein Sicherheitsbeamter an einem Tisch im Stil Ludwigs XIV. Neben ihm stand mit leicht gespreizten Beinen ein Liftboy, der die Hände vor der Gürtelschnalle gefaltet hatte.
»Dieser Herr möchte mit Mrs. Wisher sprechen«, erklärte der Türsteher dem Portier.
Der weißhaarige Mann blickte Smithback aus seinem Luxusbunker heraus prüfend an. »Ja?«
Smithback atmete tief durch. Zumindest war er ja nun schon mal bis in die Lobby vorgedrungen. »Es ist wegen der Verabredung heute vormittag. Es hat sich da etwas geändert.«
Der Portier sagte nichts und musterte mit seinen alten Augen Smithback vom Scheitel bis zur Sohle, während der Journalist inständig hoffte, daß sein Aufzug wenigstens halbwegs überzeugend wirkte.
»Wen darf ich melden?« fragte der Portier und räusperte sich.
»Sagen Sie einfach ›ein Freund der Familie‹, das dürfte genügen.«
Ganz offenbar war das dem Portier aber nicht genug, denn er bewegte sich nicht vom Fleck und sah Smithback herausfordernd an.
»Bill Smithback«, erklärte dieser rasch. Er war sich ziemlich sicher, daß Mrs. Wisher nicht zu den Lesern der New York Post zählte.
Der Portier konsultierte seinen Terminkalender. »Geht es um die Verabredung um elf?« fragte er.
»Ja. Ich bin der Ersatzmann«, antwortete Smithback aufs Geratewohl und blickte auf seine Uhr. Zufrieden stellte er fest, daß es zwei Minuten nach halb elf war.
Der Portier drehte sich um und verschwand in einem kleinen Büro, aus dem er eine Minute später wieder auftauchte. »Bitte benutzen Sie das Haustelefon. Es steht auf dem Tisch neben Ihnen.«
Smithback hob ab und hielt den Hörer ans Ohr.
»Was ist los?« fragte eine leise, aber präzise Stimme, der man die Zugehörigkeit zur Oberschicht deutlich anhörte. »Wieso hat George abgesagt?«
»Mrs. Wisher, dürfte ich wohl kurz heraufkommen und mit Ihnen über Pamela sprechen?«
»Wer ist da?« wollte die Stimme nach einer kurzen Pause wissen.
»Bill Smithback.«
Wieder eine Pause, diesmal länger. Smithback sprach weiter: »Ich habe etwas Wichtiges für Sie, eine Information über den Tod Ihrer Tochter, die die Polizei Ihnen bestimmt vorenthalten hat. Ich bin mir sicher, daß Sie …«
»So, Sie sind sich sicher«, unterbrach ihn die Stimme.
»Bitte, hören Sie mich an«, sagte Smithback, während er sich fieberhaft überlegte, was er ihr sagen sollte.
Stille.
»Mrs. Wisher?«
Smithback hörte ein Klicken. Die Frau hatte aufgelegt.
Na ja, dachte Smithback, versucht habe ich es ja wenigstens. Vielleicht sollte er sich draußen auf eine Parkbank setzen und warten, bis die Frau aus dem Haus kam. Aber noch während ihm dieser Gedanke durch den Kopf ging, wurde Smithback bewußt, daß Mrs. Wisher an diesem Tag ihre elegante Wohnung nicht mehr verlassen würde.
Ein Telefon am Tisch des Portiers klingelte, und Smithback, der vermeiden wollte, daß man ihn des Hauses verwies, machte sich schon mal auf den Weg zur Tür.
»Mr. Smithback!« rief der Portier ihm mit lauter Stimme hinterher.
Smithback drehte sich um. Solche Konfrontationen waren es, die ihm seinen Beruf manchmal verhaßt machten.
Der Portier, der den Hörer noch immer am Ohr hatte, sah ihn leidenschaftslos an. »Der Fahrstuhl ist dort drüben.«
»Der Fahrstuhl?«
Der Portier nickte. »Achtzehnter Stock.«
Der Liftboy öffnete zuerst das glänzende Messinggitter des Aufzugs, dann eine schwere doppelflügelige Eichentür, und schließlich stand Smithback in einem Foyer mit pfirsichfarben gestrichenen Wänden, das von Blumenbuketts fast überquoll. Auf einem Tisch türmten sich die Beileidskarten, von denen ein ganzer Stapel noch nicht einmal aus den Kuverts genommen war. Als Smithback am anderen Ende des Foyers eine halb offenstehende Glastür sah, ging er langsam darauf zu.
Hinter der Tür befand sich ein großes Wohnzimmer, in dem Empire-Sofas und eine Chaiselongue genau symmetrisch zueinander auf einem dicken Teppich standen. Eine Wand des Raumes bestand aus einer Reihe hoher Fenster, durch die man normalerweise vermutlich einen spektakulären Blick hinaus auf den Central Park hatte. Jetzt aber waren die Jalousien herabgelassen, so daß das geschmackvoll eingerichtete Zimmer in ein düsteres Halbdunkel getaucht war.
Smithback nahm eine Bewegung links von sich wahr und sah, daß auf einem der Sofas eine zierliche, gepflegte Frau mit perfekt gestylten braunen Haaren saß. Sie trug ein einfaches schwarzes Kleid. Mit einer Handbewegung bedeutete sie Smithback, daß er Platz nehmen solle. Der Journalist entschied sich für einen Ohrenbackensessel direkt gegenüber von Mrs. Wisher. Auf dem niedrigen Couchtisch vor ihm war ein Frühstück für zwei Personen angerichtet. Smithback ließ den Blick über die Teetassen, die Hörnchen, die Marmelade, den Honig und die Butter schweifen und bemerkte mit einem Anflug von Unbehagen, daß die Sachen vermutlich auf jenen George warteten, von dem Mrs. Wisher am Telefon gesprochen hatte und der nun jeden Augenblick erscheinen konnte.
Smithback räusperte sich. »Mrs. Wisher, zunächst möchte ich Ihnen mein tief empfundenes Beileid zum Tod Ihrer Tochter aussprechen«, sagte er.
Während er sprach, bemerkte er zu seinem eigenen Erstaunen, daß er seine Worte tatsächlich ernst meinte. Der Anblick dieses eleganten Raumes und die Erkenntnis, wie wenig all der Wohlstand angesichts einer wirklichen Tragödie bedeutete, machten ihm mit einemmal überdeutlich, welchen Verlust die Frau vor ihm erlitten hatte.
Mrs. Wisher hatte die Hände im Schoß gefaltet und sah ihn mit ruhigem Blick an. Smithback glaubte, ein kaum wahrnehmbares Nicken ihres Kopfes zu sehen, war sich in dem trüben Licht jedoch nicht sicher. Dann wollen wir mal, dachte er und drückte auf den Aufnahmeknopf seines Diktiergeräts.
»Schalten Sie das Tonband wieder aus«, sagte Mrs. Wisher mit leiser, nur leicht gestreßt klingender Stimme, die eine bemerkenswerte Autorität ausstrahlte.
Smithback zog die Hand ruckartig aus der Tasche. »Tut mir leid.«
»Wären Sie vielleicht so freundlich, das Gerät aus Ihrer Tasche zu nehmen und hier auf den Tisch zu legen? Dann kann ich mich selbst davon überzeugen, ob es auch wirklich ausgeschaltet ist.«
»Aber natürlich«, stammelte Smithback und zog das Gerät aus dem Jackett.
»Haben Sie denn gar keinen Anstand?« flüsterte Mrs. Wisher.
Während Smithback das Diktiergerät auf den Couchtisch legte, brannten ihm die Ohren vor Scham.
»Wie können Sie mir nur Ihr Beileid aussprechen und gleich darauf dieses widerliche Ding da einschalten? Und Sie habe ich auch noch in meine Wohnung eingeladen!«
Smithback rutschte unbehaglich in seinem Stuhl herum und vermied es, der Frau in die Augen zu schauen. »Es tut mir leid«, murmelte er. »Das … das ist nun mal mein Job.« Die Worte kamen ihm selbst merkwürdig vor.
»Und ich habe kürzlich mein einziges Kind verloren. Auf wen, glauben Sie, sollte man in so einem Fall mehr Rücksicht nehmen?«
Smithback schwieg und zwang sich, Mrs. Wisher in die Augen zu schauen. Sie saß noch immer mit gefalteten Händen unbeweglich auf ihrem Sofa und sah Smithback unverwandt an. Die Intensität ihres Blickes hatte einen merkwürdigen Effekt auf Smithback. Das Gefühl war so ungewohnt für ihn, daß er es fast nicht akzeptiert hätte. Zum erstenmal in seiner journalistischen Karriere war ihm etwas zutiefst peinlich. Mehr noch, er schämte sich für das, was er getan hatte. Wenn er sich zu der Frau mit allen Mitteln durchgekämpft hätte, wäre es vielleicht etwas anderes gewesen. Aber sie hatte ihn freiwillig zu sich heraufgebeten, und er hatte ihre Trauer ausgenutzt … Auf einmal war das Hochgefühl, das er sonst immer bei einer großen Geschichte empfand, völlig verflogen.
Mrs. Wisher hob eine Hand und deutete mit einer sanften Bewegung auf ein kleines Tischchen neben ihrem Sofa.
»Ich nehme an, Sie sind der Mr. Smithback, der für dieses Blatt hier schreibt.«
Als Smithback auf dem Tischchen die neueste Ausgabe der New York Post entdeckte, sank ihm das Herz in die Hose.
»Ja«, gab er kleinlaut zu.
Mrs. Wisher faltete wieder die Hände. »Ich wollte mich nur vergewissern. Und jetzt teilen Sie mir bitte diese wichtige Information über den Tod meiner Tochter mit. Oder halt, besser doch nicht. Vermutlich war das ohnehin nur ein Vorwand, um sich hier einzuschleichen.«
Smithback schwieg und hoffte fast, daß der für elf Uhr angekündigte George endlich erscheinen würde. Alles wäre ihm jetzt recht gewesen, um der Gegenwart dieser Frau zu entfliehen.
»Wie schaffen Sie es nur?« fragte Mrs. Wisher nach einer langen Pause.
»Wie schaffe ich was?«
»Wie erfinden Sie all diesen fürchterlichen Mist? Genügt es denn nicht, daß meine Tochter ermordet wurde? Müssen da auch noch Schmierfinken wie Sie ihr Andenken besudeln?«
Smithback schluckte schwer. »Mrs. Wisher, ich …«
»Wenn man diesen Dreck hier liest, dann möchte man meinen, meine Pamela sei nichts weiter gewesen als ein selbstsüchtiges Society-Häschen, um das es nicht weiter schade ist. Sie schreiben so, daß Ihre Leser Schadenfreude über ihren Tod empfinden. Warum tun Sie das?«
»Mrs. Wisher, die Menschen in dieser Stadt nehmen etwas erst dann wahr, wenn man es ihnen um die Ohren haut«, begann Smithback, hielt aber inne, als er bemerkte, daß Mrs. Wisher ihm seine Rechtfertigung genausowenig abnahm wie er selbst.
Langsam beugte sich die Frau nach vorn. »Sie wissen nichts von Pamela, Mr. Smithback, absolut nichts«, flüsterte sie. »Alles, was Sie sehen, ist die äußere Fassade. Aber für etwas anderes interessieren Sie sich ja offenbar sowieso nicht.«
»Das ist nicht wahr!« platzte Smithback heraus. Die Heftigkeit seiner Reaktion überraschte ihn. »Ich meine, ich interessiere mich schon für etwas anderes. Ich möchte gern die wahre Pamela Wisher kennenlernen.«
Die Frau sah ihn lange an, dann stand sie auf und verließ das Zimmer. Einen Augenblick später kam sie mit einem gerahmten Foto zurück, das sie Smithback reichte. Es zeigte ein etwa sechsjähriges Mädchen, das mit schwingenden Zöpfen und fliegender Schürze auf einer von einer mächtigen Eiche herabhängenden Schaukel saß. Es lachte in die Kamera, und Smithback sah, daß zwei seiner Vorderzähne fehlten.
»Das ist die Pamela, an die ich mich mein Leben lang erinnern werde, Mr. Smithback«, sagte Mrs. Wisher mit neutraler Stimme. »Wenn Sie wirklich daran interessiert sind, wer sie war, dann drucken Sie dieses Bild und nicht das, auf dem sie wie ein hirnloses Partygirl aussieht.« Mrs. Wisher setzte sich auf und strich ihr Kleid über den Knien glatt. »Pamelas Vater ist vor sechs Monaten gestorben, und sie war gerade dabei, wieder ein wenig Freude am Leben zu finden. Ist es denn verwerflich, daß sie sich ein bißchen amüsieren wollte, bevor sie im Herbst mit ihrer Arbeit begann?«
»Was wollte sie denn arbeiten?« fragte Smithback.
Wieder breitete sich in dem düsteren Raum eine unangenehme Stille aus, in der Mrs. Wisher Smithback abermals eingehend musterte. »In einem Hospiz für Aidskranke, Mr. Smithback. Aber das hätten Sie auch selbst herausfinden können, wenn Sie etwas gründlichere Recherchen angestellt hätten.«
Smithback schluckte betreten und schwieg.
»So war die wirkliche Pamela«, sagte Mrs. Wisher, deren Stimme auf einmal brach. »Freundlich, großzügig, voller Leben. Ich möchte, daß Sie über diese Pamela schreiben, Mr. Smithback.«
»Ich werde mein Bestes tun«, murmelte der Journalist betreten.
Dann war der Augenblick der Schwäche vorbei, und Mrs. Wisher zeigte sich wieder so gefaßt und distanziert wie zuvor. Als sie ihr Gesicht abwandte und mit der Hand wedelte, erkannte Smithback, daß er entlassen war. Er bedankte sich für das Gespräch, nahm sein Diktiergerät und entfernte sich so rasch, wie er es für schicklich hielt, in Richtung Aufzug.
»Eines noch«, rief Mrs. Wisher ihm hinterher. Ihre Stimme klang auf einmal schneidend hart. Smithback, der schon an der Glastür war, drehte sich noch einmal um. »Die Polizei kann mir zwar nicht sagen, wann, wie und warum meine Pamela gestorben ist. Aber eines weiß ich genau: Sie ist nicht umsonst gestorben. Das verspreche ich Ihnen.«
Die Überzeugung, mit der sie das sagte, ließ Smithback einen Schritt zurück in ihre Richtung machen.
»Wie haben Sie sich vorhin gleich wieder ausgedrückt?« fuhr Mrs. Wisher fort. »›Die Menschen in dieser Stadt nehmen etwas erst dann wahr, wenn man es ihnen um die Ohren haut.‹ Nun, Mr. Smithback, genau das habe ich vor. Ich werde den Menschen dieser Stadt den Tod meiner Tochter um die Ohren hauen.«
»Und wie?« wollte Smithback wissen, aber Mrs. Wisher hatte sich wieder zurückgelehnt, so daß er ihr Gesicht nicht mehr erkennen konnte. Als sie ihm keine Antwort gab, ging er durch das pfirsichfarbene Foyer und drückte den Knopf des Fahrstuhls. Er fühlte sich müde und ausgelaugt. Erst als er wieder unten auf der Straße war, wo ihn die grelle Sommersonne die Augen zukneifen ließ, bemerkte er, daß er das Kinderbild von Pamela Wisher noch immer in der Hand hielt. Langsam begann ihm zu dämmern, was für eine außergewöhnliche Frau die Mutter dieses toten Mädchens doch war.
5
Die Metalltür am Ende des graugestrichenen Ganges war mit schablonengeschriebenen Großbuchstaben als »Forensische Anthropologie« gekennzeichnet. Dahinter verbarg sich das hochmoderne Labor zur Untersuchung von Knochen und anderen menschlichen Überresten. Zu ihrem Erstaunen fand Margo die Tür verschlossen. Seltsam, dachte sie, denn sie war schon unzählige Male hier gewesen und hatte bei der Analyse von peruanischen Mumien oder von Knochen der Anasazi-Indianer mitgeholfen. Niemals war bislang die Tür abgesperrt gewesen. Gerade als Margo die Hand hob, um zu klopfen, wurde die Tür von innen geöffnet, so daß ihr Fingerknöchel in die Luft stieß.
Sie trat ein und blieb abrupt stehen. Das Labor, das normalerweise hell erleuchtet war und von Doktoranden und Assistenzkuratoren nur so wimmelte, war in eine merkwürdige Dunkelheit getaucht. Vor die Fenster, die normalerweise einen herrlichen Rundumblick auf den Central Park boten, hatte man schwere Vorhänge gezogen, so daß die Elektronenmikroskope, die Röntgengeräte und die großen Apparate zur Elektrophorese in dem dämmrigen Licht nur als düstere Schatten an der hinteren Wand des Labors zu erahnen waren.
Lediglich der Labortisch in der Mitte des Raumes war von starken Halogenlampen hell erleuchtet. Auf dem Tisch sah Margo ein menschliches Skelett ohne Kopf, dessen braune Knochen noch von zusammengeschrumpften Bändern und Sehnen zusammengehalten wurden. Daneben lag unter einer blauen Plastikplane ein länglicher Gegenstand von etwa derselben Größe. Erst jetzt fiel Margo auf, daß ein schwacher, aber unverkennbarer Leichengeruch den Raum erfüllte.
Sie hörte, wie jemand hinter ihr die Tür schloß und absperrte. Lieutenant Vincent D’Agosta, der ihr geöffnet hatte, nickte ihr kurz zu und ging dann zurück zu der Personengruppe, die sich um den Tisch herum versammelt hatte. D’Agosta trug denselben Anzug, den er schon bei der Untersuchung der Museumsmorde vor eineinhalb Jahren angehabt hatte und dessen Braun der Farbe des Skeletts auf dem Labortisch nicht unähnlich war. Seit Margo ihn zuletzt gesehen hatte, schien der Lieutenant ein paar Kilo abgenommen zu haben.
Nachdem Margos Augen sich an das schwache Licht gewöhnt hatten, besah sie sich die Anwesenden: links von D’Agosta stand ein nervös wirkender Mann in einem weißen Laborkittel, der in seiner fleischigen Hand eine Tasse Kaffee hielt. Neben ihm erkannte sie die große hagere Gestalt von Olivia Merriam, der neuen Direktorin des Museums. Weiter hinten in der Dunkelheit befand sich noch eine Gestalt, deren Gesicht Margo aber nicht erkennen konnte.
Die Direktorin wandte sich mit einem matten Lächeln an Margo. »Danke, daß Sie gekommen sind, Dr. Green. Der Lieutenant hier« – damit deutete sie in Richtung auf D’Agosta – »hat darum gebeten, daß Sie zu dieser Untersuchung hinzugezogen werden.«
Danach sagte niemand etwas, bis D’Agosta gereizt meinte: »Wir können jetzt nicht mehr länger auf ihn warten. Er wohnt irgendwo weit draußen in Mendham, und als ich ihn gestern abend anrief, hatte er keine allzu große Lust, in die Stadt herein zu fahren.« D’Agosta blickte in die Runde der Anwesenden. »Sie haben heute morgen ja sicher die Post gelesen.«
»Ich lese solche Blätter grundsätzlich nicht!« protestierte die Direktorin.
»Dann werde ich kurz noch einmal zusammenfassen, worum es hier geht«, sagte D’Agosta und deutete auf das Skelett. »Darf ich vorstellen: Pamela Wisher, die Tochter von Anette und dem verstorbenen Horace Wisher. Bestimmt haben Sie in den letzten Wochen ihr Bild gesehen. Es hing überall in der Stadt. Pamela verschwand am 23. Mai um drei Uhr früh, nachdem sie den Abend im Whine Cellar verbracht hatte, einer Kellerdisco in der Nähe des Central Park South. Sie verließ die Tanzfläche, um ein Telefonat zu machen, und seitdem wurde sie nicht wieder gesehen. Bis gestern, genauer gesagt, als wir sie aus dem Humboldt Kill fischten. Offenbar hat sie der Wolkenbruch vor ein paar Tagen aus dem Entwässerungssystem der Upper West Side gespült.«
Margo blickte hinüber zu den Knochen auf dem Tisch. Sie hatte in ihrem Leben zwar schon unzählige Skelette gesehen, aber nie eines von einem Menschen, dessen Namen sie gekannt hatte. Es war schwer zu glauben, daß dieses grausige Knochengerüst einmal die hübsche blonde Frau gewesen sein sollte, von der sie noch vor ein paar Minuten in der Zeitung gelesen hatte.
»Und zusammen mit den sterblichen Überresten von Pamela Wisher haben wir das hier gefunden.« D’Agosta nickte in Richtung auf die blaue Plastikfolie. »Die Presse weiß bisher nur, daß es noch ein zweites Skelett gibt – Gott sei Dank.« Er blickte hinüber zu der Gestalt im Schatten. »Alles weitere soll Ihnen Dr. Simon Brambell, der Oberste Gerichtsmediziner der Stadt New York, erzählen.«
Als Brambell ins Licht trat, sah Margo einen schlanken glatzköpfigen Mann von ungefähr fünfundsechzig Jahren. Er musterte sie wie alle anderen auch mit dunklen Augen, die durch die Gläser seiner altmodischen Hornbrille noch kleiner wirkten, als sie ohnehin schon waren. Sein längliches Gesicht ließ keinerlei Gefühlsregung erkennen.
Brambell legte einen Finger an seine Oberlippe. »Treten Sie doch bitte etwas heran«, sagte er mit einem weichen irischen Akzent, »dann sehen Sie besser, was ich Ihnen gern zeigen möchte.«
Nachdem die Anwesenden zögerlich der Aufforderung gefolgt waren, ergriff Dr. Brambell einen Zipfel der blauen Folie und zögerte noch einen Augenblick, wobei er wie unbeteiligt in die Runde blickte. Dann zog er die Folie mit einem entschlossenen Ruck weg.
Darunter kam ein weiteres, ebenfalls kopfloses Skelett zum Vorschein, dessen Knochen dieselbe braune Farbe aufwiesen wie die von Pamela Wisher. Schon auf den ersten Blick kam das Skelett Margo ziemlich seltsam vor, aber erst nach einer Weile wurde ihr der Grund bewußt, und sie hielt den Atem an: Die überdimensional verdickten Beinknochen, die bizarren Verformungen der Gelenke – nichts war so, wie es sein sollte.
Was hatte das zu bedeuten?
Auf einmal klopfte es an der Tür.
»Na endlich«, knurrte D’Agosta und ging aufmachen. »Es wurde aber auch Zeit.«