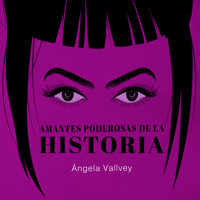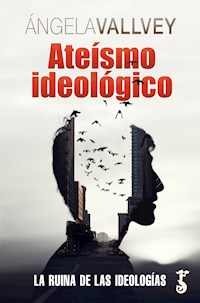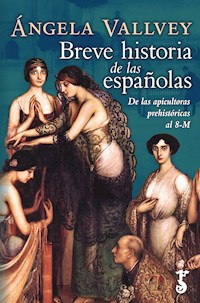3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Mach dich locker, sagt sich Candela, dann kriegst du alles. Den gut gebauten Lover, das fette Startkapital und die Antwort auf alle Fragen. Candela jobbt im Bestattungsinstitut und sucht nach dem Sinn des Lebens. Finden tut sie eine Stange Rohdiamanten – dummerweise jedoch an einer Leiche. Wenn bloß der Sohn des Verblichenen nicht so verdammt lebendig und appetitlich wäre ... Eine exzentrische Komödie am Rand des Nervenzusammenbruchs. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 305
Ähnliche
Angela Vallvey
Auf der Jagd nach dem letzten wilden Mann
Roman
Aus dem Spanischen von Elisabeth Müller
FISCHER Digital
Inhalt
Für diese und alle anderen Mädels
1
Sie suchen mich, jetzt, in diesem Augenblick, um mir die Kehle aufzuschlitzen. Ich bin sicher, dass mir dort draußen irgendwo eine kleine, mit Spritzen voller Aids, mit gewetzten Klingen und lauter bösen Absichten bewaffnete Armee von Bekloppten auflauert, die nach mir fahndet wie nach der verschollenen Bundeslade. Na super. Eigentlich sollte ich schon mal die Location für meine Bestattungszeremonie suchen oder besser: ein Loch, in dem ich mich verkriechen kann, bis alles vorbei ist; aber stattdessen sitze ich immer noch hier herum und höre mir das Gejammer einer Heulsuse an, die seit unserer Kindheit behauptet, meine Schwester zu sein. Dabei sind wir womöglich nicht einmal blutsverwandt. Wir sind uns nämlich in nichts ähnlich.
Trotz meiner Panik und ihres Gejammers sehe ich sie zärtlich an, als wenn ich nicht anders könnte. Schließlich ist sie meine Lieblingsschwester.
Entspann dich, Mädchen, sage ich mir. Schüttle die ganzen schlechten Energien, die du da mit dir herumschleppst, einfach ab wie Schuppen, die einem vom Kopf fallen und am Sofa kleben bleiben. Entspann dich, Mädchen.
»Was für eine merkwürdige Sache dieses Leben doch ist«, sagt meine Schwester Gádor.
»Im Vergleich zu was?«, frage ich murmelnd.
Sie denkt nach, aber ich fürchte, sie wird dabei nicht allzu weit kommen, weil sie sich jedes Mal verläuft, wenn man mit ihr nicht die gewohnten Wege geht, und den hier kennt sie noch nicht.
Ich hasse es, wenn die Leute anfangen vom Leben zu reden, weil mich das unweigerlich an den Tod erinnert; ein Thema, das ich aus nahe liegenden Gründen – wenn auch ziemlich erfolglos – meide und dem ich mich erst ganz zum Schluss, wenn mir keine andere Wahl mehr bleibt, endgültig zu stellen bereit bin. Vorläufig ist der Tod für mich nichts anderes als eine Möglichkeit, meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber gegen meinen natürlichen Widerstand, mich mit dieser lästigen Materie auseinander zu setzen, nötigt Gádor mich zu ein paar flüchtigen Gedanken über Leben und Tod.
Beim Anblick des Nervenbündels, das aus meiner Schwester geworden ist – meine schwangere, verzweifelte, todunglückliche, traurige Schwester –, mit vom Heulen verquollenen Augen, eine Hand beinah unabsichtlich über den eigenen Bauch streichelnd, drängen sich mir Tod und Leben regelrecht auf. Und wenn ich bedenke, dass mir vermutlich ein ganzer Trupp Zigeuner auf den Fersen ist, die mir am liebsten den Hals umdrehen würden … komme ich unweigerlich ins Grübeln.
Jemand hat einmal behauptet, beide Zustände seien gleich, Leben und Tod, es gebe keinen Unterschied. »Und wieso lebst du dann noch und bringst dich nicht gleich um?«, wurde er darauf gefragt. »Weil es nichts ändern würde«, lautete die Antwort.
Ich persönlich versuche, mich in dieser Sache an die Ratschläge von Epikur zu halten: Fürchte den Tod nicht, so wirst du auch das Leben nicht fürchten. Der Tod kann mir nichts anhaben, weil ich ja lebendig bin. Und wenn ich mal tot bin … dann kann er mir erst recht egal sein.
Das sage ich mir immer wieder, aber irgendwie überzeugt es mich nicht.
Mir zittern die Knie, ich schwitze. Ich wusste nicht mehr, dass ich schwitzen kann. Als wir klein waren, hat Gádor immer zu mir gesagt, ich sei so vornehm, dass ich weder schwitzen noch pupsen könne. Und anscheinend war das wirklich so.
»Warum ist alles so seltsam, Candela?«, bohrt Gádor weiter.
»Schon gut, ich glaube, du solltest dich erst mal beruhigen.«
»Aber, ich ertrage das Leben nicht mehr …« Sie sieht wirklich geknickt aus und schrecklich niedergeschlagen. »Die Welt ist einfach Scheiße …«
Damit bin ich nicht einverstanden. Ich glaube nämlich trotz allem an die »mundus optimus«, dass unsere Welt die beste aller möglichen Welten ist. Aber ob das jetzt, in dem Augenblick, da ich es denke, ein großer Trost ist, weiß ich auch nicht.
Ich versuche sie zu beruhigen, dabei bräuchte ich selbst jemanden, bei dem ich mich ausheulen kann. Doch ich beschließe, das für mich zu behalten und nichts zu erwarten, was ich selbst nicht geben kann. »Mensch, Candela … red doch nicht so einen Blödsinn«, antwortet meine Schwester unter Schluchzen. »Wenn das hier die beste aller möglichen Welten ist, wie sollen denn dann die anderen Möglichkeiten ausgesehen haben …? Lauter beschissene Möglichkeiten …! Das klingt, als sollte ich mich freuen, weil ich im Lotto einen Kopfschuss gewonnen habe!«
»Vielleicht gibt es in Wahrheit überhaupt keine Möglichkeiten und wir sollten mehr als zufrieden sein und …« Ich sehe sie liebevoll an, aber Gádor scheint nicht zu verstehen. »Also, Tatsache ist, dass wir nun mal hier sind, oder? Hör einfach auf zu flennen, das ist alles, was du zu tun hast.«
»Ja, für dich ist das natürlich alles ganz einfach. Du bist ja auch nicht schwanger. Aber ich!«
»Moment mal … Jetzt mach aber mal halblang!« Ich werde nervös und gerate ins Stocken. »Ich hab dich schließlich nicht geschwängert, okay? Also lass das jetzt bitte nicht an mir aus, kapiert?«
»Uhhhhh! Ja genau! Jetzt schrei du mich auch noch an!«
»Beruhige dich, ganz ruhig, ich schreie ja nicht, ich schreie nicht!«, entgegne ich – schreiend.
»Gib mir eine Serviette, nein, nicht die! Ich will mir die Nase putzen!« Sie deutet nacheinander auf verschiedene Stellen im Zimmer und ich gehe bereitwillig auf die Suche nach allem, was sie verlangt. »Hol mir die Klorolle. Die tut es auch.«
Sie schneuzt sich geräuschvoll und scheint sich etwas zu beruhigen.
»Wenn ich wenigstens eine Arbeit hätte!«, wimmert sie. »Nicht etwa, dass ich Lust hätte zu arbeiten, nur damit ich mal raus komme … Aber da wir ja alle von der Sozialhilfe leben … So ist das wohl heutzutage.«
»Stimmt … ja.«
»Weißt du noch in der Schule? Wenn sie mich nach Vaters Beruf gefragt haben, dann habe ich immer ›Arbeiter‹ hingeschrieben. Damals galt das noch etwas, ja, es galt etwas, es galt viel. Aber heute … Ich, ich …«, sie fängt wieder wie ein Welpe zu winseln an, »ich wäre auch eine Super-Arbeiterin, wenn ich nur eine Stelle hätte. Nur damit du Bescheid weißt.«
Ich betrachte sie aufmerksam, und es kommt mir völlig unwirklich vor, dass dieser Tittenberg unter dem alten blauen Schlabberpulli voller Knötchen und gezogener Fäden meine Schwester sein soll.
Zeit ist etwas Obszönes, vor allem, wenn man schon eine Menge davon verloren hat. Den meisten von uns geht es dabei wie den Uhren: Wir verstehen uns nur aufs Zeitverlieren. Gádor vorneweg. Früher war sie ein niedliches Kind mit strammen Beinchen und einer delikaten Sommersprossenhaut, aber inzwischen kann ich noch nicht mal mehr sagen, wie eigentlich ihre natürliche Haarfarbe war. Ich betrachte sie eingehend. Zur Zeit ist es jedenfalls ein unmögliches, ins Kupferne stechende Rot, das eher wie eins dieser Zauberfarbbäder für Klamotten aussieht. Sie wechselt so häufig die Haarfarbe, dass es einem manchmal von einem auf den anderen Tag schwer fällt, sie von hinten auf der Straße wieder zu erkennen.
Trotz dieses Anblicks spüre ich, dass ich Gádor von ganzem Herzen lieb habe. Eine Sau ist für eine andere Sau eben wunderschön. Ich liebe ihr Schweinchengesicht und ihren Geruch, ihre Verzweiflung und die Fältchen, die sich allmählich wie ein Heer von Belagerern um ihre Augen formieren. Außerdem hat sie mir einen ganz vorzüglichen Wein serviert, den sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht selber eingekauft hat. Im Augenblick fühle ich mich mit meinem Schwesterlein als Teil des Universums vollkommen eins.
Wenn wir aber die Teile des verfluchten Universums zerlegen, dann ist es mit dem Universum vorbei.
Ich versuche auf dem durchgesessenen Sofa dieses Arbeiterwohnzimmers, dieses Wohnzimmers eines Arbeiters-mit-Drang-zur-unteren-nicht-aber-untersten-Mittelklasse, eine vornehme Sitzhaltung einzunehmen.
»Demokrates riet vom Kinderkriegen ab.« Ich nehme einen Schluck von meinem Wein und genieße die angenehme Wärme des Alkohols und das wohlige Kitzeln im Magen.
Gádor stimmt mir mit kläglichem Ton zu, obwohl sie den Genannten mit größter Wahrscheinlichkeit nicht kennt.
»Ja …«, sagt sie gedehnt und wie aus der Versenkung; wahrscheinlich denkt sie, es wäre die Rede von irgendeinem Arzt, der im Fernsehen auftritt, und findet es unverzeihlich, dass ihr nicht einfällt, in welcher Sendung.
»Du hast schon eine Tochter. Du hättest ja nicht noch eins zu kriegen brauchen.« Sie schluckt wieder und ich werde nervös, ich meine, noch nervöser, als ich ohnehin schon bin. »Schon gut, ich mag dich, Gádor. Vielleicht tröstet dich das ja.«
»Na ja. Tut mir Leid. Ja, klar … Ich weiß das, danke … ich … weißt du … ich mag dich auch.«
Es ist gut, eine Frau zu sein und ohne allzu große Umschweife seine Gefühle ausdrücken zu können. Wenn es darum geht, seine sozialen Verdienste materiell umzusetzen, ist es zwar keine müde Pesete wert, aber immerhin erlaubt frau sich den Luxus, ihren Emotionen freien Lauf zu lassen und ihr unsägliches Glück oder ihr größtes Unglück aller Zeiten einfach herauszusprudeln, ganz gleich, ob es ankommt oder nicht. So bleibt das Lächerliche wenigstens erträglich.
Ich lege einen Arm um Gádor und sie flüchtet sich an meinen Busen. Sie fühlt sich kühl, sonderbar weich und auf eine Weise nachgiebig an, dass sich im ersten Moment eine gewisse Abwehr in mir regt, doch schon im nächsten wiege ich sie, von ihrem Geruch und ihrer Bedürftigkeit eingenommen, in meinen Armen. Ich plappere ihr allerlei dummes Zeug vor, lauter sentimentales Gewäsch in meinen Ohren, das aber bei Gádor eine heilsame Wirkung nicht zu verfehlen scheint.
Nach diesem Augenblick intensivster Gefühle richten wir uns auf dem Sofa ein wie ein altes Liebespaar nach der Versöhnung, das sich anschickt, einen weiteren langweiligen Abend vor dem Fernseher zu verbringen. Es verschafft mir eine gewisse Erleichterung, meine Schwester endlich aus der Umarmung entlassen zu dürfen, aber gleichzeitig bleibt ein Bodensatz der Nostalgie nach den mütterlichen Armen und nach der Wärme ihres Körpers in mir zurück.
Wir starren in den Fernseher, der leise gestellt ist, damit das Kind im Schlafzimmer nebenan nicht aus dem Mittagsschlaf gerissen wird. Der Film, »Geboren am 4. Juli«, geht gerade zu Ende. Wir haben seine Handlung nur streckenweise verfolgt, immer dann, wenn wir in unserem eigenen Drama noch ein wenig Aufmerksamkeit für die Mattscheibe erübrigen konnten. Ich bin froh, dass er zu Ende ist, weil Tom Cruise ohne Penis wirklich eine scheußliche Vorstellung ist!
Zugegeben, Gádors Mann Víctor war noch nie mein Fall. Diese ratzekahl geschorenen Haare und dann dieser permanente, flüchtige Seitenblick, so mechanisch wie bei anderen das Zwinkern. Aber nach dem vorangehenden Gespräch mit meiner Schwester schwanken meine Gefühle für ihn zwischen einer resignierten Akzeptanz biologischer Vielfalt und einer unbändigen Vorfreude angesichts der Worte der Apokalypse, dass das Ende nahe ist und es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird.
»Und damit nicht genug«, fährt Gádor fort. »Das Schlimmste ist, dass er so ein verfluchter Geizhals ist; das kannst du dir nicht vorstellen! Ich weiß nicht, was er mit dem Geld anstellt, denn ich darf nicht einmal daran riechen. Er hat in dieser Firma gearbeitet, du weißt doch, die von dem Typen mit dem Jaguar, der sich mit der Tochter von Josefa vom Fischgeschäft eingelassen hat. Eine Baufirma, die echt nicht schlecht geht. Er war da fast ein Jahr als Geschäftsführer. Seit der Vertrag abgelaufen ist, kassiert er Arbeitslosengeld, und außerdem schiebt ihm diese alte Zicke von seiner Mutter jeden Monat Geld zu. Und trotzdem … mein Gott, wir gehen in den Supermarkt, alle beide zusammen, weil er ja unsere Ausgaben beaufsichtigen muss, und er zwingt mich, ein Bier zu kaufen, das aussieht wie Ziegenpisse. ›Kauf das hier, das ist im Angebot‹, sagt er, ›vergiss das Mahous. Dieses kostet nur zwanzig pro Flasche.‹ ›Zwanzig Peseten pro Flasche!?‹, frage ich den Tränen nahe, ›und was glaubst du, wo das abgefüllt wird? Wahrscheinlich direkt in diesem gottverdammten Tschernobyl …!‹«
»Das Problem, also … Ich glaube, das Problem ist, dass er letztendlich zu den Kerlen gehört, die den Arsch da haben, wo bei anderen das Gehirn liegt«, sage ich verständnisvoll zu Gádor. »Aber kümmere dich nicht mehr darum, pack deine Sachen und komm mit nach Hause.«
»Nie, nie durfte ich ein anständiges Bier trinken oder mir per Telefon eine Pizza bestellen, ich habe ja noch nicht mal ein Telefon! Er, ja er hat natürlich eins, sein Handy. Selbstverständlich. Es klebt ihm wie mit Kontaktkleber oder sonst was am Gürtel fest, und nichts und niemand kann ihn von dem Ding trennen, als wäre es ein Schlüsselbund oder eine Kruste am Hosenlatz. Ich habe ihn gefragt, wofür er eigentlich ein Handy braucht, wo er doch arbeitslos ist und wir kaum unsere Rechnungen bezahlen können und ich es ja ohnehin nicht benutzen darf, aber Víctor sagt, dass er so erreichbar wäre und basta. Weißt du, so ist es mit allem … Ich habe mir nicht eine einzige anständige Unterhose kaufen können, seit ich verheiratet bin, oder eine vernünftige Tagescreme, immer alles nur bei den Schwarzen auf dem verdammten Fußboden im Markt von Benimaclet …« Sie weist zum Balkon, von wo ein weiches Licht durch die dicken, geschmacklosen cremefarbenen Gardinen fällt. »Die Geranien auf dem Balkon, Scheiße! Guck dir nur mal die Geranien an! Sie lassen die Köpfe hängen, als ob sie sich runterstürzen wollten; und alles nur, weil dieser Mistkerl findet, dass Dünger Geldverschwendung ist. Er hat mir sogar allen Ernstes angeboten, selber auf die Blumen zu scheißen, wenn sie doch nichts weiter bräuchten als ab und zu ein bisschen Scheiße, um ordentlich zu gedeihen.«
»Erinnerst du dich an Papa?«
»Ja«, antwortet sie ernst und kräuselt verträumt die Lippen. »Papa, ja, das war ein Mann! Und er hatte ein gutes Herz.«
»Na ja, schade nur, dass er es zwischen Leber und Hosenlatz hatte.«
»Pah! Das sind doch Kleinigkeiten. Ich würde Papa allemal Víctor vorziehen, und all den anderen überflüssigen Kerlen, die ich im Laufe meines Lebens kennen gelernt habe, auch. Die sind nur gut für … gar nichts. Gut für gar nichts, genau.« Sie grübelt darüber nach, dabei betrachtet sie ihre Hände. »Mit den Kerlen, weißt du, ist es mir immer so ergangen wie mit den Pfirsichen: Ich habe große Lust darauf, prüfe alle mit den Fingern und erwische am Ende doch den sauersten.«
»Soll ich dir beim Packen helfen?«
Gádor lehnt sich an ein Sofakissen und reibt sich die Nieren, als täten sie ihr weh.
»Eine riesengroße Scheiße, dieses Leben. Man wird geboren, wächst, pflanzt sich fort und stirbt … Reine Energieverschwendung. Was wird denn aus der ganzen Energie, wenn man abkratzt?«
Ich sehe sie an, weigere mich aber, etwas darauf zu erwidern. Woher zum Teufel soll ich denn das wissen, ich bin noch nie gestorben …
»Weißt du das, Candela? Na ja, schließlich hast du doch jeden Tag mit Leichen zu tun.«
»Nicht jeden Tag.«
»Na schön, aber fast jeden, oder?«
»Wenn du meinst …« Ich bin dieses Thema leid. Ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll, damit sie mich ein für alle Mal damit in Ruhe lassen. Ich rede meinetwegen über Boxen oder die Foxschen Mikrosphären, aber nicht darüber.
»Was ist los? Läuft das Geschäft nicht mehr so gut?«
»Lass uns jetzt lieber die Sachen packen, bevor dein Mann kommt.«
»Mein Ex-Mann«, verbessert sie mich, als hätte sie schon die Scheidungspapiere in der Hand. »Keine Sorge, wir brauchen uns nicht zu beeilen. Er ist nämlich bei seiner bescheuerten Mutter, die Arthrose hat. Er besucht sie, weil er arbeitslos ist. Er kommt erst in zwei, drei Tagen wieder.«
Sie erhebt sich schwerfällig. Sie ist im achten Monat und ihr Rücken biegt sich nach hinten, um ein Gegengewicht zu bilden. Aller Wahrscheinlichkeit nach war der erste Affe, der auf der Erde den aufrechten Gang einübte, gar kein Affe, sondern eine schwangere Äffin, die sich aufgerichtet hat, um den unerträglichen Druck auf ihre gepeinigten Nieren zu lindern, und damit einen kleinen Schritt für den Menschen und einen großen für die Menschheit tat.
Gádor ist sechsundzwanzig und auch eine Frau der Neunziger, obwohl sie kein Hip Hop hört, keine Performances macht, nicht mit dem Fahrrad durch Indien gefahren ist, nicht daran glaubt, dass sie etwas Besonderes ist und auch nie irgendeinen MBA machen oder in einer Event-Agentur arbeiten wird, obwohl sie sich nicht wie ein kleines Kind behandeln lässt und auch nicht weiß, wie Freud die Tragödie von Ödipus interpretierte, ja noch nicht einmal weiß, dass sich der alte Wiener überhaupt dem Theater widmete. Sie hat Wasser in den Beinen und trägt einen Streifenrock bis über die Knie.
»Ich bin erst sechsundzwanzig, Scheiße, und habe schon alles hinter mir: geboren werden, wachsen, mich fortpflanzen … Was bleibt mir da noch zu tun? Ich kann es mir vorstellen, ja, ich kann mir vorstellen, dass es …«
»… nach Hause kommen ist«, sage ich. »Ein bisschen leben. Deine Tochter großziehen und das Kind, das unterwegs ist … Du hättest es ja abtreiben können, wenn du nicht sicher warst, ob du es wirklich willst«, sage ich wenig überzeugt.
»Abtreiben?« Sie wehrt mit einer Handbewegung ab, als wäre dieser Gedanke für ihr kleines Köpfchen unvorstellbar, das nicht in der Lage ist, überhaupt so viele Gedanken zu fassen. »Das hätte ich nicht gekonnt. Ich habe es schon im zweiten Monat in meinem Bauch hüpfen gespürt, die springen wie lebendige Erdnüsse … Das wäre ja, als wollte man eine Schnecke aus ihrem Haus vertreiben, aber eine menschliche. Es steht nirgends geschrieben, dass eine Schnecke nur zur Miete wohnt oder Miete zahlen muss, und auch nicht wem. Außerdem ist es dafür viel zu spät. Das fehlte noch, dass ich jetzt, wo ich weiß, dass es ein Junge wird und er Rubén heißen wird, zum Arzt gehe und ihm sage, er soll ihn mir wegmachen, weil ich mir nicht vorstellen kann, ihn nächsten Monat zu kriegen.«
»Na ja … Wie du meinst. Rubén?«
»Ja, der Name gefällt Víctor und mir sehr. Inzwischen ist es mir zwar piepegal, was Víctor gefällt und was nicht, aber ich mag den Namen.« Sie bleibt einen Augenblick nachdenklich, als würde sie in ihrer Erinnerung kramen. »Tante Mariana wird mich hochkant wieder rauswerfen, wenn sie mich kommen sieht«, sagt sie dann, wieder drauf und dran in Tränen auszubrechen.
»Das wird sie nicht tun.«
»Und wenn doch?«
»Wir werden es nicht zulassen. Oma wird es nicht zulassen; und Brandy nicht, Bely nicht, Carmina nicht … nicht mal Mama. Und ich auch nicht. Sogar der Hund wird sie anbellen, wenn sie es versucht.«
Gádor lächelt traurig.
»Ja, der bellt bestimmt.«
2
Ich wünsche mir apàtheia, die Kontrolle über meine Leidenschaften, um mein Leben mit mehr Gelassenheit zu führen. Die Stoiker suchten sie, und ich suche sie ebenfalls, allerdings, wie ich fürchte, nicht ganz so erfolgreich.
Wenn einer mich fragen würde, woraus das Leben besteht, diese merkwürdige Sache, wie Gádor sagt, würde ich nicht antworten, aus Atomen, Quarks, Mysterien, noch nicht einmal aus Emotionen. Ich würde sagen, aus gottverdammten Überraschungen, eingelegt in diese kosmische Schweinerei, die man Chaos nennt.
Als Kind kam es mir häufig so vor, als wären die Komplexe aus Lebewesen und Dingen, die mich umgaben, hinter einem trügerischen Schein absoluter Ruhe und stiller Selbstverständlichkeit in Wirklichkeit total verrückte Systeme. Inzwischen kommt es mir nicht mehr nur so vor.
Fraktale. Wir sind nichts weiter als menschliche Fraktale.
Was mich nach wie vor begeistert, ist, dass immer noch die Sonne scheint und ich jeden Morgen die Augen aufschlagen kann, obwohl die Dinge so liegen wie sie liegen. Dieser lautlose Prozess von Keimung, Wachstum und Tod, der sich in allem vollzieht, was mich umgibt, fasziniert mich in einer Weise, als wäre ich soeben zur Welt gekommen und besäße schon ein Bewusstsein für das Wunder dieser Vorgänge.
Diese ist die beste aller möglichen Welten. Die beste – sage ich mir immer wieder –, trotz allem, die beste …
»Wie geht’s?«, frage ich meine Großtante Mariana.
»Schlechter …«
»Also …«, ich sehe sie zweifelnd an, weil ich sie gar nicht anders ansehen kann. »Dir geht es doch immer schlecht, oder?«
Ihre grünen, mit hellblauer Schminke verschmierten Schlitzaugen sind heute genauso kalt wie das Hinterteil des Mondes. Die schmalen, stets wie ein Gleichheitszeichen geformten Lippen, das kurze graue Haar, das sich leicht um das Gesichtsoval kräuselt, und das flache, erstaunlich symmetrische Näschen legen mir den Gedanken nahe, dass sie früher eine Schönheit gewesen sein muss. Davon ist heute, außer einem Haufen Falten und einer Haut, die dem Krokoleder ihrer eigenen Handtasche zum Verwechseln ähnlich sieht, nichts mehr übrig. Sie hat sich vor vier Jahren liften lassen, ist aber unter der krumpligen Pelle, die man ihr vom Gesicht gezogen hat, dieselbe geblieben.
Sie greift nach der Flasche Fundador und bedient sich großzügig, dabei benutzt sie ein Glas aus ihrem privaten Service, das nebst ihrem Besteck gesondert verwahrt wird, weil sie fürchtet, sich bei uns zu infizieren, wenn sie das allgemeine Essgeschirr mitbenutzt. Die Dunkelheit fällt herein und füllt den Raum. Es wird Abend, und die Augen der Tante scheinen als Kontrast dazu glasig zu glänzen. Die Alte kräuselt die Lippen, und das Gleichheitszeichen verwandelt sich in ein doppeltes Unendlichkeitszeichen.
»Heute geht es mir … noch schlechter«, sagt sie. Und nimmt einen kräftigen Schluck. Ich fühle mich verpflichtet – zum Teufel mit sämtlichen Verpflichtungen dieser Welt und auch jeder anderen –, sie zu fragen, was es denn in Gottes Namen diesmal ist. Rheuma? Osteoporose? Zellulitis? Ich mache Licht, indessen sie unter den verschiedenen Möglichkeiten, die uns die medizinische Wissenschaft heute anzubieten hat, ihre Wahl trifft.
»Ich glaube, es sind Verdauungsstörungen«, sagt sie schließlich und in ihrem Blick spiegelt sich eine Mischung aus Indiskretion und Angriffslust. »Manchmal habe ich den Eindruck, dass das Essen deiner Mutter das viele Geld nicht wert ist, was sie von mir dafür bekommt. Und du weißt ja, für jemanden wie mich kann das den Tod bedeuten.«
Dieses »für jemanden wie mich« muss man in »für jemanden so schrecklich Altes wie mich« übersetzen, dabei ist sie davon überzeugt, dass sie, obwohl sie so alt ist wie der Erfinder des Rades, noch wesentlich jünger ist als meine Mutter, ihre Nichte wohlgemerkt, und die allermeisten Bewohner unseres Planeten dies bloß nicht anerkennen wollen, obwohl sie ihr Alter nur als Mittel ins Spiel bringt, um ihre Leiden zu betonen, die fast ausnahmslos eingebildet sind.
Fest steht, dass sie das heiße Alter von neunundsechzig erreicht hat.
»Natürlich …«, antworte ich voller Tücke und indem ich Acht gebe, mir nicht auf die Zunge zu beißen, damit das Gift meiner eigenen Worte mich nicht auf der Stelle umbringt. »In deinem Alter … und dann bei Mutters Essen …«
Ich sehe sie blinzeln. Soll sie blinzeln, verdammt!
»Was soll das heißen, in meinem Alter, wo ich doch beinah gleich alt bin wie deine Mutter? Und das, obwohl sie meine Nichte ist.«
»Ja, du bist fast gleich alt wie meine Mutter, hast Recht«, antworte ich brav mit dem dümmlichen Gesichtsausdruck, den sie als einzigen bei uns duldet. »Du bist ja schließlich nur zwanzig Jahre älter als Mama.«
»Neunzehn …«, knurrt sie und fixiert mich, als wollte sie mir meine Frechheit nicht abnehmen.
»Ja, das meinte ich doch …!«
In diesem Augenblick betritt meine Mutter die Küche, und Tante Mariana schwankt, noch etwas verwirrt, zwischen den Möglichkeiten, ihren Zorn an meiner Mutter auszulassen, bei der sie sich immer auf eine ordentliche Reaktion auf ihre Wutausbrüche verlassen kann, oder in meinem unergründlichen Gesicht und meinem – zugegebenermaßen eigensinnigen – Humor weiterzuforschen, der sie verunsichert und ihr keine Garantie für eine möglichst hinterhältige verbale Metzelei gibt. Deshalb nimmt sie meine Mutter. Als würde sie die Angebote von zwei Banken abwägen und sich für den höheren Zins auf ihre langfristigen Sparverträge entscheiden … aus purer Gemeinheit.
»Ela!«, brüllt die alte Ratte meine Mutter an. »Wo bist du gewesen, wenn man das mal erfahren darf …?«
Ich entwende ihr ohne viel Federlesen die Flasche Fundador und stelle sie ins Flaschenregal auf dem Kühlschrank. Tante Mary straft mich mit einem finsteren Blick, weil sie auf einen Stuhl steigen müsste, um sich die Flasche wiederzuholen, und weiß, dass sie das nicht kann. Sie wird also jemanden bitten müssen und damit zugeben, dass sie sich unauffällig einen hinter die Binde kippen wollte. Aber das widerstrebt ihr, obwohl sie ihr Leben damit verbringt, fröhlich eine Flasche nach der anderen zu leeren, allerdings gewöhnlich unter dem unwiderlegbaren Vorwand, dass sie schließlich auf dem Tisch stünden. »Ich musste einkaufen, Mary. Weißt du schon, dass Gádor wieder zu Hause ist? Wir müssen der Kleinen was zu essen geben, und die ist wirklich ziemlich mäkelig … Du solltest mal sehen, wie sie bei Tisch das Essen von einer Backe in die andere schiebt!« Meine Mutter holt aus einer Plastiktüte Obst, dann Milch, tiefgefrorenes Gemüse und schließlich eine ganze Palette abgepacktes Fleisch, bestimmt von Carmina.
»Schick sie zu ihrem Mann zurück«, die Tante umklammert mürrisch ihr volles Schnapsglas, als wäre es ein Geländer; vielleicht fürchtet sie abzustürzen, wenn sie wagt, es einmal loszulassen. »Candela, hast du nicht ein paar Oliven für mich, von denen mit Anchovis? Ich finde, du solltest sie an die Luft setzen. Soll sie das doch mit ihrem Mann alleine ausmachen … Da brauchst du dich doch nicht einzumischen.«
Ich hole die erbetenen Oliven, auf deren Marinade sich deutlich eine grünliche Schicht abzeichnet. Großzügig verteile ich eine Portion Pilzbakterien auf den abgetropften Oliven und garniere sie ihr mit einer fein gehackten braunen Chilischote, damit sie die Schimmelspuren nicht entdeckt.
»Ich kann sie nicht hinauswerfen, Mary. Wegen dem Kind, wegen …«, während sie redet, räumt meine Mutter die Einkäufe in den Eisschrank und in die Kühltruhe, je nachdem, wo sie hingehören. »Sie ist meine Tochter. Sie ist schwanger. Und Víctor, ihr Mann …«
»Mama …«, unterbreche ich sie, weil ich verhindern will, dass sie der alten Hexe die intimen Probleme meiner Schwester ausplaudert. Hinter Tante Marianas Rücken werfe ich ihr warnende Blicke zu, aber sie scheint sie nicht zu bemerken.
»Weißt du, dieser Mann …«, schwatzt meine Mutter weiter, doch glücklicherweise ohne zu weit zu gehen. »Mein Gott, mein Gott … Ich war von vornherein dagegen, dass sie den heiratet. Ich habe sie gewarnt. Sie wäre zu jung, habe ich ihr gesagt, sie würde ihn nicht richtig kennen …«
»Mama, soweit ich mich erinnern kann, hast du sie kein bisschen gewarnt. Ich weiß nur, dass du einen Moment gestutzt hast, als sie ihre Hochzeit bekannt gab, aber im nächsten hast du beschlossen, dass es nicht übel wäre, eine von uns auf diese Weise loszuwerden, und hast keinen Piep mehr gesagt.«
Ich ärgere mich dermaßen für Gádor, dass ich merke, wie sich die Aggressionen in meinem Bauch zusammenballen und mir durch Brust und Hals nach oben steigen, bis sie mir aus den Augen sprühen, aus Nase, Mund und Ohren. Mitten durch die verdammte Brille hindurch!
Ich wünsche mir so verzweifelt apàtheia, o ja, wer will denn schon den Kopf verlieren, sich zu Angst und Unrecht, ja bis zum Verbrechen hinreißen lassen? Aber die apàtheia ist wie die See … sie ist da, man kann sie sehen, man kann sie fühlen, aber man kann sie nicht mit nach Hause nehmen.
»Das war doch abzusehen.« Die alte Kuh beschließt jetzt, für meine Mutter Partei zu ergreifen, weil sie sich ausrechnet, dass sie so ihre Tagesdosis an fremder Wut eher bekommt. »Töchter hören nie auf ihre Mütter. Wenn man ihnen vom Heiraten abrät, dann heiraten sie erst recht; und wenn man ihnen dazu rät, dann haben sie tausenderlei Einwände.«
»Ja?« Ich setze mich zu ihr, während meine Mutter um uns herum wirtschaftet. »Und woher willst du das wissen? Du hast doch gar keine Kinder.«
Durchaus nicht beleidigt, reagiert Mariana auf den Hinweis, von der Mutterschaft unbefleckt geblieben zu sein, wie eine Jugendliche, die keine Ahnung vom Leben hat und es gerade erst entdeckt.
»Du hast Recht. Was weiß ich schon davon?«, gesteht sie in einer plötzlichen Anwandlung von Einsicht. »Nur das, was ich bei deiner armen Mutter zu sehen bekomme …«
Dass meine Tante sich jetzt meiner Mutter erbarmt, passt mir auch nicht, erstens weil ich die Überheblichkeit der eingebildeten alten Wachtel deutlich heraushöre und zweitens, weil ich der Meinung bin, dass meine Mutter – so zierlich sie auch ist – von niemandem bemitleidet zu werden braucht.
Ich suche nach der gemeinsten Antwort, die mir einfällt. Gründe dazu habe ich genug: Ich leide an PMS, verstärkt durch einen unvermeidlichen Verfolgungswahn, der sich zu einer echten Paranoia auszuwachsen droht; ich hasse meine Tante Mariana seit jeher und bin im Moment sogar willens, auf die apàtheia zu verzichten und zu vergessen, dass das Haus, in dem wir alle zusammen wohnen, der Alten gehört, und zwar ihr ganz allein, und dass sie uns mir nichts dir nichts auf die Straße setzen kann, wenn ich meinerseits dafür sorge, dass sie völlig aus dem hinfälligen, senilen Häuschen ist.
Meine Mutter liebt diese riesige Altbauwohnung, die sie nach ihrer Heirat mit Unmengen Plastik, Resopal und geblümten Wandtellern ausgestattet hat. Sie behauptet, dass wir im Zentrum leben. Nur wovon?
Ich bin im Begriff, den Mund aufzutun, als meine Schwester Isabel zur Tür hereinkommt. Bely ist von uns allen Tante Marianas Liebling. Sie kann es sich als Einzige erlauben, ihr ins Gesicht zu sagen, was wir alle von ihr denken, aber keiner auszusprechen wagt.
»Hallo, Tante Mary! Wie geht’s?«, fragt Bely, während sie meine Mutter mit einem Kuss begrüßt. »Hallo, Mami.«
»Pfffff …«, antwortet Mariana.
»Was soll denn ›pfffff‹ heißen?«
»Dass ich vor Langeweile sterben werde, wenn nicht was dazwischen kommt. Dann könnt ihr euch freuen, ihr werdet mich beerben.« Sie hält nun ihrerseits meiner Schwester die vom Alkohol gerötete Wange zum Kuss hin.
»Jetzt übertreibst du aber, Tante.«
»Ich übertreibe?« Sie führt die Hand zur Brust, oder besser zu der Stelle, wo sie gewöhnlich ihre Geldbörse versteckt hält. »Na ja, wenn man siebzehn ist und so wenig Grips hat wie du, da ist es natürlich einfach, alles ins Lächerliche zu ziehen. Glaub mir, Bely, da ist es wirklich einfach.«
Meine Mutter bereitet währenddessen das Abendessen vor, indem sie in der Küche hin und her läuft und eine hektische Betriebsamkeit entfaltet. Sie wäscht grüne Bohnen und schnippelt sie auf der Spüle in eine Schüssel. Sie füllt Wasser in einen riesigen Topf und stellt Schinkenspeck und Brühe zum Kochen auf. Anstatt die Dunstabzugshaube anzuschalten, öffnet sie das Fenster, und die Geräusche von der Straße mischen sich in unsere Unterhaltung wie ein zusätzliches Familienmitglied.
Als Bely noch klein war, hat meine Mutter ihr jedes Mal den Po versohlt, wenn sie irgendetwas anstellte. Meine anderen Schwestern und ich waren schon größer und haben sie nach Kräften verteidigt. Ich weiß noch, wie Carmina sie anfuhr: »Jetzt ist es aber genug, lass endlich die Kleine in Ruhe«, als Bely ein Loch ins Sofakissen gebohrt hatte, um sich für die Nacht einen geheimen Mundvorrat mit Dauerwürsten und Käse anzulegen. Meine große Schwester stand wutschnaubend vor meiner Mutter, die Bely übers Knie gelegt hatte. »Hör auf! Du wirst sie noch traumatisieren!«, rief Carmina, die erst kürzlich dieses Wort gelernt hatte. »Traumatisieren?« Meine Mutter hielt inne und sah ihre vier älteren Töchter mit gefurchter Stirn an: »Sie ist viel zu stur, um traumatisiert zu werden«, sagte sie schließlich. Kaum hatte meine Mutter von ihr abgelassen, klemmte sich Bely eine von den Dauerwürsten unter den Arm, lief wie ein geölter Blitz auf die Straße hinaus und lachte dabei aus vollem Halse.
Meine Mutter hatte Recht. Sie ist unverwüstlich und zeigt nicht die mindesten Anzeichen eines Kindheitstraumas. Bald darauf entwickelte sie sich nämlich in das vollständige Gegenteil aller unserer Befürchtungen. Sie hörte auf, ungezogen zu sein, dicklich, mäkelig, weinerlich und hinterhältig, und verwandelte sich, zu unser aller Verwunderung, bei Eintritt in die Pubertät in ein fröhliches, offenes, liebevolles und unbeschwertes junges Mädchen. Sie gehört zu der Sorte Menschen, die sich an allem, was sie tun oder was ihnen widerfährt, zu freuen scheinen; und es ist schwer, sie nicht zu mögen. Das gilt sogar für Mariana, die nebenbei gesagt die Hoffnung hegt, Isabel könnte als erstes weibliches Familienmitglied ein Universitätsdiplom nach Hause bringen – nachdem ich sie so gründlich enttäuscht habe, weil ich im vierten Semester Bio die Uni habe sausen lassen und eine Karriere als Oberstudienrätin, die Mariana für mich erträumt hatte, damit ein für alle Mal gelaufen ist.
Meine Schwester wäre übrigens nicht nur das erste weibliche, sondern das erste Lebewesen überhaupt, das in unserer Familie einen akademischen Abschluss hätte. Das würde sogar ich feiern.
»Wo ist Oma?«, fragt Bely.
»Die Alte«, Mariana nennt meine Oma gerne die Alte, weil sie sich einbildet, ihre ältere Schwester übernähme damit schon das häusliche Alterskontingent und ließe sie davon verschont, »ist Lotto spielen. Heute ist Montag. Sie will noch Millionärin werden, in ihrem Alter …« Ich sehe Spott und Skepsis in Marys Augen und vermute, dass sie in irgendeinem Hinterstübchen doch befürchtet, das Glücksspiel meiner Oma könnte eines Tages Früchte tragen und sie aus dem Posten der Tyrannin und Finanzoberin der Familie entlassen.
»Bely, hilf mir mal beim Kartoffelschälen, ja?«, bittet meine Mutter sie.
Paradoxerweise ist Bely die Einzige von uns, die meiner Mutter den ganzen Tag am Rockzipfel hängt, obwohl nur sie mit wahrer Leidenschaft verdroschen worden ist, als hätte meine Mutter genau damit Punkte bei ihr gemacht und würde jetzt absahnen, wie wenn man im Supermarkt ein paar Teile umsonst kriegt.
Meine kleine Schwester summt ein Liedchen vor sich hin und schält Kartoffeln, während ich lustlos die Decke über den langen Holztisch breite; einen alten Tisch, der früher zum Schlachten zahlloser armer, argloser Schweine verwendet wurde und heute zur Speisung einer stattlichen Anzahl weiterer Tiere dient, die sich von den Leichen ersterer ernähren. Meine Oma hat ihn irgendwann angeschleppt, und er ist hier geblieben, weil wir beim Essen immer so viele waren, dass ein richtig großes und tragfähiges Untergestell absolut notwendig war. Daher kam uns dieser Sauschneidetisch wie gerufen, der im Übrigen sehr passend für uns ist, weil er aus der Unterschicht stammt, auf deren Kosten einige ihre Bankette veranstalten und die von anderen nach Belieben benutzt wird.
Aber da es mit meinem eigenen sozialen Gewissen auch nicht allzu gut bestellt ist, decke ich lieber ein Tischtuch darüber; eine echte Lagarterana-Decke, die meine Mutter, obwohl sie sonst bis zur Erschöpfung wiederholt, sie bräuchte kein Bügeleisen, mit der größten Sorgfalt zu bügeln pflegt. Ich lege zwei zusätzliche Gedecke auf für Gádor und meine Nichte Paula und sehe aus den Augenwinkeln zu meiner Tante, die ihrerseits sehnsüchtig nach der majestätisch glänzenden, aber unerreichbaren Flasche Fundador knapp unterhalb der Decke schielt.
Der Geruch von gebratenen Zwiebeln durchzieht die Küche, als meine Mutter das Gemüse dünstet. Ich höre die Verdauungssäfte der Tante rumoren, die sich hungrig durch das Labyrinth ihres böswilligen Gedärms arbeiten.
»Wann gedenken deine Töchter, deine Enkelin und diese Bingospielerin von deiner Mutter eigentlich zu kommen?«, wiehert sie. Ihre sämtlichen Bemühungen um eine mädchenhafte Stimme führen lediglich dazu, dass ihr bis zum Überschnappen hochgeschraubtes Ego noch unerträglicher hindurch schrillt und sie sich anhört wie eine hysterische Menschenmenge, die sich kopfüber einen gigantischen Hang hinabstürzt.
»Carmina und Brandy müssten eigentlich gleich da sein …«, sagt meine Mutter und kippt einen großen Berg Rosenkohl, Artischocken, grüne Bohnen und klein geschnittene Mohrrüben in die Pfanne. »Und Gádor und die Kleine sind mit Oma unterwegs. Sie haben sie begleitet, damit Paula mal rauskommt. Das arme Kind war den ganzen Tag drin und hatte keine Gelegenheit, mal vor die Tür zu gehen.«
»Sie soll froh sein, dass sie überhaupt hier sein kann. Weder Mutter noch Tochter haben einen Grund zur Klage. Wenn sie rauswollen, können sie ja zurück nach Hause gehen. Falls man das Loch mit dem Holzhacker da drin überhaupt als Zuhause bezeichnen kann …«
Ich verstehe nicht, ob sie damit sagen will, dass Gádors Wohnung ein Loch ist, weil der Holzhacker da drin ist, oder ob sie meint, die Wohnung sei so klein, dass sie mit dem Holzhacker da drin eng wie ein Loch ist. Aber was soll’s. Man muss ja nicht alles verstehen.
Ich sehe sie düster an, aber sie weicht schon seit geraumer Zeit meinen Blicken aus.
Am anderen Ende vom Flur hört man die Türe gehen und unsere kleine Hündin Achilipú, die ihr Leben auf der Fußmatte verschläft, zur Begrüßung bellen.
Ich höre, wie Brandy den Hund liebkost und sie anspricht, als würde sie mit ihrem neuesten Freund turteln. Im nächsten Augenblick betritt sie mit ihren sinnlichen, katzenhaften Bewegungen, umweht von der für sie so charakteristischen Duftwolke eines zugleich angenehmen und unerträglichen Parfüms, die Küche. Es hat mich immer gewundert, dass meine Schwester Brandy, die eine wahre Katze ist, sich so gut mit dem Hund versteht. Sie trägt das Haar lang, in großen, weichen Wellen, und so große Kreolen, dass sie ihr als Halsreifen dienen könnten. Sie hat einen hautengen Spitzenbody aus Polyester vom Wühltisch bei Woolworth an und darüber ein indisch angehauchtes, mit bunten Pailletten besticktes Jäckchen, das kaum auffälliger sein könnte. Die mehr als engen, wie eine Wurstpelle anliegenden Hosen sind aus lila Samt und ihre Farbe wiederholt sich in drei oder vier Pailletten ihrer Weste. Meine Schwester Reyes – die wir Brandy nennen, weil mein Vater angeblich bei ihrer Zeugung randvoll war mit Brandy 103