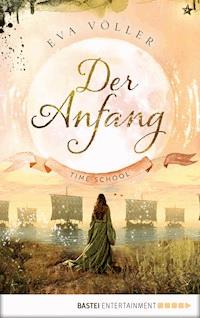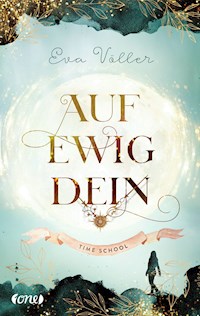
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Time School
- Sprache: Deutsch
Willkommen in Venedig! Willkommen an der Zeitreise-Akademie! Getarnt als Theater ist dies der Ort, wo eine neue Generation von Zeitreisenden ausgebildet wird. Denn neue Abenteuer warten ...
Anna und Sebastiano sind zurück! Das Traumpaar der Zeitenzauber-Trilogie ist nach vielen bestandenen Abenteuern zu Zeitreiseprofis gereift. Grund genug, um eine eigene Zeitreiseschule in Venedig zu gründen. Dem Ort, wo die Liebe und die Reisen durch die Zeit ihren Anfang fanden.
Ihre ersten beiden Novizen sind die verführerische Fatima, ein Haremsmädchen aus dem 13. Jahrhundert, und der draufgängerische Ole, Sohn eines Wikingerhäuptlings. Die erste gemeinsame Mission zum Hofe Heinrichs des Achten gerät aber zum Debakel. Anna und Sebastiano haben alle Hände voll zu tun, ihre Zöglinge zu bändigen, als ein unerwarteter Besucher aus der Zukunft auftaucht und einen grausamen Tribut von Anna fordert: »Opfere deine große Liebe, damit die Zukunft fortbestehen kann!«
Der erste Band der neuen Jugendbuch-Reihe von Eva Völler
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Zitat
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Danach
Noch was zum Schluss …
Über das Buch
Willkommen in Venedig! Willkommen an der Zeitreise-Akademie! Getarnt als Theater ist dies der Ort, wo eine neue Generation von Zeitreisenden ausgebildet wird. Denn neue Abenteuer warten … Anna und Sebastiano sind zurück! Das Traumpaar der Zeitenzauber-Trilogie ist nach vielen bestandenen Abenteuern zu Zeitreiseprofis gereift. Grund genug, um eine eigene Zeitreiseschule in Venedig zu gründen. Dem Ort, wo die Liebe und die Reisen durch die Zeit ihren Anfang fanden. Ihre ersten beiden Novizen sind die verführerische Fatima, ein Haremsmädchen aus dem 13. Jahrhundert, und der draufgängerische Ole, Sohn eines Wikingerhäuptlings. Die erste gemeinsame Mission zum Hofe Heinrichs des Achten gerät aber zum Debakel. Anna und Sebastiano haben alle Hände voll zu tun, ihre Zöglinge zu bändigen, als ein unerwarteter Besucher aus der Zukunft auftaucht und einen grausamen Tribut von Anna fordert: »Opfere deine große Liebe, damit die Zukunft fortbestehen kann!« Der erste Band der neuen Jugendbuch-Reihe von Eva Völler
Über die Autorin
Eva Völler hat sich schon als Kind gern Geschichten ausgedacht. Trotzdem verdiente sie zunächst als Richterin und Rechtsanwältin ihre Brötchen, bevor sie die Juristerei endgültig an den Nagel hängte. »Vom Bücherschreiben kriegt man einfach bessere Laune als von Rechtsstreitigkeiten. Und man kann jedes Mal selbst bestimmen, wie es am Ende ausgeht.«
Die Autorin lebt mit ihren Kindern am Rande der Rhön in Hessen.
Weitere Titel der Autorin:
Kiss & Crime – Küss mich bei Tiffany
Kiss & Crime – Zeugenkussprogramm
Zeitenzauber – Die magische Gondel
Zeitenzauber – Die goldene Brücke
Zeitenzauber – Das verborgene Tor
Leg dich nicht mit Mutti an
Der Montagsmann/Hände weg oder wir heiraten
Wenn Frauen Männer buchen
Ich bin alt und brauche das Geld
Titel in der Regel auch als Hörbuchund als E-Book erhältlich
Eva Völler
Time School
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2017 Eva Völler
Copyright Deutsche Originalausgabe © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Anna Hahn, Trier
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München, unter der Verwendung von Motiven von © Kanate/shutterstock; Shukaylova Zinaida/shutterstock; fractal-an/shutterstock; Saibarakova Ilona/shutterstock; Eisfrei/shutterstock; motion_dmitriy/shutterstock; Anastasiia Veretennikova/shutterstock; faestock/shutterstock; Allgusak/shutterstock; xpixel/shutterstock; Anastasiia Veretennikova/shutterstock; Discovod/shutterstock
E-Book-Produktion: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-7325-4827-9
Sie finden uns im Internet unter www.one-verlag.de
Bitte beachten Sie auch www.luebbe.de
Für Thea
Die Zeit ist aus den Fugen; Fluch der Pein,Muss ich sie herzustell’n geboren sein! –Nun kommt, lasst uns zusammen geh’n.
(William Shakespeare, Hamlet)
Teil 1
Wenn das mal gut geht«, murmelte ich, während ich mich anstrengte, einen Blick auf den Herrscher und seine Ehrengäste zu erhaschen. Es befanden sich einfach zu viele Leute hier. Das Gedränge in dem großen Saal war unbeschreiblich. Ich stand inmitten der Menge und reckte mich auf die Zehenspitzen, um die große Tafel auf dem Podest an der Stirnseite der Halle besser sehen zu können, aber mehr als ein paar wippende Federn auf hohen Hüten oder perlenbestickte Kappen edler Damen konnte ich beim besten Willen nicht erkennen.
Angeblich waren im sechzehnten Jahrhundert die meisten Menschen deutlich kleiner als die in der Gegenwart. Doch das nützte mir im Moment auch nicht viel, denn ich gehöre zu den Leuten, die etwas kleiner sind als der Durchschnitt. Somit war ich in diesem gewaltigen Festsaal genauso groß wie viele der anwesenden Frauen, aber dummerweise immer noch ein gutes Stück kleiner als die Mehrzahl der um mich herumwuselnden Männer.
»Ist Sebastiano hier irgendwo?«, fragte ich Ole, der rechts neben mir stand. Ole war über eins neunzig groß und damit für einen Wikinger aus dem zehnten Jahrhundert ein Riese. Hier in diesem Saal überragte er jedenfalls sämtliche Gäste um Haupteslänge und hatte daher die volle Übersicht.
»Nein«, antwortete er mit seiner tiefen Stimme. »Vor fünf Minuten habe ich ihn noch gesehen, aber jetzt kann ich ihn nirgendwo entdecken.«
»Ist er rausgegangen?«
»Mag sein. Wenn ja, habe ich es nicht bemerkt.«
»Und da vorn am Tisch des Königs? Kannst du da irgendwas erkennen?«, erkundigte ich mich.
»Ich sehe den ganzen Tisch.«
»Und was genau siehst du dort?«, fragte ich.
»Lauter edle Damen und Herren. Sie sind maskiert, wie die übrigen Gäste im Saal.«
»Ja, weil das hier ein Maskenball ist«, sagte ich um Geduld bemüht. Unwillkürlich berührte ich meine eigene Maske, ein hübsches Accessoire aus roter Seide und frei von jeglicher Magie. Kein Vergleich mit der schwarzen Katzenmaske, die mir auf meinen früheren Abenteuern schon nützliche Dienste geleistet hatte, ehe sie mir während eines Einsatzes abhandengekommen war. »Siehst du auch den König?« Ich musste lauter sprechen, weil oben auf der Galerie ein Orchester Stellung bezogen hatte, um mit Laute, Viola, Tamburin und Flötengedudel die Gäste zu erfreuen.
»Ich sehe den König«, bestätigte Ole. »Auch er trägt eine Maske. Aber kein Mensch könnte ihn aus dieser Entfernung verwechseln. Er ist fett wie ein Walross und frisst ohne Unterlass. Ein Wunder, dass sein Thron nicht unter ihm zusammenbricht.«
Ich blickte mich leicht erschrocken um. Das Schloss hatte wie jedes große Herrscherhaus der Renaissance Augen und Ohren, und Majestätsbeleidigung war sowieso in allen Zeiten ein Grund für drakonische Strafen gewesen. Wer hier den Mund zu voll nahm, konnte schnell den Kopf verlieren. Buchstäblich. Heinrich der Achte war dafür bekannt, dass er Leuten, die ihm gegen den Strich gingen, gern den Kopf abschlagen ließ.
»Du bringst uns mit deinem unvorsichtigen Gerede in Gefahr«, flüsterte ich.
Ole gab einen verächtlichen Laut von sich und reckte sich in Wikingermanier. »Ich sehe hier weit und breit niemanden, der es wagen würde, mich, den Sohn eines Jarls, in Eisen zu legen!«
Tatsächlich schien außer mir niemand Oles respektlose Bemerkung gehört zu haben. Was keineswegs selbstverständlich war, denn allein schon wegen seines Aussehens zog er eine Menge Aufmerksamkeit auf sich, vor allem weibliche. Genauer gesagt starrten die Frauen, die seinen Weg kreuzten, ihn an wie ein Fabelwesen, aber auch manche Männer konnten kaum ihren Blick von ihm wenden. Groß und breitschultrig wie ein nordischer Kriegsgott war Ole in der Tat eine ungewöhnlich männliche Erscheinung, daran vermochten auch die feinen Seidenstrümpfe und das taillierte Samtwams nichts zu ändern. Er selbst fand sich allerdings in diesen historischen Kleidungsstücken tuntig – eines der ersten Worte, die er in der Gegenwart gelernt hatte, nachdem Sebastiano und ich ihn aus dem zehnten ins einundzwanzigste Jahrhundert geholt und neu eingekleidet hatten. Die Trennung von seiner alten Fellweste und den abgeschabten Lederbreeches war ihm sichtlich schwergefallen. Aber natürlich musste er sich genau wie wir an die modischen Gepflogenheiten in den von uns besuchten Epochen halten, wenn er mit uns durch die Zeit reiste.
Stirnrunzelnd betrachtete ich die klobigen Stiefel, die er trug. Wo kamen die denn auf einmal her? Sie waren ein klarer Stilbruch. Hatten wir nicht elegante Lederschuhe mit Silberschnallen für ihn eingepackt? Ich hätte besser darauf achten müssen, was er zu diesem Fest anzog. Dass er so ehrfurchtgebietend groß und mit seinen zwanzig Jahren nicht viel jünger war als ich, ließ mich manchmal vergessen, dass er mein Schüler war. Ein Schüler, der noch viel lernen musste. Vor allem über die Sitten und Gebräuche der unterschiedlichen Jahrhunderte, die wir als Zeitwächter besuchten.
»Du musst genau aufpassen, was du sagst«, ermahnte ich ihn. »Du kannst nicht überall, wo du gehst und stehst, den Häuptlingssohn herauskehren. Du musst die Rolle spielen, die du für unseren Einsatz hier übernommen hast.«
»Ich verabscheue diese Rolle aber! Wieso kann nicht ich der Lord sein und Sebastiano der Pferdeknecht?«
Ich seufzte und fragte mich wieder mal, ob es wirklich eine so gute Idee gewesen war, mit Sebastiano zusammen diese Zeitreise-Schule aufzumachen. Bis jetzt hatten wir erst zwei Schüler, Ole und Fatima, aber das ganze Projekt war eine echte Herausforderung. Vor allem mein Job als Lehrerin. Manchmal kam ich mir vor wie das Fräulein Rottenmeier der Zeitreisenden. Es widerstrebte mir, den Besserwisser zu geben, auch wenn es oft nicht anders ging.
»Erstens bist du kein Pferdeknecht, sondern ein Knappe«, korrigierte ich Ole. Ich sprach mit gedämpfter Stimme, darauf bedacht, dass niemand sonst mithören konnte. »Ein Knappe ist viel edler als ein Knecht, nämlich so eine Art Ritter-Anwärter. Zweitens wäre eine umgekehrte Rollenverteilung gar nicht glaubhaft, denn du bist jünger als Sebastiano. Drittens bist du noch in der Ausbildung, und Sebastiano und ich sind deine Lehrer. Wir bestimmen, wie die Einsätze ablaufen. Ich dachte, das wäre klar. Es ist doch klar, oder?«
Ole gab ein widerstrebendes Grunzen von sich, das mit etwas Fantasie als Zustimmung durchging. Es war offensichtlich, dass ihm sein Part bei diesem Einsatz nicht behagte, aber wenn Sebastiano und ich es nicht schafften, unseren Schülern das kleine und große Einmaleins der Zeitreise-Regeln beizubringen, konnte das für uns alle lebensgefährlich werden. »Was habe ich dir über die Wahrnehmung von Sprache in anderen Epochen erklärt?«, fuhr ich fort. Kleine praktische Übungen zwischendurch konnten schließlich nicht schaden, erst recht nicht, wenn sie sozusagen direkt vor Ort stattfanden, so wie auf diesem Maskenball am Hofe von Heinrich dem Achten im Jahr 1540.
»Dass alles, was wir in Hörweite von Menschen anderer Epochen in unserer Muttersprache aussprechen, von diesen Menschen in ihrer eigenen Muttersprache verstanden wird«, leierte Ole gelangweilt herunter. Er rückte seine Maske zurecht, die genauso flaschengrün war wie sein Wams. »Und wenn wir Dinge aus der Zukunft erwähnen, die es in der Vergangenheit noch nicht gibt, werden die betreffenden Worte von ganz allein in Begriffe umgewandelt, die besser zu der Epoche passen, damit es den Menschen beim Zuhören nicht seltsam vorkommt. Zum Beispiel das Wort … Ferrari.« Er sah sich herausfordernd um. Seine Worte waren in dem Stimmengewirr und der Musik um uns herum untergegangen. »Ferrari«, wiederholte er etwas lauter. Offensichtlich hatte es auch diesmal niemand mitbekommen, denn sonst wäre es automatisch in einen zur Epoche passenden Begriff umgewandelt worden. Und dann brüllte Ole plötzlich ohne jede Vorwarnung: »Achtspänner!«
Ich zuckte erschrocken zusammen. Diverse Köpfe fuhren zu uns herum. Ein Mann neben uns ließ seinen Trinkpokal fallen. Eine Frau stieß einen leisen Schreckensschrei aus und griff sich an die Brust. Keine Frage, diesmal hatten es alle mitgekriegt. Ole grinste zufrieden. Seine blauen Augen blitzten durch die Sehschlitze der Maske. »Die Wortumwandlung hat funktioniert«, stellte er überflüssigerweise fest. Dann spähte er irritiert zur königlichen Tafel hinüber. »Ich sehe Fatima. Sie steht am Tisch von König Heinrich.«
»Wirklich?«, fragte ich besorgt. »Was tut sie da? Sie sollte sich doch im Hintergrund halten!« Kurzentschlossen schob ich mich durch das dichte Gedränge und kämpfte mich unter Einsatz meiner Ellbogen in Richtung des Königs vor. Die ersten Gäste hatten angefangen, sich zum Tanz zu formieren, wodurch sich die Menge ein wenig auflockerte. Heerscharen von Dienern servierten reihum Wein, den die Gäste sich hinter die Binde gossen, als gäbe es kein Morgen. Keine Frage, Heinrich verstand sich aufs Feiern, auch wenn er wegen seines Gesundheitszustands und extremen Übergewichts nicht mehr selbst das Tanzbein schwingen konnte und deshalb lieber zuschaute.
Halb entsetzt, halb mitleidsvoll sah ich beim Näherkommen, was Ole mit Walross gemeint hatte. Der König sah aus wie ein sitzender Fleischberg in Samt und Seide. Fettwülste quollen an den Rändern der Maske hervor, die seine Augenpartie bedeckte, und das Wams aus kostbarem Brokat spannte über seinem aufgedunsenen Oberkörper, obwohl es sicher von einem Meisterschneider genau nach Maß gefertigt worden war – Heinrich wuchs vermutlich schneller aus jedem neuen Outfit heraus, als man ihm die nächste Garnitur nähen konnte, weil er sich den ganzen Tag ohne Sinn und Verstand mit Essen vollstopfte.
So wie auf dieser Feier. Er futterte immer noch, während sein Hofstaat bereits die Tanzfläche bevölkerte. Gerade spießte er mit seinem Essdolch ein Stück Fasan auf, tunkte es in Soße und verschlang es, wobei ihm das Bratenfett in den Bart lief und vom Doppelkinn herab auf seine speckigen Finger tropfte. Ein Diener flitzte von der Seite heran und legte ihm sofort ein neues Stück Fleisch vor, diesmal ein Kotelett von der Größe eines Tischtennisschlägers. Heinrich machte sich unverzüglich darüber her.
Die Männer und Frauen, die mit ihm am Tisch saßen, hatten ebenfalls noch Essen auf ihren Speisebrettern liegen, aber sie pickten nur darin herum – wahrscheinlich aus reiner Höflichkeit und um ihren Herrscher nicht zu brüskieren, indem sie ihn allein vor sich hin mampfen ließen, während sie längst satt waren.
Fatima stand am Rand des Podests, direkt gegenüber vom König. Ohne Maske, mit offen herabwallenden schwarzen Locken und einem extrem weit ausgeschnittenen Kleid sah sie aus wie die personifizierte Sünde. Und als wäre das noch nicht genug, klimperte sie auch noch kokett mit den Wimpern. Ich war sofort in Alarmstimmung.
»Sag Uns, wer du bist, Mädchen«, hörte ich Heinrich mit vollen Backen zu Fatima sagen, als ich mich möglichst unauffällig von der Seite an sie heranschob.
»Ich bin nur eine bescheidene Zofe, Euer Majestät«, säuselte sie mit zuckersüßer Stimme.
»Wessen Zofe, du hübsches Kind?«
»Meine.« Ich trat drei Schritte vor und stellte mich vor Fatima, als könnte ich damit verhindern, dass der König sie anstarrte.
»Und wer seid Ihr, werte Dame?« Heinrich griff nach seinem schweren Pokal und trank ihn gluckernd leer. Er ließ einen dröhnenden Rülpser hören, ehe er weitersprach. »Verzeiht Uns, dass Wir Euch nicht erkennen. Gehört Ihr zu den fünfhundert Gästen oder zum Hofstaat?«
»Zu den Gästen, Euer Majestät. Ich bin Lady Anne, die Gattin von Lord Sebastian Foscary.« Bei diesen Worten versank ich in einen formvollendeten Hofknicks, richtete mich aber blitzartig wieder auf, um zu verhindern, dass Heinrich zu viel von Fatima zu sehen bekam. Mir war klar, dass sie exakt in sein Beuteschema fiel. Obwohl er nicht mehr der Jüngste war, ließ er nichts anbrennen.
»Hm, Foscary, das sagt Uns gar nichts«, erwiderte der König zerstreut, während er versuchte, um mich herumzusehen, um Fatima genauer in Augenschein nehmen zu können.
»Die Familie meines Gatten stammt aus Essex«, behauptete ich, inständig hoffend, dass Heinrich das nicht weiter hinterfragte. Sebastiano und ich hatten unsere Legende nicht besonders gut ausgearbeitet, denn für diesen Einsatz war nicht einkalkuliert worden, von dem König in ein Frage- und Antwort-Spiel verstrickt zu werden. Alles, was ich bisher über uns erzählt hatte, war erstunken und erlogen. Oder wenigstens zurechtgebogen. In Wahrheit war ich Anna Berg aus Frankfurt. Sebastiano hieß Foscari und war waschechter Venezianer, und verheiratet waren wir auch nicht. Jedenfalls noch nicht. Irgendwann demnächst würden wir das bestimmt nachholen. Sobald wir etwas zur Ruhe kamen und mehr Zeit für solche Dinge hatten.
Aber Heinrich interessierte sich gar nicht für meinen persönlichen Hintergrund. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte ich auch einfach stumm durch die nächstbeste Tür verschwinden können. Seine gesamte Aufmerksamkeit richtete sich auf Fatima. Er verschlang sie geradezu mit seinen Blicken, und man brauchte nicht viel Fantasie, um zu erkennen, was ihm durch den Kopf ging. Er war gerade dabei, seine aktuelle Ehefrau auszusortieren, weil sie ihm zu verbraucht und zu hässlich war. Die arme Person – zufällig eine Namensvetterin von mir, sie hieß ebenfalls Anna – war gerade mal halb so alt wie er, nämlich fünfundzwanzig, und er würde sich in Kürze von ihr scheiden lassen. Als Nächstes würde er die siebzehnjährige Catherine Howard heiraten, eine Hofdame, die sicherlich auch irgendwo hier im Saal herumschwirrte.
Fatima war ebenfalls erst siebzehn. Ich konnte unmöglich zulassen, dass der König sie zu seinem Spielzeug machte. Oder, wenn man es realistisch betrachtete, sie ihn zu ihrem. Sie stammte aus dem fünfzehnten Jahrhundert und war die Favoritin eines mächtigen Sultans gewesen, bevor Sebastiano und ich sie aus dem Harem befreit und vom alten Konstantinopel in das Venedig der Gegenwart gebracht hatten. Nach unseren Rechtsvorstellungen war sie minderjährig und musste daher vor einem zudringlichen Lüstling wie Heinrich beschützt werden. Doch zugleich war sie als ehemalige Haremsdame mit allen Wassern gewaschen und hatte einen der mächtigsten Männer ihrer Zeit um den Finger gewickelt. Mir war es noch nicht so richtig gelungen, mit diesem seltsamen Widerspruch klarzukommen. Fatima hätte vom Alter her meine kleine Schwester sein können, und dementsprechend hatte ich oft das Gefühl, mich um sie kümmern und sie behüten zu müssen, aber gleichzeitig war sie mir in gewissen Belangen eindeutig voraus. Sie hatte bereits in ihrer frühen Jugend Haremserfahrungen gesammelt, über die ich gar nicht erst genauer nachdenken wollte. Wenn sie es darauf anlegte, wirkte sie auf Männer wie eine Fackel, an die nur jemand ein Streichholz halten musste, um sie lichterloh zum Brennen zu bringen. Mit dem Effekt, dass sie auf Typen aller Altersklassen eine geradezu magische Anziehungskraft ausübte.
»Woher stammst du, schönes Kind?«, wollte Heinrich von Fatima wissen. »Du hast aus Unserer Sicht mehr von einer orientalischen Orchidee als von einer englischen Rose.« Unvermittelt hörte er auf, von sich selbst im Pluralis Majestatis zu sprechen und wurde persönlicher. »Ich finde dich ausgesprochen liebreizend.«
Damit rannte er bei Fatima offene Türen ein. Sie ließ sich für ihr Leben gern Komplimente machen. Mit einem gekonnten Augenaufschlag blickte sie zu Heinrich auf. »Ich stamme tatsächlich aus dem Orient, Euer Majestät. Mein Vater war ein Kaufmann von der Schwarzmeerküste.«
»Wie hat es dich von dort in die Dienste von Lady Foscary verschlagen?«
»Meine Lady und mein Lord retteten mich einst aus den Fängen eines grausamen Sklavenhändlers.«
Das war nicht mal gelogen. Nachdem Fatima bei dem Sultan in Ungnade gefallen war, hatte er seinem Chef-Eunuchen befohlen, sie meistbietend als Konkubine zu verschachern. Sebastiano und ich hatten sie gerade noch davor bewahren können, an einen neuen Besitzer ausgeliefert zu werden, über den man sich in Konstantinopel wesentlich schlimmere Dinge erzählte als über ihren bisherigen Herrn.
Heinrichs Interesse an Fatima wuchs. Meine Besorgnis auch. Allmählich wurde ich nervös. Das Ganze entwickelte sich in eine sehr ungute Richtung. Wo um alles in der Welt blieb Sebastiano bloß? Auch wenn er mal dringend ein gewisses Örtchen hätte aufsuchen müssen, konnte er dafür doch unmöglich so lange brauchen! Vor allem nicht ausgerechnet jetzt! Er war schon seit mindestens zehn Minuten weg!
Ich kramte meine Taschenuhr aus den Tiefen meines Samtbeutels, den ich ganz nach Sitte der Tudorzeit am Gürtel trug. Die Uhr war ein wertvolles Stück aus dem Fundus unserer Requisiten, die uns für unsere Zeitreise-Einsätze zur Verfügung standen – ein Meisterwerk deutscher Handwerkskunst, eigenhändig gefertigt von Peter Henlein, dem berühmten Uhrmacher aus Nürnberg. Und sie ging sehr genau, davon hatte ich mich vor dem Einsatz überzeugt. Bloß noch fünf Minuten bis zum Attentat! Verschreckt sah ich mich um und registrierte nur noch am Rande, dass Heinrich gerade anfing, Fatima mit Komplimenten über ihre strahlenden Augen und ihre schönen Zähne zu überhäufen.
Was sollte ich denn um Himmels willen jetzt tun?
Vor lauter Nervosität biss ich mir auf die Fingerknöchel. Wir wussten nicht, wer der Attentäter war, also konnten wir bloß warten, bis er in Erscheinung trat. Irgendeiner von den Hunderten maskierten Männern hier im Saal musste es sein. Und praktisch jeder von ihnen kam in Frage. Immerhin waren wir im Bilde darüber, gegen wen sich der Anschlag richtete – nicht etwa gegen Heinrich (obwohl das nahegelegen hätte, denn es gab jede Menge Leute, die ihn nicht leiden konnten), sondern gegen einen seiner Berater, einen gewissen Lord Wykes.
Lord Wykes war ein freundlich wirkender, weißbärtiger älterer Herr. Er saß ziemlich weit außen am Tisch. Unser Auftrag lautete, ihn zu retten. Der Attentäter, wer immer es war, würde versuchen, ihn hinterrücks zu erstechen. Den Grund dafür kannten wir nicht, wir wussten nur, dass es passieren würde und dass der Lauf der Zeit dadurch ins Wanken geraten konnte. Das hatten wir in unserem magischen Spiegel gesehen, der den Beginn möglicher gefährlicher Kausalverläufe zeigte – gewissermaßen historische Knotenpunkte, an denen sich die Zeit aufspalten und eine falsche Richtung nehmen konnte. Manche dieser Ereignisse erschienen auf den ersten Blick unwichtig, aber sie konnten die Zukunft so nachhaltig verändern, dass sie instabil wurde – mit anderen Worten, die Welt, wie wir sie in unserer Gegenwart kannten, würde in dieser Form nicht mehr existieren. Wir selbst würden vielleicht nicht mehr existieren. Länder bekämen andere Grenzen, Völker andere Herrscher, die Geschichte nähme einen komplett anderen Verlauf, womöglich bis hin zur völligen Auflösung der Zeit selbst. Dieses bedrohliche finale Chaos nannte sich Entropie, und es war unser Job, das zu verhindern.
Das Attentat auf Lord Wykes war so ein Ereignis, das in eine Entropie münden konnte. Der Spiegel hatte es uns gezeigt. Dieser Einsatz war folglich wirklich wichtig. Und die einzige Stelle, an der wir laut der Vorhersage steuernd eingreifen konnten, war der Zeitpunkt des Angriffs. Nicht früher und nicht später, sondern – ich sah noch mal auf die Uhr – in exakt zweieinhalb Minuten.
Und Sebastiano war nicht da.
Während mir all das zusammenhanglos durch den Kopf schoss, drehte ich mich Hilfe suchend zu Ole um, der die ganze Zeit ein paar Meter entfernt von mir dagestanden und den König nicht aus den Augen gelassen hatte. Beinahe hatte ich den Eindruck, dass er Heinrich gern zu einem Zweikampf herausgefordert hätte. Am liebsten mit Schwertern. Oder genauer: mit dem großen, handgeschmiedeten Bidenhänder, der einzigen Waffe, die ein richtiger Mann seiner Meinung nach im Kampf benutzen sollte. Abgesehen vielleicht noch von der doppelten Streitaxt, messerscharf geschliffen und ebenso gut im Nahkampf wie als Wurfwaffe verwendbar. Aber natürlich hatte er auf diesem Einsatz nichts dergleichen dabei. Er trug nicht mal ein Kurzschwert oder einen Dolch am Gürtel. Sebastiano hatte gemeint, Ole sei noch nicht so weit. Nicht etwa, weil er mit diesen Waffen nicht umgehen könne, sondern weil er erst mal lernen müsse, in Krisensituationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Jetzt hatten wir eine Krisensituation, und mir wäre sehr viel wohler gewesen, wenn Ole eine Waffe dabeigehabt hätte, ob mit oder ohne kühlen Kopf. So wie es aussah, konnte nämlich momentan außer ihm niemand Lord Wykes vor dem Messerstecher beschützen, der sich – ich blickte erneut auf die Taschenuhr – in knapp zwei Minuten auf sein Opfer stürzen würde.
Die Musiker stimmten ein schnelleres Stück an, zu dem die Leute eine Gaillarde tanzen konnten. In meinen Ohren klang die Renaissance-Musik immer ein bisschen eintönig, aber die Gäste im Saal fanden sie großartig, wie man an ihren erhitzten, fröhlichen Gesichtern und ihren schwungvollen Tanzbewegungen erkennen konnte.
Meine Panik steigerte sich, als ich beobachtete, wie Lord Wykes sich von seinem Platz erhob und mit einer Verneigung vor seinem Herrscher das Podest verließ. Nach ein paar Schritten schien ihm noch etwas einzufallen, und er ging zurück, um mit einem der Wachmänner zu sprechen, die im Hintergrund unweit des Durchgangs zu den Staatsgemächern postiert waren.
Es war so weit. Nur noch eine Minute. Wir hatten keine Zeit mehr, auf Sebastianos Auftauchen zu warten. Unauffällig bewegte ich mich in Lord Wykes’ Richtung und gab Ole ein Zeichen, mir zu folgen. Irgendwie mussten wir das Problem gemeinsam lösen. Ole hatte den Ernst der Lage offenbar bereits begriffen und heftete sich unverzüglich an meine Fersen. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie Fatima vor Heinrich alle Flirt-Register zog, und auf einmal ahnte ich, dass sie nicht zufällig dort vorn am Podest stand und sich von ihm angraben ließ – es schien eher so, als wollte sie den König von dem ablenken, was hier gleich passieren würde. Gutes Mädchen. Ich sollte ihr vielleicht künftig einfach mehr zutrauen!
»Ole«, flüsterte ich über die Schulter. »Fühlst du dich imstande, mit mir zusammen den Attentäter auch ohne Hieb- oder Stichwaffe unschädlich zu machen? Ich weiß, eigentlich wäre das Sebastianos Aufgabe. Schließlich hat er die beste Nahkampferfahrung, und du hast nur … äh, was hast du da?«
Ole hatte soeben mit der größten Selbstverständlichkeit einen gigantischen Dolch aus seinem Stiefel gezogen und verbarg ihn in den Falten der ausladenden Pumphose, die er über den Seidenstrümpfen trug, während er mit lockeren Schritten auf Lord Wykes zuging. »Besser, du stellst dich an die Wand da drüben, Weib«, sagte er leise zu mir. »Dann bist du mir nicht im Weg, wenn ich den Killer aufschlitze. Ah, jetzt geht es los!«
Bestürzt fuhr ich herum, doch ich sah auf den ersten Blick nur lauter beschwingt herumhopsende Höflinge. Ole musste jedoch von seiner erhöhten Warte aus irgendwas Verdächtiges in der Menge entdeckt haben. Und dann ging plötzlich alles drunter und drüber. Irgendwo zwischen den Tanzenden ertönte ein ohrenbetäubender Knall wie von einem Chinaböller. Gleich darauf merkte ich, dass es wohl genau das gewesen war – beißender Qualm stieg auf, begleitet von dem schwefligen Gestank nach Schwarzpulver.
Ein Ablenkungsmanöver!, dachte ich erschrocken, und dann stürzte auch schon mitten aus dem aufsteigenden Rauch eine dunkle Gestalt auf mich zu, ein Mann mit einer tief in die Stirn gezogenen Kappe und einer schwarzen Maske, die sein Gesicht bis zum Kinn verdeckte. Sein weit schwingender schwarzer Umhang reichte bis zum Knie, aber ich konnte trotzdem das Messer aufblitzen sehen, das er mit der rechten Hand umklammerte. Er rannte mit weiten Sprüngen an mir vorbei, und in dem Augenblick, als er sich mit mir auf einer Höhe befand, erfasste mich das absurde Gefühl, ihn von irgendwoher zu kennen. Ich dachte nicht weiter darüber nach, was zu tun war – ich streckte einfach aus einem spontanen Impuls heraus meinen Fuß vor und stellte ihm ein Bein. Der Attentäter fiel nicht hin, geriet aber ins Straucheln und ließ das Messer fallen. Um uns herum erhob sich wildes Geschrei. Ole hatte sich schützend vor Lord Wykes aufgebaut, den Dolch kampflustig vorgestreckt. Die Wachen stürzten zum König hin und umringten ihn. Im selben Augenblick krachte ein weiterer Böller, und der schwarz maskierte Mann war mit einem Mal von dicken weißen Rauchschwaden umgeben.
Noch ein Ablenkungsmanöver! Der Schwefelgestank verschlug mir den Atem, der Rauch vernebelte meine Sicht und ließ mir die Tränen in die Augen schießen. Es dauerte ein paar Herzschläge, bis ich wieder etwas erkennen konnte. Die Frauen in meiner unmittelbaren Umgebung waren kreischend zurückgewichen, einige klammerten sich in Todesangst aneinander. Weitere Wachen erschienen wie aus dem Nichts, mit drohend gereckten Spießen formierten sie sich und bildeten eine Barriere vor dem Thron des Herrschers. Der König wurde gerade wie ein riesiger Sack mit zwei nutzlos nachschleifenden Beinen von seinen Leibwachen in seine Gemächer geschleppt. Ein paar kühne Edelmänner kamen angerannt, offenbar in der Hoffnung, sich in einen Kampf stürzen zu können. Mit wildem Blick hielten sie nach dem Angreifer Ausschau. Ich blinzelte die Tränen weg und sah mich ebenfalls nach ihm um. Doch der maskierte Mann, dessen schattenhafte Umrisse ich eben noch inmitten einer dichten Wolke aus stinkendem Pulverdampf gesehen hatte, war spurlos verschwunden.
Als das ganze Chaos sich gelegt hatte, stand ich wie betäubt einfach nur da und versuchte zu begreifen, was mir vorhin beim Anblick des Mannes durch den Kopf gegangen war. Ich hatte nur seine Gestalt gesehen, seine Bewegungen, die Linien seines Kinns unter der Maske, aber trotzdem hatte ich das untrügliche Gefühl gehabt, ihn zu kennen. Wenn ich nicht ohne jeden Zweifel gewusst hätte, dass es völlig unmöglich war, hätte ich darauf wetten mögen, es wäre … Sebastiano. Sofort schüttelte ich nachdrücklich über mich und meine blühende Fantasie den Kopf. Der Typ vorhin war einfach nur ein mordwütiger Attentäter gewesen, was sonst.
Inmitten der aufgeregt durcheinanderschnatternden Höflinge sammelte ich meine beiden Schützlinge ein.
»Das habt ihr gut gemacht«, lobte ich Fatima und Ole. »Ihr habt ein Menschenleben und die Zukunft gerettet!« Rasch schaute ich mich nach Lord Wykes um, aber er hatte den Saal zwischenzeitlich verlassen. Doch vor ein paar Sekunden hatte ich ihn noch gesehen, er war wohlauf und hatte den ganzen Tumult unbeschadet überstanden.
Ole machte einen unzufriedenen Eindruck. »Ich hatte ja gar keine Gelegenheit, irgendwas zu tun! Warum hast du ihm ein Bein gestellt, Anna?«
»Um ihn daran zu hindern, Lord Wykes zu töten.«
»Hättest du ihn einfach weiterlaufen lassen, hätte ich ihm mein Messer in sein schwarzes Herz gerammt! Dann wäre er jetzt tot statt auf der Flucht!«
»Schon klar«, stimmte ich zu. »Aber ganz ehrlich – wir ziehen es bei diesen Jobs immer vor, wenn keiner dabei sterben muss. Das solltest du dir merken, wenn du ein guter Beschützer werden willst.« Ich rieb mir die Augen, die immer noch von der Schwarzpulverexplosion brannten. »Woher hast du überhaupt den Dolch?«
Anstelle einer Antwort zuckte Ole mit den Schultern, dann sah er sich mit einem albernen kleinen Grinsen um. »Ein Mann ohne Waffe ist wie ein Ferrari ohne Gaspedal.« Er konnte es ungehindert aussprechen. Die Leute im Saal waren vollauf damit beschäftigt, sich in lärmender Aufregung über den Zwischenfall auszutauschen, keiner konzentrierte sich auf uns – der unkorrigierte Ferrari war der Beweis.
Mit halbem Ohr belauschte ich die Gespräche der Menschen um uns herum. Anscheinend kam die Mehrheit der Anwesenden gerade zu dem Schluss, dass der ganze Vorfall nur eine Art witziger Streich gewesen sein konnte. Womöglich vom König selbst inszeniert. Früher hätte er, so vernahm ich aus dem Gewirr der Bemerkungen ringsum, ein ausgesprochenes Faible für solche Narreteien gehabt, womöglich sei er gerade im Begriff, seinen alten Sinn für Humor neu zu entdecken.
»Es war sehr geistesgegenwärtig von dir, den König von mir und Ole abzulenken«, sagte ich zu Fatima, die mit geröteten Wangen und funkelnden Augen in die Runde blickte. Sie wirkte aufgekratzt und hatte ersichtlich gute Laune. Die Gefahr schien sie richtiggehend belebt zu haben.
»Ich habe nur das gemacht, was José mir aufgetragen hat«, sagte sie.
Ich war erstaunt. »José ist hier im Schloss?«
Fatima nickte. »Er winkte mich in den Gang hinaus und sagte, er habe eine wichtige Aufgabe für mich. Ich müsse dem König schöne Augen machen, damit ihm nicht auffällt, was sich an der anderen Seite des Saals tut.«
»Das ist dir gut gelungen.« Nachdenklich runzelte ich die Stirn. Keiner von uns hatte gewusst, dass José auch hier sein würde. Er war sozusagen unser oberster Chef und einer von den sogenannten Alten. Mit alt meine ich richtig alt, also mehrere tausend Jahre. José entstammte einer Art Sternenvolk, das so gut wie ausgestorben war – abgesehen von einigen wenigen, die durch die Zeit streiften und gelegentlich Unheil stifteten. Und uns damit eine Menge Arbeit bescherten, weil es unsere Aufgabe war, ihre zerstörerischen Spielchen zu durchkreuzen, unter Anleitung von José – er war einer von den Guten.
Er koordinierte unsere Zeitreisen. Außerdem kümmerte er sich in unserer neu gegründeten Zeitreise-Akademie in Venedig um den Bürokram und die historischen Archive, die Verwaltung und Beschaffung von Requisiten und die Planung unserer Einsätze. Nebenher beschäftigte er sich viel mit dem Feintuning und der Weiterentwicklung unserer erst vor Kurzem in Betrieb genommenen neuen Zeitmaschine, mit der wir wesentlich komfortabler durch die Epochen springen konnten als zuvor. Unterstützt wurde er dabei von unserem rothaarigen, sommersprossigen Physikgenie Jerry, mit dem unsere kleine Akademie komplett war.
»Oh, da ist die Königin!«, rief Fatima unvermittelt. »Ich muss unbedingt mit ihr reden!« Und schon lief sie los zu einer Gruppe vornehm gewandeter Damen, die an der Stirnseite des Saals tuschelnd die Köpfe zusammensteckten. Ich folgte Fatima und versuchte, das Schlimmste zu verhindern, doch ich kam zu spät: Fatima hatte schon losgelegt, als ich sie endlich eingeholt hatte.
»Eure hochwohlgeborene Majestät.« Fatima führte einen anmutigen Hofknicks vor, exakt so, wie ich es ihr beigebracht hatte. Auch die Anrede hätte nicht höfischer und eleganter ausfallen können. Aber damit hörte es auch schon auf.
»Ihr solltet einfach alles unterschreiben«, plapperte Fatima drauflos. »Dann kriegt Ihr die Vorzugsbehandlung bis an Euer Lebensende. Schlösser, Kleider, jede Menge Geld und so weiter. Die kleine Schlampe, die an Eurem Stuhl sägt, wird schon sehen, was sie davon hat.« Sie musterte die Hofdamen der Königin eine nach der anderen. »Ist es die da? Nein, die auf dem Bild sah anders aus. Aber egal. Unterschreibt einfach alles, dann passt es. Und geht nicht nach Deutschland zurück. In England habt ihr es viel besser. Alles klar so weit?«
Sie starrte die verstört wirkende Königin an, die stocksteif dastand und stumm zurückstarrte.
»Verzeiht, Euer Majestät, meine Zofe … Sie leidet manchmal an geistigen Aussetzern … schwere Kindheit … vom Pferd gefallen und mit dem Kopf aufgeschlagen …«, mischte ich mich stammelnd ein. Ich packte Fatima am Arm und zerrte sie hinter mir her. Sie ließ sich mitziehen, rief aber über die Schulter zurück: »Die Reihenfolge sagt alles! Geschieden, geköpft, gestorben, ge…«
An der Stelle versagte ihr gegen ihren Willen die Stimme. Sie brachte schlichtweg kein Wort mehr heraus. Das war einer der Fälle, in denen die Sprachumwandlung nicht funktionieren konnte, denn hier ging es nicht bloß um Bezeichnungen für Dinge, die es erst in der Zukunft geben würde, sondern um künftige Ereignisse. Kein Zeitreisender konnte uneingeweihte Menschen aus der Vergangenheit über Geschehnisse in der Zukunft informieren. Es funktionierte einfach nicht. Dieses natürliche Hindernis nannten wir die Sperre. Den Spruch Geschieden, geköpft, gestorben, geschieden, geköpft, überlebt, der auf ziemlich drastische Weise die Schicksale von Heinrichs sechs Ehefrauen zusammenfasste, hatte Fatima nur bis zur Nummer vier aufsagen können, weil alles Nachfolgende in der Zukunft lag.
»Na gut, ich kann’s ihr nicht sagen«, meinte Fatima wegwerfend. »Aber das Wichtigste hat sie mitgekriegt. Wahrscheinlich will sie eh die Scheidung. Sicher hat sie sich schon selber alles so ausgerechnet, sonst hätte die Sperre sowieso verhindert, dass ich es ihr sage. Aber ich dachte mir, sicher ist sicher.«
Ich war außer mir vor Empörung. »Du bringst uns noch in Teufels Küche!«
»Ich wollte doch nur ihr Bestes«, verteidigte Fatima sich. Sie löste sich aus meinem Griff und rieb sich den Arm. Ihre großen dunklen Augen füllten sich mit Tränen. »Du weißt ja nicht, wie es ist, als hilfloses Mädchen einem hässlichen, alten, fetten, jähzornigen Tyrannen ausgeliefert zu sein! Wie kann ich da nicht versuchen, das arme Ding zu unterstützen!«
Ich war bestürzt. Natürlich, sie hatte ja ein ähnliches Schicksal erlitten wie die arme Königin. »Fatima, ich wollte dir wirklich nicht zu nahe treten. Ich weiß, dass du Schreckliches durchgemacht hast …«
»Sie tut doch nur so«, meinte Ole, während er sich wieder zu uns gesellte. Er hatte sich ein Stück Braten von der Speisetafel geholt und verzehrte es mit Genuss. Wenn es irgendwo was Leckeres zu essen gab, war er nicht zu halten, er verdrückte zu jeder Mahlzeit wahre Berge. Kauend fügte er hinzu: »Sie erprobt bloß ihre Schauspielkünste an dir.«
»Was weißt du schon, du großer Ochse«, sagte Fatima schnippisch. Der jämmerliche Ausdruck war wie auf Knopfdruck von ihrem Gesicht verschwunden. Ole hatte sie anscheinend besser durchschaut als ich.
Zutiefst entnervt wandte ich mich zum Gehen. »Stellt bitte mal für eine Viertelstunde keinen Blödsinn an, ja?«
Ich wollte endlich nachsehen, wo Sebastiano steckte. Und mit José sprechen, sofern er sich noch in der Nähe aufhielt. Es musste einen Grund geben, warum er uns auf diese Feier gefolgt war.
Von José war weit und breit nichts zu sehen, dafür lief ich im Durchgang zum Hof Sebastiano in die Arme.
Mir entfuhr ein Seufzer der Erleichterung. »Gott sei Dank! Da bist du ja!« Ich konnte nicht umhin, ihn voller Liebe anzusehen. Er sah einfach großartig aus in diesem azurblauen Wams. Es hatte genau die Farbe seiner Augen. Die eleganten Strümpfe betonten seine strammen Waden, und der weiße Kragen hob seine gesunde Bräune hervor. Wenn Shakespeare, der in gut zwei Jahrzehnten auf die Welt kommen würde, je eine reale Vorlage für seinen Romeo brauchte, musste es eindeutig ein Mann wie Sebastiano sein.
»Wo warst du die ganze Zeit?«, wollte ich wissen.
Er verzog schmerzvoll das Gesicht. »Im Großen Haus der Erleichterung.«
»Du warst auf dem Abtritt?«, fragte ich ungläubig. Eigentlich hatte ich Klo gesagt, aber irgendwer in der Nähe hörte unsere Unterhaltung mit, deshalb war der intergalaktische Translator angesprungen. (Natürlich war intergalaktischer Translator nur eine Fantasiebezeichnung, die ich mir schon vor Jahren für diesen seltsamen, allen Zeitreisen anhaftenden Umwandlungs- und Übersetzungseffekt ausgedacht hatte; einen richtigen Fachausdruck gab es gar nicht dafür.)
Die dumme Frage hätte ich mir auch sparen können, zumal sie ohnehin rein rhetorisch gewesen war. Ich wusste ja, dass es sich bei dem sogenannten Großen Haus der Erleichterung um das königliche Klo handelte. Hampton Court Palace – so hieß das Schloss, es war Heinrichs Lieblingsresidenz – verfügte über das ultimative Hygiene-Highlight dieser Epoche: richtige, wassergespülte Klosetts. Heinrich hatte an nichts gespart. Für seine Gäste nur das Beste. Der Nachteil war, dass es nur achtundzwanzig von diesen Toiletten gab – für einen Hofstaat von rund tausend Leuten zuzüglich ein paar hundert ständig wechselnder Gäste nicht gerade die Optimalausstattung, weshalb die meisten Schlossbewohner weiterhin mit ihren Nachttöpfen vorliebnehmen mussten.
»Hättest du nicht einfach diesen Stuhl mit dem Deckel bei uns auf dem Zimmer benutzen können?«, fragte ich, diesmal deutlich leiser, für den Fall, dass aufmerksame Zuhörer in der Nähe waren.
»Der war auf einmal nicht mehr da. Die Dienerschaft muss ihn weggeräumt haben. Also den Topf. Nicht den Stuhl, der stand noch da. Aber ohne Topf … Nun ja. Es war dringend, ich muss was Schlechtes gegessen oder getrunken haben. Außerdem wollte ich mir diese Wassertoiletten sowieso gerne mal ansehen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass mir beim Verlassen des Örtchens jemand eins überziehen würde.«
»Du wurdest niedergeschlagen?«, rief ich entsetzt.
»Pst, nicht so laut, wer weiß, was für Gestalten sich hier herumtreiben!« Sebastiano sah sich nach allen Seiten um, dann legte er den Arm um mich und zog mich in einen Arkadengang, der einen von Fackeln erleuchteten Hof umschloss. »Erzähl mir erst mal rasch, wie es gelaufen ist. Seid ihr allein mit dem Attentäter fertiggeworden?«
»Ja, zum Glück. Ich konnte ihm ein Bein stellen, als er auf Lord Wykes losgehen wollte. Er zündete dann zur Ablenkung eine Ladung Schwarzpulver und haute ab, aber wenigstens ist Lord Wykes nichts passiert.« Voller Sorge blickte ich ihn an. »Wer hat dich niedergeschlagen? Und warum?«
»Keine Ahnung. Ich wünschte, ich wüsste es. Konntest du wenigstens sehen, wer der Attentäter war?«
»Nein, er trug eine Maske.« Zögernd fuhr ich fort: »Es hört sich jetzt sicher total verrückt an, aber für eine Sekunde dachte ich, du wärst es.«
Sebastiano sah mich erstaunt an, dann lachte er ungläubig. »Du meinst, der Kerl sah aus wie ich?«
»Ich dachte nicht, dass er aussieht wie du. Sondern dass du es selbst wärst. Dabei war wirklich kaum was von dem Mann zu sehen. Es war nur … so ein Eindruck. Also eher so ein Gefühl.« Ich schüttelte den Kopf. »Vergiss es. Es war einfach nur ein Typ von deiner Größe und Statur. Anscheinend habe ich ein bisschen überkompensiert, weil ich mir so intensiv gewünscht hatte, dass du endlich auftauchst.«
»Schöne Wunscherfüllung, wenn ich auf einmal in Gestalt des Attentäters erscheine«, meinte Sebastiano trocken. »Wobei nicht außer Acht gelassen werden sollte, dass ich die ganze Zeit über bewusstlos vor dem Großen Haus der Erleichterung auf dem Pflaster gelegen habe. Wo ich wahrscheinlich immer noch liegen würde, wenn mich nicht ein unfreundlicher Edelmann mit einem Tritt in die Seite geweckt hätte. Er dachte, ich hätte einen über den Durst getrunken. Jetzt weiß ich nicht, welche Prellung mir mehr wehtut. Die oder die hier.« Er rieb sich zuerst die Rippen und dann den Hinterkopf. Dabei verzog er erneut schmerzvoll das Gesicht. »Ich glaube, mein Schädel gewinnt. Ob sie drüben im Küchentrakt ein bisschen Eis zum Kühlen haben?«
In den Kellergewölben des Schlosses gab es sicher welches. Schon in frühen Jahrhunderten hatte man im Winter das Eis von Seen und Teichen gehackt und es dick mit Stroh umwickelt in kühlen Kellerräumen aufbewahrt, sogar bis in den Sommer hinein.
»Ich könnte mich rasch erkundigen«, schlug ich vor.
»Nein, das war nicht ernst gemeint.« Er grinste ein wenig kläglich. »Ich werd’s schon überstehen, ist ja nicht die erste Beule.«
Damit hatte er leider recht. Bei unseren vorangegangenen Abenteuern hatte Sebastiano schon schlimme Verletzungen davongetragen. Vor nicht allzu langer Zeit war er während eines Einsatzes in London im Jahr 1813 während eines Duells angeschossen worden. Ich hatte ernstlich um sein Leben bangen müssen, weil Mr Fitzjohn – ein durchtriebener Erzschurke und ebenfalls einer von den Alten – sämtliche Zeitportale zerstört hatte und wir deswegen in der Vergangenheit festsaßen. Ohne Antibiotika und professionelle ärztliche Erstversorgung wurde in früheren Epochen unweigerlich aus jeder gefährlichen Wunde eine Angelegenheit auf Leben und Tod. Nicht mal José hatte uns in dieser Situation aus der Klemme helfen können.
Sebastiano beugte sich zu mir herunter und küsste mich auf die Nasenspitze. »Einen Penny für deine Gedanken.«
»Ich dachte gerade an José. Wusstest du, dass er hier ist?«
»Nein«, sagte Sebastiano überrascht. »Seit wann denn?«
»Keine Ahnung.« Verwundert hielt ich inne. »Oh, sieh nur, da ist er ja!« Ich blickte über Sebastianos Schulter hinweg. Am Ende des Arkadengangs stand José. Er nickte uns sorgenvoll zu, als wir näher kamen.
»Mit dir haben wir hier ehrlich gesagt nicht gerechnet«, meinte Sebastiano. »Ist irgendwas passiert?«
»Ach, bloß ein paar unvorhersehbare Turbulenzen in der Zeit«, erwiderte José vage. »Ich habe aber alles im Griff.«
Sein Gesicht mit der schwarzen Augenklappe wirkte im flackernden Schein der Fackeln beinahe dämonisch. Bei Tageslicht hätte ihn jeder einfach nur für einen einäugigen alten Mann gehalten, schmächtig und nicht besonders groß. Keiner wäre auf den Gedanken gekommen, dass er bereits länger lebte als jeder andere sterbliche Mensch. Zur Zeit der spanischen Inquisition hatte er sich einen klangvollen Namen zugelegt – er nannte sich José Marinero de la Embarcación.
Er hatte so seine Geheimnisse und erzählte uns längst nicht alles, was er wusste oder plante. Nach und nach war ich dahintergekommen, dass er uns nicht aus Schikane über manche Dinge im Unklaren ließ, sondern weil er damit gewährleisten wollte, dass wir unsere Aufgaben als Zeitwächter besser erfüllen konnten. Jerry, unser Physik- und Mathe-Genie, hatte uns erklärt, dass es irgendwelche hochkomplizierten Algorithmen gebe, nach denen der Erfolg einer Mission in manchen Fällen wahrscheinlicher sei, wenn die damit betrauten Zeitwächter nicht alle Risiken kannten. Jerry hatte mir sogar seine Berechnungen dazu gezeigt. Nicht, dass ich sie verstanden hätte – bei mir befand sich dort, wo andere Menschen ein natürliches Mindestmaß an mathematischem oder physikalischem Grundverständnis aufwiesen, nur so eine Art Schwarzes Loch. Es gibt sogar ein Fachwort dafür: Dyskalkulie.
In meiner Schulzeit war es mir peinlich gewesen, ständig mit schlechten Mathenoten nach Hause zu kommen – kein Wunder, meine Mutter war eine ziemlich bekannte Physikprofessorin und der Ansicht, dass sämtliche Gesetze der Genetik in meinem Fall versagt haben mussten, mit der Ausnahme, dass ich ihre hellen Haare und ihre zierliche Gestalt geerbt hatte. Mein Vater hatte das oft tröstend zu relativieren versucht, etwa mit dem Argument, dass meine Begabungen halt woanders lägen – unter anderem hätte ich doch immer sehr schöne Deutschaufsätze geschrieben und außerdem eine rasche Auffassungsgabe beim Erlernen von Fremdsprachen.
Davon abgesehen besaß ich noch andere Begabungen, von denen meine Eltern allerdings nie etwas erfahren würden. Dass ich ständig in die Vergangenheit reiste, um gefährliche Abweichungen im Kausalverlauf zu verhindern, konnte ich ihnen nicht erzählen – die Sperre verhinderte es ebenso zuverlässig, wie sie dafür sorgte, dass man uneingeweihten Menschen in der Vergangenheit nichts über die Zukunft verraten konnte. Und Sebastiano und ich konnten nicht etwa eigenmächtig bestimmen, wer zu den Eingeweihten gehörte, weil die Betreffenden dazu eine gewisse Veranlagung mitbringen mussten. Manche Menschen konnten durch die Zeit reisen oder die Zeitreisenden in den jeweiligen Epochen vor Ort unterstützen, doch wer sich für den Job als Zeitwächter oder Gehilfe eignete, blieb Josés Geheimnis. Er teilte uns lediglich mit, wen wir als Schüler für unsere Zeitreise-Akademie rekrutieren sollten, und er regelte auch, wer als Helfer an unseren jeweiligen Zielorten auf uns wartete und sich dort um Dinge wie Unterbringung, Begleitschutz und dergleichen kümmerte.
Nur eine Sache war sonnenklar: Die gefährlichen Störungen im Zeitgefüge kamen nur selten von allein zustande. Meist beruhten sie auf absichtlichen Manipulationen der Alten. Ein versprengtes Häuflein dieses prähistorischen Volkes aus einer längst zu Sternenstaub zerfallenen Galaxie hatte sich vor vielen Jahrhunderten auf der Erde angesiedelt und trieb sein Spiel mit der Zeit. Das war durchaus wörtlich zu verstehen – diese Alten betrachteten einzelne Epochen als ihre Beute und bewegten sich durch die Zeit wie auf einem unendlich großen Spielfeld. Immer wieder versuchte einer von ihnen, sich ein Stück der Zeit als Trophäe herauszuschneiden, ohne Rücksicht darauf, ob dabei das Große und Ganze in Gefahr geriet. Es war ihr Sport und ihr Hobby. Manche von ihnen wurden auch von unerbittlichen Feindschaften angetrieben, die sie untereinander hegten. Um ihre Fehden zu befeuern, scheuten sie sich nicht, rücksichtslos das Leben vieler Menschen sowie deren Zukunft aufs Spiel zu setzen – im wahrsten Sinne des Wortes.
»Ich wurde hinterrücks niedergeschlagen«, erklärte Sebastiano ohne Umschweife. »Außerdem denke ich, dass mir jemand ein Abführmittel ins Essen oder in den Wein gemischt und vorsorglich in Annas und meinem Gemach den Nachttopf weggeräumt hat, damit ich das Große Haus der Erleichterung aufsuche, wo der Betreffende mir dann auflauerte. Jemand wollte wohl sicherstellen, dass ich das Attentat nicht verhindere.«
José wirkte nicht sonderlich überrascht. »Ich sagte ja, es gab ein paar Turbulenzen in der Zeit«, sagte er.
»Hättest du denn nicht verhindern können, dass Sebastiano niedergeschlagen wird?«, wollte ich wissen.
»Ich tat das, was der Situation am angemessensten war«, meinte José nur lapidar. »Außerdem bin ich hier, um euch darüber zu informieren, dass es einen neuen Schüler gibt. Er heißt Walter, ist fünfzehn Jahre alt und der Enkel von Lord Wykes. Ihr habt bis morgen Vormittag Zeit, ihn auf seine neue Aufgabe vorzubereiten, dann geht es zurück in die Gegenwart. Gemeinsam mit Walter Wykes.«
»Hat dieser Walter Wykes denn schon eine Ahnung, was ihn erwartet?«, erkundigte ich mich vorsorglich.
»Du meinst, ob ich ihm gegenüber bereits angedeutet habe, dass er demnächst als Schüler einer Zeitreise-Akademie in der Zukunft leben wird?« José zwinkerte mit seinem gesunden Auge, er wirkte leicht amüsiert. »Ich fürchte, das werdet ihr ihm erklären müssen. Leider muss ich kurzfristig weiter. Ich hole euch morgen um elf Uhr Ortszeit mit der Zeitmaschine ab. Wir treffen uns an der Stelle wieder, wo ich euch heute abgesetzt habe.«
Und damit drehte er sich um und verschwand mit schnellen Schritten in den Schatten der Arkaden.
»Wir sollten diesen Walter Wykes suchen«, sagte ich. »Wenn er schon morgen früh mit uns kommen soll, bleibt uns nicht mehr viel Zeit, ihm alles zu erklären. Und ich muss dringend nach Fatima und Ole sehen, bevor die beiden wieder irgendwelchen Unfug anstellen.«
»Gleich«, sagte Sebastiano. »Vorher haben wir noch was Wichtiges zu erledigen.« Er fasste mich bei der Hand und zog mich tiefer in die Schatten hinein, dorthin, wo kein Fackellicht die dunklen Ecken des Hofs erhellte.
»Hier«, sagte er. »Das ist genau die richtige Stelle.«
»Wofür denn?«, fragte ich ein wenig verwirrt.
»Für das hier«, meinte er. Und dann zog er mich in seine Arme und küsste mich.
Unser Gehilfe vor Ort hieß Archibald Cuthbert und war die rechte Hand des Hofmarschalls. Er war um die vierzig und sah aus wie eine Kreuzung aus Bestattungsunternehmer und Severus Snape beziehungsweise dem Schauspieler, der Snape spielte. Sein strähniges dunkles Haar umrahmte ein düsteres Gesicht mit einer vorspringenden Nase, und die meiste Zeit machte er eine Miene, als würde er lieber sterben, als aus Versehen zu lächeln.
Trotz der ihn umgebenden Melancholie hatte er sich bisher als verlässlicher Helfer erwiesen. Er hatte uns als vermeintliche Adelsgäste bei Hofe eingeschleust und dafür gesorgt, dass wir strategisch günstig gelegene Gemächer erhielten. Ohne solche Gehilfen – wir nannten sie auch Boten – hätten wir es ziemlich schwer gehabt, in der Vergangenheit zurechtzukommen. Cuthbert war ein zuverlässiger und erfahrener Bote. Als Eingeweihter wusste er, dass wir Zeitreisende auf einer wichtigen Mission waren, auch wenn die Sperre verhinderte, dass wir ihm Details über die Zukunft verraten konnten. Wie fast alle unsere Gehilfen in früheren Epochen handelte er nicht nur aus reinem Idealismus, sondern verfolgte damit auch handfeste praktische Interessen – für seine loyale Unterstützung wurde er von José reichlich entlohnt, und sollten er oder seine Familie je in Not geraten, würde auch in diesem Fall für alles gesorgt.
»Über Walter Wykes gibt es nicht viel zu sagen«, erklärte Cuthbert, als Sebastiano und ich ihn über den Jungen ausfragten, den wir als neuen Schüler rekrutieren sollten. »Es heißt, er liebt das Lesen. Bücher bedeuten ihm offenbar mehr als die Jagd.«
»Das klingt doch schon mal positiv«, meinte ich.
»Nun, in diesem Fall trifft diese Einschätzung zweifellos zu, denn auf der Jagd würde er gewiss vor Angst vom Pferd fallen und sich den Hals brechen. Walter gilt als ausgesprochener Hasenfuß.«
Das klang schon weniger gut. Ein Hauch von Sorge machte sich in mir breit. Ängstlichkeit war nicht unbedingt eine wünschenswerte Eigenschaft, wenn es ums Zeitreisen ging.
»Walters Großvater, Lord Arthur Wykes, ist einer der königlichen Berater«, fuhr Cuthbert fort. »Nicht der wichtigste, aber auch nicht so unwichtig wie manche andere. In der letzten Zeit hält der König ihn jedoch auf Abstand. Es steht außer Frage, dass Lord Wykes’ Stern bei Hofe im Sinken begriffen ist, so ähnlich wie der von Cromwell. Ob und wann Wykes und Cromwell als Berater aber endgültig in Ungnade fallen, kann niemand sagen.« Er warf Sebastiano einen Blick zu. »Außer vielleicht Ihr, Mylord, da Ihr ja aus einer fernen Zukunft kommt und es wissen müsst.«
Darauf ging Sebastiano nicht ein, denn die Sperre hätte es sowieso nicht zugelassen. Und Cuthbert schien es auch gar nicht zu erwarten, denn er blickte nur auf seine gewohnt düstere Weise vor sich hin.
Als er den Namen Cromwell erwähnt hatte, war mir ein kleiner Gruselschauer über den Rücken gelaufen. Denn ich wusste ja, was besagtem Cromwell demnächst zustoßen würde – man würde dem armen Kerl, der dem König sein Leben lang treu gedient hatte, noch in diesem Sommer den Kopf abschlagen. Heinrich der Achte ließ nicht nur seine Ehefrauen köpfen, wenn er sauer auf sie war. Alle möglichen Leute, die sich bei ihm unbeliebt machten, fanden sich in Nullkommanichts auf dem Schafott wieder. Bis zum Ende seiner Regentschaft würde er es auf über siebzigtausend Hinrichtungen bringen. Seine blutrünstige und jähzornige Ader war auch ein Grund dafür, dass wir auf dieser Mission besonders gut auf uns aufpassen mussten. Heinrich war fast so cholerisch wie die Herzkönigin in Alice im Wunderland, die ständig »Kopf ab!« gerufen hatte, wenn ihr jemand nicht passte.
»Master Cuthbert, könnt Ihr es bewerkstelligen, dass wir den jungen Walter Wykes so schnell wie möglich sprechen?«, erkundigte Sebastiano sich. »Ich weiß, dass es sehr spät ist, aber es ist unaufschiebbar.«
»Selbstverständlich.« Cuthbert deutete eine Verbeugung an. »Ich werde ihn umgehend herholen.« Geräuschlos zog er sich zurück und verließ den Raum.
Es war schon nach Mitternacht. Das Feuer im Kamin unseres Gemachs war längst erloschen. Auf einem Wandbord brannte ein Leuchter mit acht Kerzen, die allerdings nicht besonders viel Licht spendeten und außerdem ziemlich penetrant qualmten und vor sich hin stanken. Im sechzehnten Jahrhundert war die Beleuchtung ein Kapitel für sich. Wenn man nicht ständig brennende Kerzen oder Fackeln dabeihatte, saß man schnell im Dunkeln.
Cuthbert hatte uns zwei Kammern zugewiesen. In der kleineren übernachtete Fatima, in der anderen schliefen Sebastiano und ich. Ole nächtigte auf einem Strohsack im Stall, was auch der Grund dafür war, dass mein Versuch, seine Stellung ihm gegenüber ein bisschen aufzuwerten, nicht wirklich überzeugend rübergekommen war. Ob er sich nun Knappe oder Knecht nannte – unterm Strich machte es kaum einen Unterschied, denn es war in diesen alten Zeiten einfach üblich, dass die Diener, die sich um die Pferde kümmerten, in deren unmittelbarer Nähe ihr Nachtlager aufschlugen, damit sie nicht so weite Wege hatten.
Dabei war es gar nicht die rustikale Umgebung, an der Ole sich störte; schließlich hatte er wie alle Wikinger im zehnten Jahrhundert in einem zugigen, dreckigen Langhaus zusammen mit Dutzenden ungewaschener Menschen auf einem Stapel flohverseuchter Felle geschlafen, nur durch ein paar Bretter von Kühen und sich im Schlamm suhlenden Schweinen getrennt. Ihm ging es bei der ganzen Sache eher darum, dass er auf keinen Fall irgendein sozialer Niemand sein wollte. Schließlich war er der Sohn eines Jarls, was hier bei Hofe so was wie ein Earl war, mindestens. Er fand daher, dass die Rolle, die er bei dieser Zeitreise innehatte, seinem Status nicht ausreichend gerecht wurde. Bevor wir uns vorhin eine gute Nacht gewünscht hatten, hatte er Sebastiano noch einmal trotzig seine Meinung mitgeteilt.
»Nicht genug, dass ich mir von einem Mädchen Befehle erteilen lassen muss, das mir kaum bis zur Schulter reicht und nur wenig älter ist als ich. Ich darf nicht einmal auf ehrenvolle Weise gegen einen Attentäter kämpfen.« Seine nächsten Worte hatten seine ganze Empörung zum Ausdruck gebracht. »Stattdessen muss ich zusehen, wie sie ihm ein Bein stellt und ihn damit vertreibt. Und anschließend muss ich wie hundert andere niedere Knechte im Heu nächtigen.« Nachdem er das losgeworden war, hatte er noch zusammenhanglos hinzugefügt: »Beim nächsten Einsatz will ich ein Ritter sein und meinen Bidenhänder tragen. Und eine Tapferkeitsmedaille an einem goldenen Band.«
Was sollte man darauf noch sagen? Ich hegte die schwache Befürchtung, dass wir uns mit dem Enkel von Lord Wykes möglicherweise einen ähnlich schwierigen und launischen Kandidaten einhandelten.
Sebastiano blätterte in einem der Folianten, die auf dem Wandbord standen – eine Rarität, die in diesen Jahren noch nicht häufig zu finden war: ein gedrucktes Buch.
»Spannend?«, fragte ich.
»Geht so. Ist ein Gedichtband. Stammt anscheinend vom König selber. Er hat ja früher viel gedichtet und komponiert.«
Ich setzte mich auf den Rand unseres großen, mit Seidenvorhängen abgehängten Pfostenbettes und unterdrückte ein Gähnen. Wir hatten es am Hofe von Heinrich dem Achten ziemlich komfortabel. Der König hatte vor Jahren den Palast, der früher einem Erzbischof gehört hatte, aufwändig ausgebaut und saniert. Hier in Hampton Court war alles vom Feinsten, und das galt auch für den Service. Die Laken waren frisch gewaschen und geplättet, die Federbetten mit Daunen gefüllt, und vor dem Fest hatten wir sogar ein Bad nehmen können, in einem funkelnagelneuen Holzzuber mit richtig heißem Wasser. Mehrere Hausknechte hatten in rascher Folge dutzendweise dampfende Eimer herangeschleppt, und die Zimmermädchen hatten für Handtücher und parfümierte Seife gesorgt. Personal gab es im Schloss in Hülle und Fülle. Hunderte von Dienstboten schwirrten ständig durch die Gänge und Gemächer und sorgten unermüdlich dafür, dass die Gäste und Höflinge des Königs es bequem hatten und nichts entbehren mussten.