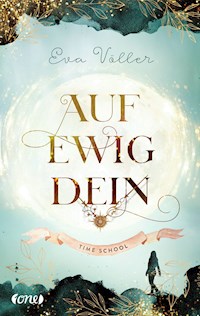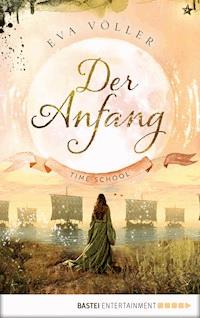Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lübbe Audio
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Ich liebe dieses Haus mehr als mein Leben!", sagte ich verzweifelt. "Ich würde eher sterben, als es aufzugeben!" Der Bankdirektor betrachtete mich mitleidig. "Glauben Sie mir, manche alten Häuser stößt man besser ab, statt sich dafür Schulden aufzuhalsen." "Was heißt alt?! Es ist genauso alt wie ich!" Er blätterte den Kreditantrag durch und legte den Finger auf die Stelle mit meinem Geburtsdatum. "Äh, ja. Nun, ich fürchte, dann ist es schlimmer als ich dachte."Annabells Nerven liegen blank. Nicht, dass die anstehende Haussanierung und der Alltag als alleinerziehende Mutter dreier ebenso liebenswerter wie nervtötender Kinder schon aufreibend genug wären. Nein, jetzt taucht plötzlich ihre chaotische Hippie-Mutter auf, um zu "helfen". Und dann droht auch noch zusätzliche familiäre Unterstützung - von Annabells äußerst resoluter Schwiegermutter...
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Zeit:6 Std. 36 min
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
CoverInhaltÜber die AutorinTitelImpressumWidmungVorspannMy home is my castleDurch Weisheit wird ein Haus gebaut und mit viel Geld erhalten.Neues Dach bringt UngemachDie Axt im Haus erschlägt den Zimmermann.Bau, schau wie.Trautes Heim, Glück alleinÜber die Autorin
Eva Völler hat sich schon als Kind gern Geschichten ausgedacht. Trotzdem hat sie zuerst als Richterin und später als Rechtsanwältin ihre Brötchen verdient, bevor sie Juristerei und Robe schließlich endgültig an den Nagel hängte.
»Vom Bücherschreiben kriegt man auf Dauer einfach bessere Laune als von Rechtsstreitigkeiten. Und man kann jedes Mal selbst bestimmen, wie es am Ende ausgeht!«
Die Autorin lebt mit ihren Kindern am Rande der Rhön in Hessen.
Eva Völler
Leg dich nichtmit Mutti an
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originausgabe
Copyright © 2012/2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Gisela Günther, München
Titelillustration: © Fantasio fine Arts/Oliver Wetter
Umschlaggestaltung: Manuela Städele unter Verwendung einer Illustration von Fantasio fine Arts, Oliver Wetter
Datenkonvertierung E-Book:
hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-8387-1528-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für meine geliebte Mama, treueste Helferin in allen Haus- und sonstigen Krisen und nicht im Entferntesten Vorlage für Figuren dieses Romans!
Was Sie vorher wissen sollten:
Die Namen aller Handwerker, Bankdirektoren, Anwälte, Zeitungen/Zeitschriften, Reporter und Verbrecher in diesem Roman sind frei erfunden. Die aller übrigen Personen auch.Für zufällige Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen wird nicht gehaftet.Noch eine gut gemeinte Warnung: Falls Sie vorhaben, in absehbarer Zeit Ihr Haus zu renovieren und dafür einen Kredit aufzunehmen, sollten Sie das vielleicht noch einmal überdenken. Sonst könnte es sein, dass Sie Albträume bekommen. Oder einen Dachdecker, von dem Sie sich wünschen, er wäre bloß ein Albtraum. In letzterem Fall gilt Obengesagtes zu 2.
My home is my castle
(Edward Coke, 16. Jh., englischer Jurist und Politiker)
»Du solltest jetzt lieber das Haus verlassen«, warnte mich Leonardo di Caprio, »es könnte jeden Moment zusammenbrechen.«
Tatsächlich rieselte schon der Putz von der Decke. Von ferne war ein Rumpeln zu spüren, das ständig näher kam. Schließlich erfasste es die Mauern des Hauses und brachte es zum Wanken. Es war nur noch eine Sache von Sekunden, bis es einstürzen würde. Leonardo DiCaprio schien sich nicht daran zu stören. Für mich war jedoch alles bitterer Ernst. Um mich herum wackelte und dröhnte es, Putz fiel von den Wänden, Mauerstücke lösten sich, ganze Betonplatten barsten heraus und krachten direkt vor meinen Füßen zu Boden. Ich schmeckte den staubigen Mörtel auf der Zunge.
Es war mir peinlich, aber ich musste vor Leonardo ausspucken, der Geschmack war einfach zu eklig. Zum Glück schaute er gerade nicht hin, sondern verfolgte mit Interesse, wie meine Habseligkeiten nach und nach unter den herabstürzenden Trümmerstücken begraben wurden und das Haus sich stückweise in eine Ruine verwandelte. Mein Kleiderschrank hielt noch eine Weile stand, dann brach er auseinander und versank im Schutt. Ein paar Schuhe flogen durch die Gegend und landeten verdreckt und zerfetzt in der Ecke. Es waren die teuren italienischen Pumps, die ich mir neulich in einem Anfall von Leichtsinn gegönnt hatte.
»Hilf mir!«, flehte ich Leonardo an.
Doch er lächelte nur bedauernd und strich sich mit beiden Händen den Mörtelstaub von seinem makellosen Smoking. »Da musst du jetzt durch«, sagte er. »Nur aus dem Zusammenbruch kann Neues entstehen. Du weißt schon, wie Phönix aus der Asche und so.«
Während ich noch überlegte, was er mir damit sagen wollte, knallte ein riesiges Trümmerstück aus der Decke auf meinen Kopf.
Vor meinem geistigen Auge blinkte eine Schlagzeile auf.
Frau im Schlaf von einstürzendem Dach erschlagen – sie ahnte nichts Böses und war sofort tot.
*
Ruckartig fuhr ich hoch, ich musste ein paar Mal heftig Luft holen, bis ich die Benommenheit abgeschüttelt hatte.
Es hatte sich so echt angefühlt! Das war leider der Fehler an den wirklich guten Filmen. Sie beeindruckten einen so sehr, dass sie einen bis in die Träume verfolgten. Eine Zeit lang hatte ich beispielsweise geträumt, mit einem gut aussehenden, muskulösen Avatar auf einem feuerroten Drachen über Pandora zu fliegen. Einmal hatte der Drache Schlagseite bekommen, weil ich zu viel wog, jedenfalls behauptete der Avatar das, während wir trotz der geringen Schwerkraft des Planeten rasend schnell an Höhe verloren.
Gleich am nächsten Tag hatte ich mit Saftfasten angefangen.
Im Jahr darauf gingen die Albträume über die zusammenbrechenden Häuser los, gleich nachdem ich Inception gesehen hatte. Diese Träume hatte ich leider immer noch ziemlich oft, vielleicht auch deshalb, weil ich mir den Film nicht nur im Kino, sondern später auch noch einmal auf DVD angeschaut hatte. Meine Freundin Berit meinte, wenn ich weiter solche Albträume hätte, müsse ich in Betracht ziehen, mich in Therapie zu begeben. Doch ich hoffte, dass es von allein nachließ. Allerdings gab es Grund, daran zu zweifeln, denn gerade der Ruinen-Traum hatte starke Bezüge zur Realität.
Ich setzte mich im Bett auf, knipste die Nachttischlampe an und wischte mir den Mörtelstaub ab, der über Nacht auf mich herabgerieselt war. In meinem Zimmer war die Decke nicht tapeziert, sondern mit Feinputz versehen, der seine besten Jahre schon lange hinter sich hatte. Er löste sich allmählich in Wohlgefallen auf, nur dass diese Floskel in dem Fall nicht wirklich passte, denn von gefallen konnte keine Rede sein, es sei denn im Sinne von runtergefallen. Ich hatte mein Bett schon ein paar Mal verschoben, doch die Rieselstellen breiteten sich aus. Fast so, als verfolgten sie mich.
Mühsam kämpfte ich mich aus dem Bett und tastete gleichzeitig nach der Nachttischlampe. Die Leuchtziffern auf dem Wecker zeigten halb sechs. Ich hätte mich noch für eine halbe Stunde aufs Ohr legen können, doch es war besser, wenn ich als Erste ins Bad ging. Später könnte es knapp werden. Wenn sich vier Personen ein Badezimmer teilen mussten, hatten nur Frühaufsteher gute Karten. Wer unbedingt länger schlafen wollte, musste ohne zu duschen aus dem Haus. Neuerdings konnte der ungeduschte Zustand allerdings auch mit dem Boiler zusammenhängen. Irgendetwas hinderte ihn daran, zuverlässig warmes Wasser auszuspucken, man musste sich auf minutenlange Wartezeiten einstellen.
Auf dem Weg ins Bad stieß ich mit dem Fuß gegen die Schüssel, die ich am Vorabend aufgestellt hatte. Eisiges Wasser platschte bis zu meinen Knien hoch, ich schrie auf und hüpfte fluchend auf einem Bein herum. Die Schüssel war voll, oder genauer: Sie war voll gewesen, bevor ich dagegengetreten hatte. Die Wetterfrösche hatten recht gehabt. Es hatte geregnet. Und zwar durchs Dach. Genau an derselben Stelle wie beim letzten Mal. Da seither niemand das Loch geflickt hatte, war es nur eine Frage der Zeit gewesen, dass es wieder passierte.
Während ich mit nassen Füßen zum Bad tappte, schwang im Flur wie von Geisterhand ein Fenster auf. Der Wind drückte es nach innen, weil es nicht mehr richtig schloss. Der Griff war kaputt, seit … vier Wochen ungefähr. Ich hatte den exakten Zeitpunkt vergessen, aber er fiel in etwa zusammen mit dem ersten Klopfen. Das Klopfen kam aus dem Badezimmer, wahrscheinlich aus den Leitungen. Oder aus dem Boiler. So genau wollte ich es gar nicht wissen.
Merkwürdig war dabei nur, dass alles auf einmal zu kommen schien. Sonst war immer alles nach und nach passiert, hübsch der Reihe nach, gerade in so großen Abständen, dass man sich daran gewöhnen konnte. Das lockere Geländer, die losen Bodendielen. Zuerst ein bisschen lästig, dann aber irgendwie, na ja, charmant. Alte Häuser sind halt so. Die haben ihre kleinen Verschleißerscheinungen. Da bröckelt schon mal der Putz, da klopfen die Leitungen, da knarren die Türen.
Die knarrten übrigens ganz schrecklich. Timo war der Meinung, wir hätten Geister im Haus, die nichts anderes zu tun hätten, als den ganzen Tag die Türen knarren zu lassen. Er war davon überzeugt, dass diese Geister in den Türangeln wohnten. Neulich hatte er ganz ernsthaft von den »Geistern in der Tür« gesprochen, und er hatte sehr ängstlich dabei ausgesehen. Ich hatte ihm das Knarren erklärt und es sogar vorgeführt (»Siehst du, jetzt mache ich die Tür auf, und sie knarrt. Und nun mache ich sie zu, und sie knarrt noch mal – das liegt an dem alten Holz. Es ist krumm geworden, daher kommt das!«), doch er blieb dabei, dass Geister ihre Hände im Spiel hatten. Ich hatte die Angeln geölt, aber das hatte die Geister leider nicht beeindruckt.
Im Bad stieg ich in die Duschkabine und drängte mich dicht an die Wand, als ich das Wasser andrehte. Das Klopfen wurde lauter, es verwandelte sich in ein Hämmern. Das Wasser rauschte, meist dauerte es eine Weile, bis es heiß wurde. Doch diesmal wurde es nicht einmal lauwarm. Irgendetwas im System hatte endgültig versagt. Es war so weit. Das Haus brach zusammen, der Albtraum hatte prophetischen Charakter gehabt. Leonardo hatte mich gewarnt, doch ich hatte nicht hören wollen.
Ich fing an zu weinen, weil mir der Fuß von der blöden Schüssel wehtat. Und weil das Wasser nicht warm wurde. Und weil alles so furchtbar war.
Mit Todesverachtung duschte ich mich kalt ab, auch das Gesicht, damit ich nachher beim Frühstück nicht verheult aussah. Nicht, dass die Kinder sonderlich darauf achteten, wie ich aussah. Aber wenn es mir so richtig mies ging, merkten sie es merkwürdigerweise sofort. Dafür hatten sie eingebaute Antennen.
An diesem Tag half auch das kalte Wasser im Gesicht nicht viel. Als ich aus der Duschkabine stieg, flossen die Tränen immer noch. So konnte es nicht weitergehen! Wie sollten wir ohne warmes Wasser auskommen? Wie lange wollte ich noch tatenlos den rieselnden Putz, die tropfenden Löcher im Dach, die kaputte Dusche ertragen? Den Kindern schien es nicht viel auszumachen, man konnte schon fast sagen, dass sie es gar nicht anders kannten (obwohl Sophie und Benedikt die kaputte Dusche garantiert nicht auf Dauer dulden würden!), und allein diese Tatsache machte alles noch viel schlimmer. Wie konnte ich meiner Familie das nur zumuten? Wie hatte ich es so weit kommen lassen können? Wie konnte ich länger hinnehmen, dass mein geliebtes Zuhause derartig herunterkam?
Na schön, ich hatte kein Geld für die nötigen Reparaturen. Aber war das ein Argument? Nein!
Schließlich lebten wir im Zeitalter der Immobilienblasen. Die ganze Welt drehte sich um Grundstückskredite; Hypotheken waren quasi ein Must-have. Ich ging bloß mit der Zeit, wenn ich mir auch eine zulegte.
Ich musste an meinen Albtraum mit Leonardo denken, an Phönix aus der Asche. Der Traum war ein Zeichen, ganz klar. Er hatte mir sagen wollen: Handle, bevor es zu spät ist!
»Heute!«, schwor ich meinem Spiegelbild mit lauter Stimme. »Heute tu ich es!«
Noch an diesem Tag würde ich die Weichen für die Zukunft neu stellen.
*
Ich ging im Bademantel nach unten und überlegte, was ich zur Weichenstellung anziehen sollte. Nicht, dass ich mir je Gedanken gemacht hätte, in welchen Klamotten ich zur Arbeit ging. Es war meist das Übliche, Jeans, T-Shirts, Blusen, Pullis, im Sommer Sandalen oder Ballerinas, im Winter Stiefeletten oder warme Schuhe.
Doch an diesem besonderen Tag, dem Tag meines großen Entschlusses, war seriöse Kleidung ein Muss. Rock und Pumps waren das Mindeste. Ich musste aussehen wie eine Frau, der man gern Geld lieh, weil bereits ihr Äußeres ein grundsolides Wesen signalisierte.
Ich deckte eilig den Frühstückstisch und warf die Kaffeemaschine an, dann ging ich wieder nach oben.
Eine Viertelstunde später stand ich fertig geschminkt und angezogen vor dem Spiegel in meinem Schlafzimmer. Gerade geschnittener Rock, Bluse, Blazer. Zeitlos und gediegen, von der Sorte, die auch nach zehn Jahren noch ordentlich aussieht. Alles in vertrauenerweckend dezenten Farbtönen. Dazu suchte ich passende Schuhe aus, geschmackvolle, aber nicht zu elegante Pumps. Auf keinen Fall die neuen italienischen, ich wollte nicht den Eindruck erwecken, verschwendungssüchtig zu sein.
Als ich wieder nach unten ging, röhrte durch die geschlossene Tür von Benedikts Zimmer die Stereoanlage.
Ich atmete tief durch, während ich im Arbeitszimmer die Klarsichthülle mit den Bankunterlagen raussuchte. Meine Hände zitterten ein bisschen, als ich sie hervorzog und alles noch einmal durchging.
Ich musste nicht oft zur Bank, nur hin und wieder zum Abholen meiner Kontoauszüge oder um mir Geld am Automaten zu ziehen. Als ich das letzte Mal dort gewesen war, hatte ich in einem Anfall von spontanem Größenwahn am Schalter nach Formularen für eine Hypothek gefragt. Eine nette junge Frau hatte mir einen ganzen Stapel in die Hand gedrückt. »Sie können jederzeit zu einem Beratungsgespräch vorbeikommen, Frau …?«
»Wingenfeld. Annabell Wingenfeld.«
»Angenehm! Unser Herr Kleinlich nimmt sich für unsere Grundschuld-Kunden gern persönlich Zeit! Wollen Sie vielleicht gleich schon zu ihm ins Büro?«
Unser Herr Kleinlich war der Filialleiter der Bank, wie ich dem Aufdruck des Briefkopfes entnehmen konnte. Harald Kleinlich, um genau zu sein.
»Ich rufe dann lieber mal an und mache einen Termin aus«, hatte ich hastig erwidert und mit den Formularen die Flucht angetreten. Natürlich war es schwachsinnig, aus dem Namen eines Bankdirektors irgendwelche Rückschlüsse zu ziehen. Ich hatte auch nicht etwa deswegen das Weite gesucht, sondern weil … hm, keine Ahnung. Vielleicht, weil die Zeit noch nicht reif gewesen war. Jetzt aber war sie es. Überreif sogar. Ich hatte die Unterlagen ja sogar schon ausgefüllt, es fehlte nur noch der blöde Termin! Jetzt oder nie!
Ich nahm mein Handy und rief bei der Bank an.
»Guten Morgen«, zwitscherte es aus dem Hörer. »Sie rufen leider außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Unsere Geschäftszeiten sind montags bis freitags von acht Uhr dreißig bis …«
Durch die Terrassentür konnte ich in den Garten blicken. Sie stand offen; irgendwer hatte am Vorabend vergessen, sie zu schließen, wahrscheinlich ich, weil ich noch spät draußen gewesen war, um die Auflagen von den Terrassenstühlen ins Haus zu holen.
Unter der Kastanie war Spikes wackelndes Hinterteil zu sehen. Sein buschiger Schwanz wedelte unternehmungslustig. Erdklumpen flogen hoch, er war wieder dabei, irgendetwas ein- oder auszugraben … Moment mal, was hatte er denn da zwischen den Zähnen?
»Spike!«, schrie ich entsetzt. Ich rannte hinaus. Der Rasen war pitschnass, die Beete schlammig. Doch darauf konnte ich keine Rücksicht nehmen.
»Gib das her!«, rief ich. »Böser Hund! Böser Hund!« Ich packte Spike beim Halsband und zerrte ihm ein zerbissenes Blatt Papier aus dem Maul. Weitere Blätter lagen überall am Fuß der Hecke verstreut, ein oder zwei davon wirbelten hoch, als ein Windstoß sie erfasste. Ich ließ Spike los und rannte den Blättern nach, bevor der Wind sie auf die Straße wehen konnte. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn jemand sie in die Finger kriegte! Heutzutage wimmelte die Welt nur so von verkannten Schriftstellern. Sogar Frau Schmalenberg, die drei Häuer weiter wohnte, hatte neulich erst gesagt, dass sie demnächst, wenn sie in Rente ging, als Erstes einen Roman schreiben wollte! Dass die Entwicklung eines romanfähigen Stoffs das Allerschwierigste daran war, wusste sie vermutlich noch gar nicht. Aber damit würde sie sich womöglich auch nie herumplagen müssen, wenn der Wind ihr ein paar passende, fertig ausformulierte Ideen vor die Füße wehte. Meine Ideen!
Ich grabschte mir ein Blatt nach dem anderen, bis ich endlich mit meiner matschigen, zerrissenen Ausbeute wieder zum Haus zurückstolpern konnte. Das Handy lag auf dem Rasen, es war genauso dreckig wie meine Schuhe. Spike hatte sich flach auf den Bauch gelegt. Alle viere ausgestreckt, robbte er winselnd auf mich zu. Jeder, der das zufällig sah, musste mich für das fieseste, gewalttätigste Frauchen der Welt halten. Zwischendurch fiepte er wie ein kleiner Welpe, eine echte Leistung für einen ausgewachsenen Riesenhund wie ihn. Als Schauspieler war er oscarverdächtig, sozusagen der Leonardo DiCaprio unter den Berner Sennenhunden. Er mochte es nicht, wenn ich mit ihm schimpfte, und griff daher zu allen Tricks, damit ich wieder lieb zu ihm war.
Er fing an zu jaulen. Laut und durchdringend, als würde er gefoltert. Bei den Hegemanns nebenan ging ein Fenster auf.
»Schon gut!«, rief ich entnervt. »Braver Hund.«
Spike wuffte und kam mit ein paar Riesensätzen begeistert auf mich zugesprungen. Bevor ich zurückweichen konnte, hatte er mir seine gewaltigen Vorderpranken auf die Schultern gelegt und leckte mir das Gesicht ab. Als ich hinterher ins Haus zurückkam, sah ich aus wie nach einem Schlammbad.
Sophie saß schon am Frühstückstisch, sie tippte auf ihrem iPod herum und trank zwischendurch Kaffee. Ihr dicker blonder Zopf hob sich hell von ihrem blauen Top ab.
Sie blickte nicht auf, als ich Spike draußen vor der offenen Terrassentür die Pfoten säuberte und ihm dann Trockenfutter in den Hundenapf füllte.
»Scheißdusche, das Wasser wird höchstens lauwarm«, sagte sie bloß und tippte weiter. Ich konnte sie verstehen. Mit siebzehn interessierte man sich für wichtigere Dinge als für Mütter, die sich bei dem Versuch, ein künstlerisches Meisterwerk zu retten, im Schlamm wälzten.
»Ich geh dann mal rauf, mich umziehen«, sagte ich, doch auch das brachte sie nicht dazu hochzuschauen.
Ich wechselte die Kleidung. Die Dreckspuren an meinen Armen würde ich im Gästeklo oder in der Küche abwaschen müssen; Benedikt blockierte immer noch das Bad.
Höchste Zeit, Timo zu wecken und ihn für den Kindergarten fertig zu machen. Mein Jüngster öffnete verschlafen die Augen, als ich ihn sacht streichelte und auf die Wange küsste. Mir ging das Herz auf bei dem Anblick seines runden Kindergesichts und der verwuschelten Haartolle, und wie so oft gab es mir auch diesmal wieder einen Stich, weil sein Vater, dem er so unglaublich ähnlich sah, ihn nie hatte kennenlernen können. Martin war acht Monate vor Timos Geburt bei einem Autounfall ums Leben gekommen und hatte eine Lücke hinterlassen, die bei solchen Gelegenheiten noch manchmal zu spüren war.
»Ich hab was Blödes geträumt«, sagte Timo.
»Da sagst du was«, meinte ich mitfühlend. »Worum ging es denn in deinem Traum?«
»Dass ich Bauchweh hab«, sagte Timo. Er verzog das Gesicht. »In echt hab ich auch Bauchweh, nicht bloß im Traum.«
Das war nichts Neues; in letzter Zeit klagte er öfters darüber, ich war schon mehrmals mit ihm beim Arzt gewesen, der allerdings bisher nichts hatte finden können.
»Kinder in diesem Alter haben oft Bauchweh, wenn ihnen was quersteckt. Nicht im anatomischen Sinne, sondern emotional. Gab es in der letzten Zeit in Ihrer Familie viel Stress?«
»Nicht mehr als sonst.«
»Oder im Kindergarten?«
»Ich werde mal nachfragen.«
Das hatte ich getan, aber die Kindergartentante aus der Pusteblumen-Gruppe, zu der Timo gehörte, hatte behauptet, dass alles ganz supi wäre mit Timo. Genau das waren ihre Worte gewesen. »Mit Timo ist alles ganz supi hier. Er ist gerne im Kindergarten. Er liebt den Kindergarten!« Aufmunternd hatte sie zu Timo hinuntergeblickt. »Stimmt doch, Timo, oder?«
Timo nickte artig. Die Kindergartentante beugte sich vertraulich zu mir, sodass Timo nicht hören konnte, was sie zu mir sagte: »Wenn Timo Stress hat, dann liegt es garantiert daran, dass er bald in die Schule muss. Er fürchtet sich vor der Einschulung, denn er würde viel lieber im Kindergarten bleiben, weil er sich hier so wohlfühlt.«
Auf der Heimfahrt fragte ich: »Stimmt das? Liebst du den Kindergarten wirklich?«
Timo nickte entschieden. »Am allermeisten liebe ich die Chantal.«
Chantal war die Tochter von Janin (Janin ohne e), der Friseurin, zu der wir immer gingen. Sie – nicht Chantal, sondern Janin ohne e – hatte jede Menge Tattoos und ungefähr drei Dutzend Piercings, und das waren nur die, die man sehen konnte. Janins Freund Olaf, der allerdings nicht Chantals Vater war, verprügelte Janin regelmäßig, und einmal hätte er auch mich fast verprügelt, als er zufällig im Hinterzimmer des Friseurladens gesessen und mitgekriegt hatte, wie ich Janin die Anschrift vom Frauenhaus geben wollte, nachdem ich ihr zugeschwollenes Auge bemerkt hatte.
»Ey, die braucht die Schläge! Alle Frauen brauchen das ab und zu«, hatte er mir erklärt und dazu beweiskräftig die Fäuste geballt. Ich war zum Glück sowieso gerade auf dem Weg nach draußen gewesen. Später hatte ich im Laden angerufen und Janin doch noch die Adresse durchgegeben. Sie hatte mir unaufgefordert geschworen, dass ihr Freund nicht die Kleine schlug; sie wusste genau, dass ich anderenfalls das Jugendamt informiert hätte.
Chantal war das süßeste kleine Mädchen, das man sich vorstellen konnte, mit blonden Ringellöckchen und Augen, die fast zu groß für das zarte Gesichtchen waren. Wäre ich mein kleiner Sohn gewesen, hätte ich sie auch von allen Mädchen in der Pusteblumen-Gruppe am liebsten gehabt. Die Vorstellung, dass sie vielleicht ein Fall für die Super-Nanny war, machte mich traurig.
Timo war inzwischen bereit zum Aufstehen, Bauchweh hin oder her. Als er die Decke zurückschlug, bemerkte ich sofort die Bescherung, aber ich sagte nichts. Der Arzt hatte gemeint, es komme vor, dass Vorschulkinder noch gelegentlich einnässten, man solle dem nicht zu viel Gewicht beimessen, das würde es nur schlimmer machen. Also sagte ich nichts, sondern zog nur rasch das Bett ab und legte frische Wäsche und eine Reservedecke bereit.
»Eines schönen Tages«, hatte der Arzt lächelnd gemeint, »sind alle Kinder trocken. Sehen Sie mich an, ich mache auch nicht mehr ins Bett.« Seitdem versuchte ich immer, mir Timo als etablierten und emotional stabilen Kinderarzt vorzustellen, wenn ihm mal wieder ein nächtliches Malheur passiert war.
Benedikt war immer noch im Bad, also musste Timo sich am Waschbecken im Gästeklo die Zähne putzen und das Gesicht waschen. Beim Kämmen half ich ihm, aber das Anziehen schaffte er allein, sogar die Schuhe konnte er schon selbstständig zubinden, worauf wir beide sehr stolz waren.
Zum Frühstück gab es für Timo Toast und Ovomaltine, für mich Kaffee; ich hatte selten vor zehn Uhr Appetit. Sophie war bereits aufgebrochen, sie hatte zur ersten Stunde Schule.
»Kann’s losgehen?«, fragte ich Timo, nachdem er sich in der Diele die Jacke angezogen hatte.
»Kann losgehen«, bestätigte er. Ich hängte ihm das Kindergartentäschchen um den Hals, und gemeinsam gingen wir nach draußen in die Einfahrt zum Wagen. Ich hatte Timo gerade auf dem Rücksitz angeschnallt und wollte selbst einsteigen, als im Obergeschoss das Fenster aufflog und Benedikt rausschaute.
»Ich brauche heute das Auto!«, schrie er.
»Wann denn genau?«
»So um elf.«
»Musst du nicht in die Schule? Du kannst doch den Bus nehmen!«
»Ich meine heute Abend!«
»Was hast du denn so spät noch vor?«
Frau Hegemann schob nebenan ihren Kopf aus dem Küchenfenster.
»Mama!«, rief Benedikt mit nach oben verdrehten Augen. Mehr musste er nicht sagen, als Mutter beherrschte ich die Kunst des Gedankenlesens: Wieso stellt sie sich so an? Um elf Uhr abends pennt sie doch schon seit Stunden, sie kapiert in ihrem Alter sowieso nicht mehr, dass die Party dann erst richtig losgeht. Und was soll immer diese Einmischung in mein Privatleben!
»Meinetwegen, aber fahr bloß nicht wieder den Tank leer!«, rief ich zu ihm hoch. Was hätte ich auch sonst sagen sollen? Etwa: Geht nicht, ich brauche das Auto selbst, obwohl es gar nicht stimmte?Während Frau Hegemann nebenan die Ohren aufspannte und sofort überall herumerzählen würde, dass ich neuerdings nachts um die Häuser zog? In manchen Dingen gab man besser sofort nach.
*
»Du hast dich ja so fein angezogen heute«, sagte Timo von der Rückbank aus.
»Ja, sogar zwei Mal«, stimmte ich zu.
»Gehst du auf eine Feier?«
»Das kann ich erst hinterher sagen.«
»Du meinst, du weißt erst nach der Feier, ob es eine Feier war?«
»So ungefähr. Manche Feiern sind nicht wirklich lustig, weißt du.«
»Zum Beispiel wie auf dem Geburtstag von Jennifer? Wo ich auf die Torte brechen musste?«
»Genau. Manche Feiern sind wirklich zum Ko … ähm, Brechen.«
Aber hingehen musste man trotzdem, sonst musste man sich auf lange Sicht einen Wohnwagen besorgen, wenn man nachts im Trockenen schlafen wollte. An der nächsten Ampel holte ich mein Handy raus und wählte die Nummer der Bank. Die Unterlagen hatte ich auf dem Beifahrersitz liegen. Bloß, damit ich sie nicht vergaß. Oder etwa auf die Idee kam, das Ganze auf einen anderen Tag zu verschieben. Womöglich auf einen Tag im Winter, wenn es nicht nur regnete, sondern auch fror. Unter anderem in den Wasserleitungen.
Diesmal meldete sich eine echte Frauenstimme, nicht nur die vom Band. Ich räusperte mich ein paar Mal hektisch und fragte dann nach einem Termin mit unserem Herrn Kleinlich. Natürlich sagte ich nicht unserem, sondern einfach nur mit Herrn Kleinlich.
»Worum geht es denn?«
»Ich war neulich schon mal da. Mein Name ist Wingenfeld. Annabell Wingenfeld.«
»Hatten Sie heute früh hier angerufen? Ich glaube, wir haben Ihre Nummer auf unserem Anrufbeantworter. Und so ein Jaulen, als würde ein Tier gequält.«
»Oh, ja, das war mein Hund. Ich meine, ich habe angerufen. Aber gejault hat der Hund. Und ich habe ihn nicht gequält. Er tut immer nur so.«
Pause, dann: »Und wie kann ich Ihnen weiterhelfen?«
»Es geht um eine … äh …« Es fiel mir schwer, das diskriminierende Wort auszusprechen, in dem sich der marode Zustand meines Hauses und mein Mangel an Bargeld manifestierten. »Hypothek. Oder Grundschuld. Oder was auch immer für mich und mein Haus besser ist.«
»Ah, ich verstehe. Einen Moment bitte.«
Ich wartete einen Moment, dann noch einen, und dann hätte ich am liebsten wieder aufgelegt, doch bevor ich das tun konnte, meldete sich die nette Frauenstimme wieder. »Heute Nachmittag um sechzehn Uhr würde es Herrn Kleinlich gut passen.«
»Prima, das freut mich«, log ich. »Dann komme ich also um vier.« Erleichtert legte ich auf. Der erste, wichtigste Schritt war getan. Jetzt gab es kein Zurück mehr!
»Mama, was ist eine Hypothek?«
»Oh, das ist …« Ich überlegte gründlich, wie ich es ihm am besten erklärte, möglichst kindgerecht, aber trotzdem fundiert und korrekt. »Weißt du, wenn man ein Haus hat, und dieses Haus sehr … ähm, viele Reparaturen nötig hat, aber kein Geld da ist, um all diese Reparaturen …« Nein, das war blöd. Ich fing von vorne an. »Manchmal braucht man die Hypothek auch, wenn man ein Haus bauen oder kaufen will, also wenn man ein Haus will, aber kein Geld hat, um …« Himmel noch mal, das musste sich doch einfacher in Worte fassen lassen! »Also, stell dir vor, jemand möchte ein Haus kaufen. Oder an seinem Haus, das er schon hat, das Dach neu decken, weil es da ständig reinregnet. Und wenn dafür eigentlich überhaupt kein Geld übrig ist, weil die ganzen Ersparnisse für Führerscheine und Klassenfahrten draufgehen, gibt es die Möglichkeit, dass man bei der Bank …«
Mein Handy klingelte und befreite mich von der Notwendigkeit, meinem jüngsten Kind zu erklären, dass es noch andere Gründe für Bauchschmerzen gab als eine bevorstehende Einschulung.
»Ja, Wingenfeld?«
»Hallo Annabell, hier ist Lieselotte! Ich will euch besuchen kommen! Nächste Woche schon! Ist das nicht toll? Ich freu mich schon wahnsinnig auf euch alle!«
Jetzt kriegte ich wirklich Bauchschmerzen.
*
Als Kind hatte ich oft darüber nachgedacht, warum meine Mutter immer Lieselotte unter die Postkarten schrieb, die sie mir mehr oder weniger regelmäßig schickte (eher weniger regelmäßig, rückblickend betrachtet).
Statt Liebe Grüße, Deine Lieselotte hätte sie beispielsweise auch einfach Liebe Grüße, DeineMama darunterschreiben können. Oder Deine Dich liebende Mutter. So eine Karte mit Deine Dich liebende Mutter hatte unsere Klassenoberzicke Ines einmal von ihrer Mutter aus der Kur bekommen, und die war gerade mal vier Wochen weg gewesen, nicht vier Monate. Oder acht Monate. Oder drei Jahre, so wie im Moment. Ich hörte nur sporadisch von meiner Mutter. Sie telefonierte nicht gern, lieber schrieb sie eine Karte. Wenn überhaupt. Vor ein paar Jahren hatte sie die Segnungen des Internets entdeckt, seither kam ab und zu auch eine digitale Grußkarte oder eine Mail.
Die letzte hatte ich zu Weihnachten erhalten, genau wie ungefähr hundertzwanzig andere Leute, die im Verteiler standen; der Text hatte gelautet: Viele liebe Grüße zu Weihnachten an alle meine guten Freunde! Eure Lieselotte!
Ich hatte meine Tante Hannelore früher einmal gefragt, ob meine Mutter überhaupt meine richtige Mutter war. Vielleicht war ich nur ein adoptiertes Kind, eins, das sie nicht richtig lieb hatte, und deshalb ständig auf Reisen ging. Tante Hannelore war ganz erschrocken gewesen. »Um Himmels willen, natürlich ist Lieselotte deine Mutter, und sie hat dich total lieb, aber sie kann es halt nicht lange an einem Fleck aushalten. Und sie ist nun mal nicht die typische Mutter, das liegt ihr einfach nicht so.«
Zum Glück lag es meiner Tante Hannelore mehr. Sie und Onkel Hubert konnten keine eigenen Kinder bekommen. Da bot es sich quasi an, dass ich zu ihnen zog, schließlich hatten sie dieses schöne neue Haus mit dem großen Garten. Und Lieselotte konnte mich ja schlecht nach Indien in den Ashram zur Transzendentalen Meditation mitschleppen. Oder zu den Hopi-Indianern nach Arizona. Oder wo sie sonst gerade dringend hinmusste, um die Grenzen ihrer Selbsterfahrung auszuloten oder sich vom ewigen Kreislauf der Wiedergeburt zu befreien.
Ein schöneres Zuhause und ein besseres Familienleben als bei Tante Hannelore und Onkel Hubert konnte ein kleines Mädchen sich wirklich nicht vorstellen, weshalb es mir die meiste Zeit piepegal war, dass meine Mutter in der Weltgeschichte herumgondelte. Fasziniert von den farbenfrohen Postkarten, wünschte ich mir zwar manchmal, sie könne mich vielleicht einmal einladen, mit ihr gemeinsam nach Sumatra oder Feuerland oder anderen exotischen Orten zu fliegen. Doch die meiste Zeit reichte mir mein friedliches, behütetes Leben bei Tante Hannelore und Onkel Hubert völlig.
»Mutter, warte mal!«, sagte ich hastig, bevor sie wieder auflegen konnte. Sie würde es sonst fertigbringen, einfach irgendwann vor der Tür zu stehen. »Wann genau willst du denn kommen? Und vor allem – für wie lange?«
»Ach, das entscheide ich ganz spontan, du weißt doch, ich lege mich nicht gern fest! Vielleicht bin ich zu deinem vierzigsten Geburtstag da. Wann war der noch mal?«
»Vor fünf Jahren.«
»Oh! Das heißt also, du bist schon … Wann genau ist dein Geburtstag noch gleich?«
»Mein nächster Geburtstag ist in genau einem Monat, Mutter. Und ich werde nicht vierzig, sondern fünfundvierzig.«
»Ach! Wie die Zeit vergeht! Oh, da kommt gerade Raoul, ich muss auflegen! Tschüssi, bis dann!«
Keine Ahnung, wer Raoul war, auf jeden Fall war er wichtiger als ein Telefonat mit mir.
»Mama, wer war das?«, wollte Timo von der Rückbank wissen.
»Deine Oma Lieselotte.«
»Kenn ich die?«
»Ja, aber als sie das letzte Mal zu Besuch war, warst du erst drei. Deshalb kannst du dich nicht an sie erinnern.«
»Wo ist sie denn?«
»Im Moment in Argentinien. Glaube ich. Sie will uns bald mal wieder besuchen kommen.«
»Ist sie eine liebe Oma?«
»Natürlich«, sagte ich sofort. »Sie denkt viel an uns und lässt dich ganz herzlich grüßen.« Mein Sohn sollte in dem Glauben aufwachsen, dass seine Großmutter ihn aufrichtig liebte und sich vor Sehnsucht nach ihrem Enkel verzehrte.
»Ist sie lieber als Oma Helga?«
»Äh …« Ich verkniff mir das Ja, das mir schon auf der Zunge lag. Lieber zu sein als meine Schwiegermutter war keine Kunst, nicht mal für Lieselotte, die sich praktisch nie blicken ließ.
»Sie sind beide gleich lieb«, behauptete ich. Die Wahrscheinlichkeit, dass Timo Gelegenheit bekam, darüber selbst Vergleiche anzustellen, tendierte gegen null. Dachte ich.
Kaum hatte ich das Handy wieder in meiner Handtasche auf dem Beifahrersitz versenkt, klingelte es erneut. Eine Hand am Steuer, fuhrwerkte ich mit der anderen in den Tiefen meiner Tasche herum, die wie immer übervoll mit tausend wichtigen und unwichtigen Dingen war. »Ja, Wingenfeld?«
»Hallo Annabell, hier ist Ines! Ines von Rathberg. Früher Ines Stolzenfeld.«
Auch das noch. Ich hätte vorhin nicht an sie denken sollen. Meist stießen einem die unangenehmen Dinge immer dann zu, wenn man vorher an sie gedacht hatte. In jüngster Zeit war mir das häufiger passiert, zum Beispiel bei der Dusche. Erst gestern hatte ich gedacht, dass dieses merkwürdige Knacken ein ganz schlechtes Zeichen war. Und prompt hatte es heute eine Eisdusche gegeben.
»Erinnerst du dich noch an mich?«, fragte Ines. »Wir haben uns zuletzt vor … warte mal, wann war es? Vor zwei Jahren, oder? Da haben wir mal zusammen in der Stadt Kaffee getrunken.«
Das war übertrieben. Wir waren uns zufällig in einem Kaffeeladen über den Weg gelaufen, wo sie Kaffeebohnen aus fairem Anbau gekauft hatte und ich den Espresso aus dem Sonderangebot. Sie hatte mir ihre Visitenkarte in die Hand gedrückt und gemeint, wir müssten unbedingt mal telefonieren. Anscheinend fand sie, dass es jetzt an der Zeit war.
»Hallo Ines«, sagte ich, um Höflichkeit bemüht. »Geht es dir gut?«
»Sehr gut. Ganz wundervoll, um genau zu sein!« Das klang so fröhlich und aufgeräumt, dass es nur die Wahrheit sein konnte. Schon in der Schulzeit war sie immer penetrant gut drauf gewesen, was vermutlich daran lag, dass sie allen Grund dazu hatte. Sie sah toll aus, hatte den besten Notenschnitt, den attraktivsten Freund, als Erste ein eigenes Auto und einen Beliebtheitsgrad bei den Lehrern, der durch nichts zu toppen war. Natürlich war sie auch beruflich in die Oberliga aufgestiegen, sie war promovierte Juristin und leitete mittlerweile eine der größten Anwaltskanzleien der Stadt. Außerdem war sie Schirmherrin von diversen Charity-Organisationen, immer noch mit demselben adligen Mann verheiratet (laut Ines war er weitläufig mit dem englischen Königshaus verwandt) und Mutter von Überflieger-Zwillingstöchtern, die beide eine Klasse übersprungen hatten und bereits für ein Auslandssemester in Oxford angemeldet waren. Das war jedenfalls der Stand der Dinge gewesen, als ich sie vor zwei Jahren das letzte Mal gesehen hatte.
»Ich hoffe, es geht dir auch gut«, fuhr Ines fort.
»Danke, ich kann nicht klagen.«
»Das hört man gern. Ich habe nämlich ein Attentat auf dich vor.« Sie lachte, es klang ausgesprochen vergnügt und richtiggehend ansteckend, beinahe hätte ich sogar mitgelacht, wenn nicht der Wagen vor mir so abrupt und ohne ersichtlichen Grund gebremst hätte. Ich konnte gerade noch mit quietschenden Reifen halten. Um ein Haar wäre ich aufgefahren, es fehlten bloß Zentimeter. Was für ein Blödmann!
»Idiot«, murmelte ich.
»Was?«
»Nicht du«, sagte ich.
»Ach so. Ja, also, weshalb ich anrufe … Weißt du, was nächstes Jahr für ein Jubiläum ist?«
»Deine silberne Hochzeit?«, riet ich.
Sie lachte noch lauter. »Der war gut! Da wäre ich selbst gar nicht draufgekommen! Dabei müsstest du eigentlich wissen, dass ich erst nach dir geheiratet habe. Ist zwar schon lange her, aber bestimmt erinnerst du dich noch, schließlich hatte ich die ganze Klasse eingeladen. Dich auch.«
Ich glaubte, ein vorwurfsvolles Obwohl ich zu deiner Hochzeit ja leider nicht eingeladen war herauszuhören, und sagte nichts.
»Nein, unsere Silberne hat noch etwas Zeit«, fuhr sie gut gelaunt fort. »Aber es geht trotzdem um ein 25-jähriges Jubiläum. Na, rätst du es jetzt?«
»Oh nein«, stöhnte ich. Der Blödmann aus dem Wagen vor mir war ausgestiegen und kam auf mich zu. Er klappte ein Mäppchen auf und hielt es vor die Scheibe, damit ich sehen konnte, was sich darin befand. Eine Dienstmarke der Kripo.
»Doch«, sagte Ines fröhlich. »Fünfundzwanzig Jahre Abitur! Ist das nicht toll?«
»Ach du Schande«, sagte ich betreten, als der Typ draußen eine kurbelnde Bewegung machte. Er wollte, dass ich die Scheibe runterließ.
»Eigentlich ist es ein Grund zum Freuen«, sagte Ines. »Und zum Feiern. Genau deswegen rufe ich ja auch an. Weil du nämlich diejenige bist, mit der ich noch den meisten Kontakt …«
»Ich muss aufhören«, sagte ich wahrheitsgemäß. »Hier will mich gerade jemand dringend sprechen.« Hastig trennte ich die Verbindung, stellte das Handy auf lautlos und stopfte es zurück in die Tasche. Dann öffnete ich notgedrungen die Tür. Die Elektronik zum Öffnen der Scheibe funktionierte schon lange nicht mehr.
Ich lächelte verbindlich. Vielleicht hatte er sich nur verfahren und wollte nach dem Weg fragen. »Was kann ich für Sie tun?«
»Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Und dann bitte einmal rechts ranfahren.«
Ich wühlte wie besessen in meiner Handtasche herum. »Ich habe sie hier irgendwo, das weiß ich genau.«
»Fahren Sie zuerst rechts ran und suchen Sie dann weiter.«
Ich tat es widerwillig, während der Typ am Straßenrand wartete, beide Hände in den Hosentaschen. Er sah mürrisch drein, gerade so, als bräuchte er dringend jemanden, an dem er seine schlechte Laune auslassen konnte.
Wo war der vermaledeite Fahrzeugschein? Er musste irgendwo in der Handtasche sein, in einem kleinen schwarzen Ledermäppchen, da war ich ganz sicher. Was man von dem Führerschein leider nicht sagen konnte. Den hatte ich schon ewig nicht mehr gesehen. Bisher hatte ich das blöde Ding noch nie herzeigen müssen, obwohl ich es schon gefühlte hundert Jahre besaß.
»Was will der Mann von uns, Mama?«
»Oh, er möchte nur mal meinen Führerschein sehen.«
»Warum? Will er wissen, wie der aussieht?« Timo dachte nach. »Er hat bestimmt selber einen Führerschein, sonst dürfte er ja nicht mit dem Auto fahren. Da könnte er doch seinen eigenen Führerschein angucken.«
Ich wühlte in meiner Tasche. »Er will ihn sehen, weil er Polizist ist. Die Polizei darf so was.«
»Er hat aber keine Uniform an.«
»Die braucht er nicht, weil er bei der Kripo ist.«
Der Typ klopfte gegen die Scheibe, und ich beeilte mich, die Tür wieder aufzumachen. »Ich finde es gleich«, sagte ich nervös. Mir brach der Schweiß aus, während ich im Geiste schon zusammenrechnete, was mich der ganze Spaß kosten würde. Fahren ohne Führerschein, das machte … keine Ahnung, dabei hatte ich es neulich erst irgendwo gelesen. Telefonieren während der Fahrt, das waren … Herrje, ich wollte es gar nicht wissen. Punkte gab es dafür auch, hoffentlich nicht so viele, dass Sophies Führerschein mit siebzehn umsonst war. Sie stand kurz vor der Fahrprüfung, aber danach würde sie nur dann einen Wagen steuern dürfen, wenn jemand sie begleitete, der über dreißig war und nicht mehr als drei Punkte in Flensburg hatte.
»Ihr rechtes Bremslicht ist kaputt«, sagte der Typ, während er ungeduldig auf den Fersen wippte und mir beim Taschenwühlen zusah.
»Woher wollen Sie das wissen?«, platzte ich heraus. »Sie sind doch vor mir hergefahren!«
»Das war vor der letzten Ampel«, korrigierte er mich. »Da habe ich Sie überholt. Als Sie gerade zum ersten Mal telefoniert haben. Sie wissen, dass man während der Fahrt nicht mit dem Handy telefonieren darf, oder?«
»Werden wir jetzt verhaftet, Mama?«, fragte Timo. Sein kleines Gesicht war blass vor Sorge.
»Gibt das mehr als drei Punkte?«, fragte ich, ebenfalls sehr besorgt.
»Warum sehen Sie nicht mal in Ihrem Handschuhfach nach?«, fragte der Kripotyp anstelle einer Antwort. »Da haben die Leute meist ihre Papiere. Oder hinter der Sonnenblende auf der Beifahrerseite.« Er ging ein wenig in die Knie und sagte über meine Schulter hinweg zu Timo: »Keine Angst, junger Mann. Verhaftet wird hier niemand. Ich sehe mir einfach nur gern ab und zu die Führerscheine von anderen Leuten an.«
Im Handschuhfach war nichts, abgesehen von ungefähr hundert CDs von Benedikt und Sophie. Ich klappte die Sonnenblende herunter. Tatsächlich, da klemmte das Mäppchen mit dem Fahrzeugschein. Und der Führerschein war gleich dahinter! Ich wusste doch, dass ich beides irgendwo griffbereit deponiert hatte! Erleichtert reichte ich die Papiere nach draußen. »Vielen Dank«, sagte ich, und es kam mir aus tiefstem Herzen. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Ohne ihn hätte ich vermutlich wochenlang vergeblich das Haus auf den Kopf gestellt und viel Geld für neue Papiere ausgeben müssen, wesentlich mehr als für das Telefonieren am Steuer.
»Hast du selber keinen Führerschein?«, erkundigte Timo sich mitfühlend.
»Doch. Aber den kenne ich ja schon. Den von anderen Leuten dagegen noch nicht. Das ist das Spannende an meinem Beruf. Ich kann Autos anhalten und mit den Leuten reden, so kann ich sie näher kennenlernen. Wie heißt du denn zum Beispiel, und wie alt bist du?«
»Timo. Ich bin sechs. Und das ist meine Mama, sie heißt Annabell und wird in genau einem Monat nicht vierzig, sondern fünfundvierzig.«
Ich stöhnte unhörbar. Warum hatte das Kind so scharfe Ohren?
»Ich heiße Tobias und bin auch fünfundvierzig«, sagte der Kripotyp.
Er prüfte meine Papiere und kritzelte etwas auf einen Block.
»Ein Punkt in Flensburg«, sagte er. »Und vierzig Euro für das Handy. Wegen der Bremsleuchte belasse ich es bei einer Verwarnung ohne Verwarnungsgeld, wenn Sie mir versichern, dass Sie es schnellstmöglich machen lassen.« Es klang, als täte er mir einen Gefallen. Ich starrte ihn an. Er war unrasiert, hatte ein paar Flecken vorn auf dem Hemd, trug ausgebeulte Jeans und sah auch sonst aus wie ein Straßenräuber. Vielleicht war er überhaupt kein richtiger Polizist, sondern wollte nur mal eben auf die Schnelle ein paar als Gebühren getarnte Euro abzocken.
»Könnte ich Ihre Dienstmarke noch mal sehen?«
Er holte sie kommentarlos raus und zeigte sie mir, zusammen mit seinem Dienstausweis. Beides sah echt aus, obwohl man natürlich nie wissen konnte.
»Kann ich das Geld auch überweisen?«
Er grinste mich an, wobei seine Zähne sich weiß gegen den dunklen Bartschatten abhoben. »Klar, das müssen Sie sowieso. Sie kriegen dann Bescheid von der Behörde.«
»Ich lasse das Bremslicht reparieren, großes Ehrenwort. Darf ich jetzt weiterfahren?«
»Sicher. Gute Fahrt noch.« Er tippte an eine nicht vorhandene Mütze und schlenderte lässig zu seinem Wagen zurück. Ich wartete vorsorglich, bis er weggefahren war. Sonst hätte er womöglich noch das Knattern vom Motor meines Wagens mitgekriegt und mir gleich die nächste Verwarnung verpasst. Seit ein paar Wochen machte das Auto komische Geräusche. Ich musste so oder so in die Werkstatt, das kaputte Bremslicht war dabei die geringste meiner Sorgen. Ob der Hauskredit, den ich beantragen wollte, vielleicht auch für die Reparatur eines alten Autos verwendet werden durfte? Frustriert ließ ich den Motor an und fuhr weiter, um Timo endlich im Kindergarten abzuliefern.
*
Vor der Tür zum Gruppenraum der Pusteblumen herrschte heilloses Gedränge. Die kleineren Kinder hockten auf den Garderobenbänkchen und ließen sich von den Müttern die Straßenschuhe aus- und die Hausschuhe anziehen; die größeren konnten es allein, brauchten dafür aber mehr Platz und Ruhe, woran es entschieden fehlte. Ich sah Timo zu, wie er Jacke und Schuhe auszog und fühlte mich uralt. Die meisten Mütter hier waren um die zehn Jahre jünger als ich, mit meinem Nachzügler von Nesthäkchen war ich mit Abstand die Älteste. Es gab sogar ein paar Omas hier, die jünger waren als ich, zum Beispiel die Mutter von Janin ohne e.
Eines von den Dreijährigen fing an zu heulen, nachdem die Mutter winkend den Kindergarten verlassen hatte. Ein Fünfjähriger hänselte es.
»Lisa ist ein Baby, Lisa ist ein Baby! Macht noch in die Windel, naanananaanah!«
Chantal, die schon mit Schuhe aus- und Hausschuhe anziehen fertig war, ging sofort dazwischen. Sie verfügte über ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden, was vermutlich daher kam, dass ihre Mutter so oft von Olaf-Arsch vermöbelt wurde und die Kleine es mitkriegte.
»Das ist nicht wahr! Lisa braucht überhaupt keine Windel mehr!«
Timo schlug sich sofort auf ihre Seite.
»Hör bloß auf, die Lisa zu ärgern!«, pflaumte er den Übeltäter an.
Vor der geballten Präsenz der beiden Vorschulkinder kniff der Fünfjährige und verzog sich in den Gruppenraum. Ich küsste Timo zum Abschied, strich Chantal über den Kopf und ging zurück zum Auto. Auf dem Parkplatz sah ich Janin, sie trug eine riesige Sonnenbrille, obwohl der Himmel verhangen war. Als sie mich bemerkte, drehte sie rasch den Kopf weg und ging schnell weiter. Wut erfasste mich, und ich nahm mir vor, in einer ruhigen Minute noch einmal mit ihr zu reden. So konnte es nicht weitergehen! Finanziell war sie bestimmt nicht auf den Typen angewiesen, ich wusste genau, dass er arbeitslos war und das Meiste von dem, was er an Hartz IV bezog, in Alkohol, Zigaretten und Sportwetten umsetzte.
Auf der Fahrt zur Redaktion war das Knattern des Wagens wieder stärker zu hören. Benedikt hatte gemeint, es liege am Vergaser, und er hatte schon angekündigt, es sich zusammen mit einem Kumpel ansehen zu wollen. Vielleicht konnten wir das Geld für die Werkstatt doch noch sparen.
Vor dem Zeitungsgebäude waren wie üblich alle Parkplätze belegt, ich war mal wieder die Letzte. Feste Parkplätze hatten nur der Verleger und der Chefredakteur, alle anderen mussten sich um die freien Stellflächen balgen. Ich kurvte zwei Mal um den Block, bis ich endlich eine Parklücke gefunden hatte. Eigentlich hätte ich dafür einen Anwohnerparkausweis benötigt, doch für die paar Stunden würde mich schon niemand aufschreiben. Spätestens in der Mittagspause gab es wieder freie Parkplätze vor dem Zeitungshaus, einige Kollegen arbeiteten nur halbe Tage.
Ich wollte gerade aussteigen, als langsam der Wagen von dem Beamten vorbeirollte, der mich vorhin aufgeschrieben hatte. Heute galt anscheinend Murphys Gesetz. Konnte er nicht irgendwas anderes tun, zum Beispiel echte Verbrecher jagen?
Hastig ließ ich mich wieder hinters Steuer sinken und tat so, als würde ich was in meiner Handtasche suchen. Zum Beispiel meinen Anwohnerparkausweis.
Doch dann sah ich, wie sein Wagen weiter vorn stehen blieb, und ich spürte auch die Blicke, die mich im Rückspiegel fixierten. Klar, er wusste ja dank meiner Papiere, wo ich wohnte, da konnte ich für diese Straße unmöglich einen Parkausweis besitzen.
Entnervt startete ich den Wagen wieder und fuhr los. Dabei merkte ich gerade noch, dass ich nicht angeschnallt war, was ich eilig nachholte, gerade noch rechtzeitig, bevor Herr Kommissar Überkorrekt es sehen konnte. Betont gelassen schaute ich während des Vorbeifahrens geradeaus, obwohl ich ihm viel lieber den Mittelfinger gezeigt hätte. An manchen Tagen ging wirklich alles schief.
*
Die Zeitungsredaktion, in der ich arbeitete, war so ähnlich gestaltet, wie man es aus amerikanischen Filmen kennt – ein riesiges Großraumbüro, nur ohne die Trennwände. Stattdessen standen zwischen den Schreibtischen locker verteilt ein paar Grünpflanzen, die allesamt schon bessere Tage gesehen hatten, genau wie der Rest des Interieurs.
Die Arbeitsplätze waren so angeordnet, dass alle Angestellten Blick zur großen Fensterfront hatten, aber mit dem Rücken zum einzigen Einzelbüro saßen, in dem Jens Hartwig, unser Chefredakteur, residierte, was insofern blöd war, als er die Angewohnheit hatte, seine Tür einen Spalt offen zu lassen und ab und zu herauszuspähen, ob auch alle bei der Arbeit waren und keiner sinnlos im Internet surfte.
Die fest angestellten Zeitungsmitarbeiter ließen sich an drei Händen abzählen, Chefredakteur, Pförtner und Anzeigenabteilung schon mitgerechnet; die Übrigen arbeiteten als sogenannte Freie, ein Schicksal, mit dem auch ich mich eine Zeit lang herumgeschlagen hatte. Freier Mitarbeiter zu sein hatte mit Freiheit nicht viel zu tun, es sei denn, man meinte damit die Freiheit des Arbeitgebers, den Mitarbeiter nach Belieben rumschubsen und für ein lachhaftes Zeilenhonorar ausbeuten zu können. Auf Wunsch der Zeitung durfte der Freie sich den ganzen Sonntag auf eiskalten Sportplätzen oder bei einschläfernden Laientheatervorführungen herumdrücken. Hinterher musste er über solche Schnarch-Events einen unterhaltsamen und zugleich von hoher Sachkenntnis getragenen Artikel schreiben, der höchstens drei Spalten haben durfte und auf eine Viertelseite passen musste, inklusive Foto versteht sich.
Wie lang die Anfahrtswege waren, interessierte niemanden, auch nicht, ob man vielleicht gerade krank oder der Laptop kaputt war. Denn man war ja frei. Fast so frei wie der Zeitungsverlag, der sich solche unbequemen Dinge sparte wie bezahlten Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Sozialversicherungsabgaben oder Arbeitsplatzgarantien während des Erziehungsurlaubs.
Ich für meinen Teil war froh, diesem entwürdigenden Zustand wieder entronnen zu sein. Gleich nach Sophies Einschulung hatte ich mich um meinen alten Posten beworben und war zum Glück sofort wiedereingestellt worden, zwar nur auf Teilzeitbasis mit Dreiviertelstelle, aber wenigstens fest und daher mit all den sozialen Segnungen eines regulären Arbeitsverhältnisses.
Rückblickend ärgerte ich mich immer noch darüber, dass ich mich von Jens – mein heutiger Chef, damals waren wir gleichberechtigte Kollegen gewesen – nach Sophies Geburt zur Kündigung hatte überreden lassen.
»Schau mal, Annabell, jetzt hast du in anderthalb Jahren zwei Kinder gekriegt, wie willst du da weiterhin regelmäßig zu den Bürozeiten in die Redaktion kommen? Arbeite doch einfach als Freie weiter, da kannst du viel zu Hause sein. Du kannst dir die Zeit prima einteilen und bleibst trotzdem im Geschäft!«
»Aber das Geld …«