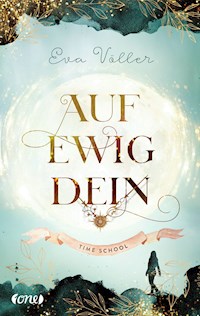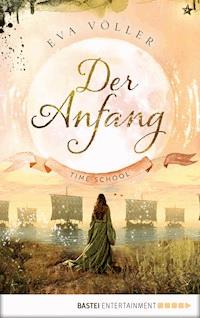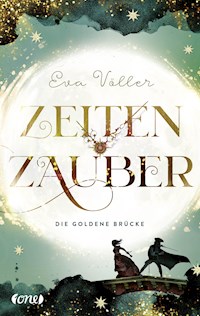
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Zeitenzauber
- Sprache: Deutsch
Nachdem Anna sich dem Geheimbund der Zeitwächter angeschlossen hat, lässt das nächste Abenteuer nicht lange auf sich warten. Mitten in ihrer Abiturprüfung ereilt sie eine Schreckensnachricht aus Paris: Sebastiano ist verschollen - und zwar im 17. Jahrhundert! Anna begibt sich auf eine gefährliche Reise und findet ihren Freund tatsächlich in Paris wieder. Doch es gibt ein neues Problem: Er hält sich für einen Musketier und hat keine Ahnung, wer Anna ist. Schafft sie es, seinem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Eva Völler
Die goldene Brücke
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Mit Illustrationen von Tina Dreher
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Copyright © 2013 by Eva Völler Copyright Deutsche Originalausgabe © 2013/2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Barbara Rumold Redaktion: Anna Hahn Covergestaltung: Sandra Taufer, München unter Verwendung von Motiven von © Johannes Wiebel, punchdesign, München; Anastasiia Veretennikova/shutterstock; Discovod/shutterstock E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-2662-5
luebbe.de
lesejury.de
Für Pia und Nora
If you’re lost, you can look and you will find me – time after time … (Cyndi Lauper)
TEIL EINS
Venedig, 1756
O mein Gott, war das hoch! Entsetzt starrte ich in die Tiefe. Das Dach hatte von unten schon hoch ausgesehen, doch wenn man draufstand und runterschaute, fühlte es sich an wie am Rand des Grand Canyons. Abgesehen davon, dass es auch noch abschüssig war – man musste höllisch aufpassen, nicht abzurutschen. Tief unter mir glitzerte das Mondlicht auf dem Kanal. Die Gondel war in der Dunkelheit kaum zu erkennen, aber ich wusste, dass sie dort war – unser Fluchtfahrzeug.
»Was meinst du, ob es wohl mehr als dreißig Meter sind?«, fragte ich kläglich. Es sah wirklich sehr hoch aus.
»Unsinn«, sagte Sebastiano. »Außerdem bist du bequem raufgekommen, und genauso bequem wirst du es wieder runter schaffen. Stell dich nicht so an. Du bist doch sonst so mutig.«
Er hatte leicht reden, er hatte keine Höhenangst.
»Ah, hier ist es.« Sebastiano zerrte eine Abdeckung von einem Loch im Dach, dann drehte er sich zu mir um. Im Licht der kleinen Nachtlaterne, die er vorhin angezündet hatte, sah er verwegen und wagemutig aus. Und gefährlich, mit all den Waffen an seinem Gürtel.
»Hör auf, nach unten zu starren. Es geht los.« Er beugte sich vor und spähte vorsichtig ins Innere des Dachs. Das Loch hatte der Gefangene, den wir heute Nacht befreien wollten, freundlicherweise schon selber hineingemacht. Leider hatte es ihm nicht viel geholfen. Jedenfalls nicht in der unkorrigierten Vergangenheit. In der war er nämlich vom Dach gefallen und hatte sich den Hals gebrochen. Wovon er natürlich nichts wusste, denn es war ja noch nicht passiert. Sebastiano und ich würden dafür sorgen, dass es beim zweiten und endgültigen Anlauf besser klappte.
»Messèr, seid Ihr wach?«, rief Sebastiano leise nach unten.
Drinnen hörte man ein Rumoren, dann kam es ungläubig zurück: »Wer ist da?«
»Eure Retter, Messèr. Wenn ich Euch nun bitten dürfte, Eure Schuhe anzuziehen und zu mir heraufzukommen, damit wir Euch in Sicherheit bringen können …«
Ich blickte ihm über die Schulter und konnte das Innere der winzigen Zelle sehen, die so niedrig war, dass man kaum darin stehen konnte. Bleikammern, so nannte man diese Knastlöcher direkt unterm Dachgebälk des venezianischen Dogenpalastes – weil das Dach mit Bleiplatten gedeckt war. Im Sommer wurde es da drin mörderisch heiß, die Gefangenen steckten in einem Backofen, und im Winter war es so kalt wie in einem Kühlschrank. Wer meckerte, hatte schlechte Karten – die Folterkammer lag nämlich praktischerweise gleich um die Ecke. In der Gegenwart hatte ich mal eine Führung durch dieses Horrorkabinett mitgemacht. Von der Decke hing immer noch der Strick, mit dem man widerspenstige Gefangene so lange an den auf dem Rücken zusammengebundenen Händen aufgehängt hatte, bis sie alles gestanden, egal ob sie was verbrochen hatten oder nicht. Amnesty international hätte hier ein breites Betätigungsfeld gefunden.
»Wer zum Teufel seid Ihr?« Es klang misstrauisch. Klar, er hatte in wochenlanger Kleinarbeit das Loch ins Dach gebohrt und wollte heute Nacht nach dem nächsten Wachwechsel abhauen. Dass auf einmal fremde Leute an seinem Fluchtweg herumstanden, musste ihm verdächtig vorkommen. Hätte er gewusst, dass diese fremden Leute außerdem Zeitreisende waren und aus dem Jahr 2011 stammten, wäre er bestimmt gar nicht erst rausgekommen.
In der Öffnung tauchte eine Gestalt auf, und dann schob sich ein zerzauster Kopf ins Freie. Mein Herz klopfte schneller. Der Mann sah trotz des schwarzen Bartgestrüpps richtig gut aus! Nicht wirklich wie Heath Ledger, aber trotzdem sehr männlich, mit einem attraktiven, wenn auch etwas übernächtigten Gesicht und breiten Schultern, die gleich darauf ebenfalls ins Freie drängten.
»Unsere Namen tun nichts zur Sache, aber glaubt uns, dass wir Euch wohlgesonnen sind.« Sebastiano half dem Gefangenen aufs Dach heraus. Der klopfte sich die Kleidung ab, und anschließend stand er einfach nur da, blickte zum sternenübersäten Himmel auf und sog in tiefen Zügen die Nachtluft ein. Dann sah er mich an und riss die Augen auf.
»Meiner Treu! Ihr seid kein Knabe! Mit Eurer Verkleidung könnt ihr mich nicht täuschen!«
»Na ja.« Ich rückte meine Kappe zurecht und stopfte eine herausgerutschte Haarsträhne zurück. »Lange Röcke sind in dieser Höhe nicht das Wahre.«
»Ich habe dir gesagt, dass die Hose zu eng ist«, bemerkte Sebastiano grollend.
»Ich kann nichts dafür. Du hast sie mir gegeben!«
»Hast du zugenommen?«
»Findest du mich etwa fett?«, fragte ich empört zurück.
»Gestattet, dass ich mich vorstelle«, mischte der Gefangene sich ein. »Giacomo Casanova.« Er verneigte sich formvollendet, griff nach meiner Hand und küsste sie. »So ein schönes Fräulein, fürwahr! Wie sehr Euer Anblick mein Herz erwärmt! Ich hoffe, Ihr verzeiht mir meine unzureichende Aufmachung und meinen unseligen Körpergeruch.«
»Ja, und wir sollten jetzt los, bevor noch jemand runterfällt und sich den Hals bricht«, sagte Sebastiano schlecht gelaunt.
»Nur zu gerne!« Giacomo Casanova strahlte mich an, und ich strahlte zurück. Er sah ziemlich ungepflegt aus mit seinem verdreckten Hemd und den ungekämmten Haaren, aber er war auch der Typ, den Heath Ledger in einem meiner Lieblingsfilme gespielt hatte. Und ich stand ihm leibhaftig gegenüber! Solche Momente waren die Highlights dieses Ferienjobs!
Sebastiano stieg vorsichtig die Dachschrägung hinauf, das Windlicht mit einem Zipfel seines Wamses abschirmend, wobei er sich ab und zu mit der Hand abstützte. Es war nicht allzu steil, doch man musste vorsichtig sein, weil die Platten an manchen Stellen glatt waren. Casanova folgte ihm und blickte sich immer wieder zu mir um. Sein Lächeln hatte etwas Bezwingendes und Verheißungsvolles. Dieser Mann war definitiv der geborene Frauenheld, es stimmte alles, was man über ihn sagte. Aber dann überlegte ich, dass er nach über einem Jahr Knast wohl einfach unter männlicher Entbehrung litt. Wahrscheinlich hätte er auch mit der alten Bettlerin geflirtet, die unten auf der Piazzetta hockte und jeden, der vorbeikam, um Kleingeld anhaute. Trotzdem war es aufregend, mit ihm bei Nacht über den Dächern von Venedig unterwegs zu sein. So ein Abenteuer erlebte man nicht alle Tage, daran würde ich bestimmt noch lange zurückdenken.
Wir kletterten über den First, von dort aus ging es abwärts in Richtung Campanile weiter. Langsam und vorsichtig bewegten wir uns Schritt für Schritt das flach abfallende Dach hinab.
Casanova warf mir einen weiteren Blick über die Schulter zu. »Wie heißt Ihr, schönes Fräulein?«
»Anna«, erwiderte ich gedankenlos.
Sebastiano stieß einen Fluch aus, weil Casanova gegen ihn gestoßen war. Er konnte ihn gerade noch festhalten, sonst wäre er abgerutscht.
»Denkt lieber an Euren Hals als an schöne Frauen«, sagte er ärgerlich.
»Ah, aber diese eine hier ist überaus liebreizend!«, gab Casanova zurück. »Sie ist es wert, dass man jeden Augenblick an sie denkt!«
Ich fühlte mich geschmeichelt, doch Sebastianos Laune geriet langsam an den Tiefpunkt.
»Ist sie Euer Weib?«, wollte Casanova höflich wissen. Darauf gab Sebastiano keine Antwort. Wenig später war unser Weg über das Dach zu Ende. Wir hatten das Fenster erreicht, durch das wir mithilfe einer Leiter zu Beginn der Rettungsaktion aufs Dach gelangt waren. Sebastiano kletterte als Erster hinein, dann half er mir beim Einstieg und anschließend Casanova. Drinnen wartete schon der schielende, nach Zwiebeln stinkende Wärter, den Sebastiano bestochen hatte.
»Lorenzo«, sagte Casanova verärgert zu ihm. »Woher kommt dieser Sinneswandel? Flehte ich dich nicht tausendmal an, mir aus diesem Rattenloch herauszuhelfen? Wieso tust du es für diese Fremden, nicht jedoch für mich?«
Dafür gab es eine einfache Erklärung. Lorenzo war nicht gerade der Hellste, aber schlau genug, um viel Gold von wenig Gold unterscheiden zu können. Das wurde Casanova im nächsten Moment auch klar, denn er nickte langsam und bedachte Sebastiano mit einem bohrenden Blick, in dem unzählige Fragen lagen. Die wichtigste stellte er zuerst.
»Warum ich?«, wollte er von Sebastiano wissen. Als dieser jedoch schwieg, wandte er sich an mich. »Warum habt Ihr von all den Gefangenen ausgerechnet mich befreit, Anna?«
Weil du ein toller Typ bist und tolle Bücher geschrieben hast und weil dein Leben ein einziges Abenteuer war! Deshalb sind wir aus der Zukunft gekommen und haben dich aus dem Knast befreit, damit du so berühmt werden kannst, wie du es in unserer Zeit sein wirst!
Doch das konnte ich ihm natürlich nicht sagen. Eine Art automatische Sperre verhinderte es. Kein Zeitreisender konnte den Menschen in der Vergangenheit Dinge aus der Zukunft verraten. Auch wenn man es wollte – es ging nicht.
Davon abgesehen hätte Casanova uns sowieso kein Wort geglaubt. Jeder vernünftige Mensch hätte uns für verrückt erklärt, wenn wir ihm erzählt hätten, dass wir Zeitwächter waren und als Beschützer bezeichnet wurden und dass unsere geheimnisumwitterten Auftraggeber sich Bewahrer nannten oder einfach nur die Alten. Bevor ich vor anderthalb Jahren zu dieser Truppe gestoßen war, hätte ich es ja selbst für absoluten Blödsinn gehalten. Von daher passte es ganz gut, dass wir wegen der Sperre nicht drüber reden konnten.
»Jetzt aber los«, sagte Sebastiano. Wieder ging er voraus. Außer Lorenzo hatte er auch den Sekretär der Staatsinquisition bestochen, der dafür gesorgt hatte, dass alle Türen in diesem Trakt offen waren. Den Weg musste uns niemand zeigen, Sebastiano war schon oft im Dogenpalast gewesen, in allen möglichen Zeiten. Durch dunkle Gänge, staubige Kabinette und über schmale Hintertreppen ging es nach unten. Im dritten Stock herrschte Stille, aber im zweiten Stock hörten wir Schritte auf dem Gang – Wachen! Wir warteten mit angehaltenem Atem und dicht an die Wand gedrückt, bis es wieder ruhig war, dann rannten wir weiter, die nächste Treppe runter. Bis jetzt war alles im grünen Bereich, dafür konnte ich die Hand ins Feuer legen – mein Nacken hatte kein einziges Mal gejuckt. Das Jucken war so eine Art übersinnliche Begabung bei mir. Oder auch ein Fluch, je nach Betrachtungsweise, denn immer, wenn ernstliche Gefahr im Anmarsch war, fing es an, dicht über der Wirbelsäule. Je schlimmer es juckte, desto größer die Gefahr. Sobald es damit losging, war also äußerste Vorsicht angesagt. Vorausgesetzt, dafür blieb überhaupt noch genug Zeit, was leider nicht immer der Fall war.
Ich hatte kaum daran gedacht, als es auch schon anfing.
»Oje«, sagte ich.
»Jetzt sag bloß nicht …« Sebastiano blieb auf halber Höhe eines finsteren Flurs im Erdgeschoss wie angewurzelt stehen und drehte sich zu mir um.
»Doch, leider.«
»Mist.«
»Was ist los?«, ließ Casanova sich hinter mir mit gedämpfter Stimme vernehmen. Sebastiano drückte mir die Laterne in die Hand und zog mit einem metallischen Ratschen seinen Degen. Casanova wich zurück.
»Was zum …«
»Pst! Seid um Himmels willen leise, Messèr!« Sebastiano reichte ihm den Degen, und Casanova verstummte verdattert.
»Nur im Notfall benutzen«, flüsterte Sebastiano. »Aber vermeidet lautes Geschrei, sonst haben wir sofort sämtliche Wachen von San Marco auf dem Hals.«
»Ich werde diese entzückende Jungfer mit meinem Leben beschützen!« Casanova beugte sich zu mir. »Ich finde nicht, dass Eure Hose zu eng ist«, vertraute er mir leise an. »Im Gegenteil. Sie schmeichelt Euren Formen ungemein!«
»Das wird mir langsam zu viel«, brummte Sebastiano. Er warf mir einen frustrierten Blick zu, dann packte er mich und gab mir einen kurzen, aber leidenschaftlichen Kuss. Anschließend sagte er zu Casanova: »Nur, um das mal klarzustellen. Und jetzt weiter.« Er zog seinen Dolch und schob sich langsam vorwärts. Ich wusste, dass er ein fabelhafter Messerkämpfer war, das hatte ich selbst schon miterlebt, aber meine Hand mit der Laterne zitterte trotzdem heftig. Casanova blieb auf Tuchfühlung hinter mir, den Degen hatte er seitlich an mir vorbeigestreckt. Und dann bogen zwei Wachen um die Ecke. Eigentlich hätten sie so früh noch gar nicht hier sein dürfen, sie mussten ihren Patrouillengang abgekürzt haben. Immerhin war der Überraschungseffekt auf unserer Seite. Den beiden blieb kaum Zeit, ihre Degen zu ziehen. Casanova stürzte sich an mir vorbei auf den einen Wachmann, und Sebastiano nahm sich den zweiten vor, während ich mit der Laterne dastand wie ein einziges zitterndes Nervenbündel. Das Klirren der aufeinanderprallenden Klingen kam mir ohrenbetäubend laut vor, und Casanova war auch nicht gerade leise. Seine Kampfschreie waren wahrscheinlich bis zum Rialto zu hören.
»Da! Nimm dies! Du elender Schurke! Sieh dich vor! Gleich krieg ich dich! Ja, erwischt!« Er hatte einen Treffer gelandet, doch sein Widersacher schüttelte sich nur kurz und kämpfte weiter. Der ganze Krach würde in null Komma nichts ein Dutzend Wachleute auf den Plan rufen! Ich sah ängstlich zu Sebastiano hinüber, der mit gezücktem Dolch seinen Gegner umkreiste. Der stürmte mit dem Degen voran auf ihn los, worauf Sebastiano elegant zur Seite trat und ihn mit einem sauberen Judogriff durch die Luft wirbeln ließ. Der Mann landete hart, sein Helm rollte scheppernd davon. Als er sich stöhnend aufrichten wollte, traf ihn Sebastianos Messerknauf an der Schläfe, und er fiel bewusstlos zurück. Casanova und der zweite Wachmann fochten immer noch. Von Ferne waren Männerstimmen und hallende Stiefelschritte zu hören. Mein Nacken juckte stärker.
»Schnell!«, rief ich.
Sebastiano eilte Casanova zu Hilfe, indem er den Wachmann von hinten zu Fall brachte und dann auf die gleiche Weise außer Gefecht setzte wie den anderen.
»Aber ich hatte ihn doch fast!«, rief Casanova ein wenig beleidigt.
»Spart Euren Atem für die Flucht«, sagte Sebastiano. Er nahm Casanova den Degen wieder weg und winkte uns, ihm durch das Tor ins Freie zu folgen. Wir traten hinaus in den endlos langen Arkadengang an der Südseite des Palastes. Entlang der Mole brannten Fackeln, in deren Licht die unheimlich schwankenden Umrisse zahlloser Boote zu sehen waren, die dort am Kai lagen.
Ich rieb mir den Nacken. »Da kommen sie!«
Ein Trupp bewaffneter Männer kam durch den Säulengang getrampelt und näherte sich erschreckend schnell. Sie waren mindestens zu viert oder fünft, den Schritten und dem Gebrüll nach zu urteilen. Im Fackellicht konnte man ihre emporgereckten Lanzen sehen.
»Besser, Ihr gebt mir den Degen wieder!«, rief Casanova kämpferisch.
»Ein andermal.« Sebastiano reckte sich auf die Zehenspitzen. »Da ist die Gondel! Es wird knapp! Kommt!«
Die Wachen waren höchstens noch ein Dutzend Schritte entfernt. Sebastiano packte mich bei der Hand, und wir rannten los. Casanova brauchte keine Extra-Einladung, er legte einen beachtlichen Sprint hin. Die Gondel war aus dem Rio di Palazzo geglitten und wartete direkt beim Ponte della Paglia auf uns. Sebastiano und ich sprangen gleichzeitig hinein, und Casanova folgte uns auf dem Fuße. Beim Einsteigen rutschte er allerdings ab und landete mit einem Bein im Wasser, doch José stieß die Gondel bereits mit dem langen Ruder von der Kaimauer ab und ruderte los wie der Teufel, hinaus in die tintenschwarze Lagune. Wir waren noch keine zwei Bootslängen von der Mole entfernt, als die wütenden Verfolger den Rand des Kais erreichten. Ein Wachmann schleuderte uns unter aufgebrachtem Gebrüll seine Lanze hinterher, die meinen Kopf um ungefähr drei Zentimeter verfehlte. Ich sah sie aus dem Augenwinkel dicht neben meinem Ohr vorbeizischen. Sebastiano stieß einen Fluch aus und zerrte mich runter, auf den Boden der Gondel. Dann krachte ein Schuss, einer der Wachmänner hatte seine Pistole zum Einsatz gebracht. Zum Glück war er ein miserabler Schütze, die Kugel pfiff weit über unseren Köpfen durch die Luft. José strengte sich an, uns mit gewaltigen Ruderstößen aus der Gefahrenzone zu bringen. Wir kamen rasch vorwärts. Die Männer waren bald nur noch ein paar schemenhafte Umrisse im Licht der Uferfackeln, und ihr Geschrei verklang in der Ferne.
»Wer seid Ihr?« Neugierig starrte Casanova José an, der auf der hinteren Abdeckung der Gondel stand und im Licht der Bootslaterne einen wirklich sehenswerten Anblick bot. Vor allem deshalb, weil er ruderte wie ein Weltmeister, aber mit seiner klapperdürren Gestalt aussah, als bräuchte er dringend ein paar Vitamine. Kein Mensch wusste, wie alt er war. Dem Aussehen nach hätte er alles zwischen sechzig und siebzig sein können, doch für einen Zeitreisenden, vor allem für einen der Alten, war das natürlich relativ. Ich schätzte ihn auf ein paar tausend Jahre, aber Sebastiano meinte, ich würde wie immer maßlos übertreiben. José selbst verriet sein wahres Alter nicht. Sein linkes Auge zwinkerte nur nachsichtig, wenn man ihn danach fragte. Das rechte verbarg er unter einer schwarzen Augenklappe, die ihm eine gewisse Ähnlichkeit mit einem in die Jahre gekommenen Piraten verlieh. Auf Casanovas Frage, wer er sei, hüllte er sich einfach in geheimnisvolles Schweigen, das tat er bei mir auch oft, wenn ich zu neugierig wurde.
Casanova nahm es ihm nicht übel, er war zu sehr damit beschäftigt, sich über seine neu gewonnene Freiheit zu freuen. Er hockte neben mir und wrang sein triefendes Hosenbein aus, während er aufgekratzt die Ereignisse rekapitulierte.
»Habt Ihr gesehen, wie ich dem Wachmann mit meiner Riposte zugesetzt habe? Er war schnell, aber ich war schneller! Im Parieren war ich schon immer gut. Ha, gelernt ist gelernt! Und dieser stumpfsinnige Lorenzo erst! Er wird sich gewiss in hundert Jahren noch fragen, womit ich das Loch in mein Zellendach gebohrt habe! Meine Flucht wird zu zahlreichen Spekulationen Anlass geben!«
In dem Stil ging es noch eine Weile weiter. Sebastianos Rolle bei der ganzen Sache fiel mehr oder weniger unter den Tisch. Rückblickend wurde er zu einer Art Assistent, der zufällig auf dem Dach rumgehangen hatte, als es losging. Leider verdarb das meinen guten ersten Eindruck von Casanova ein bisschen, er schien ein ziemlicher Angeber zu sein. Aber dann sah ich, dass seine Hände, die er immer noch in sein nasses Hosenbein krampfte, fast so schlimm zitterten wie meine. Und ich konnte jetzt auch erkennen, wie sehr er körperlich unter der Haft gelitten hatte. Er war zu dünn für seine Größe, seine Haut wies eine ungesunde Blässe auf und war von Flohbissen übersät. In dem Buch, das er über seine Flucht geschrieben hatte – oder genauer: in vielen Jahren schreiben würde –, war auch von Ratten die Rede gewesen. Die fünfzehn Monate in diesem grauenhaften Loch mussten die Hölle gewesen sein. Mit dem ganzen prahlerischen Gehabe wollte er bloß überspielen, dass er total am Ende war. Und dafür, das musste man ihm wirklich lassen, hatte er sich unglaublich gut geschlagen.
José lenkte die Gondel mit traumwandlerischer Sicherheit durch die Nacht. Vor uns tauchte die Spitze der Giudecca auf, und ich erinnerte mich zwangsläufig an den gruseligen Schlussakt meines ersten Zeitreise-Abenteuers im Jahr 1499. Doch diesmal bogen wir weit vor der Giudecca rechts ab und fuhren an der Südseite Dorsoduros entlang. Auch hier war das Ufer in unregelmäßigen Abständen von Fackeln erleuchtet. Ein paar angetrunkene Gecken mit Dreispitzhüten, Kniehosen und Schnallenschuhen kamen aus einem pompösen Palazzo und winkten uns fröhlich zu. Vor einer Kirche stapften zwei Wachmänner vorbei, und Casanova zog hastig den Kopf ein, bis José rechterhand in einen anderen Kanal einbog. Jetzt war es nicht mehr weit. Wie immer vor einem Zeitsprung erfasste mich Aufregung. Bis jetzt war es jedes Mal gut gegangen, aber ich vergaß nie, was Sebastiano zu Beginn unserer Beziehung einmal zu mir gesagt hatte. Es kommt vor, dass Reisende ganz einfach verschwinden.
Trotzdem freute ich mich auf die Gegenwart und den Karneval, zu dem wir gleich zurückkehren würden. Wir mussten bloß noch Casanova absetzen. Das Boot, das ihn aufs Festland bringen sollte, wartete in der dunklen Einmündung zum Canal Grande. Es war eine Schaluppe mit Zwei-Mann-Besatzung. Einem der beiden gehörte das Boot, er hatte sich diese Fahrt fürstlich von Sebastiano bezahlen lassen. Der andere würde dafür sorgen, dass Casanova mit dem Nötigsten versorgt wurde und sicher weiterreisen konnte. Er war der hiesige Bote – so hießen die Helfer von uns Zeitwächtern. Sie lebten in der jeweiligen Epoche und waren unter anderem für die Ausstattung mit Kleidung und für die Unterbringung zuständig. Deshalb waren sie weitgehend in alle Vorgänge eingeweiht, auch wenn wir ihnen wegen der Sperre nichts über die Zukunft erzählen konnten.
Casanova konnte sein Glück nicht fassen, er wollte andauernd wissen, warum wir das alles für ihn taten.
»Vielleicht habt Ihr ja einen edlen Gönner«, meinte Sebastiano schließlich entnervt.
Von dieser Idee war Casanova spontan begeistert.
»War es Bragadin?«, wollte er wissen. »Ganz bestimmt war er es! Ich wusste, dass mein alter Freund mich nicht im Stich lässt!«
»Am besten vergesst Ihr einfach, dass Ihr Hilfe von außen hattet«, empfahl ihm Sebastiano.
»Ich werde über Eure Rolle schweigen wie ein Grab, das schwöre ich bei meinem Leben! Aber sagt mir nur, wer Euch schickte!«
»Steigt in das Boot und geht auf die Reise«, schlug ich vor. »Irgendwann findet Ihr selbst heraus, wem Ihr die Freiheit verdankt.«
Oder auch nicht, fügte ich in Gedanken bedauernd hinzu, denn er würde es nie erfahren. Casanova würde immer auf der Suche nach dem großen Gönner bleiben. Er würde kreuz und quer durch Europa ziehen und erlauchte Persönlichkeiten an diversen Königshöfen kennenlernen. Er würde sich verlieben, verschulden, spielen, lügen und betrügen und als größter Frauenverführer aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Und in vielen Jahren würde er über die Flucht aus den Bleikammern ein unterhaltsames Buch schreiben. Sebastiano und ich würden nicht darin vorkommen, hier würde Casanova Wort halten. Und das war auch gut so, denn unsere Arbeit sollte ja geheim bleiben.
»Lebt wohl, meine Freunde«, sagte Casanova. Sebastiano bedachte er nur mit einem Nicken, aber von mir konnte er sich nur schlecht trennen. Er nahm meine Hand und bedeckte sie mit Küssen. »Ich werde Euch nie vergessen, schöne Anna!«
»Das glaub ich jetzt gerade nicht«, sagte Sebastiano ärgerlich.
»Es wird Zeit«, mahnte José. Er blickte zum Himmel. Der Mond stand voll und rund über den hohen Dächern. Casanova kletterte auf die Schaluppe und winkte uns nach. Ich winkte zurück, bis wir ihn nicht mehr sehen konnten, während die Gondel zügig weiterglitt und in den Canal Grande einbog. Am Ufer waren ein paar Leute unterwegs, und auch vereinzelte Gondeln zogen auf dem Kanal ihre Bahnen. Wir waren nicht allein, doch das machte nichts. Das Portal war das größte und stärkste in Venedig. Es war nicht nur unsichtbar, sondern tarnte auch den gesamten Vorgang der Zeitreise. Niemand würde unseren Übertritt bemerken. Die Leute wunderten sich vielleicht flüchtig, weil unsere Gondel nicht vorschriftsmäßig schwarz war, sondern rot. Aber einen Augenblick später würden sie es bereits vergessen haben.
»Es geht los«, sagte José, während wir auf den Kai zuhielten, zu der Stelle, wo wir nachher aussteigen würden. In mehr als zweihundertfünfzig Jahren. Sebastiano umarmte mich fest, während ich bereits das Flimmern um die Gondel herum aufsteigen sah, wie eine feine Linie aus grellem Licht, die immer breiter wurde.
»Du warst toll heute Nacht«, murmelte Sebastiano mir ins Ohr. »Habe ich dir schon gesagt, dass ich verrückt nach dir bin?«
»In diesem Jahrhundert noch nicht.«
Das Flimmern umgab das ganze Boot, die Luft war wie aufgeladen. Das Licht wurde blendend hell, ich musste die Augen zusammenkneifen. Schreckliche Kälte breitete sich in mir aus. Vor dieser Kälte hatte ich immer die meiste Angst. So musste sich der Tod anfühlen. Vibrationen erfassten das Boot, sie steigerten sich zu einem Rütteln und dann zu einem schlingernden Auf und Ab, man kam sich vor wie auf einer Achterbahn. Sebastiano küsste mich leidenschaftlich, und ich klammerte mich an ihn, um nicht in den Abgrund zu stürzen. Der donnernde Knall kam nicht unerwartet, aber trotzdem hatte ich auch diesmal wieder das Gefühl, als würde mein Körper explodieren und sich in Myriaden von Splittern über das ganze Universum verteilen. Ich konnte nichts mehr spüren, nicht mal mehr Sebastiano.
Und im nächsten Augenblick wurde alles um mich herum von absoluter Dunkelheit verschluckt.
Venedig, 2011
Niemand sah unsere Gondel auftauchen, wir waren einfach auf einmal da – in derselben Sekunde, in der wir zu unserer Reise in die Vergangenheit aufgebrochen waren, am frühen Abend und mitten im Karneval. Auf dem Balkon eines Palazzos stand eine Frau mit einer Harlekinmaske und trötete in eine Vuvuzela – genau dasselbe hatte sie bei unserer Abreise ins Jahr 1756 gemacht. Der Mann am Kai, der gerade seine Kamera gezückt hatte, schoss immer noch Fotos von seinem Kind, das als Löwe verkleidet war und Konfetti aufs Wasser warf. Es schien, als wären wir überhaupt nicht weg gewesen. Das war die Magie der roten Gondel. Die Zeit in der Gegenwart blieb sozusagen stehen, egal, wie lange man in der Vergangenheit gewesen war. Am Ufer herrschte dasselbe Gewimmel wie bei unserem Aufbruch. Überall wurde an diesem Faschingsdienstag gefeiert.
José ließ uns am Anleger aussteigen und tippte zum Abschied an seinen Hut, bevor er wieder losruderte und gleich darauf mitsamt der Gondel im Kielwasser eines vorbeituckernden Vaporettos verschwand. Außer mir und Sebastiano bemerkte es niemand.
Er schlang beide Arme um mich. »Da sind wir wieder.« Dann küsste er mich. »Party?«
»Party«, stimmte ich zu.
Aber vorher schauten wir noch bei Sebastianos Vater Giorgio vorbei, der ganz in der Nähe wohnte. Er begrüßte mich überschwänglich, bewunderte unsere stilechte historische Kostümierung und bestand darauf, dass wir zum Essen blieben, bevor wir uns in den Trubel stürzten. Seine Freundin war auch da, eine etwas zu stark geschminkte Blondine namens Carlotta, die uns tausend Fragen stellte. Sebastiano erklärte, dass wir leider keine Zeit hätten und weitermüssten. Seine Mutter war vor vier Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen, aber er hatte sich immer noch nicht richtig daran gewöhnt, dass sein Vater wieder eine Freundin hatte. Carlotta war beleidigt, dass wir so schnell wieder abzogen, denn wir ließen uns nicht besonders oft dort blicken. Doch Giorgio nahm es uns nicht übel und umarmte uns herzlich zum Abschied.
»Feiert schön!«, rief er uns nach.
»Machen wir!«, rief Sebastiano zurück.
Auf der Piazza war die Hölle los. Wir sahen alle Masken der Commedia dell’arte in zig Variationen versammelt. Und jede Menge Casanovas in feinen Seidenwesten und mit weißen Perücken. Unsere eigenen, mittlerweile ziemlich schmuddeligen Kostüme, mit denen wir auf dem Dach des Dogenpalastes herumgeturnt und durch die Zeit gereist waren, konnten mit dieser edlen Pracht nicht mithalten. Wir schoben uns durch das Gedränge, tranken Prosecco aus Pappbechern und bewunderten die kunstvoll zurechtgemachten Gestalten. Irgendwann hatten wir genug und beschlossen, den Abend bei Sebastiano zu Hause ausklingen zu lassen. Er hatte eine kleine Wohnung in der Nähe der Universität, was aus mehreren Gründen praktisch war: Zum einen konnte ich ihn dort besuchen und herrlich ungestörte Tage mit ihm verbringen, und zum anderen waren es bis zu seinem Arbeitsplatz nur ein paar Minuten zu Fuß – Sebastiano war wissenschaftlicher Assistent an der Uni. Hauptsächlich arbeitete er dort im Archiv. Dessen Leiter wiederum war kein anderer als José, der mit vollständigem Namen José Marinero de la Embarcación hieß. Jedenfalls nannte er sich offiziell so. Sebastiano arbeitete gern bei ihm. Er liebte seinen Job, den als Zeitwächter genauso wie den als Historiker und Kulturwissenschaftler. Übernächstes Jahr würde er seinen Master machen. Ich war davon überzeugt, dass beruflich alles wie geschmiert bei ihm laufen würde. Wenn ich bei mir selbst nur auch so sicher gewesen wäre!
Natürlich wäre es ziemlich praktisch, wenn ich mir nach dem Abi ein Studienfach aussuchte, das irgendwie mit dem Zeitreisen kompatibel war. Archäologie hätte theoretisch gut gepasst, aber das fand ich ebenso langweilig wie Geschichte. Mein Vater war ein bekannter Archäologe, er schleppte meine Mutter und mich im Urlaub ständig zu irgendwelchen Ausgrabungsorten und zeigte uns alle möglichen Ruinen, doch bisher hatte mich das nicht vom Hocker gerissen.
Ich hatte sogar schon an so abgefahrene Sachen gedacht wie Modedesign, mit Schwerpunkt Kostümgeschichte. Dummerweise hatte ich überhaupt keinen Bezug zu Mode. Mir fehlte dafür einfach die passende Veranlagung. Entweder man hatte sie oder nicht. Meine Freundin Vanessa hatte sie definitiv. Sie erkannte Schuhmarken auf dreißig Meter Entfernung und besaß eine Sammlung von ungefähr tausend Modemagazinen. Egal, was sie trug – in jedem ihrer Outfits sah sie aus wie ein Covergirl der Cosmopolitan. Ich zog hingegen immer nur das an, was in der Wäschekommode gerade oben lag. Sebastiano störte sich nicht daran, ihm gefiel ich so, wie ich war, jedenfalls behauptete er das immer. Mittlerweile glaubte ich es sogar, auch wenn es mir anfangs schwergefallen war.
Bis jetzt lief es ja auch wirklich super mit uns, und das schon seit anderthalb Jahren. Und demnächst würde es noch besser laufen, denn dann war Schluss mit den vielen teuren Flügen und Zugfahrten: Bald hatte ich das Abi in der Tasche, dann konnten wir zusammenziehen. Ich freute mich wie verrückt darauf, und er sich auch, aber ich hätte mich deutlich besser gefühlt, wenn ich gewusst hätte, was ich studieren sollte. Mein Italienisch war inzwischen ganz brauchbar, die Vorlesungen an der Uni würde ich auf alle Fälle gut verstehen – vorausgesetzt, bis dahin wäre klar, welche es sein sollten.
»Was geht dir durch den Kopf?« Sebastiano drückte mich an sich und küsste mich auf die Wange. »Du siehst so ernst aus!«
Ich seufzte. »Ich denke über meine Zukunft nach. Studium und so.«
»Warum lässt du es nicht einfach auf dich zukommen?«
Er konnte so beneidenswert locker sein. Ich liebte ihn dafür, aber trotzdem wäre ein konkretes Ziel eine gute Sache.
»Wenn ich wenigstens für irgendwas richtig begabt wäre!«
»Aber das bist du doch. Du spielst toll Klavier.«
»Ach, das ist bloß Geklimper. Ich meinte eher was Nützliches. So wie bei dir. Oder bei meiner Mutter.«
Meine Mutter war noch berühmter als mein Vater. Sie war Physikdozentin und hatte schon diverse internationale Preise eingeheimst. Angesichts ihrer überragenden Intelligenz hatte ich früher lange Zeit felsenfest geglaubt, dass ich ein adoptiertes Kind sein müsse. Meine Eltern hatten immer wieder das Gegenteil behauptet, aber das hatte ich ihnen nicht abgekauft, bis sie irgendwann zum Beweis die Geburtsurkunde gezückt und ein paar Fotos aus dem Kreißsaal vergrößert hatten. Sie hatten mir meinen Namen auf dem Schildchen an dem Babyärmchen gezeigt, doch manchmal dachte ich immer noch, dass es vielleicht ein Fake war. Vor allem, wenn ich wieder mal eine Fünf in Mathe kassiert hatte, was ziemlich oft vorgekommen war.
»Na ja«, meinte Sebastiano. »Du hast dieses Nackenjucken. Das ist eine tolle Begabung, die hat sonst kein Mensch auf der Welt.«
»Klar«, sagte ich verdrossen. »Ich sollte mich damit selbstständig machen.«
Sebastiano grinste. »Du wirst schon einen schönen Beruf finden. Erst mal schreibst du jetzt in aller Ruhe deine Abi-Klausuren, und dann sehen wir weiter.«
»Erinnere mich nicht daran.«
Wir hatten das Mietshaus erreicht, in dem Sebastiano wohnte. Er schloss die Tür auf und zog mich ins Treppenhaus, wo er mich gegen die Wand drängte und mich küsste, bis mir die Luft wegblieb.
»Das war jetzt dringend nötig«, sagte er hinterher schwer atmend.
»Warum denn?«, fragte ich mit wackligen Knien, während er mich die Treppe zu seiner Wohnung hochzog.
»Um dich auf andere Gedanken zu bringen.«
Das war ihm auf alle Fälle gelungen. Und der Abend hatte erst angefangen. Für den Rest des Tages und die darauffolgende Nacht war mir mein Abi völlig egal.
Frankfurt, 2011
Acht Tage später sah das wieder ganz anders aus. Ich saß in der Matheklausur und hatte keine Ahnung. Zuerst brütete ich über einer Kurvendiskussion, die sich irgendwie nicht richtig ableiten ließ. Analysis war meine Nemesis, ein Fremdwort, das ich mir nur deshalb gemerkt hatte, weil beides sich aufeinander reimte – es bedeutete so viel wie Schreckgespenst. In Stochastik konnte ich auch nur raten. Die Ergebnisse – immerhin hatte ich welche – kamen mir seltsam vor, aber besser kriegte ich es nicht hin. Zwischendurch tauschte ich immer wieder verzweifelte Blicke mit Vanessa, die drei Tische rechts von mir saß und ähnliche Probleme hatte wie ich. Unsere Mathe-Aversion teilten wir schon seit der Einschulung, das war sozusagen der Grundstein für unsere Freundschaft gewesen. Wir hatten deswegen sogar gemeinsam eine Klasse wiederholen müssen.
Irgendwie brachte ich die Klausur hinter mich und gab sie mit einem mulmigen Gefühl im Magen ab. Vanessa und ich verließen zusammen den Raum. Draußen diskutierten die anderen über die richtigen Lösungen, und nichts davon klang so, als wäre ich jemals damit in Berührung gekommen.
Am liebsten hätte ich mir die Ohren zugehalten.
»Komm, lass uns abhauen«, sagte Vanessa frustriert. »Dieser ganze Mist war auch so schon schlimm genug. Meldest du dich nachher?«
Ich nickte bloß stumm. Sie drückte mich kurz und ging zu ihrem Auto, während ich mich auf mein Rad schwang.
Zu Hause wartete Papa mit dem Essen auf mich. »Ich hab dir extra Nudelauflauf gemacht, Kind.« Er hatte diese Woche den Innendienst, weil meine Mutter auf einem Kongress in Kopenhagen war. Zwischen seinen Ausgrabungen hielt er Vorlesungen an der Uni, aber mindestens genauso oft war er daheim und gab sich Mühe, während Mamas Abwesenheit Familienstimmung zu verbreiten. Unter anderen Umständen hätte ich mich gefreut, mit ihm zusammen zu Mittag zu essen und zu quatschen, doch heute war mir nicht danach.
»So schlimm?«, fragte er mitfühlend. »Konntest du denn gar keine Aufgabe?«
»Ich hab sie alle gemacht. Das Blöde ist nur – ich hab keine Ahnung, ob ich irgendwas davon richtig habe.«
»Dann ist bestimmt nicht alles falsch«, meinte er sofort tröstend. »Das wäre gegen jede Wahrscheinlichkeit.«
Über Wahrscheinlichkeiten hätte ich ihm viel erzählen können. Aber von meinen Zeitreisen durfte ich meinen Eltern nichts verraten. Niemand wusste etwas davon, nicht mal Vanessa. Sebastiano hatte mir eingeschärft, dass unautorisiertes Wissen für unbeteiligte Personen gefährlich sein konnte. Er selbst hatte in all den Jahren, in denen er den Job machte, noch nie jemandem davon erzählt.
Um Papa einen Gefallen zu tun, aß ich etwas Nudelauflauf. Anschließend verkroch ich mich in meinem Zimmer, schaute bei Facebook rein, telefonierte eine Runde mit Vanessa und versuchte, die Matheklausur zu vergessen. Die beiden LK-Klausuren in Deutsch und Bio waren super gelaufen, immerhin. Jetzt hatte ich das Schriftliche hinter mir und konnte erst mal durchatmen. Am liebsten wäre ich sofort wieder nach Venedig geflogen. Wenn das nur nicht immer so ins Geld gehen würde! Im letzten Jahr hatte ich angefangen, einem Nachbarskind Klavierunterricht zu geben, und verdiente damit nebenher ein bisschen, aber für mehr als einen Flug im Monat reichte es nicht. Und den musste man lange genug im Voraus buchen, sonst kostete es zu viel. Sebastiano verdiente als studentische Hilfskraft ebenfalls nicht die Welt, er konnte auch nicht ständig nach Frankfurt kommen.
Ich tat mir gerade sehr leid, weil ich jetzt so gern bei ihm gewesen wäre und er so weit weg war, da klingelte mein Handy. Das musste er sein! Er hatte mich nach jeder Klausur angerufen und gefragt, wie es gelaufen war. Sofort ging es mir besser. Doch die Nummer auf dem Display hatte ich noch nie gesehen, obwohl der Anruf aus Venedig kam, wie ich an der Vorwahl erkennen konnte. Hastig meldete ich mich.
»Anna Berg.«
»Anna«, kam es wie ein Echo zurück. Es klang leise und irgendwie … schwach.
»Wer ist da?«, fragte ich beunruhigt.
»José. Anna, Sebastiano braucht deine Hilfe.«
Ich konnte ihn kaum verstehen.
»Was ist los mit ihm?«, rief ich erschrocken. »Wo ist er?«
»In Paris.«
»In Paris? Wieso das denn?«
»Er hat eine Aufgabe übernommen … ist in der Zeit gestrandet … Steckt da fest …«
Mir fiel vor Schreck fast das iPhone aus der Hand. »In Paris? Sonst ist er doch immer nur in Venedig!«
»Sondereinsatz«, kam es leise zurück. Josés Stimme wurde immer schwächer.
»José? Was ist mit dir? Bist du krank? Was soll ich tun? Sag mir, was ich tun soll!«
»Ihm helfen.«
»Ja!«, schrie ich. »Das will ich ja gerne sofort machen! Ich muss nur wissen, wo er ist! Ich meine … wann?! Und was ist mit dir passiert?«
»Bin verletzt, muss mich ausruhen. Ist jetzt … dein Job. Sechzehnhundertfünfundzwanzig.«
»O Gott! Wie soll ich denn da hinkommen?«
»Da ist jemand.« Er diktierte mir mit schwacher Stimme eine Telefonnummer und einen Namen. Ich schrieb fieberhaft alles auf meinen Arm, weil ich in der Hektik keinen Zettel fand.
»Anna … Trau keinem. Auch nicht Sebastiano.«
»Was?«, fragte ich schockiert.
Aber er hatte schon aufgelegt. Ich rief ihn sofort zurück, doch die Leitung war besetzt, und beim zweiten Mal kam eine automatische Bandansage auf Italienisch, dass der Teilnehmer vorübergehend nicht erreichbar sei. Als Nächstes rief ich die Nummer an, die er mir genannt hatte. Sie gehörte zu einem gewissen Gaston Leclerc (auf meinem Arm stand allerdings Garçon Eclair, die richtige Schreibweise seines Namens bekam ich erst später raus), aber auch da meldete sich nur eine Stimme vom Band – auf Französisch. Das war eine Sprache, von der ich dummerweise nur ein paar Wörter kannte, hauptsächlich aus der Essenskategorie, zum Beispiel Mon Chérie oder Ratatouille.
Danach verlor ich keine Zeit. Ich stopfte ein paar Sachen in meine Reisetasche und suchte mir im Internet den nächsten Flug nach Paris raus. Es war mörderisch teuer und würde meinen Kontostand ins Nirwana befördern, doch das spielte nicht die geringste Rolle. Jetzt musste ich mir nur noch eine gute Ausrede für Papa überlegen. Zu meiner Erleichterung nahm er mir die Mühe ab. Während ich noch fieberhaft nachdachte, was ich ihm erzählen sollte, klopfte er an und kam in mein Zimmer.
»Wäre es sehr schlimm, wenn du das Wochenende über alleine bleiben müsstest?«, wollte er wissen. »Ich würde nämlich gern zu Mama fahren, die langweilt sich ein bisschen. Natürlich könntest du auch mitkommen.« Dann sah er meine Reisetasche. »Ach, du willst sowieso weg? Zu Sebastiano? Da warst du doch erst letzte Woche zum Karneval.« Er runzelte die Stirn. »Hatten wir darüber geredet, dass du diese Woche wieder hinfliegst? Ich glaube, ich hab’s total vergessen.«
»Ähm, ja. Ich wollte mich mit ihm treffen. Aber ausnahmsweise nicht in Venedig, sondern in Paris. Da wohnt ein … Freund von ihm.«
»Hast du denn schon ein Flugticket?«
»Gerade gebucht und ausgedruckt.« Ich deutete gespielt fröhlich auf das Blatt Papier, das noch im Drucker lag. Papa zog es raus und warf einen Blick darauf.
»Oh«, sagte er.
»Ja, ich weiß. Es ist sehr teuer. Aber ich muss wirklich unbedingt zu Sebastiano! Die Klausuren waren so … anstrengend. Und er fehlt mir so wahnsinnig!«
»Okay«, sagte Papa langsam. Dann tat er etwas, das ganz typisch für ihn war. Er schnappte sich meinen aufgeklappten Laptop, rief sein Online-Banking auf und überwies mir das Geld für das Ticket auf mein Konto.
»Schon mal vorträglich zum Abi«, sagte er.
Ich umarmte ihn stürmisch und bedankte mich. Gleich darauf wurde es auch schon Zeit, zum Flughafen zu fahren. Papa brachte mich zum Hauptbahnhof und ließ mich davor aussteigen, und im Wegfahren winkte er mir lächelnd nach. Ich lächelte zurück, bis er nicht mehr zu sehen war, dann kamen mir die Tränen. Mir war übel vor Angst und Sorge. Die ganze Zeit hatte ich mich zusammengerissen, doch jetzt ließen die Nerven mich im Stich. Nur gut, dass ich öfters flog. Ich musste nicht groß darauf achten, wie alles ablief. Mit der S-Bahn war ich schnell am Flughafen, und das Einchecken ging ruckzuck, ich hatte nur Handgepäck und zog mir die Bordkarte am Automaten. An der Sicherheitsschleuse war auch nicht viel los. Während des Anstehens dachte ich ununterbrochen an Sebastiano und fragte mich, was um alles in der Welt da passiert war. Und was hatte José damit gemeint, dass ich Sebastiano nicht trauen sollte? In meinem Kopf wirbelte es konfus durcheinander, ich konnte kaum einen klaren Gedanken fassen. Erst, als ich im Boardingbereich saß, kam ich ein wenig zur Ruhe. Und begriff, dass ich echte Probleme hatte. In Paris war ich noch nie gewesen. Und im Jahr sechzehnhundertfünfundzwanzig auch nicht. In meinem Magen blubberte der Auflauf vom Mittagessen. Hastig holte ich mein iPhone raus und fing an zu googeln.
Paris, 2011
Ich kam gegen halb neun am Flughafen Charles de Gaulle an und probierte sofort noch einmal, diesen Garçon zu erreichen. Diesmal hatte ich mehr Glück, er ging gleich dran. Ich hielt mir das freie Ohr zu, weil ich mitten im Trubel der Ankunftshalle stand. Zur Sicherheit sprach ich ihn auf Englisch an, in der Hoffnung, dass er mich verstand, doch zu meiner Überraschung konnte er gut Deutsch.
»Ich bin Gaston Leclerc«, sagte er. »L-e-c-l-e-r-c, falls du dich fragst, wie man das schreibt. Willkommen in Paris! Du musst Anna sein. Ich habe deinen Anruf schon erwartet.« Er hatte eine nette, etwas gestresst klingende Stimme mit französischem Akzent. Ich war zutiefst erleichtert. Die erste Hürde war genommen. Ich stand nicht allein da, offenbar hatte José schon alles Wichtige organisiert. Gott sei Dank!
»Was ist mit Sebastiano passiert?«, platzte ich heraus.
»Ach, das kann ich schlecht am Telefon erklären. Wir sehen uns nachher, dann erzähle ich dir, was ich weiß.«
»Wo soll ich hinkommen?«, fragte ich.
»Kennst du dich in Paris aus?«
»Leider kein bisschen. Ich war noch nie hier.«
»Oh, das ist aber eine Bildungslücke! Doch jetzt bist du ja da und kannst sie schließen. Leider kann ich gerade überhaupt nicht weg, ich muss mich noch um alle möglichen Dinge kümmern. Am besten nimmst du dir ein Taxi. Ich hab ein Hotelzimmer für dich reserviert, im Britannique in der Avenue Victoria.«
»Ist das günstig?«, fragte ich.
»Ja, sehr zentral. Es liegt ganz in der Nähe vom Pont au Change.«
»Nein, ich meinte eigentlich den Preis.«
»Eigentlich schon, es kostet unter zweihundert.«
»Pro Nacht?«, fragte ich erschrocken.
Gaston lachte. »Das hier ist Paris, Anna.«
»Dann suche ich mir lieber ein anderes Hotel. Ich hab’s nicht so dicke, weißt du.«
»Das Zimmer ist schon bezahlt. Flug und Taxi kriegst du auch von mir erstattet, wir haben hier ein Budget für so was.«
Ich atmete auf. Budget klang gut. Es war ein nettes, beruhigendes französisches Wort, auch wenn ich es nicht aus eigener Erfahrung kannte. So was wie Spesenerstattung war ich nicht gewöhnt. Wenn ich mit Sebastiano in die Vergangenheit reiste, bekamen wir Geld aus der betreffenden Epoche und passende historische Kleidung, aber Unterbringung und Anreise zum Ausgangspunkt waren bisher immer mein Privatvergnügen gewesen. Vielleicht sollte ich José mal fragen, wie es demnächst mit einer kleinen Beteiligung an meinen Flugtickets wäre. In Venedig waren sie möglicherweise nicht ganz auf der Höhe der Zeit bei den Mitarbeitervergünstigungen.
»Lass dir im Hotel einen Stadtplan geben«, sagte Gaston. »Damit du den Pont au Change findest. Da musst du nämlich nachher hin.«
»Ich hab eine Navi-App.«
»Du solltest deinen persönlichen Kram besser im Hotel lassen, also Handtasche, Geld, Handy und so weiter. Du weißt ja, dass du nichts davon mitnehmen kannst. Und beim Zurückspringen ist nicht gewährleistet, dass jedes Mal alles wieder auftaucht. Ich hatte da mal eine wahnsinnig teure Patek-Philippe-Uhr …«
»Heißt das, der Übertritt soll noch heute Nacht stattfinden?«, unterbrach ich ihn aufgeregt.
»Sicher. Wir wollen doch keine Zeit verlieren. Um halb zwölf treffen wir uns auf der Brücke.«
»Warte! Wie erkenne ich dich?«
»Ich schick dir ein Bild aufs Handy. Sekunde.« Er war kurz still, dann hörte ich eine eingehende Nachricht. »Hast du auch eins von dir?«, wollte er anschließend wissen.
»Moment. Kommt sofort.« Ich schickte ihm eins von den neueren, das ich mit ausgestrecktem Arm von mir und Sebastiano geknipst hatte und auf dem wir beide lachend unsere Gesichter aneinanderschmiegten. Es schnürte mir die Luft ab, als ich es mir anschaute. Sebastiano, dachte ich, was ist mit dir geschehen?
»Sehr schönes Bild von euch beiden«, meinte Gaston. »Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du wie Miley Cyrus aussiehst?«
»Ja, schon oft.« Meine Stimme klang nach unterdrückten Tränen. »Ich fahr dann jetzt mal los. Bis später.«
»Bis später, Anna!«
Ich verließ das Flughafengebäude und nahm mir ein Taxi. Während der Fahrt sah ich mir Gastons Foto an. Er war rundlich und hatte sandfarbenes Haar. Dem Bild nach war er ungefähr in Sebastianos Alter, also um die zwei-, dreiundzwanzig, und er hatte eine kleine Zahnlücke, die ihm ein sympathisches und verschmitztes Aussehen verlieh.
Unterwegs zwang ich mich, bei Wikipedia weitere Informationen über meine Zielepoche nachzulesen, damit ich nicht total unbedarft dort ankam. Vorsorglich hatte ich vor dem Abflug eine Internet-Flatrate für Frankreich gebucht, um jede Minute bis zum Übergang ausnutzen zu können. Beim Googeln nach »Paris 1625« hatte ich den Namen d’Artagnan entdeckt und mich an den Film erinnert, den ich letztens erst auf DVD gesehen hatte. Daraufhin hatte ich mir Die drei Musketiere als E-Book runtergeladen und im Flugzeug ein paar Kapitel quergelesen. Ein paar der Mitspieler fand ich jetzt bei Wikipedia wieder. Ludwig der Dreizehnte. Kardinal Richelieu. Aha, der war in dem Film von Christoph Waltz gespielt worden, das wusste ich noch.
Zwischendrin kam eine SMS von Vanessa. Wo zum Teufel steckst du???
Oje, auch das noch. Ich dachte mir schnell eine passende Antwort aus. Habe mich spontan mit S. in Paris verabredet. Stadt der Liebe, du weißt schon. Papa hat Flug spendiert.
»Mademoiselle?«
Das Taxi hatte angehalten. Die Fahrt war zu Ende, ohne dass ich unterwegs ein einziges Mal einen Blick auf die Stadt geworfen hatte. Aber es war ja schon dunkel, wahrscheinlich hätte ich sowieso kaum was gesehen. Der Fahrer verlangte eine horrende Summe von mir, hinterher hatte ich nicht mehr viel im Portemonnaie, doch ich ließ mir vorsichtshalber eine Quittung geben. Gastons Budget würde meine Bargeldbestände hoffentlich bald auffrischen.
Das Hotel war nett, mit roten Markisen, schmiedeeisernen Balkongittern und Grünpflanzen in Kübeln. Am Rand des Gehwegs wuchsen Bäume. Die Empfangsdame begrüßte mich freundlich und überreichte mir den Zimmerschlüssel und einen Stadtplan, nachdem die Meldeformalitäten erledigt waren. Das Zimmer befand sich im zweiten Stock und wies zur Straße. Besonders groß war es nicht, jedoch sauber und anheimelnd. Ich öffnete das Fenster, um durchzulüften. Ein bisschen Zeit blieb mir noch, aber ich konnte mich weder auf Wikipedia noch auf Die drei Musketiere konzentrieren. Stattdessen sah ich mir den Stadtplan an und prägte mir die umliegenden Straßen und die Lage der Brücke ein, auf der ich gleich Gaston treffen würde. Pont au Change … Ich schlug die Bedeutung nach, übersetzt hieß es Wechselbrücke, das stammte von den Geldwechslern, die es früher dort gegeben hatte. Aber genauso gut hätte der Name auch auf das Wechseln zwischen den Zeiten gepasst. Vielleicht war es ein Zufall, vielleicht auch nicht.
Grübelnd stand ich am offenen Fenster. Unten rauschte der Verkehr vorbei. Das Hotel lag in der Nähe der Seine, bis zum Pont au Change war es nicht weit. Wer würde uns wohl das Portal öffnen? Es musste einer von den Alten dabei sein, sonst funktionierte es nicht. Man kam auch nicht immer an derselben Stelle heraus, an der man aufgebrochen war. Jedes Tor hatte seine Eigenheiten und individuellen Besonderheiten, manche waren auch unberechenbar und instabil. So richtig durchschaut hatte ich das Prinzip immer noch nicht, obwohl ich inzwischen schon einige Male in die Vergangenheit und wieder zurück gereist war.
Und dann war da noch die Sache mit der Maske, die so eine Art tragbare Zeitmaschine war. Sie verlieh dem Reisenden große Macht, denn sie ermöglichte einen Übertritt ohne Hilfe der Alten, aber gleichzeitig war sie auch gefährlich, denn es konnte passieren, dass sie einen an Orte brachte, die man besser niemals sah. Momentan verstaubte meine Maske irgendwo im Kostümfundus von Esperanza, der Alten, von der ich sie damals bekommen hatte. Ich hatte Esperanza lange nicht mehr gesehen, sie kam und ging wie ein Schatten und blieb nie lange an einem Ort oder in einer Zeit.
Gedankenverloren rieb ich mir den Nacken. Dann musste ich stärker reiben, denn es fing auf einmal an zu jucken. Ein Mann stand unten vorm Haus und schaute zu mir herauf! Er trug eine Baskenmütze, die er in die Stirn gezogen hatte, deshalb konnte ich das Gesicht nicht ganz sehen. Aber seine Aufmerksamkeit galt allein mir, daran bestand kein Zweifel. Der Mann hatte eine normale Statur und sah auch sonst nicht ungewöhnlich aus. Er war irgendwas zwischen vierzig und sechzig, genauer konnte man das wegen der Kappe nicht einschätzen, und er trug einen Trenchcoat. Die Hände hatte er in die Manteltaschen geschoben. Unsere Blicke kreuzten sich für den Bruchteil einer Sekunde. Im nächsten Augenblick zog er sich zurück und verschwand unter den Bäumen. Das Jucken in meinem Nacken ließ nach, doch ich hatte es mir auf keinen Fall eingebildet. Etwas stimmte hier ganz und gar nicht!
Ich vergewisserte mich, dass ich die Zimmertür abgeschlossen hatte, dann versuchte ich, José anzurufen, bekam aber wieder nur die Bandansage. Nervös sah ich auf die Uhr. Eigentlich hatte ich noch duschen wollen, denn in der Vergangenheit würde ich darauf verzichten müssen. Doch meine Fantasie machte sich gerade selbstständig. Ich hatte alles plastisch vor Augen. Frau nackt in der engen Duschkabine, überall Wasserdampf. Kamerafahrt auf den Duschvorhang, er wird zur Seite gerissen, und dann das große Schlachtermesser. Nein, ich würde jetzt ganz sicher nicht duschen, egal, wie lange ich ohne Badezimmer auskommen musste.
Stattdessen beschloss ich, sofort zu der Brücke zu gehen. Dann wäre ich eben etwas früher da und konnte mich wenigstens nicht verspäten. Mein Gepäck und die Handtasche mitsamt Geldbörse, Papieren und iPhone gab ich an der Rezeption ab, mit der Bitte, alles für mich aufzubewahren. Die Empfangsdame nahm die Sachen höflich entgegen. Falls es ihr merkwürdig vorkam, ließ sie es sich nicht anmerken. Meine Armbanduhr behielt ich an, den Verlust konnte ich notfalls verschmerzen.
Mit dem Stadtplan bewaffnet, marschierte ich los. Als ich aus dem Hotel kam, hielt ich mich rechts, dann sofort wieder links, anschließend ein Stück geradeaus, und schon war ich auf der Uferstraße, die von netten Cafés und einer Reihe von Bäumen gesäumt war. Es war frisch und windig, aber nicht kalt. Die Brücke war auch bei Nacht nicht schwer zu finden. Es ging sogar besonders schnell, weil ich einen Zahn zulegte, aus Sorge, der komische Typ könnte noch irgendwo herumlungern.
Ich lief ein Stück die Seine entlang, und gleich die nächste Brücke war der Pont au Change. Keine Ahnung, was ich mir vorgestellt hatte – vielleicht, dass es irgendwie verwunschener oder älter aussah. Aber es war nur eine ganz normale Brücke – mehrspurig befahrbar, mit breiten Fußgängerwegen auf beiden Seiten und auch sonst ohne hervorstechende Merkmale. Hübsch fand ich bloß die altertümlichen Laternen. Drüben am anderen Ufer lag die Île de la Cité – jedenfalls sagte das der Stadtplan –, eine lang gestreckte Insel im Fluss mit vielen historischen Gebäuden, unter anderem Notre-Dame.
Auf der Brücke waren Passanten unterwegs. Vor mir schlenderte händchenhaltend ein verliebtes Pärchen. Als ich die beiden überholte, lächelten sie mich an. Das Glück umgab sie wie eine Wolke, es versetzte mir einen Stich, denn bei dem Anblick musste ich wieder an Sebastiano denken. Ungefähr in der Mitte der Brücke hockte ein Penner auf einem Stück Pappe. Er hatte eine Schnapsflasche in der Hand und nahm gerade einen kräftigen Schluck, als ich vorbeikam. Gleichzeitig streckte er mir mit der anderen Hand einen umgedrehten Hut entgegen, in dem ein paar Münzen lagen. Ich blieb stehen und kramte in meinen Taschen. In meiner Jacke fand ich noch zwei Euro Wechselgeld von der Taxifahrt. Ich warf sie in den Hut. Mitnehmen konnte ich sowieso nichts.
Ich sah auf die Uhr und wurde immer unruhiger, obwohl ich zu früh war. Die Ungewissheit war das Schlimmste. Wenn ich nur schon wüsste, was mit Sebastiano passiert war!
Der Penner rülpste geräuschvoll und bot mir einen Schluck aus seiner Flasche an, was ich dankend ablehnte, woraufhin er es sich auf der Pappe etwas bequemer machte und laut schnarchend einschlief. Ich ging ein paar Schritte weiter und blickte über das Geländer zum Fluss hinab, der träge und dunkel unter mir dahinfloss. Tief in Gedanken versunken blieb ich dort stehen und wartete.
Eine Hand legte sich auf meine Schulter. Mit einem erschrockenen Laut fuhr ich herum.
»Oh, tut mir leid, Anna! Du hast mich wohl nicht kommen hören. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ich bin Gaston Leclerc. Schön, dass du da bist!«
Gaston lächelte und streckte mir zur Begrüßung die Hand hin. Er sah aus wie auf dem Foto, rundlich und mit Zahnlücke, nur eine Idee pausbäckiger. Seine untersetzte Gestalt steckte in Ralph-Lauren-Klamotten – die kannte sogar ich –, und aus der Brusttasche seiner Jacke ragte ein Sonnenbrillenetui mit Ray-Ban-Aufdruck. Wenn er sich solchen Luxus vom Zeitwächter-Budget leisten konnte, würden Sebastiano und ich wirklich mal ein ernstes Wort mit José reden müssen!
Nach der Begrüßung hielt ich mich nicht mit Small Talk auf, sondern platzte sofort mit der wichtigsten Frage heraus.
»Was ist mit Sebastiano passiert?«
Gaston verzog das Gesicht. »Wenn ich das bloß wüsste!«
»Aber ich dachte, du wüsstest es!« Sofort wurde ich wieder panisch.
»Na ja, es geht ihm gut, falls du dir darum Sorgen machst.«
Ich atmete tief durch. Es ging ihm gut! Das war die Hauptsache. Alles andere würde sich schon finden. Sofort stellte ich die zweitwichtigste Frage.
»Wenn er gesund ist – wieso kommt er dann nicht zurück? Ist das Portal kaputt?«
Die Rückreise-Fenster in der Vergangenheit waren in der Regel auf die Mondphasen eingestellt. Man musste also normalerweise nur warten, bis wieder Neumond oder Vollmond war, dann konnte man in die Zukunft zurückspringen und landete im selben Moment, in dem man zuvor aufgebrochen war.
Es gab auch andere Fenster für den Übertritt, die unabhängig von den Mondphasen funktionierten. Die befanden sich zwar meist an versteckten, unbeobachteten Stellen, doch die Alten kannten sie alle. Diese Portale hatten allerdings den Nachteil, dass man nicht zum Moment des Aufbruchs zurückkehren konnte, sondern später landete, weil dann die Zeit in der Zukunft parallel weitergelaufen war.
»Nein, das Portal auf der Brücke funktioniert«, sagte Gaston. »Ich hab’s ja selbst benutzt.«
»Und warum ist er dann noch dort?«
Gaston machte ein trauriges Gesicht. »Ich fürchte, er will nicht zurück.«
»Was soll das heißen, er will nicht zurück?«
»Ich habe ihm zweimal eine Botschaft geschickt und ihn darum gebeten, sich zur verabredeten Stunde am Portal mit mir zu treffen. Er kam nicht.«
»Zweimal?«, vergewisserte ich mich entsetzt. »Du meinst zwei Mondwechsel? Heißt das, er hängt schon einen Monat in der Vergangenheit fest?«
»Nein, drei«, korrigierte Gaston.
»Drei?!«, rief ich schockiert. »Wie konnte das passieren?«
»Nach den beiden schriftlichen Botschaften bin ich vor dem nächsten Mondwechsel persönlich zu ihm gegangen und habe ihn gefragt, wieso er nicht gekommen ist, aber er hat einfach so getan, als würde er mich nicht kennen. Schlimmer noch – er meinte, wenn ich mich nicht verpisse, spießt er mich mit seinem Degen auf.«
»Das hat er gesagt?«, fragte ich ungläubig.
»Wortwörtlich. So wahr ich hier stehe. Keine Ahnung, was mit ihm los war. Ich wollte es dann zwei Wochen später noch mal versuchen, aber da war ich verhindert.« Er zuckte bedauernd die Achseln. »Prüfungen, weißt du.«
»Was für Prüfungen?«
»Ich studiere noch. Von diesen Zeitreisejobs allein kann kein Mensch leben, also lerne ich nebenher was Vernünftiges.«
Ich hatte den deutlichen Eindruck, dass er etwas mehr persönliches Interesse von mir erwartete. »Was denn?«, fragte ich daher höflich, obwohl ich fast vor Ungeduld platzte.
»Ich studiere Deutsch!« Er strahlte mich an.
»Oh. Toll.« Ich rang mir ein Lob ab und heuchelte Bewunderung, obwohl alles in mir danach schrie, weitere Einzelheiten über Sebastiano aus ihm herauszuquetschen. »Du sprichst es wirklich klasse. Man hört kaum noch Akzent. Wie kommt man dazu, Deutsch zu studieren?«
»Ich habe eine deutsche Freundin. Sie ist die Liebe meines Lebens und lebt in Berlin. Nach dem Examen will ich zu ihr ziehen und mir da einen Job suchen.« Er seufzte abgrundtief. »Kein Mensch kann sich vorstellen, wie teuer die ganzen Flüge und Zugfahrten sind!«
»Doch«, sagte ich geistesabwesend, gedanklich schon um die drittwichtigste Frage kreisend. »Was hat Sebastiano überhaupt in der französischen Vergangenheit zu tun?«
»Ich fürchte, das ist geheim.«
»Also echt jetzt! Das kannst du mir ja wohl sagen! Schließlich bin ich hier, um ihn zurückzuholen!«
Gaston schüttelte bedauernd den Kopf. »Ich würd’s dir wirklich sagen, wenn ich könnte. Aber ich weiß es ja selber nicht. Es ist einer von diesen speziellen Sondereinsätzen, bei denen man vorher nicht weiß, worum es geht.«
Das traf mich wie ein Schlag. Ich hatte selbst schon so einen Einsatz gehabt. Gleich mein erster war einer von dieser Sorte gewesen. Ich hatte erst zurückreisen können, als meine Aufgabe erfüllt war. Das Blöde daran war – ich hatte zuerst keinen blassen Schimmer gehabt, worin die Aufgabe bestand. Dass ich einem wichtigen venezianischen Politiker das Leben retten und ein paar Bösewichte ausschalten musste, war erst nach und nach herausgekommen. Wochenlang hatte ich damals dort festgesteckt! Doch es gab noch schlimmere Fälle – der von Clarissa beispielsweise, eine junge Adlige, die ich im Jahr 1499 kennengelernt hatte. Sie stammte aus der Zeit der Französischen Revolution und hatte über fünf Jahre lang als Dienstmagd in der venezianischen Vergangenheit festgehangen, bis sie ihre Aufgabe gelöst hatte – die darin bestand, mir das Leben zu retten. Erst danach durfte sie zurück in ihre Zeit. Aber da hatte sie sich schon in Bartolomeo verliebt, den Boten aus dem Jahr 1499. Sie war dann einfach dortgeblieben und hatte ihn geheiratet.
Mir fiel ein, dass José einen Sondereinsatz erwähnt hatte. Falls Sebastiano wirklich in der Vergangenheit festsaß, weil er sich für die Erfüllung einer speziellen Aufgabe bereithalten musste, könnte er gar nicht zurück, selbst wenn er es wollte. Jetzt erinnerte ich mich auch wieder, dass José nicht von Zurückholen gesprochen hatte, sondern von Helfen.
Gaston sah bekümmert aus. »Ich habe ihm meine Hilfe angeboten, aber er hat mich bedroht. Ganz ehrlich, er hat sich unmöglich benommen! Deshalb sollst du ja auch mit ihm reden. Du bist schließlich seine Freundin.«
»Woher wusstest du das eigentlich?«
»Dieser Alte aus Venedig hat’s mir gesagt. Er meldete sich bei mir und sagte, ich müsse dich zu Sebastiano bringen.«
»Wann hast du zuletzt mit José gesprochen? Ich erreiche ihn nicht mehr. Er sagte was von einer Verletzung, ich mache mir echt Sorgen um ihn.«
Gaston hob die Schultern. »Er hat nur einmal angerufen. Ich kenne den Typen überhaupt nicht, aber der hiesige Alte meinte, das ginge klar, also mache ich es.«
»Wer ist denn der hiesige Alte?«, fragte ich. »Müsste er nicht bald da sein?«
»Oh, das ist er schon längst.« Gaston zog die Brauen hoch und warf dann einen bezeichnenden Blick auf den schnarchenden Penner.
Ich konnte es kaum fassen. Das war der Alte?
»Darauf wäre ich nie gekommen!«