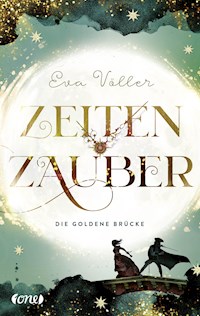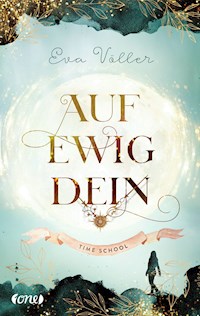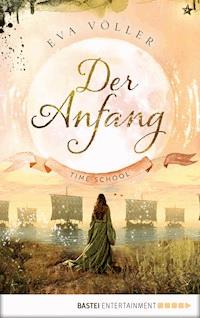6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Baumhaus
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Zeitenzauber
- Sprache: Deutsch
Die 17-jährige Anna verbringt ihre Sommerferien in Venedig. Bei einem Stadtbummel erweckt eine rote Gondel ihre Aufmerksamkeit. Seltsam. Sind in Venedig nicht alle Gondeln schwarz? Als Anna kurz darauf mit ihren Eltern eine historische Bootsparade besucht, wird sie im Gedränge ins Wasser gestoßen - und von einem unglaublich gut aussehenden jungen Mann in die rote Gondel gezogen. Bevor sie wieder auf den Bootssteg klettern kann, beginnt die Luft plötzlich zu flimmern und die Welt verschwimmt vor Annas Augen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Eva Völler
Die magische Gondel Mit Illustrationen von Tina Dreher
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieser Titel ist auch als Hörbuch lieferbar
Mit Illustrationen von Tina Dreher
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Copyright © 2011 by Baumhaus Verlag in der Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Barbara Rumold Redaktion: Anna Matschke Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel, punchdesign, München Umschlagmotiv: © Illustration Johannes Wiebel | punchdesign E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-1145-4
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für meine Tochter Clara
You must remember this A kiss is just a kiss A sigh is just a sigh The fundamental things apply As time goes by. (Herman Hupfeld)
PROLOG
Venedig, 1499
H* l* o!
Zuerst das Wichtigste:
Mein Name ist Anna. Ich habe drei Mal versucht, meinen vollen Namen und mein Geburtsjahr hinzuschreiben, aber es geht nicht.
Ich weiß sowieso nicht, ob ich noch viel schreiben kann. Allein für die ersten Sätze habe ich fast eine Stunde gebraucht und keiner davon ist stehen geblieben. Das liegt natürlich daran, dass ich zu unvorsichtig war. Ich muss darauf achten, welche Begriffe und Zahlen ich verwende, denn wenn sie nicht passen, lassen sie sich nicht aufschreiben. Oder sie verändern sich, bis sie eine ganz andere Bedeutung bekommen.
Ach ja, und dann natürlich das Papier. Meine Schrift sieht darauf merkwürdig fremd aus. Das macht das Schreiben nicht gerade leicht. Ich muss Pergament nehmen, weil es haltbarer ist, aber am Ende kann man die Kleckse kaum noch zählen. Die Tinte stinkt wie verfaultes Gift. Von der Feder will ich erst gar nicht reden, auch nicht von dem Geräusch, das sie beim Schreiben macht. Unfassbar, dass Menschen auf diese Weise ganze Bücher schreiben!
Die Zeit ist knapp! Mein Versteck ist nicht sicher, ich kann jeden Moment erwischt werden. Ob ich danach wieder so schnell an Schreibzeug komme, ist fraglich.
Sobald ich diesen Brief fertig habe, will ich ihn verstecken und beten, dass er gefunden wird. Von einem Mann aus dem hohen Norden. Falls sich das verrückt anhört, ist das leider unvermeidlich. Genauer kann ich es nicht ausdrücken. Ich werde den Brief in Wachstuch einwickeln und darauf vertrauen, dass er nicht verschimmelt.
Ich höre Schritte und muss aufhören. Später hoffentlich mehr.
TEIL EINS
Venedig, 2009
Wir aßen wie üblich im Restaurant neben dem Hotel zu Abend. Mama meinte, in ganz Venedig gebe es keine bessere Pasta. Mir persönlich gefiel das Restaurant schon deshalb, weil es in Reichweite vom WLAN-Anschluss des Hotels lag und ich zwischen Antipasti und Hauptgang im Internet surfen konnte.
»Weißt du, manchmal könntest du etwas mehr Interesse zeigen, wenn dein Vater von seiner Arbeit erzählt«, sagte Mama, als Papa nach der Vorspeise kurz zum Telefonieren hinausging. »Sein Beruf ist für ihn sehr wichtig!«
»Aber ich zeige doch Interesse«, behauptete ich. »Ich höre immer zu!«
»Und spielst dabei unterm Tisch mit deinem Handy herum.«
»Es ist kein Handy, sondern ein iPod Touch«, sagte ich lahm.
Mama hatte recht, besonders faszinierend fand ich Papas Berichte von seiner Arbeit nicht. Vielleicht lag es daran, dass ich es mir schon so oft hatte anhören müssen. Mein Vater ist ein wunderbarer Mensch und ein weltweit anerkannter Wissenschaftler auf seinem Fachgebiet. Aber wenn an zehn Abenden hintereinander staubige alte Münzen, vergammelte Tongefäße und Freskenfragmente das einzige Tischthema sind, reißt es einen am elften Abend nicht mehr vom Hocker.
Manchmal fand mein Vater auch gruselige Dinge oder wusste zumindest davon zu berichten. Ein paar Jahre zuvor hatten Archäologen auf einer Insel in der venezianischen Lagune Massengräber mit Hunderten von Toten entdeckt, die im 15. Jahrhundert bei einer der großen Pestepidemien dort verscharrt worden waren. Noch unheimlicher wurde es, als Papa von einem weiteren venezianischen Fund aus demselben Jahrhundert berichtete, der erst ein paar Monate zurücklag. Es handelte sich um das Skelett einer Frau, der man einen Pflock in den Hals gestoßen hatte.
»Wie grausam!«, hatte Mama bestürzt ausgerufen.
»Wie bei den Vampiren«, sagte ich.
Zu meiner Überraschung nickte Papa. »Das ist gar nicht so abwegig. Dieser Aberglaube war schon in der Renaissance verbreitet. Danach stiegen die Verstorbenen aus ihren Gräbern, um sich von den Pesttoten zu nähren.«
»Uahh!«, machte ich beeindruckt.
»Man nimmt an, dass die Frau an der Pest starb und durch den Pfahl daran gehindert werden sollte, zu einer Wiedergängerin zu werden. Deshalb nennt man sie auch Vampirfrau.«
Das war wirklich mal eine interessante archäologische Geschichte, mit echtem Sensationswert. Aber meist waren die Berichte meines Vaters ungefähr so aufregend wie Spätnachrichten, die einen bloß daran erinnerten, dass es Zeit zum Schlafengehen war.
Kurz nachdem Mama mich aufgefordert hatte, Papas Arbeit mehr Aufmerksamkeit zu widmen, kam er vom Telefonieren zurück und setzte sich wieder an den Tisch. »Ein Kollege aus Reykjavík hat ein hochinteressantes Fundstück gemeldet.«
Eigentlich war das genau der Moment, in dem ich die Ermahnung meiner Mutter hätte beherzigen sollen. Stattdessen sagte ich nur höflich: »Ach, in Reykjavík gibt es auch Archäologen? Lohnt sich das da überhaupt? Ich meine, das Buddeln. Sprudeln nicht Geysire aus der Erde, wenn man dort anfängt zu graben?«, während ich unterm Tisch bereits wieder mit meinem iPod hantierte. Vanessa hatte mir im ICQ geschrieben: Ich bring die Schlampe um!
»Wir sind ein internationales Team«, sagte Papa. »Der Kollege, von dem ich sprach, arbeitet hier vor Ort mit mir zusammen. Das Fundstück wurde in den Fundamenten des Palazzo Tassini entdeckt, den wir gerade untersuchen.«
Das fand ich nicht halb so spannend wie Vanessas Nachricht.
Ein schwerer Fehler. Hätte ich nur meinem Vater zugehört!
So aber las ich die blöde Nachricht von Vanessa und verstand von dem, was Papa erzählte, nur ungefähr jedes dritte Wort. Wenn überhaupt.
»… eigenartiges Dokument, ein Brief, sagt Mister (unverständlicher isländischer Name, klang wie Bjarnignokki), mit möglicherweise anachronistischen Einsprengseln.«
Vanessa: Kann nicht fassen, dass das Arschloch es wagt, nur eine Woche nachdem er mich abserviert hat, mit dieser bescheuerten Tussi ins Kino zu gehen!
»… konnten jedoch nur Teile der ersten Seite des Dokuments entziffert werden, Rest muss zunächst präpariert werden … größtenteils zerfallen … Mister Bjarnignokki ist allerdings der Meinung, es müsse sich um eine Fälschung handeln. Ich werde es hier an der Universität untersuchen lassen, sie haben da einige wirklich fähige Schriftexperten. Gleich morgen schicke ich es hin.«
»Warum sollte es eine Fälschung sein?«, fragte meine Mutter.
»Wegen des möglichen Anachronismus.«
Anachronismus! Ich meine – hallo?! Wer sollte so was interessant finden? Gut, ich hätte natürlich fragen können, was das bedeutet, aber meine Eltern blickten mich bei dieser Art von Fragen immer an, als könne ich unmöglich ihre Tochter sein, sondern eher jemand, der aus Versehen zur Familie gehörte. Mein Vater war Professor und meine Mutter hatte einen Doktortitel, und ich hatte gerade die elfte Klasse wiederholt, mit Noten, die nicht viel besser waren als in der zehnten. Besonders nicht in Mathe.
Vanessa: Werde heute noch neues Album bei Schüler-VZ einrichten, Titel: Ex zum Abgewöhnen. Und da stelle ich dieses eine Foto von ihm rein, das du während der Paris-Fahrt im Bus aufgenommen hast. Das, auf dem er mit offenem Mund pennt. Oder vielleicht auch das, das du bei meinem letzten Geburtstag gemacht hast. Als er gerade in die Rosen kotzt.
»… könnte es sich laut Mister Bjarnignokki auch um einen Scherz von jemandem aus dem Team handeln, vielleicht von einem der Studenten. Denn es scheint fast so, als beginne der Brief mit dem Wort Hallo.«
Vanessa: Oder das eine Foto von der letzten Party, von dem du meintest, da sähe er aus wie Gollum.
»Hallo?«, fragte meine Mutter erstaunt.
»Ganz recht, hallo«, meinte Papa.
Rasch blickte ich auf. »Ich hör die ganze Zeit zu, ehrlich.«
»Kaum zu fassen«, sagte Mama kopfschüttelnd.
Das bezog ich auf mich und schaltete schnell den iPod aus.
Gleich darauf brachte der Kellner das Abendessen und Bjarnignokki und Gollum waren vergessen.
Am nächsten Morgen ging ich wie immer eine gute Stunde nach meinen Eltern frühstücken. Schließlich hatte ich Ferien. Schon vor der Reise hatte ich klargestellt, dass ich nicht vor neun Uhr aufstehen würde. Meine Eltern mussten arbeiten, ihnen war es egal, dass ich ausschlief.
Der dicke Typ, der drei Tage zuvor mit seinen Eltern ins Hotel gekommen war, kam in den Frühstücksraum und blickte sich verstohlen um. Als er mich sah, wurde er rot und schaute schnell zur Seite. Dasselbe wie jeden Morgen, nur dass er diesmal ohne seine Eltern erschien.
Ich beugte mich über meinen Toast und tat so, als hätte ich ihn nicht gesehen. Zu meinem Schrecken kam er jedoch an meinen Tisch, wo er stehen blieb und tief Luft holte.
»Hi, ich bin Matthias«, stieß er hervor. »Ist hier noch frei? Kann ich mit dir frühstücken?«
Ich war so verdattert, dass ich unwillkürlich nickte. Erst als er sich aufseufzend auf den Stuhl mir gegenüber plumpsen ließ, wurde mir klar, was das bedeutete: Er war auf meine Gesellschaft aus. Das hatte mir noch gefehlt!
»Bist du schon lange hier?«, fragte er.
»Zwei Minuten«, sagte ich.
»Ich meinte, seit wann du im Hotel bist«, sagte er.
»Seit zehn Tagen.«
»Du bist mit deinen Eltern hier, oder?«, wollte er wissen.
Als ich nickte, fuhr er fort: »Ich auch.«
»Ich weiß. Ich sah euch zusammen einchecken. Und frühstücken. Kommen sie gleich noch zum Frühstück?« Hoffnungsvoll blickte ich zur Tür. Wenn seine Eltern auftauchten, wäre er abgelenkt, das könnte ich ausnutzen und rasch verschwinden.
»Nein, sie haben schon gefrühstückt. Heute haben sie Termine, deshalb bin ich alleine hier. Ich habe heute noch nichts vor.« Er sah mich hoffnungsvoll an.
Ich ignorierte es. »Was für Termine haben deine Eltern denn?«, fragte ich.
»Ach, langweilige vermutlich. Mein Vater ist Kurator und hat bei der Biennale zu tun. Meine Mutter geht mit, weil sie seine Arbeit wichtig findet. Und weil sie dort wichtige Leute treffen kann. Sie mag wichtige Leute. Sie sucht alles über sie im Internet raus.«
»Ach ja«, sagte ich, lustlos an meinem Toast knabbernd.
»Meine Mutter sagte, dein Vater sei einer der führenden Archäologen auf dem Gebiet spätmittelalterlicher Kirchen- und Palastkultur. Und deine Mutter ist Physikdozentin und nimmt hier an einem internationalen Kongress teil. Und ihr seid aus Frankfurt.«
»Ich weiß«, sagte ich.
»Äh … klar.«
Wir schwiegen eine Weile. Ich aß meinen Toast auf, spülte mit Tee nach und überlegte, mit welcher eleganten Ausrede ich am besten verschwinden konnte.
Aber irgendwie klappte es nicht. Vielleicht hing es damit zusammen, dass er mir leidtat. Er trug teure Klamotten und angesagte Sneakers, aber die änderten nichts daran, dass er wie ein übergewichtiger Loser aussah.
Matthias war drei Monate jünger als ich und kam aus München, wo er noch zur Schule ging. Wie ich hatte er Sommerferien und war mit seinen Eltern nach Venedig gekommen, in der Hoffnung, das sei weniger langweilig als wochenlang zu Hause unter der Oberherrschaft seiner Tante herumzuhängen.
»Bei mir wäre es meine Oma gewesen«, sagte ich. »Da hatte ich auch keine Lust drauf.«
»Dann haben wir ja quasi dasselbe Schicksal. Was machst du tagsüber so in Venedig, wenn deine Eltern arbeiten?«
»Nichts Besonderes.«
Treffender konnte ich es nicht ausdrücken. Die ganzen bekannten Sehenswürdigkeiten hatte ich schon mit Mama und Papa abgeklappert, denn am Wochenende stand immer Kultur auf dem Programm. Unter der Woche zog ich allein los. Ich ließ mich einfach treiben und fuhr mit den Linienbooten durch die Gegend. Oder ich spazierte kreuz und quer herum, beobachtete die unzähligen Touristen und hielt Ausschau nach interessanten Läden.
»Hast du nachher schon was vor?«, fragte Matthias.
»Ähm … ja, ich wollte mich noch eine Runde aufs Ohr legen, ich hab letzte Nacht schlecht geschlafen«, flunkerte ich.
»Und danach?«
»Weiß noch nicht.« Ich hatte es kaum gesagt, als ich es auch schon bereute. Es stand Matthias förmlich im Gesicht geschrieben, dass er überlegte, was wir alles gemeinsam unternehmen könnten. Also fuhr ich schnell fort: »Wahrscheinlich gehe ich Schuhe kaufen.«
Schuhe kaufen war reine Frauensache. Kein normal veranlagter siebzehnjähriger Typ würde mit einem Mädchen Schuhe kaufen gehen.
»Da könnte ich mitkommen«, sagte er eifrig. »Ich liebe es, Schuhe zu kaufen!«
Ich zuckte zusammen. »Meinetwegen«, sagte ich widerwillig. »Dann treffen wir uns in einer Stunde in der Lobby und gehen Schuhe kaufen.«
Schuhe konnte man immer brauchen, von daher kostete es keine allzu große Überwindung. Im Gegenteil. Zumal es in Venedig wirklich wundervolle Schuhläden gibt, mit Modellen, die man in Deutschland nicht an jeder Straßenecke findet. Leider sind auch die Preise nicht wie an jeder Straßenecke, außer man nimmt die Straßenecken von Venedig als Maßstab. Mit anderen Worten, es geht richtig ins Geld, in Venedig Schuhe zu kaufen. Aber ich hatte noch fast mein ganzes Geburtstagsgeld zur Verfügung, von zwei Großmüttern, einer Großtante, einem Patenonkel und natürlich von meinen Eltern, da kam ganz schön was zusammen. Seit ich vor zwei Jahren dazu übergegangen war, mir zum Geburtstag und zu Weihnachten nur noch Geld zu wünschen, waren auch mal teurere Anschaffungen drin, so wie der neue iPod, den ich mir kürzlich zugelegt hatte. Oder eben jetzt neue Schuhe.
Als ich aus dem Aufzug in die Lobby kam, stand Matthias schon am Ausgang, einen unsicheren Ausdruck im Gesicht, als fürchte er, ich hätte es mir anders überlegt. Als er mich sah, strahlte er bis zu den Ohren und ließ dabei überraschend weiße und perfekte Zähne sehen. »Da bist du ja!«
Das Hotel lag im Sestiere Dorsoduro, es war nicht weit bis zum Canal Grande. Wir gingen in Richtung Accademia.1 Motorboote tuckerten vorbei und brachten das Wasser zum Schäumen. Die Sommerhitze lag schwer über dem Kanal und zauberte goldene Lichtreflexe auf die Wellen. Zu beiden Seiten des Ufers bildeten die edlen alten Palazzi eine prachtvolle Kulisse für das geschäftige Treiben, das auf dem Wasser herrschte.
»Oh, sieh mal«, rief ich. »Eine rote Gondel!«
Matthias reckte den Kopf. »Wirklich? Wo denn? Ich dachte, alle Gondeln in Venedig müssten schwarz sein.«
Dasselbe hatte man mir und meinen Eltern auch erzählt, gleich bei der ersten Stadtbesichtigung, zu der auch eine Gondelfahrt gehört hatte. Früher, so hatte der Stadtführer berichtet, habe es die venezianischen Gondeln in allen Farben gegeben. Bis der Große Rat der Stadt im Jahre 1633 ein Gesetz erließ, wonach alle Gondeln schwarz anzustreichen seien. Dieses Gesetz galt heute noch.
Wieso gab es dann eine rote Gondel auf dem Canal Grande?
Für einen Augenblick nahm ich an, ich müsse mich getäuscht haben, aber dann bemerkte Matthias sie auch.
»Na so was, da ist sie!«, rief er.
Sie trieb mitten auf dem Canal Grande an uns vorbei, gelenkt von dem Gondoliere, der auf der hinteren Abdeckung stand und das lange Ruder mit beiden Händen durchs Wasser zog.
Als die Gondel näher kam, stellte ich fest, dass der Gondoliere genauso ungewöhnlich aussah wie sein Boot. Anders als die übrigen Gondelführer in Venedig trug er nicht die Einheitstracht aus flachem Hut mit Flatterband, gestreiftem Hemd und dunkler Hose, sondern eine Art Turban und ein weites weißes Hemd, dazu eine enge Weste mit Goldlitzen und eine Kniebundhose, die seine knochigen Schienbeine sehen ließ. Er war klapperdürr und alt, meiner Schätzung nach weit über siebzig, es war ein Wunder, dass er überhaupt noch in dem Tempo rudern konnte. Zumal er nur mit einem Auge sah: Das andere war wie bei einem Piraten von einer schwarzen Klappe bedeckt.
Dass Allermerkwürdigste aber war: Er kam mir irgendwie bekannt vor, obwohl ich keine Ahnung hatte, wo ich ihn schon gesehen hatte.
»Was für ein Freak«, sagte Matthias.
»Bestimmt übt er schon für Sonntag«, meinte ich. Mir war gerade eingefallen, dass die Regata storica bevorstand, ein Ereignis, das in Venedig jedes Jahr am ersten Sonntag im September Einwohner und Touristen anzog. Eine Menge Boote starteten zu dieser historischen Fahrt auf dem Canal Grande, herausgeputzt wie vor Hunderten von Jahren. Mama hatte schon gesagt, dass wir es uns anschauen würden.
»Stimmt«, sagte Matthias. »Die Regata storica. Gehst du auch hin?«
Als ich bejahte, erklärte er sofort, dass er sie sich ebenfalls ansehen wolle. Unwillkürlich fragte ich mich, ob ich ihn nun die beiden nächsten Wochen von früh bis spät am Hals hatte.
»Eigentlich will ich gar keine Schuhe«, sagte ich.
»Sondern?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht …« Egal, Hauptsache, irgendwas, das schnell gekauft war, damit ich wieder ins Hotel konnte. Es lag nicht allein an Matthias, dass ich auf einmal keine Lust mehr auf neue Schuhe hatte. Eigentlich war er ganz in Ordnung. Er war umgänglich und freundlich und machte sogar hin und wieder Witze, über die ich lachen konnte. Aber vorhin, beim Anblick der roten Gondel, hatte ich dieses komische Jucken in meinem Nacken gespürt. Und es war seither nicht richtig weggegangen. Ich hatte das Bedürfnis, mich irgendwo zu verkriechen.
Wir kamen an der Einmündung einer winzigen Gasse vorbei, an die ich mich nicht erinnerte, obwohl ich die ganze Gegend um San Marco herum schon mehr als einmal ausgiebig abgeklappert hatte. Ein altertümlich bemaltes, über einer Ladentür hängendes Schild weckte meine Aufmerksamkeit.
»Da ist ein Maskenladen«, sagte ich. »Komisch. Als ich das letzte Mal hier langgegangen bin, habe ich den nicht gesehen.«
»Willst du dir eine Maske kaufen? Anstelle der Schuhe?«
»Hm … Ja, wieso nicht.«
Und so kam es, dass ich in dem winzigen, von Masken und alten Kostümen überquellenden Laden herumstöberte. Ein staubiger Geruch hing in der Luft, als ob das ganze Zeug schon seit Jahren hier war, ohne dass sich je ein Mensch dafür interessiert hätte. Fadenscheinige Umhänge, zerfledderte Federboas, eigenartige, bestickte Samtjacken. Und Masken. Jede Menge Masken. Es gab die typisch venezianischen Masken, die sich die Leute zu Karneval aufsetzen, manche mit langen, schnabelartigen Nasen, andere mit goldverzierten, ebenmäßigen Gesichtszügen oder auch weiße und schwarze Halbmasken, die nur die obere Gesichtspartie bedeckten. Andere waren Fabelwesen und Tieren nachempfunden.
»Die Katze«, sagte eine kratzige Stimme.
Ich fuhr herum und sah aus den dunklen Tiefen des Ladens eine alte Frau auftauchen. Mit ihrer gebückten Gestalt und dem dünnen grauen Haarknoten kam sie mir eigenartig bekannt vor, doch ich hatte keine Ahnung, wo ich sie schon gesehen hatte. Anscheinend passierte mir das in Venedig öfter. Zuerst der Gondoliere und nun diese alte Frau.
Sie hatte so gut wie keine Zähne mehr und ihr Gesicht war zerknittert wie uraltes Pergament.
Ihre Hände waren von Gicht verkrümmt, doch sie bewegte sich erstaunlich flink, als sie eine Maske von einem der Ständer nahm und sie mir hinhielt. »Nimm die Katze, Kind.«
Es war eine schöne Maske, mit schwarzem Samt bezogen und ringsum mit goldenen Fäden bestickt, sodass es fast aussah, als hätte sie Haare. Die Augenlöcher waren mit winzigen Perlen umrandet und unter der Nase waren täuschend echt wirkende Schnurrhaare aufgenäht. Man konnte die Maske mit Seidenbändern befestigen. Ich probierte es aus und fand, dass sie überraschend gut passte. Sie drückte und rutschte nicht, sondern lag überall perfekt an, als sei sie extra für mich gemacht worden.
Und sie sah teuer aus. Wahrscheinlich kostete sie ein Vermögen. Ich wollte sie der Alten wieder zurückgeben, doch Matthias kam mir zuvor. »Was soll sie denn kosten?«, fragte er die Frau auf Italienisch. An mich gewandt, setzte er flüsternd hinzu: »Ist alles Verhandlungssache.«
»Was kann das Mädchen denn bezahlen?«, fragte die Alte.
»Fünf Euro«, sagte Matthias prompt.
»Zehn«, widersprach ich. Zögernd fügte ich hinzu: »Vielleicht auch zwanzig.« Das war die Maske garantiert wert. Außerdem hatte ich ja das viele Geld für die Schuhe gespart.
»Zwanzig Euro sind gut«, sagte die Alte freundlich.
»Für zwanzig Euro ist das ein echtes Schnäppchen«, zischte Matthias, als er mein Zögern bemerkte.
Ich kämpfte mit meinem Gewissen. Der ganze Laden wirkte auf mich, als sei hier schon lange nichts mehr verkauft worden. Vielleicht war die Alte so sehr darauf angewiesen, endlich wieder ein Stück loszuschlagen, dass sie jeden Preis akzeptierte, egal wie niedrig er war. Am liebsten hätte ich noch fünf Euro draufgelegt, doch die Alte griff sich einfach den Zwanzigeuroschein, den ich hervorkramte, und verschwand wortlos im Hinterzimmer.
Matthias und ich blieben eine Weile stehen, in der Annahme, sie würde gleich mit einer Tüte zum Einpacken zurückkommen oder uns vielleicht noch einen Kassenbon bringen, doch sie blieb verschwunden.
»Anscheinend war’s das«, sagte Matthias. »Zwanzig Euro ohne Quittung, das ist so viel wie dreißig mit Quittung, jedenfalls finanzamtsmäßig, sagt meine Mutter immer.«
Zögernd folgte ich ihm hinaus auf die Gasse, wo ich die Maske vorsichtig in meiner Umhängetasche verstaute.
Auf dem Weg zum Hotel ließ ich mich von Matthias zu einem Sandwich einladen, bestand aber darauf, die Getränke zu bezahlen. Wir setzten uns auf eine niedrige Mauer und betrachteten die vorbeiströmenden Touristen, während wir unsere Tramezzini2 aßen und dazu eiskalte Limo tranken.
»Das tut gut«, sagte Matthias.
»Ja, lecker«, meinte ich geistesabwesend. Das blöde Jucken hatte wieder angefangen.
»Weißt du eigentlich schon, was du werden willst?«, fragte Matthias. »Ich meine, nach der Schule.«
»Nein, noch keine Ahnung. Hauptsache, es hat nichts mit Mathe zu tun. Und du?«
»Ich wollte schon als kleiner Junge Zahnarzt werden.« Er wurde rot. »Ich lese alles, was es über Zahnmedizin zu wissen gibt.«
Verblüfft blickte ich ihn an. »Echt? Für das Studium muss man aber gut in der Schule sein!«
Er wurde noch röter. »Äh … ja, mein Schnitt geht einigermaßen.« Er spähte mir in den Mund. »Du hast tolle Zähne.«
»Hm, ich musste ja auch zwei Jahre lang eine blöde Zahnspange tragen.«
»Ich auch. Wir sollten froh darüber sein. Die richtige kieferorthopädische Behandlung führt dazu, dass die Zähne ein Leben lang erhalten bleiben.«
»Was du nicht sagst.« Besonders spannend fand ich das nicht, für mich hörte sich die Zahnarztbegeisterung eher freakig an. Wer hatte schon Lust auf Zahnspangen und Oberflächenversiegelung?
Meine Gedanken drifteten ab. Hinter uns ragte eine Kirche auf, in der ich schon gewesen war, und ich versuchte mich daran zu erinnern, wie sie hieß. Doch im Laufe der letzten anderthalb Wochen hatte ich schon zu viele Kirchen besichtigt, allesamt so beeindruckend und mit Kunst vollgestopft, dass man davon förmlich erschlagen wurde.
»Warst du auch schon in der Santo-Stefano-Kirche?«, fragte Matthias.
Ich nickte, immer noch geistesabwesend. Santo Stefano, genau. Die Kirche mit dem schiefen Turm und dem merkwürdigen Dach, das von innen aussah wie ein umgedrehter Schiffsrumpf. Matthias hatte anscheinend ein besseres Gedächtnis als ich.
Ich rieb mir den Nacken, denn das Jucken wurde schlimmer.
»Was ist los mit dir, hat dich da was gestochen?«
»Nein, das ist so eine Art Allergie.«
Was hätte ich auch sonst sagen sollen? Mein Nacken juckt immer, wenn Gefahr im Anzug ist? Er würde sofort glauben, dass ich einen an der Waffel hätte, und das zu Recht. Ich wusste genau, warum ich es keinem erzählte. Außer mir und meinen Eltern wusste niemand davon und von diesen drei Personen waren zwei der Überzeugung, dass ich nicht ganz dicht war. Eine davon war ich.
Meine Mutter, ganz die Naturwissenschaftlerin, meinte, es handle sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um intermittierende Wahrnehmungsstörungen. Mein Vater hingegen fand, es gebe mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als der Mensch in seiner Vernunft sich erklären könne.
Öfter als vier Mal war es bisher zum Glück nicht vorgekommen. Beim ersten Mal hatte ich das Jucken im Alter von zehn Jahren gespürt, als ich gerade im Schwimmbad aufs Dreimeterbrett steigen wollte. Mit einem Mal wusste ich, dass mir da oben Gefahr drohte. Also blieb ich unten und sah zu, wie ein anderes Kind hochkletterte und mitsamt dem abgebrochenen Brett ins Wasser stürzte. Zu meiner grenzenlosen Erleichterung verletzte sich niemand, es kamen alle mit dem Schrecken davon, sowohl das abgestürzte Kind als auch die Leute im Wasser.
Beim zweiten Mal – ich war zwölf – sollte mein Vater mich zu einer Freundin fahren, die mich zu ihrem Geburtstag eingeladen hatte. Wegen meines heftig juckenden Nackens trödelte ich so lange herum, bis er entnervt erklärte, ich solle gefälligst den Bus nehmen. Das tat ich, auch wenn es ein ziemlicher Umweg war. Später erfuhr ich, dass es auf der kürzeren Strecke, die wir mit dem Wagen genommen hätten, einen furchtbaren Unfall mit mehreren Toten gegeben hatte – genau zu der Zeit, als wir dort vorbeigefahren wären.
Zwei Jahre später geschah es zum dritten Mal, kurz vor Mamas vierzigstem Geburtstag. Sie wollte groß feiern und hatte eine Menge Leute eingeladen und sie fand, der Baum im Vorgarten würde sich netter machen, wenn Papa ihn zur Feier des Tages mit einer Lampiongirlande schmückte. Also holte er die Leiter aus der Garage und stellte sie an den Baum.
Ich rieb meinen juckenden Nacken und sagte besorgt: »Geh nicht da rauf! Es passiert was, das weiß ich!«
Er lachte und erklärte, er werde sich schon vorsehen. Mit der Folge, dass Mamas Geburtstag in der Ambulanz endete, wo sie Papas Bein eingipsten und ihn informierten, dass er an diesem Tag schon der dritte Neuzugang sei, der von einer Leiter gestürzt sei.
Aus Furcht, beim nächsten Mal wieder nicht ernstgenommen zu werden – wobei ich natürlich hoffte, dass es kein nächstes Mal geben möge –, erzählte ich meinen Eltern an diesem Tag von dem Jucken. Sie klopften mir auf die Schulter und meinten, ich solle das nicht überbewerten.
Gott sei Dank kam es nicht zum Schlimmsten, als es zum vierten Mal geschah, vor einem Jahr, ein paar Tage nach meinem sechzehnten Geburtstag. Wir wollten essen gehen, Papa hatte in unserem Lieblingsrestaurant einen Tisch reserviert.
Kurz bevor wir losfahren wollten, fing das Jucken an. »Wir sollten lieber nicht da hinfahren«, sagte ich.
Papa war fasziniert und ein bisschen besorgt. »Hast du es wieder?«
Ich nickte stumm.
Mama ärgerte sich. »Es wäre eine gute Gelegenheit, Anna und auch uns zu beweisen, dass es sich hierbei um eine Art Autosuggestion handelt. Wissenschaftlich nicht haltbar.«
»Auch nicht als Phänomen sogenannter Self-Fulfilling-Prophecy?«, wandte Papa ein.
»Hm. Das hängt davon ab, ob zweiwertige oder polykontexturale Logik anzuwenden ist. Obwohl – nein.« Mama schüttelte entschieden den Kopf. »Lass uns fahren.«
»Ich will nicht«, sagte ich eigensinnig. Aus Sorge, sie könnten einfach ohne mich losfahren, schnappte ich mir den Autoschlüssel und warf ihn ins Klo.
»Ich habe einen Reserveschlüssel«, sagte Mama
»Dann lege ich mich in die Einfahrt.«
Damit hatte sich der Restaurantbesuch erledigt. Zwei Stunden später rief Mama bei dem Lokal an und erkundigte sich, ob es dort besondere Vorkommnisse gegeben habe, etwa einen Brand oder eine bewaffnete Geiselnahme, worauf man ihr befremdet versicherte, dass alles in bester Ordnung sei. Mama lächelte mich mild an und meinte, da hätte ich es, das sei der Beweis.
Am nächsten Morgen fuhr Papa zur Arbeit. Genauer, er wollte zur Arbeit fahren. Nach weniger als drei Minuten kam er zurück und berichtete von einer Pfütze, die er beim Zurücksetzen aus der Einfahrt entdeckt habe. Die Pfütze bestand aus Bremsflüssigkeit. Am Abend zuvor hätten wir sie wegen der Dunkelheit nicht bemerkt.
»Zwei, drei Mal gebremst«, sagte der herbeigerufene Mechaniker, während er sich mit dem Finger über die Kehle fuhr, »und aus die Maus.«
Seither hatte es nicht mehr gejuckt. Bis heute.
Aber warum war diesmal das Jucken einfach so aufgetreten, ohne Zusammenhang mit irgendwelchen Vorhaben oder Absichten? Ich hatte weder in die rote Gondel steigen wollen, noch hatte ich anderweitige Pläne.
Möglicherweise war die drohende Gefahr eher allgemeiner Natur. Ein Erdbeben? Ein Jahrhunderthochwasser?
»Vielleicht bist du gegen die Sonne allergisch«, sagte Matthias.
»Kann sein«, stimmte ich wider besseres Wissen zu. Das Sandwich schmeckte plötzlich nicht mehr, obwohl ich diese dreieckigen, typisch italienischen Weißbrote liebte und jeden Tag mindestens eines davon aß. Die Mayonnaise quoll mir zwischen den Fingern hervor, als ich das letzte Stück in den Mund schob und hastig kaute und schluckte, nur um endlich mit dem Essen fertig zu werden. Auf einmal drängte es mich, so schnell wie möglich zu verschwinden. Nicht nur von dem Campo,3 auf dem Matthias und ich unser kleines Picknick veranstalteten, sondern am besten gleich aus der Stadt.
Beunruhigt von dieser merkwürdigen Anwandlung blickte ich auf.
In diesem Moment sah ich ihn zum ersten Mal.
Er zog alle Blicke auf sich, als er näher kam, nicht nur meine. Das lag nicht etwa an seinem Aussehen – okay, er sah toll aus, ganz ohne Frage –, sondern daran, dass er im Begriff war, mit einem anderen Typ eine Prügelei anzufangen.
Beide waren ungefähr im selben Alter, schätzungsweise zwanzig, und sie brüllten sich gegenseitig an, was das Zeug hielt. Als das nicht mehr reichte, begannen sie, einander zu schubsen.
Der eine, von dem ich kaum die Blicke wenden konnte, war lässig gekleidet, fast abgerissen, mit schäbigen Jeans, schmutzigen Turnschuhen und einem schwarzen T-Shirt, auf dem in Großbuchstaben I’m the original Winner stand. Seine Haare waren dunkel und lockig und eine Spur zu lang und sogar aus einigen Metern Entfernung war zu sehen, wie unglaublich weiß seine Zähne waren. Zusammenhanglos dachte ich: Mit seinen Klamotten hält dieser Winner es nicht so genau, aber auf seine Zähne lässt er nichts kommen.
Der andere war ein Stück kleiner, aber dafür stämmiger gebaut. Und er wirkte deutlich aggressiver. Erst recht, als er auf einmal ein Messer aufschnappen ließ.
Eine Frau sah es und schrie entsetzt auf. Dann merkten es auch andere und erregtes Stimmengewirr setzte ein. Ich hielt die Luft an, während immer mehr Passanten stehen blieben und gafften.
Die beiden Typen schrien sich unentwegt an, bis der Stämmige mit dem Messer in die Luft stach und sich dem Lockigen drohend näherte. Der wiederum wich keinen Schritt zurück, sondern breitete die Arme aus, als wolle er seinen Kontrahenten auffordern, es doch einfach zu versuchen.
»Scheiße aber auch«, sagte Matthias erschrocken. »Der sticht ihn gleich ab! Wir sollten die Polizei rufen!«
Der Stämmige holte mit dem Messer aus und alles, was danach folgte, geschah so schnell, dass man es kaum richtig mitkriegte. Blitzartig packte Winner den Arm des anderen und drehte ihn herum, worauf das Messer in hohem Bogen durch die Luft flog. Gleichzeitig sprang er hoch und trat dem Stämmigen gegen das Knie, worauf dieser ächzend zusammenknickte und fluchend auf dem Pflaster hocken blieb.
Der Lockige machte dem Aufdruck auf seinem T-Shirt alle Ehre. Er hob den Kopf und blickte kurz, aber siegesbewusst in die Runde. Dabei traf sein Blick auf meinen und abermals hielt ich die Luft an. Seine Augen waren fast unwirklich blau und wenn man sich nicht in Acht nahm, konnte man für alle Ewigkeit darin versinken. Das Jucken in meinem Nacken war plötzlich so stark, dass es kaum noch auszuhalten war.
»Kennst du den Typ?«, raunte Matthias mir zu. »Wieso starrt der dich so an?«
Vielleicht, weil ich ihn so anstarrte? Ich brachte keinen Ton heraus.
Dann war der Moment vorbei. Winner hob das Messer seines Gegners auf, klappte die Klinge ein und marschierte davon.
Matthias’ Mutter war eine gertenschlanke, hochgewachsene, nordisch blonde Schönheit mit eisblauen Augen und einer Haut wie Porzellan. Als ich sie das erste Mal sah, fand ich, dass sie wie eine Filmschauspielerin aussah. Ich wusste zwar nicht, welche, aber auf alle Fälle eine berühmte. Kein vernünftiger Mensch wäre auf die Idee gekommen, Matthias könne ihr Sohn sein. Allenfalls ging er als ihr Kofferträger durch. Vor drei Tagen, als die Familie Tasselhoff im Hotel eingecheckt hatte, war er schwer beladen hinter seiner Mutter hergedackelt, in der Rechten ihre Kosmetikbox, in der Linken ihren Koffer und unterm Arm eine Reisetasche, alles in demselben edlen türkisfarbenen Leder, passend zu Frau Tasselhoffs Kostüm.
Dann betrat Herr Tasselhoff mit dem restlichen Gepäck die Lobby und sofort war klar, dass er Matthias’ Vater war. Er sah genauso aus wie Matthias, nur etwas größer und etwas dicker und mit Brille. Betont langsam sagte er: »Wir hier Zimmer gebucht, per favore. Dop-pel-zim-mer. Mit Zu-stell-bett. You capito?«
»Unter welchem Namen bitte?«, fragte die Empfangsdame in perfektem Deutsch zurück.
»Äh … Ach so. Ähm … Ja. Unter Eheleute Heinrich Tasselhoff. Nebst Sohn.«
Frau Tasselhoff lächelte dazu, als sei es völlig normal, dass sie als Teil der Eheleute Heinrich Tasselhoff keinen eigenen Vornamen brauchte.
Mittlerweile wusste ich, dass sie Juliane hieß, schon deshalb, weil sie es innerhalb von drei Tagen irgendwie geschafft hatte, sich mit meinen Eltern zu duzen. Sie und ihr Mann trafen meine Eltern zufällig abends in der Hotelbar und in null Komma nichts fand man bei ein paar Gläsern Rotwein heraus, wie viele gemeinsame Interessen man hatte, und schon war man per Du.
Juliane Tasselhoff schleppte meine Mutter zur Biennale und mein Vater zeigte Heinrich Tasselhoff seine Ausgrabungsstätte am Palazzo Tassini. Ich selbst hatte keine Lust auf überfüllte Kunstausstellungen oder uralte Schutthalden. Mit Matthias loszuziehen erschien mir als das kleinere Übel, also vertrieben wir zwei uns zusammen die Zeit. Wir liefen kreuz und quer durch die Stadt oder schipperten mit den Vaporetti durch die Kanäle. Einmal fuhren wir mit dem Lagunenboot nach Burano und besichtigten auf dem Rückweg Murano. Damit war gleich ein ganzer Ferientag ausgefüllt, ohne dass ich etwas Spannenderes gesehen hätte als viele bunte Häuser (auf Burano) und viel buntes Glas (auf Murano).
Später sollte ich es noch sehr bereuen, dass ich nicht stattdessen Papa begleitet oder mich wenigstens nach Mr. Bjarnignokkis Fundstück erkundigt hatte. Mein Vater erwähnte kurz, dass er das merkwürdige Dokument ins Labor geschickt habe, um die Echtheit zu überprüfen.
»Stell dir vor«, hatte er gemeint, »es wurde ganz offensichtlich von einer Frau geschrieben, die denselben Vornamen hatte wie du!«
»Anna?«, hatte ich etwas dümmlich zurückgefragt.
Er nickte. »Aber wie gesagt, es ist noch nicht geklärt, ob es echt ist. Wegen gewisser handschriftlich aufgebrachter Ornamente, die bei oberflächlicher Deutung anachronistische Implikationen indizieren.«
Ich verstand nur Bahnhof und versäumte es, genauer nachzufragen.
Mein Desinteresse hing zum Teil damit zusammen, dass mir dieser Winner nicht mehr aus dem Kopf ging. Ich musste ständig an ihn denken. Was für blaue Augen er gehabt hatte. Wie geschmeidig er sich bewegt hatte. Wie er mich angesehen hatte!
Wenigstens war das Jucken seither nicht wieder aufgetreten, dafür konnte ich wohl dankbar sein. Und dafür, dass es anscheinend falscher Alarm gewesen war – es war ja nichts Schlimmes passiert. Ich tendierte mittlerweile immer mehr zu Mamas Meinung, nämlich ihrer These über intermittierende Wahrnehmungsstörungen. In Alltagssprache übersetzt bedeutete das so viel wie ab und zu auftretende Verpeiltheit. Doch ich war bereit, das zu akzeptieren. Hauptsache, es wiederholte sich nicht.
Dann kam der Sonntag, der Tag der Regata storica. Ab da lief alles aus dem Ruder. Im wahrsten Sinne des Worte.
Heinrich und Juliane fanden, es sei eine gute Idee, gemeinsam zu frühstücken, bevor wir zu der Veranstaltung aufbrachen. Meine Eltern stimmten zu und so trafen wir uns am Sonntagmorgen im Frühstücksraum zu einer mörderisch frühen Uhrzeit. Ich war so müde, dass ich noch Stunden hätte schlafen können, aber Juliane Tasselhoff erklärte, wenn wir nicht rechtzeitig einen guten Platz am Ufer des Canal Grande ergatterten, würden wir höchstens die Wimpel an den Masten sehen, aber keines von den Booten, geschweige denn die traumhaften Kostüme der darin sitzenden Menschen.
Normalerweise, so berichtete sie, hätten wir uns das Spektakel von der Loggia eines Palazzo direkt am Kanal anschauen können. Dort wohnte nämlich ein Golfpartner von Heinrich, dem es eine Freude gewesen wäre, uns alle in seinem stilvollen Heim zu empfangen. Aber leider war er verreist.
»Ganz wichtiger Mann in der Europapolitik«, sagte Frau Tasselhoff.
»Und Bankier«, sagte Herr Tasselhoff. »Spielt Golf mit unglaublichem Handicap.«
»Ist er schwerbehindert?«, fragte ich.
Matthias prustete in seinen Tee.
Papa unterdrückte einen Hustenanfall.
Frau Tasselhoff musterte mich nachsichtig. »Am Handicap misst man die Fähigkeiten des Golfspielers. Bis auf die Profis hat praktisch jeder eins.«
»Wahrscheinlich fahren sie deshalb alle mit diesen Elektrowägelchen durch die Gegend«, meinte ich. »Geht auf dem Rasen sicher besser als mit Krücken oder Rollstühlen.«
Matthias kicherte haltlos.
»Matthias, es gehört sich nicht, andere Menschen auszulachen, nur weil sie nichts vom Golfsport verstehen«, sagte Frau Tasselhoff scharf.
»Mama, ich habe gelacht, weil Anna einen Witz gemacht hat«, sagte Matthias.
»Woher willst du das wissen?«, rügte ihn seine Mutter.
»Ja, woher?«, fragte ich. »Vielleicht bin ich ja von Natur aus blöd. Erzählte ich schon, dass ich gerade eine Klasse wiederholt habe?«
»Das lag nur an deiner beispiellosen Faulheit«, sagte Mama. »Und an deiner bedauernswerten Dyskalkulie.«
»Oh, nennt man so nicht eine Rechenschwäche?«, fragte Frau Tasselhoff mitleidig. »Wie schrecklich für dich.«
»Ich kann damit leben«, sagte ich. »Eine Fünf in Mathe ist ja kein richtiges Handicap, jedenfalls keines, für das man ein Golfwägelchen braucht.«
»Eigentlich meinte ich dich«, sagte Frau Tasselhoff zu meiner Mutter. »Für dich ist es schrecklich. Lieber Himmel, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Physik zu sein, aber das eigene Kind …«
Mein Vater verteidigte mich. »Das hat Anna von mir. Ich konnte auch nie besonders gut rechnen. Und fast wäre ich auch mal sitzen geblieben.«
»Matthias hat eine Klasse übersprungen«, sagte Frau Tasselhoff. »Er macht nächstes Jahr bereits Abitur und wird dann Zahnmedizin studieren.«
»Mama«, sagte Matthias peinlich berührt.
»Jeder Mensch hat seine speziellen Fähigkeiten«, erklärte Herr Tasselhoff mit fester Stimme. »Der eine da, der andere dort.«
Frau Tasselhoff legte ihre Hand auf seine. »Wie recht du hast, Heinrich. Seien wir froh, dass Matthias so überragend begabt ist. Es kann nicht jeder so intelligent sein wie er.«
Das konnte Papa nicht auf mir sitzen lassen. »Anna schreibt wundervolle Aufsätze«, sagte er. »Sie hat ein Talent fürs Schreiben. Und für lustige Geschichten. Ihr Sinn für Humor ist unschlagbar.«
»Papa!« Diesmal war ich peinlich berührt. Gleich würde er noch erzählen, dass ich mal einen Pokal beim Bodenturnen gewonnen hatte.
»Und Anna sieht toll aus«, warf Matthias ein, als wäre das eine überzeugende Rechtfertigung für meine Rechenschwäche. »Wie eine Zwillingsschwester von Miley.«
»Danke«, sagte ich.
»Welche Miley?«, fragte Frau Tasselhoff
»Miley Cyrus«, erklärte Matthias.
»Wer ist das?«
»Na, die Sängerin. Die auch bei Hannah Montana die Hauptrolle spielt.«
»Bei was?«
»Das ist eine Serie. Sie läuft auf Disney Channel.«
Seinen und meinen Eltern war anzusehen, dass sie keinen blassen Schimmer hatten, wer Miley oder Hannah waren, aber niemand wollte es zugeben.
»Aussehen wird oft überbewertet«, erklärte Frau Tasselhoff.
Herr Tasselhoff zog den Bauch ein. »Du hast recht, Liebes.«
Nachdem das geklärt war, brachen wir zur Regata storica auf.
Frau Tasselhoff hatte nicht übertrieben, es war fast unmöglich, zum Kanal zu gelangen. Zu beiden Seiten des Kanals rangelten die Leute um die besten Plätze. Auf den Balkonen und Loggien der Palazzi tummelten sich bereits zahlreiche Zuschauer. Manche hatten sich vorausschauend in einem der Uferrestaurants einen Tisch reserviert, andere hatten gute Sicht von ihren Booten aus, die entlang der Kaimauern festgemacht waren. Überall herrschte Gedränge, es schien nahezu aussichtslos, überhaupt einen Blick aufs Wasser zu erhaschen.
»Wir sind zu spät«, klagte Frau Tasselhoff.
»Unsinn«, meinte ihr Mann. »Die Bootsparade fängt doch erst in einer halben Stunde an!«
»Ja, aber es ist so voll hier! Wir werden nichts sehen!«
Wir kehrten um und marschierten im Zickzack durch ein paar Gassen, um an einer anderen Stelle zum Ufer vorzustoßen, doch auch dort war der Kai schon überfüllt.
»Wie ärgerlich«, sagte Mama.
»Da vorn, an der Anlegestelle«, sagte Papa. »Da ist noch Platz.«
»So ein glücklicher Zufall!«, rief Frau Tasselhoff.
Ich sah, wie Mama die Stirn runzelte. »Ich glaube nicht, dass sich Zuschauer dort hinstellen dürfen. Sonst würden da schon längst welche stehen.«
»Siehst du vielleicht ein Verbotsschild oder eine Absperrung?«, fragte Frau Tasselhoff. Siegessicher bahnte sie sich einen Weg zwischen den Leuten hindurch, ein auffallender Farbklecks in dem pinkfarbenen Kostüm, das sie heute trug.
Tatsächlich war ein breiter Streifen unmittelbar an dem Bootsanleger leer, als hätte man ihn extra für uns frei gehalten. Die Leute wichen sogar zur Seite, um uns vorbeizulassen, als wir uns dorthin vorkämpften.
»Das ist ja ein richtiger Logenplatz«, freute sich Herr Tasselhoff.
»Ja, unglaublich!«, stimmte Papa zu.
»Es ist wirklich unglaublich«, meinte Mama irritiert. Sie blickte sich um, als erwarte sie, dass jeden Moment Carabinieri oder sonstige Autoritäten auftauchten, um uns zu verbieten, dort zu stehen, etwa weil die Stelle für das Feuerwehrboot frei zu halten sei. Doch niemand machte uns den Platz streitig.
Eine Weile standen wir einfach da und während meine Eltern mit den Tasselhoffs Small Talk veranstalteten, betrachtete ich die Umgebung.
Überall drängten sich Menschen, die in erwartungsvoller Stimmung auf den Kanal blickten.
Aus dem Internet wusste ich inzwischen, dass die Regata storica mehr war als nur ein Touristenspektakel. Gerade für die Venezianer hatte dieses Ereignis eine besondere Bedeutung, weil es für sie das jährliche Highlight des hier sehr verbreiteten Rudersports darstellte.
Vor der eigentlichen Regatta fand jedoch die historische Bootsparade statt, mit vielen Gondeln und Barken, die in feierlicher Prozession über den Canal Grande gerudert wurden. Alle Boote waren bis ins kleinste Detail historisch geschmückt, und Gondolieri sowie Mitfahrende trugen Kostüme im Stil des fünfzehnten Jahrhunderts.
Am Vorabend hatte ich noch ein paar Fotos und Berichte mit meinem iPod gegoogelt und wusste daher ungefähr, was mich erwartete.
»Das prächtigste Schiff von allen ist der Bucintoro«, rief Frau Tasselhoff gegen den allgemeinen Lärm an. »Das ist die goldene Prunkbarke des Dogen.«
»Du weißt wirklich gut Bescheid«, rief Mama zurück.
»Ich habe alles über Venedig gelesen, was man wissen muss. Wenn man fremde Städte besucht, sollte man über sie im Bilde sein. Geschichtlich und kulturell – ihr könnt mich alles fragen.« Sie deutete auf den Kanal hinaus: »Seht nur, da kommen die ersten Boote! Diese Verstrebungen am Bug der Gondel gab es übrigens schon vor fünfhundert Jahren. Sie bestehen, wie man bei genauerem Hinsehen erkennen kann, aus sechs Teilen. Jeder Teil steht für einen Teil Venedigs. Für ein Sechstel, um genau zu sein. Es gibt nämlich sechs venezianische Stadtteile, deshalb heißen sie auch Sestiere. Im Einzelnen sind das San Marco, San Polo, Cannaregio, Dorsoduro, Santa Croce, Castello und die Giudecca.«
»Interessant!«, rief Mama.
Kurz darauf hörte ich sie leise zu Papa sagen: »Die Frau fängt an, mich zu nerven.«
»Erst jetzt?«, fragte Papa zurück.
»Ich hör euch«, sagte ich.
»Das war vertraulich«, wies Mama mich zurecht. »Und das mit den Golfwägelchen war nicht lustig. Man macht keine Witze über Behinderte.«
»Ich fand es saukomisch«, sagte Papa.
»Ich sehe schon die ersten Boote!«, rief Frau Tasselhoff entzückt.
Von der Einmündung des Canal Grande her näherten sich die historisch geschmückten Boote, und schon von Weitem war zu sehen, wie farbenfroh sie waren.
»Sieh mal, da ist auch die rote Gondel«, sagte Matthias.
Tatsächlich, dort trieb sie heran. Das Ruder bediente wieder der einäugige alte Mann, genauso kostümiert wie noch vor einigen Tagen. Die Gondel hielt sich etwas abseits von der übrigen Formation, näher zur Kaimauer hin. Zu meinem Erstaunen scherte sie auf einmal ganz aus. Der einäugige alte Mann stieß sie mit ein paar kräftigen Ruderstößen zu der Anlegestelle, an der wir standen.
»Was macht der denn?«, fragte Mama.
»Keine Ahnung«, sagte Papa.
Die Gondel trieb gegen die Treppenstufen, die im Kai eingelassen waren.
Gestikulierend winkte der Alte zu uns hoch.
»Sieht so aus, als wolle er, dass wir einsteigen«, sagte Frau Tasselhoff.
»Für mich sieht es eher so aus, als wolle er uns zur Seite scheuchen«, widersprach Mama.
»Für mich nicht«, meinte Frau Tasselhoff.
»Irgendwas will er auf jeden Fall«, sagte Mama.
»Wahrscheinlich hundertfünfzig Euro im Voraus«, mutmaßte Herr Tasselhoff.
Der alte Mann verstand es und schüttelte den Kopf. Er winkte erneut, diesmal ungeduldiger. Wollte er uns wegscheuchen? Vielleicht war er bei der Feuerwehr. Ich sah zwar nirgends Löschutensilien, aber von der knallroten Farbe her hätte es gepasst.
Auf einmal entstand auf der Anlegestelle Gedränge. Menschen schoben sich näher und plötzlich wurde es um mich herum fast tumultartig.
»Wir waren zuerst da«, empörte sich Herr Tasselhoff.
Frau Tasselhoff fasste einen Entschluss. »Wir sollten uns doch in die Gondel setzen. Bevor uns andere zuvorkommen. Wir geben dem Alten anstandshalber ein paar Euro und fertig.«
»Sorry!« Jemand in der Menge drängte sich nach vorn und schubste dabei die Umstehenden beiseite. Offenbar hatte er mit seiner rüden Art, alle Leute wegzuschieben, das Gedränge erst verursacht. Ich konnte nicht sehen, wer er war, aber dafür war er umso besser zu hören. Er fluchte ärgerlich auf Italienisch vor sich hin, weil es ihm nicht schnell genug ging. Dann rief er über die Köpfe der Umstehenden dem alten Mann in der Gondel etwas zu und der rief zurück. Es klang wie eine Aufforderung.
Frau Tasselhoff machte einen großen Schritt nach vorn und kletterte in die Gondel. »Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!« Sie blickte zu uns hoch. »Kommt schon, worauf wartet ihr! Einen besseren Platz zum Gucken kriegen wir im Leben nicht!«
Herr Tasselhoff und Matthias stiegen folgsam ebenfalls in die Gondel und setzten sich. Unterdessen schob der Drängler in der Menge, von dem ich nur einen dunklen Haarschopf sah, die letzten Leute, die ihm noch im Weg standen, zur Seite. Dummerweise waren das meine Eltern und ich.
Papa fing an zu schimpfen, weil Mama um ein Haar gestürzt wäre. Er konnte sie gerade noch festhalten.
Ich selbst verlor das Gleichgewicht, und flog in hohem Bogen ins Wasser. Platschend landete ich im Kanal und versank wie ein Stein.
Das Wasser war nicht allzu kalt, jedenfalls nicht kälter als im Freibad, doch nach der schwülheißen Spätsommerhitze war es trotzdem ein ziemlicher Schock. Ganz abgesehen davon, dass es die reinste Kloake war. Irgendwo mussten die Venezianer ihr Abwasser lassen und da boten sich natürlich die Kanäle an. Sie lagen schließlich direkt vor der Haustür, im wahrsten Sinne des Wortes.
Prustend kam ich wieder hoch und schnappte nach Luft.
»Anna!«, hörte ich meine Mutter schreien. »O Gott, sie ist ins Wasser gefallen!«
Sehen konnte ich nichts, denn meine Haare hingen mir wie ein Bündel Algen vor dem Gesicht. O Gott, vielleicht waren es Algen! Stinkende, grüne, giftige Kanal-Algen!
Hände griffen nach mir und zerrten mich aus dem Wasser in ein Boot, mitsamt meiner Tasche, die ich eisern festhielt. Schließlich befand sich mein neuer iPod darin. Hoffentlich hatte er nichts abgekriegt!
Hastig wischte ich mir die Algen aus den Augen, wobei ich feststellte, dass es sich zum Glück doch nur um meine Haare handelte. Als Nächstes merkte ich, dass man mich in die rote Gondel gezogen hatte, in der ich nun der Länge nach lag wie ein gestrandeter Fisch. Schräg über mir sah ich Matthias’ erschrockenes Gesicht, auf den Kopf gestellt, weil er von hinten auf mich herabblickte. »Alles in Ordnung, Anna?«
»Das war nur Ihre Schuld, Sie Flegel!«, hörte ich Frau Tasselhoff zetern. »Hätten Sie nicht alle Leute weggestoßen, wäre das nicht passiert. Dabei haben Sie doch gesehen, dass wir die Gondel schon gemietet hatten!«
Gemietet fand ich nach Lage der Dinge nicht gerade passend. Beschlagnahmt hätte es eher getroffen.
»Immerhin hat er Anna gerettet«, sagte Matthias.
Er? Wer? Ich setzte mich auf und blickte aus verklebten Augen umher. Als Erstes sah ich die Parade der historischen Boote, die neben uns durch das Wasser zog. Dann fiel mein Blick auf den alten Gondoliere, dessen eines Auge mich ausdruckslos betrachtete. Oben auf dem Kai entdeckte ich in der Menge die erleichterten Gesichter meiner Eltern.
Und dann drehte ich mich zu meinem Retter um, der mich deutlich verärgert anschaute.
Es war Winner.
Der alte Gondoliere sagte etwas zu ihm, es klang wie eine Warnung.
»Sie sollten sofort aussteigen«, wandte sich Winner auf Englisch an mich. Er wirkte nervös.
»Das können Sie vergessen«, versetzte Frau Tasselhoff. »Wir waren zuerst hier. Wenn jemand auszusteigen hat, dann Sie!«
»Sie können hierbleiben, aber das Mädchen nicht!«
»Kein Problem, ich hatte sowieso keine Lust aufs Gondelfahren«, erklärte ich. Mein Englisch war nicht berauschend, aber ich hoffte, dass dieser Winner es verstand. Soeben hatte ich nämlich gesehen, dass er immer noch das Messer am Gürtel stecken hatte, das er dem anderen Typen beim Kampf angenommen hatte. Und er machte ganz den Eindruck, als wolle er keinen Widerspruch dulden.
Er war historisch kostümiert, genau wie der alte Gondoliere, nur dass es bei Winner deutlich besser aussah. In den engen Strumpfhosen wirkten seine Waden sehr muskulös und auch das bestickte rote Seidenwams kleidete ihn vorzüglich. Die Schuhe sahen ein bisschen albern aus mit den schnabelförmigen Spitzen, aber sie passten zu dem übrigen Kostüm. Genau wie der Hut, der neben ihm auf der Sitzbank lag.
All das sah ich aus dem Augenwinkel, während ich mich bereit machte, aus der Gondel zu steigen. Das war jedoch nicht so einfach, denn alles, was ich trug, einschließlich der Umhängetasche, hatte sich bis in die letzte Faser mit Wasser vollgesogen. Es fühlte sich an, als wöge ich doppelt so viel wie sonst. Als ich einen Schritt auf die Treppe zumachte, wäre ich um Haaresbreite abermals in den Kanal gefallen. Winner packte mich von hinten am Hosenbund und bewahrte mich vor einem erneuten Bad in der Brühe, während Papa sich vom Kai herabbeugte und die Hände ausstreckte, um mir an Land zu helfen.
Einen Sekundenbruchteil, bevor ich Papas Finger berührte, hörte ich Winner etwas rufen, es klang wie troppo tardi,4 was im Italienischen wahrscheinlich Trampeltier bedeutete.
Dann, zu meinem grenzenlosen Erstaunen, begann es zwischen mir und dem Kai zu flimmern. Zuerst war es wie eine dünne Linie aus Licht, die aussah, als hätte sie jemand mit einem Beamer in die Luft projiziert, und dann wurde das Phänomen flächiger, als würde sich zwischen mir und den Menschen am Kai eine Schicht aus purem, blendendem Licht bilden, die immer dichter wurde.
Mein Vater und die Leute um ihn herum verschwammen und wurden gleichzeitig von dem Licht verhüllt, bis nichts mehr von ihnen zu sehen war.
»Was geschieht hier?«, schrie Frau Tasselhoff hinter mir. »Hilfe! Heinrich, tu doch was!«
Falls Heinrich etwas tat, so half es nichts. Frau Tasselhoff schrie abermals schrill um Hilfe, um dann von einer Sekunde auf die andere zu verstummen.
Ich wollte etwas sagen, aber meine Stimmbänder waren plötzlich aus Eis. Ich versuchte, die Hände auszustrecken, doch mein Körper war gelähmt.
Kälte umfing mich, ich konnte nicht mehr atmen. Um mich herum begann es zu vibrieren, alles geriet in Bewegung, ich wurde gerüttelt und geschüttelt, das Boot schien sich zu heben und zugleich in einen Abgrund zu fallen, obwohl es unmöglich war, dass beides gleichzeitig geschah.
Ich bin ertrunken, schoss es mir durch den Kopf. In Wahrheit hat mich niemand gerettet. Ich liege auf dem algenverseuchten Grund des Canal Grande und bin tot. Das, was ich hier erlebe, sind sozusagen die letzten Zuckungen meiner armen Aura, bevor sie für immer im Nirwana verschwindet.
Die blendende Helligkeit umgab mich nun vollständig. Und im nächsten Moment, schrecklich unerwartet, explodierte sie, begleitet von einem ohrenbetäubenden Knall. Dann versank die ganze Welt in absoluter Schwärze.
Als ich wieder zu mir kam, konnte ich nichts sehen. Dafür konnte ich umso besser fühlen. Ich kam mir vor wie klein gehackt, gut durchgekaut und ausgespuckt. Von Kopf bis Fuß tat mir alles weh. Am schlimmsten waren die Kopfschmerzen. Von innen schlug jemand mit einem Hammer gegen meine Schläfen. Vielleicht auch mit einer Spitzhacke.
Stöhnend machte ich mich bemerkbar und versuchte gleichzeitig herauszufinden, wo ich war. Und warum ich flach auf dem Rücken auf steinhartem Untergrund lag.
Ich lag auf Stein, wie ich gleich darauf feststellte. Meine Fingerspitzen tasteten über holpriges Pflaster. Schmutziges Pflaster. Hatte ich da eben einen Hundehaufen angefasst? Tatsächlich, es stank widerlich!
Aber das war nicht das Schlimmste. Ich war nackt! Sogar meine Unterwäsche war weg! Sofort versuchte ich, um Hilfe zu schreien, doch es kam kein Ton heraus.
»Was soll ich mit dem Mädchen machen, wenn sie aufwacht?«, fragte eine leise Männerstimme. »Sicher kommt sie bald zu sich.«
»Dasselbe wie mit den anderen«, kam es genauso leise zurück. Das war Winners Stimme! »Sorg dafür, dass sie sich anzieht und heimgeht. Wenn sie mitgekommen ist, muss sie hier auch ein Zuhause haben.«
»Bist du sicher?«, fragte der erste Mann. »Schließlich war sie nicht vorgesehen.« Obwohl er nur flüsterte, war zu hören, dass er verärgert war.
»Hast du einen anderen Vorschlag?«
»Ja, dass du dich selbst um sie kümmerst. Schließlich hast du die unerwünschte Fracht mitgebracht!«
»Ich muss sofort weiter, und das weißt du. Noch heute Nacht soll es Trevisan ans Leder gehen, und wenn nicht ich es verhindere, wer dann? Die Malipieros lauern mit Gift und Dolch an jeder Ecke!«
»Na gut, dann verschwinde und tu, was du nicht lassen kannst«, sagte er erste Mann resigniert.
Schritte entfernten sich, und dann sah ich endlich den ersten Schimmer von Licht – eine Decke wurde von meinem Gesicht weggezogen. Genauer, eine Art grober Sack, den irgendwer über mich gebreitet und mir damit die Sicht versperrt hatte.
Im schwachen Schein einer flackernden Laterne erblickte ich ein Gesicht über mir, das nicht sonderlich vertrauenswürdig wirkte. Zumindest hätte es eine gründliche Rasur vertragen, bei dem zotteligen Bart. Der dazugehörige Mann war noch jung, höchstens Anfang zwanzig, und ihm war deutlich anzusehen, dass er nicht gut auf mich zu sprechen war.
Meine Gedanken machten wilde Sprünge. Man hatte mich entführt. Mir eine Knockout-Droge verpasst. Mich nackt ausgezogen. Und vielleicht sogar noch schlimmere Sachen mit mir angestellt. Wo blieb die Polizei, wenn man sie dringend brauchte?
»Finger weg von mir, oder ich schreie«, stieß ich hervor.
»Ich will dir nur helfen, du undankbares Ding«, sagte der bärtige Typ.
Mühsam richtete ich mich auf, den stinkenden Sack vor meinen Körper pressend.
»Wie komme ich hierher? Was ist passiert? Wo sind meine Eltern? Und meine Sachen?«
Er hielt mir einen Stapel Kleidung hin. »Hier, zieh das an. Um der Schamhaftigkeit willen.« Während er mir die Sachen reichte, schaute er zur Seite, aber ich traute seiner Rücksichtnahme nicht und ließ ihn nicht aus den Augen, während ich die Decke zur Seite warf und nach der Kleidung griff. Die Sachen waren eigenartig und glichen in nichts den Klamotten, die ich vorher getragen hatte. Ein viel zu weites, ziemlich steifes Hemd, so ähnlich wie die Nachthemden, die meine Oma immer trug. Das andere Kleidungsstück war braun und fast genauso weit, jedoch am Oberteil mit Schnüren versehen. Das ganze Zeug sah aus, als stammte es aus einem Theaterfundus für historische Kostüme.
Auch der Bärtige war altertümlich angezogen. Sein Outfit bestand aus Flatterhemd, langer Weste und Strumpfhosen. Dazu trug er einen ähnlichen Hut wie jenen, den ich neben Winner auf dem Boot gesehen hatte. Historischer ging es kaum noch. An seinem Gürtel steckte sogar ein kurzes Schwert.
Hatte er bei der Regata storica mitgemacht und dort auch die Frauensachen abgestaubt, die er mir gegeben hatte?
Egal, Hauptsache, ich musste nicht nackt herumlaufen und konnte mich möglichst schnell verdrücken. Eilig streifte ich mir zuerst das weite Hemd über den Kopf und danach den kleiderartigen Überwurf. Nach einem Slip oder BH suchte ich unter diesen Umständen gar nicht erst. Für die Füße gab es immerhin eine Art Schnabelschuhe, ähnlich denen, wie Winner sie getragen hatte.
Wo war der Kerl hin? Er hatte es ziemlich eilig gehabt, zu verschwinden! Was mir den Vorteil verschaffte, dass ich nur vor einem Typ abhauen musste statt vor zweien.
Während ich die Schnüre an dem Gewand festzog, sichtete ich meine Umgebung und machte mich gleichzeitig bereit zum Wegrennen. Ich musste eine ganze Weile bewusstlos gewesen sein, denn es herrschte tiefste Nacht. Ich befand mich in einer dieser extrem engen, typisch venezianischen Gassen, mit verwinkelten Häusern und schiefen Fassaden, wie es sie in der Stadt zu Hunderten gibt. Abgesehen von dem matten Schein der Kerzenlaterne in der Hand des Bärtigen war es stockfinster.
»Wie ist dein Name, Mädchen?«, fragte der Bärtige. Er hatte sich wieder umgedreht und musterte mich.
»Tut mir leid, ich muss ganz dringend nach Hause«, sagte ich, langsam rückwärtsgehend. »Es ist wirklich schrecklich spät.«
»Du kannst gleich gehen, aber deinen Namen muss ich wissen, und auch den Ort, wo du wohnst.«
»Ich heiße Hannah Montana.«
»Und wo wohnst du?«
»Am Disney Kanal.« Ich wandte mich zum Gehen. »Dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg.«
»Warte.« Er wirkte irritiert. »Willst du denn gar nicht wissen, was geschehen ist?«
Das wollte ich mehr als alles andere, aber noch viel dringender wollte ich zurück ins Hotel. Hilfsweise zum nächsten Telefon, um die Polizei anzurufen. Der Bärtige schien aber gesteigerten Wert darauf zu legen, dass ich ihn fragte, was passiert sei, also tat ich es, um ihn bei Laune zu halten. »Was ist denn geschehen?«
»Nun, das ist rasch erzählt«, antwortete er. Es klang wie vorher eingeübt. »Räuber überfielen dich, schlugen dich bewusstlos und stahlen deine Kleidung. Als sie mich sahen, ließen sie dich liegen und rannten davon. Man könnte sagen, dass ich dich gerettet habe.«
»Ja, klar«, sagte ich. »Das ist fein.« Ich machte ein möglichst dankbares Gesicht. »Gute Nacht.«
Gemächlich schlenderte ich davon, bis ich sicher sein konnte, dass der Bärtige mich nicht mehr sah. Dann rannte ich blitzartig los. Und blieb schon nach wenigen Schritten wie vom Donner gerührt stehen.
Vor mir lag der Canal Grande, ich erkannte ihn sofort wieder. In ganz Venedig gibt es nur einen Kanal dieser Größe, der zu beiden Seiten von so vielen pompösen Palazzi gesäumt ist.
Doch anstelle von Laternenbeleuchtung sah ich nur vereinzelte Fackeln am Ufer. Fackeln! Und weit und breit war kein einziges Vaporetto zu sehen, von denen sonst immer welche über den Canal Grande tuckerten. Wo waren die ganzen Motorboote hin? Ich hätte außerdem schwören können, dass mit den Häusern etwas nicht stimmte, auch wenn ich nicht auf Anhieb sagen konnte, was es war. Die Anlegestellen für die Linienboote schienen sich ebenfalls in Luft aufgelöst zu haben.
Auf einmal zweifelte ich, ob das hier wirklich der Canal Grande war. Vielleicht gab es doch noch einen anderen Kanal, der so ähnlich aussah, mir aber auf meinen Streifzügen bisher entgangen war.
Dann sah ich einen Mann und eine Frau aus einem der Palazzi kommen. Im ersten Moment wollte ich sie ansprechen, bekam dann aber keinen Ton heraus. Die beiden waren angezogen, als seien sie einem historischen Kostümfilm entsprungen. Zusammen bestiegen sie eine Gondel. Am vorderen Teil des Bootes war eine Laterne befestigt, ganz ähnlich wie die des Bärtigen. Auch der Gondoliere war historisch verkleidet. Er schickte sich an, loszurudern, während das Paar sich auf der Sitzbank niederließ.
Ging die Regata storica etwa auch über Nacht weiter? War das ein neues Konzept? Alles auf altertümlich gestylt, nirgends elektrisches Licht, keine Motorboote, keine normalen Klamotten mehr? Oder handelte es sich um einen Film, von dem hier gerade eine Szene gedreht wurde, und gleich würden überall die Scheinwerfer angehen und der Regisseur Schnitt! brüllen und vor der nächsten Klappe das Schminkteam zum Abpudern auf den Set schicken?
Ich wartete und wartete, doch nirgends tauchten Filmleute auf. Stattdessen kam eine weitere Gondel vorbei, dann noch eine, und in beiden saßen historisch kostümierte Gestalten. Gleich darauf sah ich drei Männer am gegenüberliegenden Ufer vorübermarschieren. Sie trugen Speere, Helme und als Oberteile eine Art Ritterrüstung.
Ich merkte, dass ich angefangen hatte zu zittern und jetzt spürte ich auch wieder, wie weh mir der Kopf tat. Trotzdem bemühte ich mich, halbwegs konzentriert zu denken. Irgendeine logische Erklärung für all das würde mir schon einfallen!
Allzu viele Möglichkeiten gab es nicht. Soweit ich es beurteilen konnte, höchstens vier. Entweder ich war tot und im Fegefeuer. Oder ich stand unter Drogen. Oder es war ein Film. Oder ich war verrückt.
Ich fuhr zusammen. Hinter mir war der Bärtige aufgetaucht. »Du bist ja noch hier, Hannah. Fürchtest du dich, deinen Heimweg allein anzutreten? Soll ich dich nach Hause begleiten?«
Sein Gesicht spiegelte ehrliche Anteilnahme wider. Im Grunde sah er nicht aus wie jemand, vor dem man sich fürchten musste. Vorhin war er sauer gewesen, weil er mich aus irgendeinem Grund lästig fand, aber jetzt wirkte er aufrichtig besorgt.
Ich holte Luft. »Ich möchte nur eins wissen: Bin ich tot? Angenommen, es wäre so – dann würde sich doch nicht alles so echt anfühlen, oder?«
Er runzelte die Stirn. »Du lebst und bist wohlauf. Warum fragst du, Hannah?«
»Ähm – wird hier gerade ein Film gedreht?«, fragte ich.
Genau genommen wollte ich das fragen. Stattdessen kam aber eine ganze andere Frage heraus, nämlich: »Wird hier gerade ein Kostümstück aufgeführt?«
Verstört klappte ich den Mund zu. Warum hatte ich das Wort Film nicht aussprechen können? Ich versuchte es erneut, diesmal energischer: »Kostümstück«, hörte ich mich sagen. »Kostümstück.« Mindestens zehn Mal hintereinander. Egal, wie oft ich es versuchte – das Wort Film kam nicht über meine Lippen.
Mit einem Mal wirkte der Bärtige extrem wachsam. »Sag mir, woran du dich erinnerst. Von dem, was geschah, bevor du zu dir gekommen bist.«
Verständnislos starrte ich ihn an. Hatte er sie noch alle?
»An alles eigentlich«, sagte ich vorsichtig. »Ich fiel ins Wasser, und dann zog mich dieser Kerl in die rote Gondel von dem einäugigen alten Gondoliere. Und dann knallte es, und ich wurde hier wach und war nackt.«
»O mein Gott! Du hast deine Erinnerungen behalten!«
Was hatte er denn erwartet? Dass die Droge, die ich intus hatte, ewig wirkte?
»Ich erinnere mich nicht an die Räuber«, meinte ich einschränkend.
Er seufzte. »Es gab keine Räuber. Die hat sich Sebastiano ausgedacht.«