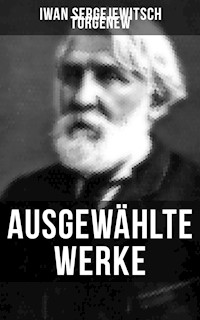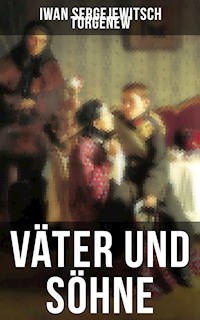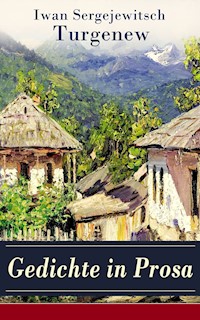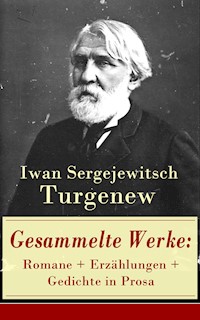1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Iwan Sergejewitsch Turgenews 'Aufzeichnungen eines Jägers' ist eine Sammlung von Erzählungen, die das Leben von russischen Adligen und Bauern des 19. Jahrhunderts beleuchten. Turgenew zeigt eine tiefgreifende Charakterdarstellung und beschreibt einfühlsam die sozialen und politischen Probleme seiner Zeit. Sein einfacher und dennoch poetischer Schreibstil macht diese Geschichten sowohl anspruchsvoll als auch zugänglich für die Leser. Die Erzählungen sind reich an Details, die die Leser in die Welt des zaristischen Russlands eintauchen lassen und gleichzeitig zeitlose Themen wie Liebe, Freiheit und Moral ansprechen. Turgenews Werk wird oft als Gründungstext des russischen Realismus angesehen, der eine Brücke zwischen den Traditionen der Romantik und des Realismus schlägt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Aufzeichnungen eines Jägers
Books
Inhaltsverzeichnis
Chorj und Kalinytsch
Inhaltsverzeichnis
Wer einmal Gelegenheit hatte, aus dem Bolchowschen Kreise in den Shisdrinschen zu kommen, dem ist wohl sicher der scharfe Unterschied zwischen dem Menschenschlag im Orjolschen Gouvernement und dem Kalugaschen aufgefallen. Der Orjolsche Bauer ist klein von Wuchs, untersetzt, mürrisch, blickt unfreundlich, lebt in elenden Hütten aus Espenholz, tut den Frondienst, treibt keinen Handel, nährt sich schlecht und trägt Bastschuhe; der Kalugasche Zinsbauer wohnt in geräumigen Häusern aus Fichtenbalken, ist groß gewachsen, blickt verwegen und lustig, hat eine reine und weiße Gesichtsfarbe, handelt mit Öl und Teer und trägt an Feiertagen Stiefel. Das Orjolsche Dorf (wir meinen den östlichen Teil des Orjolschen Gouvernements) liegt gewöhnlich mitten im Ackerland, in der Nähe einer Vertiefung, die man mit den dürftigsten Mitteln in einen schmutzigen Teich verwandelt hat. Außer einigen, stets dienstbereiten Bachweiden und zwei oder drei mageren Birken sieht man auf eine Werst weit keinen einzigen Baum; Hütte klebt an Hütte, die Dächer sind mit faulem Stroh gedeckt … Ein Dorf im Kalugaschen Gouvernement ist hingegen meistens von Wald umgeben; die Hütten stehen freier und gerader da und sind mit Schindeln gedeckt; die Tore schließen fest, die Zäune hinter dem Hofe sind nicht zerstört, fallen nicht nach außen um und laden nicht jedes vorbeigehende Schwein ein … Auch der Jäger hat es im Kalugaschen Gouvernement besser. Im Orjolschen Gouvernement werden die letzten Wälder und Plätze in vielleicht fünf Jahren verschwinden, von Sümpfen gibt es aber keine Spur. Im Kalugaschen Gouvernement dagegen ziehen sich die Gehege Hunderte und die Sümpfe Dutzende von Werst hin, und das edle Federwild, das Birkhuhn, ist hier noch nicht ausgerottet; es gibt auch noch gutmütige Doppelschnepfen, und das geschäftige Rebhuhn erfreut und erschreckt durch sein plötzliches Aufschwirren den Jäger und den Hund.
Als ich zur Jagd in den Shisdrinschen Kreis kam, lernte ich im Feld einen kleinen Kalugaschen Gutsbesitzer namens Polutykin kennen, einen leidenschaftlichen Jäger und folglich vortrefflichen Menschen. Er hatte allerdings einige Schwächen: Er freite zum Beispiel um alle reichen Bräute des Gouvernements; wenn ihm die Hand und das Haus versagt wurden, vertraute er sein Leid zerknirschten Herzens allen seinen Freunden und Bekannten, fuhr aber fort, den Eltern der Bräute saure Pfirsiche und andere unreife Produkte seines Gartens zum Geschenk zu schicken; er liebte es, immer wieder den gleichen Witz zu erzählen, der, wie hoch ihn Herr Polutykin auch schätzte, keinen Menschen zum Lachen brachte; er lobte die Werke Akim Nachimows und die ErzählungPinna; er stotterte; er nannte seinen Hund Astronom; sagte statt ›aber‹ – ›allein‹ und hatte in seinem Hause die französische Küche eingeführt, deren Geheimnis nach Auffassung seines Koches darin bestand, daß man den natürlichen Geschmack einer jeden Speise auf das radikalste veränderte: Fleisch schmeckte bei diesem Künstler nach Fisch, Fische nach Pilzen, Makkaroni nach Schießpulver; dafür kam bei ihm keine einzige Mohrrübe in die Suppe, ohne vorher die Gestalt eines Rhombus oder eines Trapezes angenommen zu haben. Aber abgesehen von diesen wenigen und unerheblichen Mängeln war Herr Polutykin, wie schon gesagt, ein vortrefflicher Mensch.
Gleich am ersten Tage meiner Bekanntschaft mit Herrn Polutykin lud er mich zum Übernachten ein.
»Bis zu mir sind es an die fünf Werst«, fügte er hinzu. »Zu Fuß ist es zu weit; wollen wir zuerst bei Chorj einkehren.« (Der Leser möge mir erlauben, sein Stottern nicht wiederzugeben.)
»Wer ist Chorj?«
»Einer meiner Bauern … Er wohnt ganz nahe von hier …«
Wir begaben uns zu ihm. Mitten im Walde erhob sich auf einer ausgerodeten und gepflügten Lichtung, das einsame Gehöft Chorjs. Es bestand aus einigen aus Fichtenbalken gezimmerten, durch Zäune verbundenen Gebäuden; vor dem Hauptgebäude zog sich ein von dünnen Säulchen gestütztes Schutzdach hin. Wir traten ein. Uns empfing ein junger, etwa zwanzigjähriger, hübscher Bursche.
»Ah, Fedja! Ist Chorj daheim?« fragte ihn Herr, Polutykin.
»Nein. Chorj ist in die Stadt gefahren«, antwortete der Bursche lächelnd und seine schneeweißen Zähne zeigend. »Befehlen ein Wägelchen anzuspannen?«
»Ja, Bruder, ein Wägelchen. Und bring uns Kwaß.«
Wir traten in die Stube. Kein einziges Susdalsches Bild klebte an den sauberen Balken der Wände; in der Ecke vor dem massiven Heiligenbild mit silbernem Beschlag brannte ein Lämpchen; der Tisch aus Lindenholz war frisch gescheuert und gewaschen; zwischen den Balken und an den Fensterrahmen trieben sich keine flinken Schaben herum und hingen keine nachdenklichen Kakerlaken. Der junge Bursche erschien bald mit einem großen, weißen, mit gutem Kwaß gefüllten Kruge, mit einer riesengroßen Scheibe Weizenbrot und einem Dutzend Salzgurken in einer hölzernen Schüssel. Er stellte alle diese Produkte auf den Tisch, lehnte sich an die Tür und begann uns lächelnd zu betrachten. Wir waren mit dem Imbiß noch nicht fertig, als vor der Tür schon das Wägelchen polterte. Wir gingen hinaus. Ein etwa fünfzehnjähriger, lockiger und rotbäckiger Junge saß als Kutscher da und hatte Mühe, den satten, scheckigen Hengst zu halten. Um den Wagen herum standen an die sechs junge Riesen, die miteinander und mit Fedja große Ähnlichkeit hatten. »Lauter Kinder Chorjs!« bemerkte Polutykiri.
»LauterIltisjungen!« fiel ihm Fedja ins Wort, der uns vors Haus gefolgt war. »Aber es sind noch nicht alle: Potap ist im Wald, und Sidor ist mit dem alten Chorj in die Stadt gefahren … Paß auf, Waßja«, fuhr er fort, sich an den Kutscher wendend. »Fahr schnell, du fährst doch den Herrn. Aber wo der Weg schlecht ist, sollst du langsamer fahren, sonst machst du den Wagen kaputt und bringst auch die Eingeweide des Herrn in Unruhe!«
Die übrigen Iltisjungen lächelten über diesen Witz Fedjas.
»Man setze den Astronomen herein!« rief Herr Polutykin feierlich aus.
Fedja hob nicht ohne Vergnügen den gezwungen lächelnden Hund in die Höhe und setzte ihn auf den Boden des Wagens nieder. Waßja ließ die Zügel locker. Wir rollten davon.
»Das da ist mein Kontor«, sagte mir plötzlich Herr Polutykin, auf ein kleines, niedriges Häuschen weisend, »wollen Sie hineinschauen?«
»Gerne.«
»Es ist jetzt aufgehoben«, bemerkte er, aus dem Wagen steigend, »aber es lohnt sich doch hineinzublicken.«
Das Kontor bestand aus zwei leeren Zimmern. Der Wächter, ein einäugiger Alter, kam vom Hinterhof herbeigelaufen.
»Grüß Gott, Minjajitsch«, versetzte Herr Polutykin. »Wo ist denn das Wasser?«
Der einäugige Alte verschwand und kam sofort mit einer Flasche Wasser und zwei Gläsern wieder.
»Versuchen Sie doch«, sagte mir Polutykin, »ich habe hier ein ausgezeichnetes Quellwasser.«
Wir tranken je ein Glas, während der Alte sich vor uns tief verbeugte.
»Nun, jetzt können wir, glaube ich, fahren«, versetzte mein neuer Freund. »In diesem Kontor habe ich dem Kaufmann Allilyjew vier Deßjatinen Wald um einen guten Preis verkauft.«
Wir setzten uns in den Wagen und fuhren schon nach einer halben Stunde in den Hof des Herrenhauses ein.
»Sagen Sie mir bitte«, fragte ich Polutykin beim Abendessen, »warum wohnt Ihr Chorj getrennt von den anderen Bauern?«
»Sehen Sie, er ist ein gescheiter Kerl. Vor fünfundzwanzig Jahren ist ihm sein Haus abgebrannt; da kam er zu meinem seligen Vater und sagte: ›Erlauben Sie mir, Nikolai Kusmitsch, mich in Ihrem Wald auf dem Sumpfgrund anzusiedeln. Ich werde Ihnen einen guten Zins zahlen!‹ – ›Warum willst du dich denn auf dem Sumpfgrund ansiedeln?‹ – ›Ich möchte es halt; aber bitte, Väterchen Nikolai Kusmitsch, verwenden Sie mich zu keiner anderen Arbeit mehr, legen Sie mir nur einen Zins auf, so hoch Sie wollen.‹ – ›Fünfzig Rubel im Jahr!‹ – ›Gut.‹ – ›Aber daß du pünktlich zahlst, paß auf!‹ – ›Natürlich pünktlich …‹ – So siedelte er sich auf dem Sumpfboden an. Seitdem nennt man ihn Chorj.«
»Und da wurde er reich?« fragte ich.
»Ja, er wurde reich. Jetzt zahlt er mir ganze hundert Rubel Zins, und ich werde ihn vielleicht noch steigern. Ich habe ihm schon mehr als einmal gesagt: ›Chorj, kaufe dich los …!‹ Aber der Gauner behauptet, er hätte kein Geld … Ja, wer’s glaubt …!«
Am nächsten Tag begaben wir uns gleich nach dem Morgentee wieder auf die Jagd. Als wir durchs Dorf fuhren, ließ Herr Polutykin seinen Kutscher vor einem niederen Hause halten und rief laut: »Kalinytsch, Kalinytsch!«
»Sofort, Väterchen, sofort«, erklang es vom Hof her; »ich binde mir nur den Bastschuh fest.«
Wir fuhren im Schritt weiter; hinter dem Dorf holte uns ein etwa vierzigjähriger, großgewachsener, hagerer Mann mit einem kleinen, in den Nacken geworfenen Kopf ein. Es war Kalinytsch. Sein gutmütiges, bräunliches, hier und da pockennarbiges Gesicht gefiel mir auf den ersten Blick. Kalinytsch ging (wie ich später erfuhr) jeden Tag mit seinem Herrn auf die Jagd, trug ihm die Tasche, manchmal auch das Gewehr, paßte auf, wo sich das Wild niedersetzte, brachte Wasser, sammelte Erdbeeren, baute Jagdhütten und lief den Jagdwagen holen; ohne ihn tat Herr Polutykin keinen Schritt. Kalinytsch war ein Mann vom heitersten und sanftesten Charakter, summte stets mit halber Stimme vor sich hin, blickte sorglos nach allen Seiten, sprach etwas durch die Nase, kniff beim Lächeln seine hellblauen Augen zusammen und packte oft mit der Hand seinen dünnen, keilförmigen Bart. Er ging nicht schnell, aber mit großen Schritten, und stützte sich dabei auf einen langen, dünnen Stecken. Im Laufe des ganzen Tages sprach er mich kein einziges Mal an, bediente mich ohne Unterwürfigkeit, gab aber auf seinen Herrn acht wie auf ein kleines Kind. Als die unerträgliche Mittagsglut uns zwang, Schutz zu suchen, führte er uns in seinen Bienengarten tief im Waldesdickicht. Kalinytsch sperrte uns die kleine Hütte auf, in der überall Bündel trockener, wohlriechender Gräser hingen, bettete uns in das frische Heu, zog sich eine Art Sack mit einem Netz vorne über den Kopf, nahm ein Messer, einen Topf und eine glimmende Kohle und begab sich in seinen Bienengarten, um uns eine Honigwabe zu schneiden. Wir tranken zu dem durchsichtigen, warmen Honig Quellwasser und schliefen beim eintönigen Summen der Bienen und dem geschwätzigen Rauschen der Blätter ein.
Ein leichter Windstoß weckte mich … Ich schlug die Augen auf und erblickte Kalinytsch; er saß auf der Schwelle der halbgeöffneten Tür und schnitzte sich mit dem Messer einen Holzlöffel. Ich bewunderte lange sein Gesicht, das so mild und heiter war wie der Abendhimmel. Auch Herr Polutykin erwachte. Wir standen nicht sogleich auf. Es war so angenehm, nach dem langen Marsch und dem tiefen Schlaf unbeweglich im Heu zu liegen: Der Körper ist so wonnig ermattet, das Gesicht atmet eine leichte Hitze, und eine süße Trägheit schließt die Augen. Endlich standen wir auf und trieben uns wieder bis zum Abendessen umher. Beim Abendessen brachte ich wieder die Rede auf Chorj und Kalinytsch.
»Kalinytsch ist ein guter Bauer«, sagte mir Herr Polutykin, »ein eifriger und dienstfertiger Mann; aber er kann seine Wirtschaft nicht in Ordnung halten, ich reiße ihn immer heraus. Jeden Tag geht er mit mir auf die Jagd … Wie soll er da seine Wirtschaft versehen können, urteilen Sie doch selbst.«
Ich stimmte ihm zu, und wir legten uns schlafen.
Am anderen Tag mußte Herr Polutykin wegen eines Prozesses mit seinem Nachbar Pitschukow in die Stadt. Der Nachbar Pitschukow hatte ihm ein Stück Land weggepflügt und auf dieser Stelle auch noch eines von Polutykins Bauernweibern mit Ruten züchtigen lassen. So begab ich mich allein auf die Jagd und kehrte gegen Abend bei Chorj ein. An der Schwelle des Hauses empfing mich ein kahlköpfiger, kleingewachsener, breitschultriger und stämmiger Alter – es war Chorj selbst. Ich sah diesen Chorj mit Neugierde an. Seine Gesichtszüge erinnerten an Sokrates: die gleiche hohe Stirne voller Beulen, die gleichen kleinen Äuglein und die gleiche Stumpfnase. Wir traten zusammen in die Stube. Der gleiche Fedja brachte mir Milch und Schwarzbrot. Chorj setzte sich auf die Bank, strich sich seinen krausen Bart und begann ein Gespräch mit mir. Er schien sich seiner Würde bewußt zu sein, sprach und bewegte sich langsam und lächelte manchmal unter seinem langen Schnurrbart hervor.
Wir sprachen über die Aussaat, über die Ernte, über das ganze Bauernleben. Er tat so, als ob er mir zustimmte, aber, ich fühlte mich nachher irgendwie geniert, und ich merkte, daß ich nicht das Richtige sprach … Es kam so sonderbar heraus. Chorj drückte sich zuweilen, wohl aus Vorsicht, schwer verständlich aus … Hier ist eine Probe unseres Gesprächs:
»Hör mal, Chorj«, sagte ich ihm, »warum kaufst du dich nicht von deinem Herrn frei?«
»Warum soll ich mich freikaufen? Jetzt kenne ich meinen Herrn und weiß, was ich ihm zu zahlen habe … Wir haben einen guten Herrn.«
»Aber die Freiheit ist doch besser«, bemerkte ich. Chorj sah mich von der Seite an.
»Gewiß«, versetzte er.
»Warum kaufst du dich dann nicht frei?«
Chorj schüttelte den Kopf.
»Womit soll ich mich freikaufen, Väterchen?«
»Tu doch nicht so, Alter …«
»Kommt Chorj unter die freien Leute«, fuhr er halblaut, wie vor sich hin, fort, »so ist jeder, der keinen Bart trägt, ein Herr über Chorj.«
»Nimm dir doch auch den Bart ab.«
»Was ist der Bart? Der Bart ist Gras, man kann ihn abmähen.«
»Also was denn?«
»Chorj wird wohl gleich unter die Kaufleute kommen; die Kaufleute haben ja ein gutes Leben, auch tragen sie Bärte.«
»Sag, du treibst doch auch Handel?« fragte ich ihn.
»Wir handeln wohl ein wenig mit Öl und auch mit Teer … Nun, Väterchen, soll ich dir das Wägelchen anspannen?«
Du verstehst deine Zunge im Zaume zu halten und bist wohl gar nicht so dumm, dachte ich mir.
»Nein«, sagte ich laut, »ich brauche kein Wägelchen; ich will morgen hier in der Nähe jagen und bleibe, wenn du erlaubst, in deinem Heuschuppen über Nacht.«
»Bitte sehr. Wirst du es aber im Schuppen bequem haben? Ich will den Weibern sagen, daß sie dir ein Laken und ein Kissen hinlegen. – He, Weiber!« rief er aufstehend. »Weiber, hierher …! Und du, Fedja, geh mit ihnen mit: Die Weiber sind doch ein dummes Volk.«
Eine Viertelstunde später geleitete mich Fedja mit einer Laterne zum Schuppen. Ich warf mich auf das duftende Heu; der Hund rollte sich zu meinen Füßen zusammen; Fedja wünschte mir gute Nacht, die Tür knarrte und fiel ins Schloß. Ich konnte recht lange nicht einschlafen. Eine Kuh trat vor die Tür und schnarchte zweimal laut; mein Hund knurrte sie mit Würde an; ein Schwein ging, nachdenklich grunzend, vorbei; irgendwo in der Nähe fing ein Pferd an, Heu zu kauen und zu schnauben … endlich schlummerte ich ein.
Fedja weckte mich beim Sonnenaufgang. Dieser lustige, aufgeweckte Bursche gefiel mir sehr gut; soviel ich merken konnte, war er auch ein Liebling des alten Chorj. Sie neckten sich beide in der freundschaftlichsten Weise. Der Alte kam mir entgegen. Kam es daher, weil ich die Nacht unter seinem Dach verbracht hatte, oder aus einem anderen Grund, jedenfalls behandelte er mich diesmal viel freundlicher als am Abend vorher.
»Der Samowar ist für dich bereit«, sagte er mir mit einem Lächeln. »Komm Tee trinken.«
Wir setzten uns an den Tisch. Ein kräftiges Frauenzimmer, eine seiner Schwiegertöchter, brachte einen Topf Milch. Seine Söhne kamen einer nach dem andern in die Stube.
»Was hast du für riesengroße Kerle!« bemerkte ich dem Alten.
»Ja«, versetzte er, indem er ein winziges Stück Zucker abbiß. »Über mich und meine Alte haben sie sich wohl nicht zu beklagen.«
»Und leben alle bei dir?«
»Alle. Sie wollen es selbst so.«
»Sind alle verheiratet?«
»Nur ein Schlingel will nicht heiraten«, antwortete er, auf Fedja zeigend, der wie früher an der Tür lehnte. »Waßja ist jung, der kann noch warten.«
»Warum soll ich heiraten?« entgegnete Fedja. »Ich hab’s auch so. gut. Was brauche ich ein Weib? Vielleicht um mich mit ihr herumzuzanken?«
»Ach, du …! Ich kenne dich schon! Silberne Ringe trägst du … Hast nur die Hausmädchen im Sinn … ›Hören Sie auf, Sie Unverschämter!«« fuhr der Alte fort, ein Stubenmädchen nachäffend. »Ich kenne dich schon, du Müßiggänger!«
»Was taugt denn ein Weib?«
»Das Weib ist eine Arbeiterin«, versetzte Chorj mit Würde. »Das Weib ist des Mannes Dienerin.«
»Was brauche ich aber eine Dienerin?«
»Das ist es eben, du liebst mit fremden Händen die Glut zusammenzuscharren. Wir kennen euch.«
»Nun, so verheirate mich. Wie? Was? Was schweigst du jetzt?«
»Hör auf, Spaßvogel. Du siehst doch, wir langweilen den Herrn. Ich werde dich schon verheiraten … Nimm’s nicht übel, Väterchen, du siehst doch, er ist noch ein dummes Kind, hat noch nicht Zeit gehabt, zu Verstand zu kommen.« Fedja schüttelte den Kopf …
»Ist Chorj daheim?« erklang hinter der Tür eine mir bekannte Stimme, und in die Stube trat Kalinytsch mit einem Büschel Walderdbeeren in der Hand, die er für seinen Freund gepflückt hatte. Der Alte begrüßte ihn herzlich. Ich sah Kalinytsch erstaunt an: Offen gestanden, ich hätte von einem Bauern eine solche zarte Aufmerksamkeit nicht erwartet.
An diesem Tag ging ich vier Stunden später als gewöhnlich auf die Jagd und verbrachte die folgenden drei Tage bei Chorj. Meine neuen Bekannten interessierten mich. Ich weiß nicht, wodurch ich ihr Vertrauen gewonnen hatte, aber sie sprachen mit mir ganz ungezwungen. Es machte mir Vergnügen, ihnen zuzuhören und sie zu beobachten. Die beiden Freunde sahen einander gar nicht ähnlich. Chorj war ein positiver Mensch, ein praktischer, administrativer Kopf und ein Rationalist; Kalinytsch dagegen gehörte zu den Idealisten, Romantikern, begeisterten und träumerischen Naturen. Chorj hatte Verständnis für die Wirklichkeit, das heißt, er hatte sich ein Haus gebaut und etwas Geld gespart und kam mit dem Herrn und den anderen Obrigkeiten gut aus; Kalinytsch trug Bastschuhe und schlug sich mit knapper Not durch. Chorj hatte eine große Familie, die einträchtig lebte und ihm gehorsam war; Kalinytsch hatte einmal eine Frau gehabt, die er fürchtete, Kinder hatte er aber keine. Chorj durchschaute den Herrn Polutykin; Kalinytsch vergötterte seinen Herrn. Chorj liebte Kalinytsch und protegierte ihn; Kalinytsch liebte und verehrte Chorj. Chorj sprach wenig, lächelte spöttisch und wußte, was er wollte; Kalinytsch sprach immer mit großem Feuer, obwohl er auch nicht verstand, gleich manchem durchtriebenem Fabrikarbeiter, ›wie eine Nachtigall zu singen …‹ Aber Kalinytsch hatte Vorzüge, die sogar Chorj anerkannte; er verstand zum Beispiel das Blut, den Schreck und die Tollwut, zu besprechen und die Würmer abzutreiben; die Bienen gediehen bei ihm gut, er hatte, was man so nennt, eine leichte Hand. Chorj bat ihn in meiner Gegenwart, er möchte sein neugekauftes Pferd zuerst in den Stall führen, und Kalinytsch erfüllte die Bitte des alten Skeptikers mit gewissenhafter Würde. Kalinytsch stand der Natur näher, Chorj dagegen den Menschen und der Gesellschaft; Kalinytsch liebte nicht zu räsonieren und glaubte alles blind; Chorj erhob sich sogar zu einer ironischen Lebensauffassung. Er hatte viel gesehen, wußte viel, und ich lernte von ihm eine Menge Dinge. So erfuhr ich zum Beispiel, daß jeden Sommer vor der Ernte in den Dörfern ein kleines Wägelchen von besonderem Aussehen erscheint. In diesem Wägelchen sitzt ein Mann im Kaftan und verkauft Sensen. Bei Barzahlung kostet die Sense von einundeinviertel bis einundeinhalb Rubel in Assignaten, auf Kredit aber drei Papier-und einen Silberrubel. Alle Bauern nehmen die Sensen natürlich auf Kredit. Nach zwei oder drei Wochen kommt er wieder und verlangt sein Geld. Der Bauer hat seinen Hafer eben gemäht und ist also bei Geld; er geht mit dem Händler in die Schenke und rechnet dort mit ihm ab. Einige Gutsbesitzer kamen auf den Gedanken, die Sensen selbst für bares Geld zu kaufen und an die Bauern zum Selbstkostenpreis auf Kredit abzugeben; die Bauern waren aber damit unzufrieden und grämten sich sogar: Man nahm ihnen das Vergnügen, die Sense mit den Fingern zu beklopfen, zu hören, wie sie klingt, sie in den Händen hin und her zu wenden und an die zwanzigmal den schlauen Händler zu fragen: »Was meinst du, Bursch, ist die Sense auch nicht zu … du weißt wohl, was ich meine?« Dasselbe wiederholt sich auch beim Ankauf von Sicheln, bloß mit dem Unterschied, daß sich hier auch die Weiber hineinmischen und den Händler oft sogar in die Notwendigkeit versetzen, sie zu ihrem eigenen Nutzen zu prügeln. Am meisten haben aber die Weiber bei folgender Gelegenheit zu leiden. Die Lieferanten des Materials für die Papierfabriken beauftragen mit dem Ankauf der Hadern eigene Personen, die man in manchen Landkreisen ›Adler‹ nennt. So ein ›Adler‹ bekommt vom Geschäftsmann etwa zweihundert Rubel in Assignaten und zieht damit auf Beute aus. Aber im Gegensatz zu dem edlen Vogel, von dem er seinen Namen hat, überfällt er seine Opfer nicht offen und kühn; im Gegenteil: der › Adler ‹ wendet List und Schlauheit an. Er läßt sein Wägelchen irgendwo im Gesträuch hinter dem Dorf stehen und begibt sich zu Fuß hintenherum ins Dorf wie ein zufälliger Wanderer oder ein müßiger Spaziergänger. Die Weiber wittern sein Nahen und schleichen ihm entgegen. Das Geschäft wird in der größten Eile abgeschlossen. So ein Bauernweib gibt dem ›Adler‹ für einige Kupfermünzen nicht nur alle ihre unnützen Lumpen her, sondern oft sogar das Hemd des Mannes und den eigenen Rock. In der letzten Zeit haben es die Weiber vorteilhaft gefunden, sich selbst den Hanf zu stehlen und auf diese Weise zu‹ verkaufen, besonders den Sommerhanf – das ist eine wichtige Erweiterung und Vervollkommnung der › Adler‹-lndustrie! Dafür sind nun auch die Bauern ihrerseits schon gewitzigt und greifen beim leisesten Verdacht oder beim bloßen Gerücht, daß ein ›Adler‹ in der Nähe sei, zu Korrektions-und Vorbeugungsmaßregeln. Und in der Tat, das ist doch kränkend! Der Hanfverkauf ist ihre Sache, und sie verkaufen ihn wirklich, doch nicht denen in der Stadt – in die Stadt müßten sie sich doch selbst schleppen –, sondern durchfahrenden Aufkäufern, welche in Ermangelung einer Waage das Pud zu vierzig Handvoll rechnen – aber man weiß doch, was für eine Handfläche der Russe hat und was bei ihm ›eine Handvoll‹ bedeutet, besonders wenn er sich Mühe gibt!
Ich, der ich unerfahren war und nur wenig auf dem Lande gelebt hatte, bekam viele solche Erzählungen zu hören. Chorj erzählte aber nicht nur, sondern fragte auch mich über vieles aus. Als er erfuhr, daß ich im Ausland gewesen war, entbrannte seine Neugierde … Kalinytsch blieb hinter ihm nicht zurück; aber ihn rührten mehr Beschreibungen der Natur, der Berge und Wasserfälle, der ungewöhnlichen Gebäude und der großen Städte; Chorj interessierte sich mehr für administrative und politische Fragen. Er nahm alles der Reihe nach durch: »Haben die es dort wie wir oder anders…? Sag doch, Väterchen, wie ist es nun…?«
»Ach, Herr,, dein Wille geschehe!« rief Kalinytsch während meiner Erzählungen.
Chorj schwieg, zog seine buschigen Augenbrauen zusammen und ließ nur ab und zu die Bemerkung fallen: »Das würde bei uns nicht gehen, das aber ist gut, das ist Ordnung.«
Alle seine Fragen kann ich nicht wiedergeben, und es hat auch keinen Zweck; aber aus unseren Gesprächen gewann ich eine Überzeugung, die meine Leser wohl nicht erwarten – die Überzeugung, daß Peter der Große im Grunde genommen ein echter Russe gewesen ist, Russe gerade in seinem Reformwerk. Der Russe ist so sehr von seiner eigenen Kraft und Stärke überzeugt, daß er bei Gelegenheit nicht abgeneigt ist, sich selbst Gewalt anzutun: Er interessiert sich wenig für seine Vergangenheit und blickt kühn in die Zukunft. Was gut ist, das gefällt ihm, was vernünftig ist, das will er haben, woher es aber kommt, ist ihm vollkommen gleich. Sein gesunder Menschenverstand macht sich gern über die trockene Vernunft des Deutschen lustig; aber die Deutschen sind, nach den Worten Chorjs, ein interessantes Völkchen, bei dem er sogar manches lernen möchte. Infolge seiner besonderen Stellung und seiner faktischen Unabhängigkeit sprach Chorj mit mir über vieles, was man aus einem anderen – wie sich die Bauern noch ausdrücken – mit keinem Hebel herausbringen oder mit keinem Mühlstein herausmahlen könnte. Er hatte für seine Stellung volles Verständnis. In meinen Gesprächen mit Chorj hörte ich zum erstenmal die einfache, kluge Rede des russischen Bauern. Seine Kenntnisse waren in ihrer Art sehr umfassend, aber lesen konnte er nicht; Kalinytsch konnte wohl lesen. »Dieser Gauner hat es gelernt«, bemerkte Chorj. »Ihm sind auch niemals Bienen eingegangen.«
»Hast du deinen Kindern das Lesen beibringen lassen?«
Chorj schwieg eine Weile. »Fedja kann es.«
»Und die anderen?«
»Die anderen nicht.«
»Warum?«
Der Alte antwortete nicht und brachte das Gespräch auf etwas anderes. Wie klug er übrigens war, hatte er doch viele Vorurteile und manchen Aberglauben. Die Weiber verachtete er zum Beispiel aus tiefster Seele und machte sich, wenn er gut aufgelegt war, über sie lustig. Seine Frau, eine zänkische Alte, lag den ganzen Tag auf dem Ofen und tat nichts als brummen und keifen; die Söhne schenkten ihr keine Beachtung, aber ihre Schwiegertöchter hielt sie in der Furcht des Herrn. Nicht umsonst singt im russischen Volkslied die Schwiegermutter: ›Was bist du mir für ein Sohn, was für ein Herr im Haus! Du schlägst nicht dein Weib, deine junge Frau …‹ Einmal versuchte ich für die Schwiegertöchter einzutreten und in Chorj Mitleid zu erwecken; aber er entgegnete mir ruhig: »Was brauchen Sie sich mit diesem … Unsinn abzugeben, sollen sich die Weiber nur herumschlagen … Wenn man sie auseinanderzubringen versucht, so wird es noch schlimmer, es lohnt auch nicht, sich die Hände zu beschmutzen.« Die böse Alte kroch manchmal vom Ofen herunter, rief den Hofhund aus dem Flur herein und bearbeitete seinen mageren Rücken mit der Ofengabel; oder sie stellte sich unter den Dachvorsprung und ›kläffte‹, wie sich Chorj ausdrückte, alle Vorbeigehenden an. Ihren Mann fürchtete sie jedoch und zog sich, wenn er es befahl, wieder auf den Ofen zurück. Besonders interessant war es, dem Streit zwischen Chorj und Kalinytsch zuzuhören, wenn die Rede auf Herrn Polutykin kam. – »Den sollst du mir nicht anrühren, Chorj«, sagte Kalinytsch.
»Warum läßt er dir aber keine Stiefel machen?« entgegnete jener.
»Ach, Stiefel …! Was brauche ich Stiefel? Ich bin ein Bauer …«
»Auch ich bin ein Bauer, aber sieh …«
Bei diesem Worte hob Chorj seinen Fuß und zeigte Kalinytsch einen Stiefel, der wohl aus Mammutshaut zugeschnitten war.
»Ach, du bist doch was ganz anderes!« antwortete Kalinytsch.
»Nun, er hätte dir wenigstens Geld für Bastschuhe geben können, du gehst doch mit ihm auf die Jagd und brauchst wohl jeden Tag ein neues Paar.«
»Er gibt mir Geld für Bastschuhe.«
»Gewiß, im vorigen Jahre hat er dir ein Zehnkopekenstück geschenkt.«
Kalinytsch wandte sich geärgert weg, und Chorj wälzte sich vor Lachen, wobei seine kleinen Äuglein ganz verschwanden.
Kalinytsch sang recht angenehm und spielte die Balalaika. Chorj hörte ihm lange zu, neigte dann den Kopf auf die Seite und fiel mit klagender Stimme in seinen Gesang ein. Besonders gern hatte er das Lied ›Du mein Schicksal, Schicksal!‹ Fedja ließ sich keine Gelegenheit entgehen, den Alten zu necken. »Was bist du so trübsinnig, Alter?«
Aber Chorj stützte die Wange in die Hand, schloß die Augen und fuhr fort, sein Schicksal zu beklagen … Dafür gab es zu anderen Zeiten keinen fleißigeren Menschen als ihn: Ewig machte er sich zu schaffen – entweder besserte er den Wagen aus oder stützte den Zaun oder sah das Pferdegeschirr nach. Auf besondere Reinlichkeit hielt er übrigens nichts und sagte mir einmal auf meine diesbezügliche Bemerkung, daß es in der Stube doch nach einer Menschenwohnung riechen müsse.
»Schau nur«, entgegnete ich ihm, »wie sauber es Kalinytsch in seinem Bienengarten hat.«
»Sonst würden die Bienen nicht leben, Väterchen«, sagte er mit einem Seufzer.
»Sag doch«, fragte er mich ein anderes Mal, »hast du auch dein eigenes Erbgut?«
»Ja.«
»Ist es weit von hier?«
»An die hundert Werst.«
»Nun, wohnst du auch auf deinem Erbgute, Väterchen?«
»Ja «
»Aber du ziehst wohl meistens mit dem Gewehr herum?«
»Die Wahrheit zu sagen, ja.«
»Du tust recht daran, Väterchen; schieß nur zur Gesundheit recht viele Birkhähne und wechsele recht oft den Dorfschulzen.«
Am Abend des vierten Tages schickte Herr Polutykin nach mir. Es tat mir leid, mich von dem Alten zu trennen. Ich setzte mich mit Kalinytsch in den Wagen. »Nun, leb wohl, Chorj, bleibe gesund«, sagte ich. »Leb auch du wohl, Fedja.«
»Leb wohl, Väterchen, leb wohl, vergiß uns nicht.«
Wir fuhren ab; das Abendrot begann eben zu glühen. – »Wir werden morgen schönes Wetter haben«, sagte ich, auf den heiteren Himmel blickend.
»Nein, es wird regnen«, entgegnete Kalinytsch. »Die Enten plätschern, und auch das Gras duftet so stark.«
Wir fuhren ins Gebüsch. Kalinytsch begann mit halber Stimme zu singen, indem er auf dem Bock auf und nieder hüpfte und in einem fort auf das Abendbrot schaute …
Am anderen Tag verließ ich das gastfreundliche Dach des Herrn Polutykin.
Jermolai und die Müllerin
Inhaltsverzeichnis
Am Abend ging ich mit dem Jäger Jermolai auf den Schnepfenstrich … Meine Leser wissen vielleicht nicht, was der Schnepfenstrich ist. Hören Sie also.
Eine Viertelstunde vor Sonnenuntergang im Frühjahr gehen Sie mit dem Gewehr, doch ohne Hund in den Wald. Sie suchen sich am Waldsaum einen Platz aus, sehen sich um, untersuchen das Zündhütchen und wechseln Blicke mit Ihrem Begleiter. Die Viertelstunde ist vorüber. Die Sonne ist untergegangen, aber im Wald ist es noch hell; die Luft ist rein und durchsichtig; die Vögel zwitschern geschwätzig; das junge Gras glänzt lustig und smaragden … Sie warten. Im Wald wird es allmählich dunkler; das rote Licht der scheidenden Sonne gleitet langsam über die Wurzeln und Stämme der Bäume, steigt immer höher hinauf und geht von den unteren, fast noch nackten Zweigen zu den unbeweglichen, einschlafenden Wipfeln über … Nun sind auch die Wipfel selbst erloschen; der Himmel, der eben rötlich war, wird immer blauer. Der Wald duftet stärker, ein warmer feuchter Hauch kommt gezogen; der Wind erstirbt um Sie herum. Die Vögel schlafen ein, nicht alle zugleich, sondern je nach der Gattung: Da sind die Finken verstummt, einige Augenblicke später die Grasmücken, dann die Ammern. Im Wald wird es immer dunkler und dunkler. Die Bäume fließen zu großen schwarzen Massen zusammen; am blauen Himmel treten scheu die ersten Sternchen hervor. Alle Vögel schlafen. Die Rotschwänzchen und die kleinen Spechte allein zwitschern noch leise und verschlafen … Nun sind auch sie verstummt. Noch einmal erklingt über Ihnen die helle Stimme des Weidenzeisigs; irgendwo schreit kläglich eine Goldamsel; die Nachtigall läßt ihren ersten Triller erklingen. Ihr Herz ist vor Erwartung ganz matt, und plötzlich – doch nur ein Jäger wird mich verstehen – plötzlich ertönt in der tiefen Stille ein leises, eigentümliches Krächzen und Zischen, das gleichmäßige Schlagen schneller Flügel, und die Waldschnepfe fliegt, den langen Schnabel schön geneigt, hinter der dunklen Birke langsam Ihrem Schuß entgegen.
Das heißt ›auf dem Schnepfenstrich stehen‹.
Also begab ich mich mit Jermolai auf den Schnepfenstrich; aber entschuldigen Sie, ich muß Sie erst mit Jermolai bekannt machen.
Stellen Sie sich einen Mann von etwa fünfundvierzig Jahren vor, großgewachsen, hager, mit einer langen und dünnen Nase, einer schmalen Stirn, kleinen grauen Augen, zerzausten Haaren und dicken, spöttischen Lippen. Dieser Mann trug Winter und Sommer einen gelblichen Nankingrock von deutschem Schnitt, doch mit einem Gürtel; dazu eine blaue Pluderhose und eine Lammfellmütze, die ihm in einer guten Stunde ein ruinierter Gutsbesitzer geschenkt hatte. Am Gürtel waren zwei Säcke angebunden; der eine vorn, kunstvoll in zwei Hälften geknüpft, für Pulver und für Schrot, der andere hinten für Wild; die Baumwolle für die Pfropfen holte sich Jermolai aus seiner eigenen, anscheinend unerschöpflichen Mütze. Er könnte wohl für das Geld, das er aus dem Verkauf des Wildes löste, sich eine Patronentasche und eine Jagdtasche kaufen, aber diese Anschaffung war ihm überhaupt nie in den Sinn gekommen, und er fuhr fort, sein Gewehr wie bisher zu laden, wobei er die Zuschauer durch die Kunst in Erstaunen setzte, mit der er der Gefahr, das Pulver zu verschütten oder es mit Schrot zu vermischen, aus dem Wege ging. Sein Gewehr hatte nur einen Lauf und ein Feuersteinschloß und dazu noch die üble Eigenschaft, stark zurückzuprallen, aus welchem Grunde Jermolais rechte Wange immer voller war als die linke. Wie er mit diesem Gewehr treffen konnte, begriff auch der Klügste nicht, aber er traf doch. Er hatte auch noch eine Hühnerhündin namens Valetka, ein sehr merkwürdiges Geschöpf. Jermolai fütterte sie niemals. »Fällt mir gar nicht ein, einen Hund zu füttern«, sagte er. »Außerdem ist der Hund ein kluges Tier und kann selbst Nahrung finden.« Und so war es auch in der Tat: Valetka setzte zwar einen selbst gleichgültigen Vorübergehenden durch ihre ungewöhnliche Magerkeit in Erstaunen, blieb aber doch am Leben und lebte lange; trotz ihrer unseligen Lage war sie sogar kein einziges Mal entlaufen und hatte auch nie den Wunsch geäußert, ihren Herrn zu verlassen. Einmal in ihren jungen Jahren war sie wohl, von Liebe hingerissen, für zwei Tage verschwunden, aber diese Dummheiten hatte sie schon längst aufgegeben. Die hervorragendste Eigenschaft Valetkas war ihre absolute Gleichgültigkeit gegen alles in der Welt … Wäre die Rede nicht von einem Hund, so hätte ich wohl den Ausdruck ›Blasiertheit‹ gewählt. Gewöhnlich saß sie, den kurzen Schwanz untergeschlagen, da, blickte finster drein, zuckte manchmal zusammen und lächelte niemals. (Die Hunde haben bekanntlich die Fähigkeit zu lächeln, sie machen es sogar sehr nett.) Sie war außerordentlich häßlich, und kein müßiger Vertreter des Hofgesindes ließ sich die Gelegenheit entgehen, giftige Bemerkungen über ihr Äußeres zu machen; Valetka ertrug aber allen Spott und sogar Schläge mit ungewöhnlicher Kaltblütigkeit. Ein besonderes Vergnügen gewährte sie den Köchen, die sofort ihre Arbeit liegenließen und ihr schreiend und schimpfend nachsetzten, wenn sie aus einer Schwäche, die nicht nur Hunden allein eigen ist, ihre hungrige Schnauze durch die halbgeöffnete Türe der verführerisch warmen und wohlriechenden Küche steckte. Auf der Jagd zeichnete sie sich durch Unermüdlichkeit aus und hatte eine recht gute Witterung; wenn sie aber einmal einen angeschossenen Hasen erwischte, so fraß sie ihn mit Genuß bis zum letzten Knöchelchen auf, irgendwo im kühlen Schatten, unter einem grünen Busch, in einer respektvollen Entfernung von Jermolai, der in allen bekannten und unbekannten Dialekten schimpfte.
Jermolai gehörte einem meiner Nachbarn, einem Gutsbesitzer von altem Schrot und Korn. Die Gutsbesitzer von altem Schrot und Korn mögen keine Schnepfen und halten sich an das Hausgeflügel. Höchstens in außergewöhnlichen Fällen wie bei Geburtstagen, Namenstagen und Adelswahlen schreiten die Köche solcher Gutsbesitzer zur Zubereitung der langschnäbeligen Vögel; sie geraten dabei in die dem russischen Menschen so eigene Rage und erfinden so komplizierte Zutaten, daß die Gäste zum größten Teil die aufgetischten Gerichte mit Neugierde und Aufmerksamkeit betrachten, sich aber nicht entschließen, von ihnen zu versuchen. Jermolai hatte den Auftrag, für die herrschaftliche Küche einmal monatlich zwei Paar Birkhühner und Rebhühner zu liefern, durfte aber im übrigen leben, wie er wollte und wovon er wollte. Man hatte ihn aufgegeben als einen zu keiner Arbeit fähigen Menschen, als einen Schwächling, wie man bei uns in Orjol sagt. Pulver und Schrot wurden ihm nicht geliefert, wobei man dieselbe Regel befolgte, nach der er seinen Hund nicht fütterte. Jermolai war ein Mensch von besonderem Schlag: sorglos wie ein Vogel, ziemlich geschwätzig, zerstreut und dem Aussehen nach unbeholfen. Er trank gerne über den Durst, hielt es niemals lange auf einem Platz aus, schlurrte und watschelte beim Gehen und legte dabei doch an die fünfzig Werst in vierundzwanzig Stunden zurück. Er hatte schon die verschiedenartigsten Abenteuer erlebt: in Sümpfen, auf Bäumen, auf Dächern, unter Brücken genächtigt, mehr als einmal in Kellern, Schuppen und auf Dachböden eingesperrt gesessen, oft sein Gewehr, seinen Hund und die notwendigsten Kleidungsstücke eingebüßt, reichliche und kräftige Prügel bekommen, war aber nach einiger Zeit doch immer gekleidet und mit Gewehr und Hund nach Hause zurückgekehrt. Man konnte ihn keinen lustigen Menschen nennen, obwohl er fast immer guter Laune war; er machte überhaupt den Eindruck eines Sonderlings. Jermolai schwatzte manchmal gerne mit einem guten Bruder, besonders bei einem Glas Schnaps, aber nicht zu lange; mitten im Gespräch stand er auf und ging. »Wo willst du denn hin, Teufel? Es ist ja Nacht.«
»Nach Tschaplino.«
»Was sollst du dich nach Tschaplino schleppen, es sind ja zehn Werst.«
»Ich will beim Bauern Sofron übernachten.«
»Übernachte doch hier.«
»Nein, es geht nicht.«
Und so geht Jermolai mit seiner Valetka in die finstere Nacht durch Gebüsch und Sumpf; der Bauer Sofron wird ihn aber vielleicht gar nicht hereinlassen und haut ihm vielleicht auch noch den Buckel voll: »Laß anständige Leute in Ruhe!« Dafür konnte sich niemand mit Jermolai in der Kunst messen, im Frühjahr bei Hochwasser Fische zu fangen, die Krebse mit den Händen herauszuholen, das Wild mit der Nase zu wittern, Wachteln heranzulocken, Habichte abzurichten, Nachtigallen mit der ›Teufelspfeife‹ und dem »Kuckucksüberschlag‹ zu fangen … Eines verstand er aber nicht: Hunde zu dressieren; dazu hatte er keine Geduld. Er hatte auch eine Frau. Einmal in der Woche besuchte er sie. Sie wohnte in einer elenden, halbzerfallenen Hütte, schlug sich mit knapper Not durch, wußte niemals, ob sie morgen satt zu essen haben werde, und hatte überhaupt ein bitteres Los. Jermolai, dieser sorglose und gutmütige Mensch, behandelte sie roh und grob und nahm bei sich zu Hause eine finstere und drohende Miene an; seine arme Frau wußte gar nicht, wie sie es ihm recht machen sollte, zitterte vor seinem Blick, kaufte ihm für die letzte Kopeke Schnaps und bedeckte ihn unterwürfig mit ihrem Schafpelz, wenn er sich majestätisch auf dem Ofen ausstreckte und zu schnarchen anfing. Ich selbst hatte mehr als einmal Gelegenheit, an ihm unwillkürliche Äußerungen einer seltsamen, düsteren Wut wahrzunehmen: So gefiel mir sein Gesichtsausdruck nicht, wenn er einem angeschossenen Vogel mit den Zähnen den Garaus machte. Jermolai blieb aber nie länger als einen Tag zu Hause; außerhalb des Hauses verwandelte er sich aber wieder in den Jermolka, wie man ihn hundert Werst im Umkreis und wie er sich auch selbst manchmal nannte. Der letzte Mann im Hausgesinde fühlte seine Überlegenheit über diesen Landstreicher und behandelte ihn vielleicht gerade aus diesem Grunde freundschaftlich; die Bauern pflegten ihn anfangs mit Hochgenuß wie einen Hasen im Feld zu hetzten und zu fangen, ließen ihn aber dann in Gottes Namen laufen, rührten ihn, wenn sie den Sonderling einmal erkannt hatten, nicht mehr an, gaben ihm sogar Brot und unterhielten sich mit ihm … Diesen Menschen nahm ich mir zum Jagdgehilfen und begab mich mit ihm auf den Schnepfenstrich in einen großen Birkenwald am Ufer der Ista.
Viele russische Flüsse haben wie die Wolga ein hohes und ein flaches Ufer; so auch die Ista. Dieser kleine Fluß windet sich launisch wie eine Schlange dahin, fließt keine halbe Werst gerade und ist an manchen Stellen, von einem steilen Hügel herab, zehn Werst weit mit seinen Dämmen, Deichen, Mühlen und Gemüsegärten, von Bachweiden und dichten Gärten umgeben, zu sehen. In der Ista gibt es eine Unmenge Fische, besonders Äschen (die Bauern holen sie an heißen Tagen mit den Händen unter den Sträuchern hervor). Kleine Sandschnepfen schwirren pfeifend längs der steinigen, von kalten und hellen Quellen durchfurchten Ufer; Wildenten schwimmen in die Mitte der Teiche und sehen sich vorsichtig um; Reiher stehen in den Buchten im Schatten der überhängenden Ufer… Wir standen etwa eine Stunde auf dem Strich, schossen zwei Paar Waldschnepfen und entschlossen uns, da wir unser Glück vor Sonnenaufgang noch einmal versuchen wollten (man kann auf den Schnepfenstrich auch am frühen Morgen gehen), in der nächsten Mühle zu übernachten. Wir traten aus dem Wald und gingen den Hügel hinab. Der Fluß rollte dunkelblaue Wellen; die von nächtlicher Feuchtigkeit gesättigte Luft wurde immer dichter. Wir klopften ans Tor. Im Hofe bellten die Hunde. »Wer ist da?« ertönte eine heisere und verschlafene Stimme.
»Jägersleute, laß uns übernachten.«
Wir bekamen keine Antwort.
»Wir werden bezahlen.«
»Ich werde es dem Herrn sagen … Kusch, ihr Verfluchten …! Daß euch die Pest!« – Wir hörten, wie der Knecht in die Stube trat; bald kehrte er zum Tor zurück. »Nein«, sagte er, »der Herr erlaubt nicht, euch einzulassen.«
»Warum erlaubt er es nicht?«
»Er fürchtet, ihr seid ja Jägersleute; wie leicht könntet ihr die Mühle in Brand stecken; ihr habt ja solches Zeug bei euch.«
»Was für Unsinn!« »Bei uns ist schon vor zwei Jahren die Mühle abgebrannt: Viehhändler haben bei uns übernachtet und sie wohl in Brand gesteckt.«
»Was sollen wir tun, Bruder, wir können doch nicht draußen übernachten!«
»Tut, was ihr wollt…« Und er ging, mit den Absätzen klopfend.
Jermolai wünschte ihm allerlei Unannehmlichkeiten. »Wollen wir ins Dorf gehen«, sagte er endlich mit einem Seufzer. Aber bis zum Dorf waren es noch an die zwei Werst…
»Wollen wir doch hier übernachten«, sagte ich. »Die Nacht ist warm; der Müller wird uns für Geld wohl Stroh herausschicken.«
Jermolai willigte ohne Widerrede ein. Wir fingen wieder zu klopfen an.
»Was wollt ihr denn?« erklang wieder die Stimme des Knechtes. »Ich hab’ euch doch schon einmal gesagt, daß es nicht geht.«
Wir erklärten ihm, was wir wollten. Er ging sich mit seinem Herrn beraten und kehrte mit diesem zurück. Die Pforte knarrte. Es erschien der Müller, ein großgewachsener Mann mit fettem Gesicht, einem Stiernacken und einem runden und dicken Bauch. Er ging auf meinen Vorschlag ein. Etwa hundert Schritt von der Mühle befand sich ein kleiner, von allen Seiten offener Schuppen. Man brachte uns Heu und Stroh heraus; der Knecht stellte im Gras am Fluß den Samowar für uns auf, kauerte sich hin und begann eifrig in den Schornstein zu blasen … Die knisternde Kohlenglut beleuchtete hell sein jugendliches Gesicht. Der Müller lief hin, seine Frau zu wecken, und schlug mir schließlich selbst vor, in der Stube zu übernachten; aber ich zog vor, im Freien zu bleiben. Die Müllerin brachte uns Milch, Eier, Kartoffeln und Brot. Bald kochte der Samowar, und wir machten uns ans Teetrinken. Vom Fluß stieg Nebel auf, die Luft war windstill; ringsum schrien die Schnarrwachteln; von den Mühlrädern kam ein leises Geräusch: Es waren die Tropfen, die von den Schaufeln fielen, und das Wasser, das durch die Schleuse sickerte. Wir legten ein kleines Feuer an. Während Jermolai in der Asche Kartoffeln briet, hatte ich Zeit, ein wenig einzuschlummern … Ein leises, verhaltenes Flüstern weckte mich. Ich hob den Kopf: Vor dem Feuer saß auf einem umgestürzten, Kübel die Müllerin und unterhielt sich mit meinem Jäger. Ich hatte in ihr schon früher an ihren Kleidern, an der Aussprache und den Körperbewegungen eine frühere Angehörige des Hausgesindes erkannt; sie war jedenfalls kein Bauernweib und keine Kleinbürgerin; aber erst jetzt konnte ich ihre Züge genau unterscheiden. Dem Aussehen nach mochte sie etwa dreißig Jahre alt sein; das schmächtige blasse Gesicht zeigte noch die Spuren einer außergewöhnlichen Schönheit; besonders gut gefielen mir ihre großen, traurigen Augen. Sie stützte beide Ellenbogen auf die Knie und das Gesicht in die Hände. Jermolai saß mit dem Rücken zu mir und legte Späne ins Feuer.
»In Sheltuchina ist wieder eine Viehseuche«, sagte die Müllerin. »Dem Popen Iwan sind beide Kühe eingegangen … Gott sei uns gnädig!«
»Und wie steht’s mit euren Schweinen?« fragte Jermolai nach einer Pause.
»Die leben.«
»Wenn Ihr mir doch ein Ferkelchen schenken wolltet.«
Die Müllerin antwortete nichts, dann seufzte sie auf.
»Mit wem seid Ihr hier?« fragte sie.
»Mit dem Herrn von Kostomarowo.«
Jermolai warf einige Tannenzweige ins Feuer; die Zweige knisterten sofort laut, und ein dichter weißer Rauch stieg ihm gerade ins Gesicht.
»Warum hat uns dein Mann nicht in die Stube gelassen?«
»Er fürchtet sich.«
»Der Dickwanst… Liebste Arina Timofejewna, bring mir doch ein Gläschen Schnaps!«
Die Müllerin erhob sich und verschwand im Dunkeln. Jermolai sang mit halber Stimme:
»Als ich zu der Liebsten lief, trat ich meine Stiefel schief …«
Arina kam mit einer kleinen Flasche und einem Glas zurück. Jermolai erhob sich, bekreuzigte sich und trank den Schnaps in einem Zuge. »Das habe ich gern«, fügte er hinzu.
Die Müllerin setzte sich wieder auf den Kübel.
»Du kränkelst wohl immer, Arina Timofejewna?«
»Ja, ich kränkele.«
»Was fehlt dir denn?«
»Jede Nacht quält mich der Husten.« »Der Herr ist, glaub’ ich, eingeschlafen«, sagte Jermolai nach kurzem Schweigen. »Geh aber nicht zum Doktor, Arina, sonst wird es noch schlimmer.«
»Ich geh’ auch nicht.«
»Komm lieber zu mir.«
Arina senkte den Kopf.
»Meine Frau jag’ ich dann aus dem Hause«, fuhr Jermolai fort. »Wirklich!«
»Wecken Sie doch lieber den Herrn, Jermolai Petrowitsch; Sie sehen doch, die Kartoffeln sind fertig.«
»Soll er nur schnarchen«, bemerkte mein treuer Diener gleichgültig. »Er hat sich müde gelaufen, darum schläft er jetzt.«
Ich rührte mich auf meinem Heu. Jermolai erhob sich, trat zu mir und sagte: »Die Kartoffeln sind fertig, wollen Sie essen.«
Ich kam aus dem Schuppen heraus; die Müllerin erhob sich von ihrem Kübel und wollte weggehen. Ich zog sie ins Gespräch.
»Habt ihr die Mühle schon lange in Pacht?«
»Zu Pfingsten waren es zwei Jahre.«
»Wo stammt dein Mann her?«
Arina überhörte meine Frage.
»Woher ist dein Mann?« wiederholte Jermolai mit lauter Stimme.
»Aus Bjelew. Er ist ein Bjelewer Kleinbürger.«
»Bist du auch aus Bjelew?«
»Nein, ich bin eine Herrschaftliche … bin eine Herrschaftliche gewesen.«
»Wessen?«
»Des Herrn Swjerkow. Jetzt bin ich frei.«
»Welcher Swjerkow ist das?«
»Alexander Silytsch.«
»Warst du nicht Zofe bei seiner Frau?«
»Ich war es. Woher wissen Sie das?«
Ich sah Arina mit doppelter Neugierde und Teilnahme an.
»Ich kenne deinen Herrn«, fuhr ich fort.
»Sie kennen ihn?« fragte sie mit leiser Stimme und senkte die Augen.
Ich muß dem Leser erklären, warum ich Arina mit solcher Teilnahme ansah. Während meines Aufenthaltes in Petersburg hatte ich zufällig den Herrn Swjerkow kennengelernt. Er bekleidete einen ziemlich hohen Posten und galt als kenntnisreicher und erfahrener Mensch. Er hatte eine korpulente, empfindsame, zum Weinen aufgelegte und böse Frau, ein schwerfälliges Dutzendgeschöpf; er hatte auch ein Söhnchen, ein echtes, verzogenes und dummes Herrschaftskind. Das Äußere des Herrn Swjerkow nahm nicht zu seinen Gunsten ein: Aus seinem breiten, beinahe viereckigen Gesicht blickten listig zwei kleine Mauseaugen und ragte eine große und spitze Nase mit weitgeöffneten Nasenlöchern; die kurzgeschorenen grauen Haare stiegen wie Borsten über der gerunzelten Stirn empor, und die dünnen Lippen bewegten sich fortwährend und lächelten zuckersüß. Herr Swjerkow stand gewöhnlich mit gespreizten Beinen da, die dicken Hände in den Hosentaschen. Einmal mußte ich mit ihm im Wagen vor die Stadt fahren. Wir kamen ins Gespräch. Als erfahrener und tüchtiger Mensch fing Herr Swjerkow an, mir ›den rechten Weg‹ zu weisen.
»Gestatten Sie mir die Bemerkung«, sagte er schließlich mit seiner piepsenden Stimme. »Ihr jungen Leute urteilt und redet über alle Dinge aufs Geratewohl; ihr kennt euer Rußland nicht – das ist die Sache! Ihr lest ja nur deutsche Bücher. Sie sagen mir jetzt zum Beispiel dies und jenes von den Leibeigenen … Gut, ich will nicht streiten, das ist alles schön, aber Sie kennen sie nicht, Sie wissen gar nicht, was das für ein Volk ist.« Herr Swjerkow schneuzte sich geräuschvoll die Nase und nahm eine Prise. »Gestatten Sie mir zum Beispiel, Ihnen eine kleine Anekdote zu erzählen; sie kann Sie interessieren.« Herr Swjerkow räusperte sich. »Sie wissen ja, was ich für eine Frau habe. Eine gutmütigere Frau kann man wohl schwer finden, das werden Sie mir zugeben. Ihre Zofen haben ein paradiesisches Leben … Aber meine Frau hat es sich zum Grundsatz gemacht, keine verheirateten Zofen zu halten. Solche taugen auch wirklich nicht. Sie kriegen Kinder, bald dies, bald jenes; wie soll dann die Zofe so, wie es sich gehört, ihre Herrin bedienen und auf ihre Gewohnheiten achten? Sie hat dann ganz andere Sachen im Kopf. Man muß die Sache rein menschlich nehmen. So kamen wir einmal durch eines unserer Dörfer, es sind, wenn ich mich recht besinne, an die fünfzehn Jahre her. Da sehen wir, der Schulze hat eine Tochter, ein reizendes Mädel; sie hat sogar, wissen Sie, etwas Einschmeichelndes in den Manieren. Meine Frau sagt zu mir: ›Koko‹, wissen Sie, sie pflegte mich so zu nennen, ›wollen wir dieses Mädel nach Petersburg mitnehmen, sie gefällt mir, Koko …‹ Ich sage: ›Mit Vergnügen, nehmen wir sie nur mit.‹ Der Schulze fällt uns natürlich zu Füßen; dieses Glück, verstehen Sie, hatte er gar nicht erwartet. … Das dumme Mädel weinte natürlich. Es ist ja anfangs wirklich traurig: das Vaterhaus … und überhaupt … Es ist wirklich nicht zu verwundern. Aber sie gewöhnte sich bald an uns; zuerst steckten wir sie in die Mädchenkammer und ließen sie natürlich abrichten. Und was glauben Sie …? Das Mädel zeigt ungewöhnliche Fortschritte; meine Frau ist ganz verliebt in sie; schließlich macht sie sie mit Umgehung der anderen zu ihrer Kammerzofe … Beachten Sie es bloß … ! Man muß ihr Gerechtigkeit widerfahren lassen: Eine solche Zofe hat meine Frau noch nie gehabt, dienstfertig, bescheiden, gehorsam – mit einem Wort alles, was man sich nur wünscht. Dafür verzog sie meine Frau offen gestanden in einer übertriebenen Weise: Sie kleidete sie vorzüglich, ließ sie von der herrschaftlichen Tafel essen, gab ihr Tee zu trinken – mit einem Wort alles, was Sie sich nur vorstellen können. Eines schönen Morgens kommt plötzlich Arina – sie hieß Arina – , denken Sie sich nur, ohne Anmeldung zu mir ins Kabinett und fällt mir zu Füßen … Offen gestanden kann ich das nicht leiden. Der Mensch soll nie seine Würde vergessen, nicht wahr? – ›Was willst du?‹. – ›Väterchen Alexander Silytsch, ich bitte um eine Gnade.‹ – ›Um was für eine Gnade?‹ – ›Erlauben Sie mir, zu heiraten.‹ – Offen gestanden war ich darüber erstaunt. ›Du weißt doch, dumme Gans, daß meine Frau keine andere Zofe hat?« – ›Ich will der Gnädigen weiter dienen.‹ – ›Unsinn! Unsinn! Die Gnädige hält sich keine verheirateten Zofen.‹ – ›Die Malanja kann an meine Stelle treten.‹ – ›Räsoniere bitte nicht!‹ – ›Wie Sie wollen…‹ – Offen gestanden war ich ganz starr vor Erstaunen. Ich muß Ihnen sagen, daß ich ein Mensch bin, den nichts so sehr kränkt wie Undankbarkeit … Ihnen brauche ich es nicht zu sagen, Sie wissen doch, was ich für eine Frau habe: Sie ist ein Engel in Menschengestalt, die Güte selbst. … Selbst ein Verbrecher müßte mit ihr Mitleid haben. Ich warf Arina hinaus. Ich dachte mir, sie würde zur Besinnung kommen; ich wollte, wissen Sie, an das Böse, an den schwarzen Undank im Menschen nicht glauben. Und was denken Sie? Nach einem halben Jahr kommt sie wieder zu mir mit der gleichen Bitte. Diesmal warf ich sie ganz wütend hinaus und drohte ihr, es meiner Frau zu sagen. Ich war empört … Stellen Sie sich nur mein Erstaunen vor: Einige Zeit später kommt zu mir meine Frau in Tränen und so aufgeregt, daß ich sogar erschrak. – ›Was ist denn geschehen?‹ – ›Arina …‹ Sie verstehen, ich schäme mich, es auszusprechen. – ›Es kann nicht sein …! Wer war es denn?‹ – ›Der Lakai Petruschka.‹ Ich geriet ganz außer mir. Ich bin mal so ein Mensch … ich liebe keine halben Maßregeln …! Petruschka … hat keine Schuld. Bestrafen kann man ihn wohl, aber er ist meiner Ansicht nach nicht der Schuldige. Arina … was soll man da noch viel reden? Ich befahl natürlich sofort, ihr die Haare abzuschneiden, sie in Zwillich zu kleiden und ins Dorf zu schicken. Meine Frau verlor eine vorzügliche Zofe, aber es war nichts zu machen: Man darf doch keine Unordnung im Hause dulden. Ein krankes Glied schneidet man lieber gleich ab … Nun urteilen Sie selbst, Sie kennen ja meine Frau, sie ist doch wirklich … ein Engel …! Sie hatte sich an Arina gewöhnt, und Arina wußte das und hatte sich doch nicht gescheut … Wie? Sagen Sie mir doch … Wie? Aber was soll man da viel reden! Jedenfalls war nichts zu machen. Was mich persönlich betrifft, so fühlte ich mich noch lange Zeit durch die Undankbarkeit dieses Mädchens gekränkt. Was Sie auch sagen mögen – Herz, Gefühl werden Sie in diesen Menschen nicht finden! Man mag den Wolf füttern, soviel man will, er schielt immer nach dem Wald … Das ist aber eine Lektion für die Zukunft! Ich wollte Ihnen nur beweisen …«
Herr Swjerkow beendete seine Rede nicht, wandte den Kopf weg, hüllte sich fester in seinen Mantel und unterdrückte männlich seine Aufregung.
Der Leser begreift jetzt wahrscheinlich, warum ich Arina mit Teilnahme betrachtete.
»Bist du schon lange mit dem Müller verheiratet?« fragte ich sie schließlich.
»Seit zwei Jahren.«
»Nun, hat es dir dein Herr erlaubt?«
»Man hat mich freigekauft.«
»Wer denn?«
»Sawelij Alexejewitsch.«
»Wer ist das?«
»Mein Mann.«
Jermolai lächelte vor sich hin. »Hat denn mein Herr Ihnen von mir erzählt?« fragte Arina nach kurzem Schweigen.
Ich wußte nicht, wie ich ihre Frage beantworten sollte.
»Arina!« rief der Müller aus der Ferne.
Sie erhob sich und ging.
»Hat sie einen guten Mann?« fragte ich Jermolai.
»Das nicht.«
»Haben sie Kinder?«
»Sie haben eins gehabt, es ist aber tot.«
»Hat sie dem Müller so gut gefallen? Wieviel Lösegeld hat er für sie bezahlt?«
»Ich weiß es nicht. Sie kann lesen und schreiben; in ihrem Geschäft ist das … gut. Sie gefiel ihm wohl.«
»Kennst du sie schon lange?«
»Lange. Einst pflegte ich zu ihrer Herrschaft zu kommen. Ihr Gut ist nicht weit von hier.«
»Kennst du auch den Lakai Petruschka?«
»Den Pjotr Wassiljewitsch? Gewiß, ich kannte ihn wohl.«
»Wo ist er jetzt?«
»Ist unter die Soldaten gekommen.«
Wir schwiegen eine Weile.
»Sie scheint nicht ganz gesund zu sein?« fragte ich schließlich Jermolai.
»Ganz und gar nicht …! Morgen gibt es aber einen guten Schnepfenstrich. Sie sollten jetzt etwas ausschlafen.«
Ein Schwarm Wildenten flog sausend über uns vorbei, und wir hörten, wie sie sich auf dem Fluß nicht weit von uns niederließen. Es war schon ganz dunkel geworden, es begann auch kalt zu werden; im Gehölz schlug laut die Nachtigall. Wir vergruben uns ins Heu und schliefen ein.
Das Himbeerwasser
Inhaltsverzeichnis
Anfang August herrscht bei uns oft eine unerträgliche Hitze. Um diese Zeit ist auch der entschlossenste und geduldigste Mensch in den Stunden zwischen zwölf und drei nicht imstande zu jagen, und selbst der ergebenste Hund beginnt ›dem Jäger die Sporen zu putzen ‹, d. h., er folgt ihm im Schritt, die Augen schmerzvoll zusammengekniffen und die Zunge übertrieben hervorgestreckt; auf die Vorwürfe seines Herrn wedelt er nur unterwürfig mit dem Schwanz und zeigt eine verlegene Miene, ist aber nicht vorwärtszubringen. Gerade an einem solchen Tag befand ich mich einmal auf der Jagd. Lange widerstand ich der Versuchung, mich irgendwo, wenn auch nur für einen Augenblick, in den Schatten zu legen; lange trieb sich mein unermüdlicher Hund in den Büschen herum, obwohl er von seiner fieberhaften Tätigkeit auch selbst nichts Vernünftiges erwartete. Die drückende Hitze zwang mich schließlich, an die Erhaltung unserer letzten Kräfte und Fähigkeiten zu denken. So gut es ging, schleppte ich mich zum Flüßchen Ista, den meine geneigten Leser schon kennen, stieg den steilen Abhang hinunter und ging über den gelben, feuchten Sand in der Richtung auf eine Quelle, die in der ganzen Gegend unter dem Namen Himbeerwasser bekannt ist. Die Quelle sprudelt aus einer Uferspalte hervor, die sich allmählich in eine kleine, aber tiefe Schlucht verwandelt hat, und ergießt sich zwanzig Schritte weiter mit lustigem, geschwätzigem Geräusch in den Fluß. Die Abhänge der Schlucht sind mit Eichengebüsch bewachsen; in der Nähe der Quelle grünt ein kurzer, samtweicher Rasen; die Sonnenstrahlen berühren fast nie ihr silbernes, kaltes Naß. So erreichte ich die Quelle; im Gras lag eine Schöpfkelle aus Birkenrinde, die irgendein vorübergehender Bauer zum allgemeinen Nutzen zurückgelassen hatte. Ich stillte meinen Durst, legte mich in den Schatten und sah mich um. An der Bucht, die der Ausfluß der Quelle in den Fluß bildete und deren Wasseroberfläche daher ständig gekräuselt war, saßen mit dem Rücken zu mir zwei Greise. Der eine, kräftig und groß gewachsen, in einem dunkelgrünen, sauberen Kaftan und einer warmen Mütze, angelte; der andere, klein, mager, in einem geflickten, halbseidenen Röckchen und ohne Mütze, hielt einen Topf mit Würmern auf den Knien und fuhr sich ab und zu mit der Hand über seinen grauen Kopf, als wollte er ihn vor der Sonne schützen. Ich sah ihn genauer an und erkannte in ihm den Stjopuschka aus Schumichino. Ich bitte den Leser um Erlaubnis, ihm diesen Menschen vorstellen zu dürfen.
Einige Werst von meinem Gut liegt das große Dorf Schumichino mit der steinernen, den Heiligen Kosmas und Damian geweihten Kirche. Dieser Kirche gegenüber prangte einst das große Herrenhaus, umgeben von allerlei Anbauten, Dienstgebäuden, Werkstätten, Pferdeställen, Wagenschuppen, Badestuben, Hilfsküchen, Flügeln für die Gäste und Verwalter, Treibhäusern, Schaukeln für das Volk und anderen mehr oder weniger nützlichen Baulichkeiten. In diesem Herrenhaus hatten einst reiche Gutsbesitzer gewohnt, und alles ging in der besten Ordnung, bis eines Morgens dieser ganze Segen bis auf den Grund niederbrannte. Die Herrschaft siedelte auf eine andere Besitzung über, und dieses Gut verödete. Die ausgedehnte Brandstätte verwandelte sich in ein Gemüsefeld, auf dem hier und da Ziegelhaufen, die Überreste der alten Fundamente ragten. Aus den unverbrannten Balken wurde in aller Eile ein Hüttchen zusammengezimmert und mit Planken gedeckt, die man zehn Jahre früher zur Errichtung eines Pavillons im gotischen Stil angeschafft hatte, und in diesem Hüttchen wurde der Gärtner Mitrofan mit seiner Frau Aksinja und mit sieben Kindern angesiedelt. Mitrofan hatte den Auftrag, für den Tisch der Herrschaften, die sich in einer Entfernung von hundertfünfzig Werst aufhielten, Grünzeug und Gemüse beizustellen; Aksinja wurde mit der Aufsicht über eine Tiroler Kuh betraut, die man in Moskau für teures Geld gekauft hatte, die aber leider vollkommen zeugungsunfähig war und daher seit dem Tag ihrer Anschaffung keinen Tropfen Milch gegeben hatte; außerdem wurde ihr ein rauchgrauer Enterich mit dem Schopfe anvertraut, das einzige ›herrschaftliche‹ Geflügel; die Kinder bekamen infolge ihres jugendlichen Alters keinerlei Ämter, was sie übrigens nicht hinderte, furchtbar faul zu werden. Bei diesem Gärtner hatte ich an die zweimal übernachtet und pflegte bei ihm im Vorbeigehen Gurken zu kaufen, die, Gott weiß warum, selbst im Hochsommer sich durch ihre Größe, durch ihren schlechten wässerigen Geschmack und ihre dicke gelbe Rinde auszeichneten. Bei ihm hatte ich auch zum erstenmal Stjopuschka gesehen. Außer Mitrofan mit seiner Familie und dem alten, tauben Küster Gerassim, den eine einäugige Soldatenfrau in einem winzigen Kämmerchen beherbergte, war in Schumichino kein Mensch vom Hofgesinde zurückgeblieben, denn Stjopuschka, mit dem ich den Leser bekannt zu machen beabsichtige, konnte weder als Mensch im allgemeinen noch als einer vom Hausgesinde im besonderen gelten.
Jeder Mensch hat doch sonst irgendeine Stellung in der Gesellschaft oder irgendwelche Beziehungen zu anderen Menschen; jeder Mensch im Hofgesinde bekommt, wenn auch kein Gehalt, so doch wenigstens ein sogenanntes Deputat; Stjopuschka erhielt aber keinerlei Unterstützung, war mit niemandem verwandt, und niemand wußte etwas von seiner Existenz. Dieser Mensch hatte nicht mal eine Vergangenheit; man sprach von ihm nicht; selbst in den Revisionslisten wurde er kaum geführt. Es gingen dunkle Gerüchte, er sei einmal bei jemandem Kammerdiener gewesen; aber wer er war, woher er stammte, wessen Sohn er war, auf welche Weise er unter die Untertanen von Schumichino geraten war, wie er zu seinem halbseidenen Röckchen, das er seit undenklichen Zeiten trug, kam, wo und wovon er lebte – davon hatte absolut niemand eine Ahnung, und offen gestanden kümmerte sich auch niemand um diese Fragen. Großvater Trofimytsch, der den Stammbaum des ganzen Hofgesindes in aufsteigender Linie bis ins vierte Geschlecht hinauf kannte, hatte nur einmal gesagt, daß Stepan, soweit er sich erinnere, mit der Türkin verwandt sei, die der selige Herr, der Brigadier Alexej Romanytsch, aus dem Feldzug mit seiner Bagage heimgebracht hatte. Selbst an Feiertagen, an denen alle Leute beschenkt und nach altrussischer Sitte mit Brot und Salz, mit Buchweizenkuchen – und Schnaps bewirtet wurden, selbst an diesen Tagen kam Stjopuschka nicht zu den aufgestellten Tischen und Fässern, bückte sich nicht vor dem Gutsherrn, küßte ihm nicht die Hand und trank nicht auf das Wohl und vor den Augen des Herrn das Glas, das der Gutsverwalter mit seiner fettigen Hand gefüllt hatte; höchstens gab ihm irgendeine gute Seele im Vorbeigehen den Rest eines Kuchens. Am Ostersonntag tauschte man mit ihm zwar den Osterkuß, aber er schlug seinen fettigen Ärmel nicht zurück und holte nicht aus seiner rückwärtigen Tasche ein rotes Ei hervor, um es, schwer atmend und mit den Augen zwinkernd, den jungen Herrschaften oder sogar der Gnädigen selbst anzubieten. Im Sommer wohnte er in einer kleinen Vorratskammer hinter dem Hühnerstall, im Winter aber in der Vorbadestube; bei strengem Frost nächtigte er auf dem Heuboden. Man hatte sich an seinen Anblick gewöhnt, manchmal gab man ihm auch einen Fußtritt, aber niemand sprach ihn an, und auch er selbst hatte wohl noch nie den Mund aufgemacht. Nach dem Brand hatte dieser vergessene Mensch beim Gärtner Mitrofan Unterschlupf gefunden. Der Gärtner rührte ihn nicht an, sagte ihm nicht: »Wohne bei mir«,